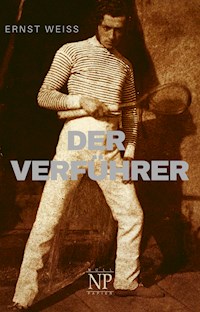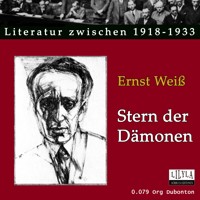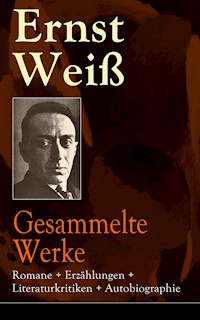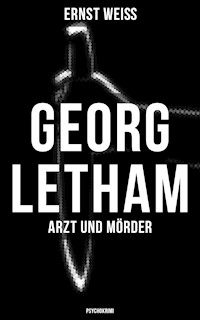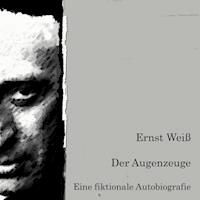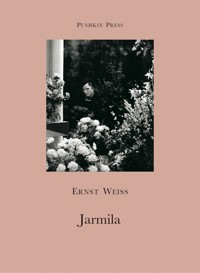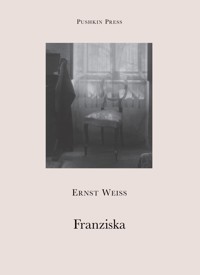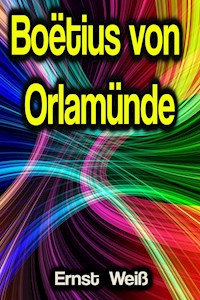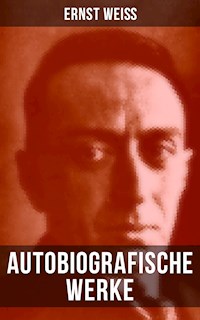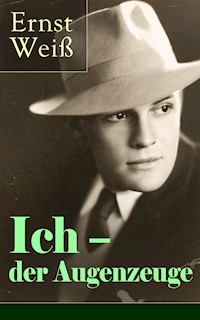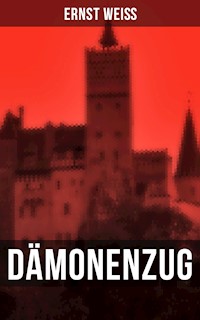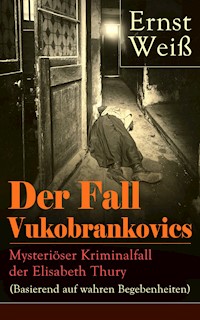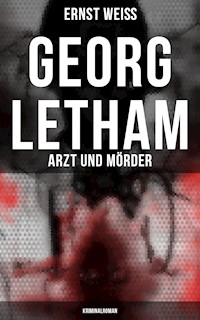Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ernst Weißs Buch 'Franziska' ist ein literarisches Werk aus dem frühen 20. Jahrhundert, das eine faszinierende Mischung aus Psychologie, Romantik und Gesellschaftskritik bietet. Das Buch erzählt die Geschichte einer jungen Frau namens Franziska, die sich in den zwielichtigen Berliner Kunst- und Bohème-Kreisen verliert. Weißs literarischer Stil zeichnet sich durch eine präzise Beobachtung der menschlichen Natur und eine eindringliche Darstellung von Emotionen aus. 'Franziska' reflektiert die gesellschaftlichen Umbrüche und moralischen Konflikte der Zwischenkriegszeit und bietet eine tiefgründige Analyse der menschlichen Psyche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Franziska
Erster Teil
1
Eine Mutter starb.
Das ganze Zimmer atmete Sterben. Niemand rührte sich. Die Morgendämmerung lag wie Nebel vor den Fenstern, blickte mit weißen Augen in den Raum. Der Atem der Mutter verstummte. Franziska ging zum Klavier, holte die zwei Kerzen vom Notenpult und stellte sie zu Häupten der alten Frau hin, leise, ganz zart; die Kerzenhalter aus dünnem Glas klirrten hell wie Silber. Dann sank von neuem das Schweigen in das Zimmer und drängte sich wie eine schwere Wolke in ein enges Tal.
Die Krankenpflegerin zündete die Kerzen an. Die Töchter wichen zurück.
Nun zitterte in der schon erstarrten Maske nur noch der zuckende Mund, atmete heftig, leidenschaftlich, in gequälter Hast, dann ward er ruhiger, versank tief in sich. Eine namenlose Stille griff allen an die Kehle.
Die Krankenpflegerin wandte sich ab. Franziska ging zu ihrer Mutter hin, ordnete ihr graues Haar, das feucht war, strich ihr sehr weich, wie einem Kinde, über die Augen hin; die Schwestern standen an der Tür und zitterten. Und das war alles; nur das Kreuz fehlte; es lag zu Füßen der Toten, versteckt in den schweren Falten der Decke. Franziska gab es der Mutter in die Hand; nun beugte sie sich selbst zu dem Bett nieder, sank in die Knie, fühlte den Atem der Schwestern auf ihrem gebeugten Nacken, schloß die Augen und drückte ihre Stirn auf ihrer Mutter Brust, auf eine grauenhaft stille Brust. Das dauerte lange; dann stand sie auf und ihre Schwestern mit ihr.
Die Krankenpflegerin winkte ihnen, und sie gingen in ihr kleines Zimmer. Minna, die Jüngste, wandte sich noch an der Tür zurück, warf sich fassungslos über die bleichen Hände der Toten, riß sie, die sonst so strengen, nun willenlosen, an den Mund, küßte sie, sah sie wie zum erstenmal: armselige, kranke Greisenhände, die in den Furchen und Falten noch den Staub der schweren Arbeit, die Furchen eines mühevollen Lebens trugen wie eine dunkle Schrift auf weißem Grunde.
Dann standen die drei Schwestern einander gegenüber, starrten einander an wie fremde Menschen.
Kein Wort, keine Träne. Etwas Unbegreifliches war da, unwiderruflich war die letzte Nacht.
Lange schon war das Herz der Mutter müde und abgearbeitet; aber in der letzten Nacht erst war es widerwillig geworden, hatte um sich geschlagen, gegen die Brust, immer wieder, weithin, bis in die Spitzen der Finger schlug das Herz. Und dann warf sich eine Faust gegen die Augen: ein rotes Licht stand plötzlich da, hoch und breit wie eine Mauer. Vor sich rote Finsternis, hinter sich rote Finsternis. Wohin waren ihre Kinder verschwunden, wohin das seit Jahrzehnten bewohnte Zimmer, die kleine Stadt vor den Fenstern, die alte Lampe über dem alten Tisch?
Die Mutter hatte das Tischtuch an sich gezogen, sie riß den Mund weit auf, von unbeschreiblicher Angst ergriffen.
Henriette, die Lehrerin, schrak von ihren Schulheften empor, die ihr in die Falten des Kleides flatterten, sie schrie auf, und Franziska erstarrte mitten in der höchst beschwingten Glut ihres Spiels. Zitternd stieß die Mutter etwas Böses zurück mit unsicher verkrampften Händen, dann sank sie zusammen, schwer, und doch ganz sanft.
Schon war Franziska ganz nahe bei ihr, schon hatte sie sich über sie gebeugt, aber die Mutter murmelte verstört, mit fremder, schüchterner Mädchenstimme, sie wandte den Kopf zur Seite: und ihr Auge, unbewegt, in grenzenlosem Dunkel, starrte der Tochter entgegen, starrte und war blind. Die rote Finsternis hatte sich verdüstert, alles war Nacht.
Franziska allein weinte nicht. Sie nahm die Mutter bei der hilflosen Hand, sie führte sie zum Bett. Sie eilte fort, rief den Arzt, der aber erst am nächsten Morgen kommen wollte. –
Die Mutter sah nichts mehr: Nur ein rotes Licht? Sie hatte sicherlich vorher gelesen ... Nein, es war nur eine Augenkrankheit – nein, nicht einmal das, nur eine Schwäche. Hatte es nicht noch Zeit bis zum nächsten Morgen? –
Franziska eilte zurück. Es war alles, wie es der Arzt gesagt hatte. Es hatte Zeit bis zum nächsten Morgen! Das waren nicht mehr als zehn Stunden Sorge, Unruhe, aber der Arzt war ja seiner Sache sicher: die Augen wollten nicht mehr, aber es war keine Gefahr.
Es war doch keine Gefahr? Und doch war das Gesicht der Mutter nicht mehr das von gestern. Die Augen waren geschlossen, die Mutter schlief. Aber in der Tiefe der Augen wohnte vielleicht unrettbares Dunkel. Aber so grauenhaft die Blindheit war, es gab noch Grauenhafteres. Was sollte diese Stille? Was bedeutete dieser starre Schlaf? Was bedeutete es, daß die Atemzüge der Mutter sich unsagbar schwer aus dem tiefsten Grund der Brust losrissen und sich mühselig durch das Halbdunkel schleppten, von einer Stunde zur anderen. Dann aber wurden sie immer leichter, immer schneller – die drei Schwestern atmeten auf –, sie schwebten dahin, wie wenn ein Mensch eilt und fliegt, weite Wege entlang, blühende Berge empor, und seine Augen glänzen, und dann – als stände er nun da, umarmt von plötzlicher, mittagsstrahlender Sonne, leuchtend, beseligt am Ziel, hielte staunend allen Atem an – die Hand an das süßzitternde Herz gepreßt.
Die Schwestern waren zu der Kranken hingestürzt, die sich mit starr abwehrenden Händen aufgerichtet hatte und Überirdisches mit ihren erblindeten Augen zu sehen schien, schon sank sie wieder zurück, wie aus allzu weiter Ferne kam ein weicher Atem zurück in der Mutter Brust; wieder lief eine Seele im Dunkel der Nacht den Lauf hin gegen den Tod.
Gegen drei Uhr morgens eilte Franziska zum zweitenmal um den Arzt; er war aber nicht mehr daheim; die Jahreszeit war rauh, nie hatte es so viel Kranke gegeben wie jetzt: eben verrollte sein Bauerngefährt auf der Straße. Nun lief Franziska zum Geistlichen, der die alte Frau kannte und der ihr schon vor zwei Jahren bei einer plötzlichen Krankheit die letzte Ölung erteilt hatte. Seine Ruhe erfüllte alles mit Milde. Der tiefe Duft des Weihrauchs schläferte ein, die bewußtlose Frau schien zu lächeln, als er ihr die Handflächen und die Fußsohlen mit seinem heiligen Öl salbte. Ihr starrer Blick wurde menschlich im Lichte der geweihten Kerzen. Mit dem Geistlichen kam die Krankenpflegerin; ungerufen und doch erwünscht; denn sie blieb.
Nun war es nicht mehr das grauenvolle Schweigen, erpreßt durch eine wilde Faust, nicht mehr das Schreckliche eines unerbittlichen Wettlaufes, nun wußten auch andere Menschen davon. Alles ging vorüber, nichts geschah zum erstenmal: so wurde es ein Sterben wie alle Tage, das bürgerliche Ende eines bürgerlichen Schicksals.
2
Henriette und Minna weinten: Minna leidenschaftlich wie ein Kind, das mit der ganzen Seele, mit ganzem Herzen weint, Henriette wie ein müder gedrückter Mensch, ein Mensch mit vielen Dienstjahren, mit wenig Hoffnungen, viel Arbeit und ohne Freude.
Franziska stand am Fenster, fühlte ihr Herz stürmend pochen. Sie konnte nicht weinen, in dieser Stunde nicht, nicht in diesem unbarmherzig grauen Tageslicht, Wand an Wand mit ihr, die es vielleicht noch hörte.
Die Krankenpflegerin öffnete leise die Tür. Ihr Lächeln war Mitleid, Verstehen und Tröstenwollen. Ihr schwerer Blick drängte jeden Schmerz zurück in seine Alltäglichkeit, in die Beschränkung von vier weißen Wänden, zwischen denen ein einfacher Mensch bescheiden gestorben war. Im Sterbezimmer ragten zwei große Kerzen aus hohen, sandgefüllten Messingmörsern hervor. Die anderen Lichter waren ausgelöscht und standen dünn und unscheinbar am geöffneten Fenster.
Franziska ließ das Notenpult herab, auf dem noch vom letzten Abend her Beethovens Sonate aufgeschlagen war. Der alte Flügel seufzte. Minna hatte ein Büschelchen Himmelsschlüssel, das sie tags zuvor aus dem Wald geholt hatte, der Mutter auf die Bettdecke gelegt.
Franzi sah sie immer noch weinen.
Sie sehnte sich in diesem Augenblick leidenschaftlich nach solchen Tränen, sie hätte lautlos untersinken, auf immer aufgehen mögen in diesem Schmerz: in irgendeinem Schmerz der ganzen Welt; sie sehnte sich danach, eine Sekunde wenigstens nichts von sich zu wissen, eine Sekunde wenigstens der toten Frau zu gehören und sich ihr jetzt, jetzt noch ganz hinzugeben, wenn sie es früher im Leben nie gekonnt hatte.
Die Krankenpflegerin hatte die Schwestern allein gelassen. In der Küche wanderte sie mit ihren schweren Tritten. Sie fühlte sich jetzt hier wie zu Hause: aber die Töchter waren es nicht. Kein lautes Wort; keinen Blick ließen sie fort von dem Mund der Mutter, um den ein strenges, fast böses Lächeln leuchtete.
»Nur fort ... eine Stunde nur!«
»Franziska!« sagte Henriette ernst.
»Kannst du mich nicht verstehen? – Es muß sein. Nachher bleibe ich bei ihr den ganzen Tag, die ganze Nacht.«
»Und ich morgen«, sagte Henriette.
»Und ich ... die letzte Zeit ... den letzten Tag«, sagte Minna in Tränen.
In der Küche war der Tisch gedeckt. Frau Reichner, die Krankenpflegerin, hatte die drei Eßbestecke der Kinder auf den Tisch gelegt. Sie selbst hielt der Mutter altes schwarzes Eßbesteck in den harten, knochigen Händen. Das verschlug den Töchtern den Atem. Aber die Krankenpflegerin lächelte, wenn auch nur ein demütiges untertäniges Lächeln. Nach dem Essen ging sie in das Sterbezimmer zurück, stellte die Stühle und den Tisch an die Wand und ließ sich der Toten bestes Kleid aus dem Schrank herausgeben. Nun lag es da, schimmernd im Glanz stiefmütterchenblauer, etwas verblaßter, sehr weicher Seide, und ließ das lebendige Mittagslicht über altmodische Volants, kleine Glasperlen und über verdrückte Schleifen hinwegflimmern; als die Reichner es mit harten, gierigen Fingern angriff, zitterte das alte Gewand.
»Keinen Menschen mehr lieben«, dachte Franziska, »damit mir keiner sterben kann.« –
Die Heide vor der kleinen Stadt war noch grau und steinig, voll von Gestrüpp und toten Zweigen, die mit ihren dünnen Armen den letzten Schnee umklammert hielten.
Nach und nach kamen die Schwestern zur Höhe empor; ein leichter Nebel stieg aus der Heide, schlich ihnen nach, legte seine graue Hand über die steinigen Wege, über die fernen Hänge, und alles Harte wurde weich und mild.
»Was soll nun werden?« fragte Franzi.
»Sprich heute nicht davon«, sagte Minna.
»Warum? Ist heute ein Feiertag?«
»Franzi! Denkst du nur an dich? Kaum daß unsere Mutter kalt ist ...«
»Ach, Worte. Wenn Mutter noch ... da wäre, auch sie hätte sicherlich von nichts anderem gesprochen: – können wir drei beisammenbleiben, oder können wir es nicht?«
»Kannst du noch fragen? Du weißt doch alles – oder weißt du es nicht? Wenn du schon herzlos genug bist, an einem solchen Tage davon zu reden, dann mußt du ganz offen reden – und ich werde dir ganz offen antworten: So wie jetzt kannst du nicht weiterleben. Ich will arbeiten, mehr noch als vorher, ich bin schon jetzt von früh morgens bis spät abends in der Schule; ich will 42 Stunden wöchentlich halten. Und du, Minna, du hast schon jetzt keinen freien Augenblick gehabt, du hast ja alles im Haus geschafft, hast der Mutter jede Mühe erspart und alles ohne Entgelt, alles umsonst ...«
»Nicht davon reden, Henriette«, sagte Minna.
»Aber es geht ja doch um dich, liebe Minna«, sagte Henriette. »Wir sollten von jetzt an nur ein einzelnes Zimmer mit einer kleinen Küche mieten. Und wenn alles noch so geräumig ist, für das Klavier ist schwerlich Platz. Sieh, Minna, dort, wo dein Bett steht, von dort muß Franzis Klavier fort.«
»Mein Klavier muß also fort?«
»Das sag’ ich dir nicht aus Bosheit, Franzi. Du selbst hast damit angefangen. Ich hätte heute nicht den alten Jammer aufgerührt. Es ist schon jetzt nicht mehr recht angegangen. Ich verdiene ein wenig Geld: 700 elende Gulden, und auch das nur, wenn ich endlich definitiv werde. Einmal wird es ja sein. Vielleicht sogar bald. Was ist das aber für drei Menschen? Sag’ doch selbst! Wir können uns winden und schmiegen und klein machen, es geht und geht halt doch nicht zusammen. Ich bin müde. Wenn ich nachmittags heimkomme, möchte ich ein bißchen pausieren. Aber du bist immer am Klavier. Nein ... ich denk’ es mir, kann es mir nicht anders denken: die eine verdient das tägliche Brot, die andere steht am Herd. Aber die dritte ...«
»Ja, die dritte«, sagte Franzi mit bösem Lächeln.
»Du brauchst nichts zu sagen. Ich weiß alles. Ich will nicht von deinen sauren Groschen zehren. Nicht einmal einen Tag. Das ist der Grund, weshalb ich habe heute mit dir sprechen wollen ...«
»Ach, sprechen«, sagte Henriette, »was sollen denn alle Worte? Ich habe dir das tausendmal gesagt. Wenn schon die Mutter sich nicht traute, dir das zu sagen, wenigstens ein Mensch muß doch offen mit dir sein. Sieh doch, wo führt das hin? Was nützt dir alle Arbeit? Hättest du doch auch am Pädagogium studiert! Wie anders könnten wir jetzt an unsere Zukunft denken.«
»Sieh doch«, sagte Franzi, »es muß ja nicht sein. Auch ohne Pädagogium werde ich mir mein Brot verdienen, wenn auch nicht hier.«
»Nein, Franzi«, sagte Minna, »wir bleiben auf jeden Fall beisammen; unsere Mutter hätte es sicher so gewollt.«
»Nein«, sagte Henriette, »eine ist zuviel.«
»Das weiß ich. Ich habe mich nicht auf eure Kosten sattessen wollen. Henriettes 700 Gulden sind mir heilig. Was soll ich nun tun? Was wird aus meinem Klavier? Aber ihr könnt ja das Klavier in Stücke schlagen lassen und den Winter über damit Feuer zünden. Und mich kann vielleicht jemand als Ladenmädchen brauchen. Nur über Tag. Abends komm ich heim – und irgendein warmes Winkerl unterm Herd werdet ihr doch für mich haben?«
»Ach, Franzi«, sagte Minna, »was denkst du dir denn? Wir werden dich doch nicht im Winkel schlafen lassen.«
»Es gibt doch nur Brot für zwei«, sagte Henriette.
»Gut, dann will ich euch etwas sagen«, sprach Minna, »ich will fort, ich geh nach Prag, ich geh zu anständigen Leuten in Dienst. Die kleinen Kinder mögen mich leiden. Ich ...« »Nein«, sagte Henriette, »das kann ich nicht zugeben. Du ... ein Dienstmädchen! Nein, das kann nicht sein!«
»Aber es ist ja nicht hier. Kein Mensch weiß davon. Ich mache euch keine Schande ...«
»Es ist nicht darum. Aber kann das wirklich dein Ernst sein?« »Was wäre ich bei euch anderes gewesen als euer Dienstmädchen? Die Henriette ist in der Schule, du spielst Klavier, was bleibt mir?«
Sie lächelte. »Macht euch doch nur keine Sorgen um mich. Ich werde nicht schlechter, als ich bin ...«
Die Waldeshöhe war erreicht. Die Heide tief unten schimmerte wie ein graues Stück Seide inmitten der hohen, grünen Wälder. Die Erde duftete nach Frühling, die ganze graue Februarwelt atmete Frühling; und ein leiser Regen fiel. Er streichelte die langen, halbergrauten Nadeln der Kiefern, die plötzlich tiefgrün wurden und leuchteten. Franziska gab Minna die Hand. Sie schwiegen. Dann gingen sie zurück in die kleine Stadt, in das alte Haus im Schatten der Kirche, in dem die Mutter lag. Als sie vor dem Hause standen, sahen sie die zwei großen Totenkerzen aus dem Fenster in den Vorfrühling hinaus schimmern.
»Schreib mir, bis du dort bist«, sagte Franziska leise, »dann ... komm ich zu dir.«
»Ach geh«, sagte Minna, »ich tu’s ja nicht euretwegen, deinetwegen tue ich’s ja nicht.«
Sie begann zu weinen, als sie die hölzerne Treppe hinaufstieg; niemand wußte, ob deshalb, weil ihre Mutter gestorben war oder weil aus einer Bürgerstochter ein Dienstmädchen werden sollte – auch sie selbst wußte es nicht.
3
Als Franziska ihre Schwester zum Bahnhof begleitete, fühlte sie mit Staunen, daß sie sich auf die Minute freute, da sie ganz allein zwischen ihren vier Wänden sein würde; sie freute sich auf die erste Nacht allein in ihrem Zimmer, es schien ihr, als würde dann die Welt weiter, als schliefe sie dann in einem entfernten Land, unter Zeltwänden oder unter freiem Himmel.
Aber Minna weinte, und ihre Hände zitterten beim Abschied. Der Zug kam: Franziska küßte Minna auf den Mund; Minnas Arm lag so schwer, so verlangend, so fassungslos zärtlich um ihren Hals, daß sie fürchtete, sie würde niemals mehr frei. Aber es war nur ein Augenblick: dann kreischten die Räder, der Zug ging. Minna winkte aus dem Abteil mit einem weißen Tuch, und ihr von Tränen verschwollenes Gesicht schien aus der Ferne zu lächeln.
Franziska hatte eigentlich nur einen einzigen, ihren Vater, geliebt: als Kind, als erwachender Mensch und dann in der Erinnerung, und sie vermochte es nie zu fassen, daß sie ein Mensch, den sie liebte, verlassen konnte.
In zwei schlaflosen Nächten, den ersten schlaflosen Nächten ihres jungen Lebens, in denen sie ihn mit gewaltsamen Tränen wieder ins Dasein, Nebenihrsein, in den blühenden Tag zurückwünschte, war ihr mit ihm die ganze belebte Welt gestorben.
Das einzige, was noch lebte, war die Musik. Nichts sprach zu ihr als das alte Klavier, nie gab sie ihre Seele preis, als wenn sie sich allein im dunklen Zimmer von den Tönen berauschen ließ. Die ersten Lektionen hatte ihr der Vater erteilt; als er starb, stand sie vereinsamt da. Sie hatte von ihm die Fähigkeit der Improvisation geerbt, konnte stundenlang frei über ein Bild, über eine Erinnerung phantasieren. Die Gedanken kamen ihr von selbst; oft schloß sie die Augen oder sah auf die Kirche hin, deren Fenster ganz fein vergittert waren, um den Spatzen und Tauben das Nisten zu erschweren. Sie spielte lange ganz ohne Gedanken. Sie glaubte, jeder könnte so spielen, wenn er wollte. Das machte ihr Glück, ein etwas haltloses Glück, aber doch eins.
Als sie fünfzehn Jahre alt war, starb plötzlich ein Herr von Kornhen, ein verarmter Aristokrat, der Vertreter einer Versicherungsgesellschaft gewesen war.
Franziska ging an der Kirche vorbei, in der die Leiche aufgebahrt war; der Tod des Herrn war zwar etwas geheimnisvoll vor sich gegangen, man sprach von Selbstmord, aber der Geistliche, der mit ihm gut befreundet gewesen war, deckte die kirchliche Bestattung mit seinem eigenen Gewissen.
Franziskas Kleid streifte das Portal der Kirche. Totenstille herrschte in dem hohen Haus, und Franziska dachte, der Tote läge ausgestreckt da, im offenen Sarg, um den Hals die Schlinge des Seiles oder an der Stirn die Spuren der mörderischen Kugel.
Die Mutter hatte ihr verboten, der Totenmesse beizuwohnen; aber Franziska konnte nicht widerstehen. Das Grauenhafte lockte sie.
Grünes Dunkel lag über dem Schiff der Kirche; graue Weihrauchwolken wogten, dufteten schwer. An dem geschlossenen Sarge kniete der Sohn des Verstorbenen, ein blondlockiger, schlanker Mensch, und das Zittern seiner kleinen weißen Hände über dem dunklen Holz war rührender als Weinen. Von der Empore senkte sich süßer Orgelklang herab, kleine Glöckchen klingelten. Das Gezwitscher aufflatternder Vögel war hell wie kühler Wind.
Franziska schauerte. Sie ging langsam zurück, das Gesicht stets dem Altar zugewandt, an dem fahle Kerzen brannten. Mit einem letzten Blick sah sie, wie der alte Priester den jungen Menschen sanft zu sich emporzog. Sie träumte von diesem edlen, blassen Knabengesicht. Ihre Nächte und ihr Spiel am Klavier waren lange davon erfüllt. Er hieß Erwin. Im nächsten Jahr kam eine fremde Künstlerin in die kleine nordböhmische Stadt und gab im Tanzsaale des einzigen Gasthofes ein Konzert. Franziska war bedrückt, als sie die ersten Töne der Geige hörte; nach dem ersten Satz der ersten Sonate aber war sie tief ergriffen, zitterte vor Aufregung und war so blaß, daß die Mutter sie mit harten Händen zwang, heimzugehen. Das vergaß Franziska ihrer Mutter nie.
Von diesem Tage an begriff sie, daß ihr die elementare Kraft zum Schaffen fehle, daß sie nie über den Augenblick und sein Leid und seine Freude hinüberfliegen könne und daß das halbfreie Phantasieren der sichere Untergang ihrer Kunst war.
Sie zwang sich, drei Wochen lang keine Taste zu berühren, dann begann sie in einem Alter, da die anderen schon Mittelmäßiges leisteten, wieder mit den allerersten Anfängen des systematischen Klavierspiels.
Die kränkliche Mutter hatte aushilfsweise für die gröbsten Arbeiten der Hauswirtschaft ein junges Bauernmädchen aufgenommen. Franziska brachte sie dazu, das Mädchen zu entlassen, ihr selbst die Arbeiten zu übertragen und ihr dafür das Entgelt zu bezahlen.
4
Junge Menschen haben eine rücksichtslose Energie. Franziska kannte das Leben nicht; kannte nicht die Kunst: sie glaubte beide mit bloßen Händen überwinden zu können. Für das erarbeitete Geld nahm sie Klavierunterricht bei einem alten Organisten, der früher einmal Orgelvirtuose in Leipzig gewesen war: aber Torvenius war der Musik ebenso ergeben wie dem Trunk, und so waren ihm bei einem Gasthausstreit mit einem Bierglasscherben die Beugesehnen der linken Hand zerschnitten worden. Nun, nach der erzwungenen Rückkehr in die Heimat, wollte er sich am Leben rächen, das ihm unrecht getan hatte, und diese Rache bestand darin, daß er sich fast täglich bis zur Sinnlosigkeit berauschte und einen kleinen Hund namens Orla blutig schlug; und doch war das in seinem Schmutz halbverkommene Tier das einzige Wesen, das er liebte und dem er seine Zärtlichkeit durch plumpe Liebkosungen bewies.
Er beneidete, haßte und verachtete Franziska; nur die bitterste, atembeklemmendste Not konnte ihn zwingen, ihr weiterzuhelfen. Er dachte sie damit zu quälen, daß er sie vor die schwersten Aufgaben stellte; aber ein Mensch wie Franziska kannte keine Müdigkeit. Wenn sie bis spät in die Nacht in der feuchten Waschküche die Wäsche gewaschen oder Körbe mit Kohlen und Holz die Treppen aus dem Keller heraufgeschleppt hatte, fand sie immer noch Zeit, zu üben und theoretische Bücher und Partituren zu lesen. Alles erschien ihr leicht im Vergleich zu den drei Wochen, in denen sie sich das freie Phantasieren abgewöhnt hatte. Denn das waren ihre einzigen ganz hellen, freudebestrahlten Stunden gewesen. Das war ja herrlich über alles: spielen, woran man dachte, wirklich spielen, die Schönheiten der gegenwärtigen Erde und des halbverträumten Erinnerns wie bunte Bälle durch die Abendstille werfen, mit feinen Fingern sich das Süßeste auf den Tasten zusammensuchen und plötzlich doch erschauern vor einer ganz neuen, unbegreiflich wundervollen Harmonie, die im nächsten Augenblick windverweht ins Niedagewesene entschwand, über das gesenkte Pult des Klaviers schritten in der Abenddämmerung die biblischen Gestalten, von denen der Vater ihr erzählt hatte: der verlorene Sohn, der zögernd an die hölzerne Tür klopfte und von liebenden Akkorden empfangen wurde, oder Ruth, die glückselig in der sinkenden Herbstsonne über die rauhen Stoppelfelder ging, oder die Muttergottes, die stets die Arme ins Leere ausstreckte und unsichtbare Tränen in den Augen hatte, die Frau Lots, die, zur Salzsäule verwandelt, in der Wüste auf einer Sanddüne dastand und im Regen kleiner und kleiner wurde. Wie sich einst Musik und biblische Kleinkindererinnerung vereinigt hatten, das verstand sie später nach diesen hungrigen drei Wochen nicht mehr.
Auch die Gestalt des Vaters und die Erinnerung an den blonden Knaben in der schwarzverhangenen Kirche wurde gleich der der Frau Lots immer durchsichtiger: Franziska, die Siebzehnjährige, fühlte schon weit hinter sich eine erste Jugend, ein für immer verlassenes, längst ins Unrettbare versunkenes Reich.
Und doch war es auch jetzt noch an manchen Tagen herrlich zu leben. Denn alles, was sie erlebte, jeder Augenblick, der seine Flügel vorüberschimmern ließ, gehörte ihr allein, jeder Schritt, den sie tat, zog in unnennbare Fernen, weit war der erste Saum des dunklen Waldes, weit waren die in der Frühlingsdämmerung zitternd erwachten Lichter der kleinen Stadt im Tal, alles fiel ihr mitten in die rauhen, abgearbeiteten Hände; wenn sie eine Fuge von Bach, ein Scherzo von Haydn, eine Sonate von Beethoven spielte, so war es immer, als hörte sie es zum erstenmal, als gehöre ihr nun diese Musik allein; und ging sie unter dem ferngestirnten Firmament unter nachtbehangenen Bäumen, so fühlte sie das Unentrinnbare der Stunde süß, nahm es auf in tiefster Seele, weil sie wußte, niemals kehrt es wieder.
Menschen, die so stark an sich selbst hängen, die sich keinem zweiten Menschen geben wollen, die geben sich der Natur, der Unendlichkeit des Unbeseelten hin. Sie versinken darin, berauschen sich an der Stille, am Nebel, am Waldesduft. Wenn jetzt, hart neben dem Weg, ein Eisenbahnzug aus den ernsten Wäldern hervordonnerte, stampfend wie auf Gigantenfüßen, leuchtend in tausend goldenen Funken, die aus dem dunklen kegelförmigen Schlot der Maschine hervorströmten wie ein Zug Bienen aus sonnengebräuntem Korb am Gartenrand, wenn plötzlich die Flamme aus dem Kamin hervorschlug und sich in dichtem, rotem Rauch hoch über die windgebeugten Baumwipfel emporbäumte, da jubelte Franziskas jungfräuliches, starkes Herz dieser unüberwindlich schreitenden Kraft entgegen: denn sie fühlte, daß sie lebte.
Als der schwere Zug in die Ferne gerollt war, war sie plötzlich müde, es rief sie das Zimmer daheim, das Sterbezimmer ihrer Mutter, das nun ihr gehören sollte, und Mutters Bett, in dem sie diese Nacht und alle anderen kommenden schlafen mußte.
Henriette war noch nicht daheim. Aber in der Ofenröhre war noch etwas Essen aufbewahrt. Dachte Minna nicht an alles? Und woran dachte sie jetzt?
Franziska mochte nichts essen; ihr war, als könne sie vom Schlaf allein satt werden; sie zog den Schlaf ein wie einen berauschenden Duft, und als sie wußte, daß sie schlief, sehnte sie sich nach einem Traum, und fühlte sofort die müden Augen angekettet an eine Erscheinung. Als erste stand ihre Mutter vor ihr, einen schwarzen Strumpf um den Hals und lächelte ihr ernst zu. Aber sie stand gar nicht da, sondern schleppte sich am Boden hin; schon zog sie die Tochter mit sich und griff heftig nach ihr, wenn Franzi müde zurückbleiben wollte. Und wie sie so dahinging, scharrte sie unaufhörlich in der Erde, das Ende des Strumpfes, der auf der Erde nachschleifte, war eigentlich aus Eisen und grub eine tiefe Rinne in den Boden, in den Händen hatte die Mutter ihr Eßbesteck aus schwarzem Bein und den dünnen silbernen Löffel, und diese Gegenstände wollte sie nun in der Erde verscharren. »Ihr braucht sie ja gar nicht mehr«, sagte ihre Stimme, »Minna ist fort, ihr andern verdient sie nicht.« Plötzlich zeigte sie mit furchtsam bösem Blick nach rückwärts: da ging auch der Vater, bleich, mit einem tiefen Schirm über die Augen, und wollte die schwarzglänzende Okarina, auf der er immer gespielt hatte, in seiner Brusttasche verstecken; sie war drei Monate nach seinem Tod plötzlich zerbrochen, obwohl sie längst ruhig im Glaskasten auf grünem Samtpolster lag. Dann kamen noch viele Gestalten, auch lebende, die bloß aus der Stadt verschwunden waren; und ein kleiner Knabe, den sie aus den Kinderjahren kannte, hielt eine abgelaufene Zwirnspule in der Hand. Um alle Gestalten war Halbdunkel, und ihre Schritte klangen wie murmelnde Stimmen.
Plötzlich stieg eine lohende Flamme vorn empor. Alle Gesichter wandten sich nach oben, alle waren entzückt, Staunen und Jubel lag in jedem Auge. Ringsum war Wüste, einsame Palmen streiften mit tief herabhängenden Blättern den nachtfeuchten Sand, eine leise, wundervoll fließende Melodie rauschte hinter einer Sanddüne wie ein Quell, und jetzt sah Franziska sich allein im halbdunklen Zimmer sitzen; ernüchtert glaubte sie sich in die Wirklichkeit zurückgeworfen. Aber die Musik dauerte fort. Sie hörte sich selbst auf dem Klavier phantasieren, fühlte, wie sie immer neue Töne, immer neue Harmonien mit den ausgebreiteten Armen empfing. Auch das alte Klavier ging schwerfällig auf seinen drei Beinen dahin, strebte der lodernden Feuersäule entgegen wie alle die anderen; die Mutter aber stand am nächsten, fast in der Mitte der singenden Glut, ihr blasses Gesicht war selig zurückgebeugt, und all die feinen Runzeln und Falten ihrer Züge erglänzten in Goldfäden. Da fühlte Franzi plötzlich alles langsam weit, weithin versinken, alles entschwinden: sie erwachte. An der Tür stand Henriette und leuchtete in das Zimmer hinein.
5
Solche Traumesnächte glitten wie Wolken über Franziskas Leben hin, aber sie spiegelten sich nicht in ihrem Leben; denn wann hätten sich Sonne und Sterne in einer geschotterten Landstraße gespiegelt? Eine Stimme in ihr sagte »Vorwärts!« ganz gleich, wohin. Von einer Stufe der Kunst zur anderen, von einem mühsam ersparten Pfennig zum anderen. Jede Ruhestunde, in die sie schonungslose Arbeit zwängte, schien ihr Gewinn, jede Schwierigkeit, die sie überwand, positives Glück, Reichtum jeder Tag.
Das erste, das letzte, der Tod blieb unfaßbar.
Sie sprach es nicht aus, sie fühlte es: ich bin keine von denen, die sterben können; eines Tages werde ich vielleicht zu ihnen gehören, aber dann werde ich der Franziska von heute zuwinken, vom anderen Ufer her, ein anderer Mensch wird zurückbleiben, mit einem anderen wird ein neues Dasein beginnen und enden.
Eines Tages wartete sie im strömenden Regen auf Torvenius, ihren Klavierlehrer. Sie stand in der Tür seines kleinen Häuschens, sah hinaus auf den Rasen in den winzigen Vorgarten, der in der frühlingsschweren Luft zu wachsen schien. Endlich kam Torvenius; er trug einen Koffer in der Hand. Seine Augen glänzten sonderbar, und seine Hand zitterte, als sie den Schlüssel ins Schloß des Koffers steckte.
Aber Franzi dachte nie über Menschen nach; sie spielte; Torvenius schwieg und sah ihr zu. Die Sonate war zu Ende; Franzi wandte sich zu ihm und wartete auf sein Urteil. Er stand auf, öffnete den Koffer und zog den Leichnam seines Hundes heraus.
»Alles stirbt«, dachte Franzi. Gestern war der Hund noch umhergelaufen und hatte mit einem abgenagten Knochen am Pedal des Klaviers geschabt. Nun schien ihr das Tier von heute ein anderes zu sein, ein Doppelgänger des lebendigen. Aber es graute ihr vor beiden.
»Was ist das jetzt? Nun werden die Leute sagen, ich hätte den Orla zu Tode geprügelt«, sagte Torvenius, »aber ich habe ihn ja nie angerührt. Die Bestie heulte, wenn ich zur Tür hereinkam. Das Aas heulte eben zum Vergnügen. Papageien werden 150 Jahre alt, aber Hunde müssen genau so sterben wie Menschen. Was sagt Orla?« Er beugte sich über das entkräftete, offenbar an Altersschwäche verendete Tier und nahm ihm ein weißes Handtuch ab, das er ihm um den Hals geschlungen hatte.
Warum er den Hund in seinem Koffer herumgeschleppt hatte, erfuhr niemand. Vielleicht hatte er ihn irgendwo verscharren wollen.
Torvenius verschwand am nächsten Tage auf einige Wochen. Franzi übernahm die Klavierstunden, die er bis dahin erteilt hatte. Plötzlich erschien er wieder in der Stadt. Er betrank sich nicht mehr, aber gerade jetzt wichen ihm sonderbarerweise die Leute aus und zeigten ihm offen, daß sie ihn verabscheuten. Endlich nahm ihn der Besitzer eines Kinematographentheaters als Klavierspieler auf. Atemlos gebannt hingen die Leute an der leuchtenden Fläche, keiner hörte auf das Spiel, keiner merkte, daß dem Klavierspieler die Sehnen der rechten Hand den Dienst versagten. Franzi traf ihn manchmal auf der Straße. Nun grüßte er demütig, lief ihr sogar nach und wollte mit ihr reden; aber Franzi fühlte, daß sie ihn haßte. Ihr graute vor ihm wie vor seinen zwei Hunden. Das war so deutlich auf ihrem Gesicht zu lesen, daß er sich ohne Worte wieder davonmachte. Am nächsten Abend sah ihn Franzi im Kinematographen; eine tropische Landschaft, windbewegte Bäume, dunkle Kähne, hellglitzerndes Wasser und rauschende Ruder – alles zog vorüber. Torvenius saß an seinem Klavier, den Kopf zurückgelehnt, die Augen halb geschlossen. Um sein gequältes Gesicht zitterte der Widerschein des wandelnden Lichtes. Und in diesem Augenblick erschien ihr sein Gesicht schön, von einer inneren Flamme erhellt. Aber das war nur ein Augenblick.
Diese Stunde im Kinematographen, Sonnabendabend von sieben bis neun Uhr, diese Stunde war ihr Sonntag. Denn sie hielt die Sonntage nicht mehr. Und seitdem sie nicht mehr in die Kirche ging, glaubte sie auch nicht mehr an Gott.
Es waren harte Tage, bis an den Rand gefüllt mit Arbeit: und an manchem Sonnabend fühlte sich Franzi müde zum Sterben. Der Kopf dröhnte; die Finger krampften sich zusammen, und es knirschte in den Gelenken. Sie fühlte Schmerzen von den Fingerspitzen bis zu den Schultern. Das schwerste war, daß sie dann an sich zu zweifeln begann. Dieser Zweifel schmerzte mehr als die Gelenke. Und doch überwand sie sich, blieb stark. Denn sonst hätte sie dieses Leben nicht jahrelang ertragen. Sie konnte unbarmherzig streng gegen sich sein; sie mußte es sein. Wenn sie ein Stück auswendig spielte und plötzlich ihr Gedächtnis auch nur eine Sekunde lang zögerte, dann wartete sie nicht, bis es wirklich versagte, sondern sie verurteilte sich dazu, das ganze Stück abzuschreiben, von den donnernden Akkorden des Beginns bis zu den feinen Arabesken des Finales, die so wesenlos schienen und doch so unbeschreiblich mühsam waren. Sie saß lange Nächte hindurch aufrecht im Bett, ein altes Zeichenbrett von Vaters Zeiten her auf den Knien, und schrieb, bis ihr die Feder aus den Fingern sank. Aber wenn sie morgens erwachte und die Knie kaum bewegen konnte – denn diese waren von dem schweren Zeichenbrett fast gelähmt –, da fühlte sie sich jung, fühlte sich endlich, endlich glücklich, vom Leben als einzige unter Tausenden auserwählt, sie fühlte den Hauch einer großen Zukunft sich entgegenwehen: da erhob sie sich über ihre Geschwister, über den alten Torvenius, über all die matten Menschen der kleinen, grau- und braunfarbenen Stadt und über sich selbst; über die unvollkommene Franziska von gestern abend, die beim 58. Takt der Fis-Moll-Sonate von Schumann versagt hatte. Sie erwartete Übermenschliches von sich, Grenzenloses vom Leben. Das gab ihrem Auge den Glanz der Überwältigten, ihrer zarten, feingliedrigen Figur die Kraft, ihren herben Zügen die Schönheit; das adelte sie. Aber es machte sie auch leer, herzlos, kalt bis zur Härte, empfindlich bis in die letzten Fingerspitzen und, wie alle Hochmütigen, im tiefsten Innern wehrlos wie ein Kind.
6
Im Februar des nächsten Jahres reiste Franziska nach Prag. Leonore Constanza sollte ein Konzert geben.
Die Fahrt dauerte lange; mutlos, unterirdisch klang das dumpfe Dröhnen des Zuges. Nebel lag über den winterlich tiefgerunzelten leeren Feldern, Nebel lag auch als feuchter Glanz auf den Straßen Prags, Nebel hing als zarte Hülle um die Bogenlampen, die sich über den breiten Straßen wiegten, an kaum sichtbaren Fäden gehalten. Nebel stand schüchtern vor den Schaufenstern der Geschäftsläden und wartete, Nebel schritt die ganze grandiose Weite des Wenzelplatzes empor, bis zur Höhe, wo ein gewaltiges ehernes Reiterstandbild drohend einen säulengetragenen Palast bewacht, erfüllt von wuchtender Kraft, heldenhaft und doch sanft wie ein Fürst vor einer Zauberburg in Tausendundeiner Nacht.
Ganz dürftig aber war das alte Haus, in dem die Schwester wohnte. Die dunkle Stiege war gekrümmt wie ein buckliger Rücken, die Stufen schadhaft wie eines greisenhaften Menschen Zähne. Hier war Minna vor einem Jahr bei einem pensionierten General in Dienst getreten. Franziska klingelte; eine alte Frau steckte ihr alabasterweißes Köpfchen heraus und hielt ihr das pergamentene Ohr hin.
»Ich möchte Fräulein Minna sprechen«, sagte Franzi.
»Die Minna?« gab die schwerhörige Frau zurück und lachte. Sie sprach das Wort aus, als hätte sie es nie gehört, winkte dann mit flatternder Hand, schloß die Tür und legte den Riegel vor.
Franzi wartete. Unten klingelte die elektrische Straßenbahn, Menschenschritte gingen am Hause vorüber, man hörte Worte in einer fremden Sprache. Sie fühlte sich müde zum Umsinken, müde, wie sie es seit den Kinderjahren nicht gewesen war. Da wurde an der Tür gerüttelt, der Flügel wurde aufgerissen, die Kette klirrte. Tiefatmend fiel ihr die Schwester um den Hals und preßte sie schmerzhaft innig an sich. –
»Ich wußte sogleich, daß du es bist«, sagte Minna. »Du hast doch nicht lange gewartet? Wie lange bleibst du bei uns? Ich lasse dich nicht mehr fort. Jetzt habe ich Dienst, aber abends fährt die Herrschaft aus, und dann ...«
»Die Herrschaft? Was sind das für Worte?« fragte Franzi.
»Ich habe es nicht so gemeint«, sagte Minna; und wie zur Entschuldigung: »Du darfst nicht böse sein, du weißt doch. – Erinnerst du dich nicht mehr? Ich war krank.«
»Du Arme«, sagte Franzi, »was hat dir denn gefehlt?«
»Typhus! Aber du mußt mich nicht bemitleiden. Im Anfang hatte ich ja solche Angst vor dem Krankenhaus, aber im Grunde war es doch schön. Glaubst es? Denk nur, die ehrwürdigen Schwestern wollten mich gar nicht fortlassen. Als ich dann gesund wurde, gab es soviel zu essen. Sie haben mich wirklich verwöhnt, gaben mir Cheaudeau zu trinken, und ich konnte den ganzen Tag daliegen und durfte nichts arbeiten ... Und das Haar wuchs mir wieder. Aber im Anfang, da hatte ich einen kahlen Kopf wie unsere gnädige Frau.«
»Hast du jetzt Zeit?« fragte Franzi.
»Jetzt? Nein, ich denke, es geht nicht. Hör’ nur zu, der General schläft, ach, er schläft fast den ganzen Tag, er schläft und ißt und ißt – und dann schläft er wieder ein, er ist ja uralt –, und wenn er dann aufwacht, muß alles fix und fertig sein, und ich muß doch noch die Teller waschen und den Tisch decken, muß Ordnung machen in allen sechs Zimmern ... und für den Abend Feuer zünden ... Sieh nur«, sie wies auf ihre Hände, die vom Küchenfeuer und der Lauge des Abwaschwassers gerötet waren; manchmal schämte sie sich ihrer, denn früher waren sie ihr Stolz gewesen. In der ersten Zeit hatte sie die Hände vor dem Schlafengehen mit Glyzerin eingerieben und Handschuhe angezogen. Später fügte sie sich in alles.