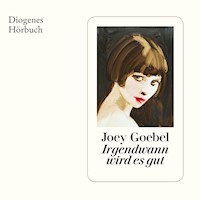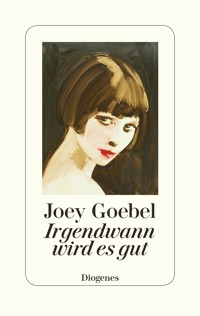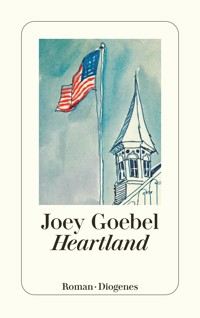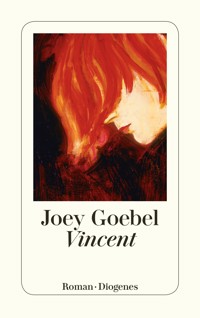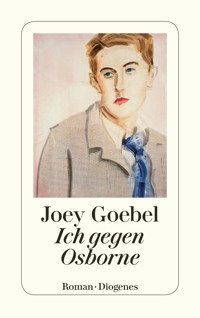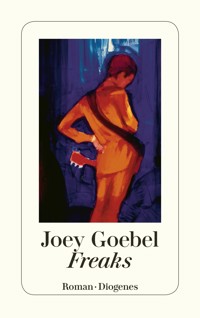
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kann Musik die Welt verbessern? Verhilft ein neuer Sound zu neuem Sinn? Das wohl nicht – höchstens den Musikern. Vor allem wenn es sich um fünf Außenseiter in einer gottverlassenen Kleinstadt handelt, mit denen niemand etwas zu tun haben will. Aber wenn sie Musik machen, setzen sie ihre eigenen Macken unter Strom und verwandeln sie in den Sound ihrer Befreiung. Eine Tragikomödie mit mehr als einem Ende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Joey Goebel
Freaks
Roman
Aus dem Amerikanischen von Hans M. Herzog
Diogenes
{5}Adam Joseph Goebel jr. gewidmet,
in liebender Erinnerung
{9}1Humanpotential
Luster
Leicht war es nicht, sechs Milliarden gebrochene Herzen auf einmal zu flicken, doch ich schaffte es.
So lautet die erste Zeile des Buches, das ich eines Tages schreiben werde. Es wird das beste Buch aller Zeiten sein und auf meiner Lebensgeschichte beruhen, gescheiter als jede Boulevardzeitung und mindestens so sexy wie die Bibel. Oprah Winfrey wird es weiterempfehlen.
Dieses Schlafzimmer hier wird mit Samtkordeln abgetrennt sein, und die Teppichflecken werden als Sammlerstücke bei eBay versteigert werden. Und wenn die Besucher aus Ortschaften mit dickeren Telefonbüchern hierher in mein bescheidenes Heim pilgern, werden sie alle dasselbe denken:
»Wie ist es nur möglich, daß es damals, als die Klingeltöne unserer Handys noch aus Musicalmelodien bestanden, als Angstneurosen überhandnahmen, als die Erde so schwer wurde, daß die Schwerkraft außer Kraft gesetzt wurde, einen unterernährten Knaben gab, der so wertvolle, weltverändernde Gedanken absonderte, die später unsere {10}Hymnen wurden, der einen revolutionären Geistesblitz pro Minute auf Spiralblöcke kritzelte, und das auf einem mottenzerfressenen Bett in einem miefigen Schlafzimmer in einem lächerlichen Haus an einer dumpfen Straße in einer inzestgeplagten Stadt in einem derart tristen Bundesstaat der USA?«
Dieselbe Frage stelle ich mir, während die Antwort hinter mir kauert und nach billigem Bier und Marihuana riecht. Er treibt mich zu etwas Großem an, dieser Mann, dabei bin ich nichts als ein schrecklich durchschnittlicher Humanoide.
Er zieht mich auf. »Du bist doch so schlau, oder? Also schreib mir gefälligst einen von deinen dämlichen Songs, du verdammter Klugscheißer, du klugscheißender Scheißkerl.«
Er inspiriert mich, während er seine große Knarre hinten in meine Gedanken drückt. Also spucke ich ein paar Lyrics aus, während er den Abzug spannt wie der echte Neandertaler, der er ist.
{11}2Das sagen sie alle
Opal
Die Leute reden immer über Wellenlängen. Vermutlich hab ich eine dieser Wellenlängen, die man nur schwer auffangen kann. Vielleicht bin ich noch auf Mittelwelle oder so was. Keine Ahnung. Aber ein paar können mich hören, beispielsweise die Kleine auf meinem Beifahrersitz, die die Passanten bespuckt. Die finden sie niedlich, bis ihnen ein ekliger Speichelklumpen seitlich am Gesicht runterläuft. Dann ist die Kleine weniger niedlich als ekelerregend. Ich glaube, die gleiche Einstellung haben die Leute mir gegenüber.
Ich bin zwar zehnmal so alt wie Ember, aber wir sind auf einem Level. Entweder ist sie enorm reif, oder ich bin enorm unreif. Keine Ahnung. Der größte Unterschied zwischen uns beiden (mal abgesehen von den 72 Jahren) ist wohl der, daß ich Jungs mag und sie Jungs haßt. Aber das wird sich ändern.
»Weißt du was, kleine Freundin?« sage ich zu meiner Kleinen, während sie versucht, noch ein wenig Spucke zusammenzukriegen. »Wir sind einander schon ziemlich ähnlich.«
{12}»Nein, sind wir nicht.«
»O doch! Wir hassen Langeweile, wir sind immer auf Achse, und ich bin viel lieber mit jemand wie dir zusammen statt in aller Herrgottsfrühe bei Hardee’s zu frühstücken und dauernd an diesen Bridgeturnieren teilzunehmen.«
»Und ich bin froh, daß ich mir keine dämlichen Zeichentrickfilme angucken muß«, erwidert sie.
»Genau«, sage ich. »Du machst dir auch nichts aus diesen Gimmicks in den Cornflakes-Packungen, auf die andere Kinder so abfahren.«
Wir springen aus meinem Kombi, und ich ziehe so rasch wie möglich den blöden Velours-Trainingsanzug aus. Ich achte immer darauf, daß mich Embers Eltern nicht in meinen Rockklamotten sehen, weil sie sich darüber aufregen könnten. Ich bezweifle allerdings, daß sie es täten. Anscheinend interessieren sie sich immer weniger für ihr Kind und immer mehr für ihre Themenpartys und Urlaube auf Inseln, von denen ich noch nie gehört habe.
Nachdem ich mein Alte-Damen-Outfit auf den Rücksitz geschmissen habe, machen Ember und ich ein Wettrennen zum Eingang des Red-Lobster-Restaurants, das sie ausgewählt hat. Sie ißt den Mahi-Mahi dort total gern. Ich hab ihr gesagt, Luster mag keine Kettenrestaurants, doch das war ihr egal. Ich kann mich übrigens nicht beklagen, weil ich die Geflügel-Sticks dort so gern esse.
Natürlich sind ihre flinken Beinchen schneller im Restaurant als meine arthritischen alten Knochen.
{13}Kellnerin
Zum ersten Mal heute abend ist mein Lächeln echt. Ich kann nicht anders. Da kommt ein kleines, vielleicht sieben oder acht Jahre altes Mädchen auf mich zugehüpft, und sie hüpft irgendwie synchron zum Rhythmus der Muzak. Ich schwör’s … sie ist ein Engel.
Sie hat lockige blonde Haare, das Gesicht eines Babys und riesengroße wunderschöne Augen. Ein bißchen sieht sie aus wie das Mädchen in den alten Werbespots von Welch-Traubensaft, nur nicht so unheimlich. Allerdings haben ihre Eltern sie ziemlich schräg angezogen. Sie hat ein T-Shirt an mit einem Monstertruck drauf, Gravedigger heißt der. Es ist viel zu groß für sie und reicht bis über die Knie. Es sieht aus, als trüge sie überhaupt keine Hose, was ich bei einem Kind schon immer daneben fand. Wenigstens hat sie niedliche Schuhe an. Elegante schwarzweiße Halbschuhe, Saddle Oxfords.
»Hi!« begrüße ich sie.
»Hey.«
Sie sieht sich nach einer alten Frau um, die hinter ihr herkommt, wahrscheinlich ihre Oma. Die Oma sieht sogar noch peinlicher aus, und ich muß mir auf die Unterlippe beißen, um nicht laut zu lachen. Sie hat kurze weiße Haare, aber eine totale Schwuchtelfrisur und trägt hautenge Jeans, schwarze Cowboyboots mit Quasten und ein T-Shirt, auf dem »Sex Pistols« steht. Mir fällt nicht ein, welcher Prominenten sie ähnlich sieht, wahrscheinlich weil es unter den Promis keine alten Frauen gibt.
»Hi! Wie viele Personen? Zwei?«
{14}Darauf die Oma mit lauter hoher Omastimme: »Nein, fünf. Die anderen kommen gleich.«
»Auf welchen Namen haben Sie reserviert?« Das muß ich fragen.
»Oglesby.«
»Raucher oder Nichtraucher?« Auch das muß ich fragen. Doch diesmal antwortet die Piepsstimme des niedlichen kleinen Mädchens.
»Raucher!«
Das gibt mir endlich einen Vorwand, um laut zu lachen. Ich habe Anweisung, den Gästen möglichst oft Komplimente zu machen, doch diesmal ist es mir ernst.
»Ihre Enkelin ist wirklich süß.«
»Sie ist nicht meine Enkelin«, entgegnet die alte Dame. »Und ich bin keine Oma.«
Ember
Die bescheuerte Kellnerin weist uns einen Tisch zu. Alle hier sind doof, von Opal und mir mal abgesehen. Wir mögen Rockmusik. Wir rocken.
Ein paar Familien mit Mamis und Papis sind da. Auch Männer und Frauen auf einem Date. Außerdem sind ein paar süße Jungs da. Das sind alle Gäste.
Ein Kellner kommt. Ich merke, daß Opal ihn so ansieht, wie sie Catcher ansieht.
»Hi! Mein Name ist Todd, und ich bediene Sie heute. Was darf ich Ihnen beiden zum Trinken bringen?«
»Ein Bier. Michelob Light«, antworte ich.
{15}»Oh! Ihre Enkelin ist wirklich süß!«
»Sie ist nicht meine Enkelin«, sagt Opal. »Und ich bin keine Oma.«
Und ich will auf keinen Fall süß sein.
»Oh. Verzeihen Sie«, sagt Arschgesicht.
»Ich nehme ein Vervifontaine, und ihr geben Sie einen Shirley Temple statt des Michelob.«
Ich will keinen Shirley Temple. Normalerweise würde ich jetzt laut fluchen, aber ich mag Opal. Deshalb halte ich mich zurück.
»Tut mir leid«, sagt Arschgesicht. »Wir haben kein Vervi … was Sie eben gesagt haben.«
Nirgends kriegt sie das, was sie will.
»Na schön. Dann halt ein Budweiser für mich«, sagt Opal.
»In Ordnung. Danke. Ist schon unterwegs«, sagt Doofkopp. Opal ist damit beschäftigt, den Hintern des Kellners zu betrachten, daher spiele ich mit meinem Messer. Verstümmeln. Verstummeln. Ich werde immer besser darin, mich nicht zu schneiden.
»Schneid dir bloß nicht deine hübschen Fingerchen ab, Ember.«
Ich richte das Messer auf sie.
»Uuuhh. Tu mir nichts, sonst kommt der schwarze Mann und holt dich.«
»Scheiß drauf. Den stech ich auch ab.«
Vor dem schwarzen Mann hatte ich noch nie Angst. Es gibt nämlich gar keinen schwarzen Mann. Es gibt keinen schwarzen Mann. Es gibt auch keine Zahnfee. Es gibt keinen Osterhasen. Und den Weihnachtsmann gibt’s schon mal gar nicht. Ich bin nicht bescheuert. Der {16}Weihnachtsmann ist eine dicke fette Lüge, mit der man dafür sorgt, daß die Kinder brav folgen.
Ich hasse die Feiertage.
Kellner
Die Tussi will ich flachlegen.
Sie kommt mit einem kräftigen, dußlig aussehenden Schwarzen hereingerollt. Ich schätze, sie sind kein Paar, weil sie irgendwie nicht zusammenpassen. Er hat so ’ne komische Wuschelfrisur mit Löckchen, trägt ein T-Shirt mit einem Pudel drauf, gebleichte Jeans und dazu weiße Lackschuhe. Irgendwie sieht er aus wie der schwarze Comedian bei Saturday Night Live, bloß ohne Gesichtsbehaarung.
Sie hingegen ist weiß. Cremeweiß. Sie hat lange schwarze Haare, ein hautenges weißes Kleid und Netzstrümpfe an. Sie ist perfekt geschminkt und hat ein perfektes Dekolleté. Irgendwie sieht sie aus wie diese Mädchen bei Baywatch, nur hübscher und realer. Wirklich schade, daß sie in einem Rollstuhl sitzt. Aber mich stört das nicht. Sie könnte mir wenigstens einen blasen, und ich steh total auf Blow Jobs, ehrlich.
Richtig kurios ist, daß die Kellnerin, die ich mal gevögelt habe, die Tussi im Rollstuhl und den Schwarzen zu dem Tisch mit der abgefahrenen Alten und dem abgefahrenen Mädchen bringt, das nicht ihre Enkelin ist.
Ich trete wieder an den Tisch.
»Hi! Mein Name ist Todd, und ich bediene Sie heute. Was darf ich Ihnen beiden zu trinken bringen?«
{17}Ich bemühe mich, nicht auf die Möpse der heißen Tussi zu starren, aber vergebens. Verdammt.
»Ich nehme einen Hawaiipunsch.« Sie redet leise und gehaucht wie Marilyn Monroe.
»Tut mir leid. Wir haben keinen Hawaiipunsch.«
»Dann nehme ich halt ein Root Beer.«
»Tut mir leid. Root Beer haben wir auch nicht.« Möpse.
»Wasser.«
»In Ordnung. Und für Sie, Sir?«
»Ich würde gern eine Coca-Cola Classic trinken, bitte.« Er redet nicht wie ein Schwarzer, allerdings auch nicht wie ein Weißer. Er ar-ti-ku-liert jede einzelne Silbe, als ob er mich für dämlich oder schwerhörig oder so was hält.
»Ist Pepsi okay?« Das soll ich immer fragen, nur für alle Fälle. Doch er glotzt mich an, als hätte ich mich gerade über seine Mutter lustig gemacht oder so was.
»Nein! Nein, das ist keineswegs okay, Sie voreilige Schlüsse ziehende Dumpfbacke! Bringen Sie mir einfach eine Milch!«
»In Ordnung. Danke. Ich bin gleich wieder da.«
Was für ’n Freak. Gut, daß ich gefragt habe.
Ray
Leute arbeiten hier. Leute essen hier auch. Ich trete ein, weil ich etwas essen will, und zwar in der Öffentlichkeit. Eine hier beschäftigte junge Frau schenkt mir ein großes Lächeln. Ich schenke ihr auch eins und gehe rasch Richtung Essen. Da brüllt sie mir hinterher:
{18}»Halt! Sir, wie viele?« höre ich, ehe ich den Eßraum erreiche.
Ich drehe mich zu der jungen Frau um. »Ich verstehe nicht.«
»Wie viele gehören zu Ihrer Gruppe?«
Ich betrachte sie, überlege, suche in meinem Gedächtnis. Gruppe. Wie viele.
»Mit wie vielen Personen möchten Sie essen?« fragt sie langsam und mit lauter Stimme, als wäre ich ein Baby und geistig behindert. Ich halte vier Finger hoch.
»Raucher oder nicht?« fragt sie.
Ich überlege gründlich, dann antworte ich: »Ich verstehe nicht.«
»Sir, rauchen Sie gern Zigaretten oder möchten Sie sich lieber nicht in der Nähe von Menschen aufhalten, die gern Zigaretten rauchen?«
Da fällt mir ein, daß es hier so viele Alternativen gibt. Hier trennt man Esser nach ihren Rauchgewohnheiten. Das gefällt mir! Aber ich will nur essen.
»Ich möchte mich gern in der Nähe eines jungen Schwarzen, eines kleinen Mädchens, einer älteren Dame und einer hübschen jungen Frau im Rollstuhl aufhalten.«
Die junge Frau lächelt. »Aha. Okay. Möglicherweise weiß ich, welchen Tisch Sie meinen.«
Am liebsten möchte sie laut lachen, drückt es aber herunter. Sie glaubt, ich verstehe den Humor dieser Situation nicht.
{19}Gast
Kaum dachte ich, noch ausgeflippter könnte es nicht werden, als so ein dicklicher, tuntiger mittelalter Ausländer reinkommt. Der Typ sieht total schrill aus in seinen Flipflops mit weißen Socken, superkurzen Khaki-Shorts, einem Hemd mit abgeschnittenen Ärmeln und mit seiner Hüfttasche aus Jeansstoff. Und einem dicken schwarzen Schnauzbart. Mit anderen Worten, er ist der typische dunkelhäutige Nahostler, bloß ohne Vollbart und ohne Handtuch um den Kopf. Er setzt sich neben die Oma mit dem T-Shirt, auf dem »Sex Pistols« steht.
»Jungs, ich hätte nie gedacht, daß ich so was noch mal erleben darf«, sage ich zu meinen Kumpels. »Wir sitzen nicht mehr am coolsten Tisch.« Sie lachen. Ich hab’s drauf.
Ich denke mir, das muß wohl so ’ne Art Ausflug aus irgendeiner Anstalt sein, in der sie Irre oder Zurückgebliebene wegsperren. Scheiße. Es muß doch ’ne Erklärung dafür geben, daß die hier im Rudel auftreten. Wer wohl als nächster kommt? Ein Rabbiner? Ein Zwerg? Ein Roboter?
Meine Kumpels und ich beobachten sie weiter, während wir unsere Rolling Rocks austrinken. Die Kleine hätte sich fast eine Zigarette angezündet, doch die alte Schnepfe nimmt sie ihr weg und raucht sie selber. Das hat Josh und Jeremy wohl auf die Idee gebracht, sich auch eine anzuzünden, also zünde ich mir ebenfalls eine an.
»Hab noch nie so viele miese Frisuren an einem einzigen Tisch gesehen«, sag ich zu meinen Jungs. Wieder wird gelacht. Da steh ich drauf.
{20}Doch die eine Schnalle ist echt scharf. Nur schade, daß sie in ’nem Rollstuhl sitzt, so wie die aussieht, geht sie im Bett ab wie ’ne Rakete. Die Kleine wird eines Tages wohl auch mal scharf aussehen. Bestimmt war die alte Zicke vor siebzig Jahren auch mal scharf.
O Mann. Ich schwör’s, die Rollstuhlschlampe guckt zu mir rüber. Die würde mir wohl gern mal die Stange halten.
Joshs Handy klingelt, ein alter Song von Jay-Z, und zwar der, in dem er dieses Lied aus dem Musical Annie gesampelt hat. Das dürfte der Anruf von Joshs Dealer Jerome sein, auf den wir gewartet haben. Meine Frau müßte den Kleinen eigentlich in ein paar Stunden ins Bett gebracht und sich selbst hingelegt haben, dann ist die Hütte frei für meine Jungs und mich, dann können wir Party machen. Ich frag mal die Kellnerin hier, die ich zu High-School-Zeiten gebumst habe, ob sie sich nachher ein bißchen mit uns amüsieren will.
»Jede Wette, die Gruppe da drüben weiß, wie man so richtig abfeiert«, sage ich zu meinen Jungs. Kein Riesenlacher, aber ich bin immer noch der King. Zum Ausgleich lache ich selbst extra laut.
Plötzlich dreht sich der Schwarze zu uns um, deshalb hören wir auf zu lachen und sehen absichtlich weg.
Aurora
Wenn ich statt Brustwarzen Augen hätte, würde ich jetzt gerade einen Anglotzwettbewerb verlieren. Aber wenigstens werde nicht ich allein angestarrt. Meine Freunde {21}ziehen einige der Blicke auf sich, noch ein Grund mehr, mit ihnen befreundet zu bleiben.
»Hey! Laßt uns anstoßen!« schlage ich vor, als der Kellner Ray eine Limo gebracht hat. Seit kurzem stehe ich sehr auf Trinksprüche, schließlich gehören sie zu den Dingen, bei denen man sich erwachsen vorkommt, ohne daß man Krankheiten verbreitet.
»Klar. Gute Idee«, sagt Luster. »Worauf sollten wir anstoßen, kleine Ember?«
»Auf Vaginas.«
»Das gefällt mir. Auf Vaginas«, sagt Luster. Und wir heben unsere Gläser und rufen: »Auf Vaginas«, was mir nicht so behagt.
Ich bin in einem schwierigen Alter, und das seit neunzehn Jahren. Und es wird immer schlimmer. Beispielsweise gibt es auf den Partys meines Dads das Problem, mit seinen Freunden zu reden. Rein rechnerisch gesehen, bin ich inzwischen alt genug, daß man eigentlich von mir erwarten könnte, ein Gespräch mit ihnen zu führen, aber ich weiß nie, was ich sagen soll, und komme mir am Ende immer doof vor. Manchmal denke ich, ich sollte es wie meine Schwester, die Schlampe, machen und nach Kalifornien ziehen. Dann müßte ich mir nicht mehr überlegen, was ich auf den Partys meines Vaters machen soll.
Wenigstens brauche ich hier keine Angst zu haben, mich zu blamieren. Ich kann alles sagen, was mir gerade einfällt.
»Deine Haare sehen bomfortionös aus, Opal«, sage ich. Sie hat eine neue Dauerwelle.
»Ich weiß. Hab ich heute erst machen lassen«, antwortet sie.
{22}»Ich habe überlegt, wieder blond zu werden, aber schwarz paßt besser zu dem ganzen Satansding«, sage ich.
Sie nickt nur. Hier werde ich akzeptiert, und unter diesen Leuten bin ich wirklich glücklich. Für mich sind diese Freunde so etwas wie die Verkaufsautomaten im Untergeschoß eines Krankenhauses.
Damals, als meine Mom im Sterben lag und Dad, meine Schwester, die Schlampe, und ich sie im Krankenhaus besuchten, waren die Automaten im Keller mein einziges Vergnügen oder meine einzige Fluchtmöglichkeit. Alles andere war krank oder keimfrei, beige und schauderhaft und wurde außerdem ausgesprochen unvorteilhaft beleuchtet. Doch unten im Keller standen die Automaten, voller fröhlicher bunter Packungen, genau wie man sie außerhalb des Krankenhauses bekam.
Heute bin ich älter, und Süßigkeiten schmecken mir nicht mehr so gut wie früher, aber das ist unwichtig. Wichtig ist, daß mir die passenden Bilder dazu einfallen.
Inzwischen bin ich mir sicher, daß diese Deppen uns anglotzen. Ich kenne die Sorte aus der High-School, und auch wenn sie aussehen, als wären sie Anfang Zwanzig, sind sie mental nie über die zehnte Klasse hinausgekommen, da bin ich mir sicher. Solche Typen haben sich mittags in der Essensschlange immer vorgedrängelt, als wäre es ihr gottgegebenes Recht, vor den Menschen zweiter Klasse zu essen. Solche Typen mußten auf dem Klassenfoto immer in der ersten Reihe stehen, damit alle sahen, wie sie ihre Stinkefinger in die Kamera hielten (wie rebellisch!). Solche Typen fuhren mit offenen Fenstern durch die Straßen und ließen Rapmusik laufen, immer in genau der gleichen Pose, {23}den linken Ellbogen aufgestützt, die linke Hand lässig vor dem Mund, fast als würden sie für ein Klassenfoto posieren. Ich wollte schon damals nichts mit ihnen zu tun haben, und ich will heute nichts mit ihnen zu tun haben. Ich weigere mich zu studieren, damit keine jungen Leute um mich sind.
Und die sehen meine Freunde und mich an und lachen.
»Sie machen’s immer noch«, sage ich. »Ich halte das echt nicht mehr aus.«
»Es ist wirklich betrüblich, wenn Gelächter nicht willkommen ist. Falls das nicht aufhört, werde ich mir die Ärsche vornehmen müssen«, sagt Luster.
»Nein, Luster, bitte nicht schon wieder.« Ich wechsle das Thema. »Na, was hast du heute in der Schule gelernt, Ember? Und sag nicht ›Gar nichts‹.«
»Heute hab ich die Schule geschwänzt.«
»Ja!« ruft Ray. »Ich dachte doch, ich hätte dein Zweirad an der Sonnenbank vorbeifahren sehen, aber ich hatte Kunden und konnte dir keinen Gruß schenken.«
Mir fällt auf, daß Ray sich, noch während er spricht, umsieht, ob er nicht irgendwo seinen Typ sieht.
Dann prusten die schicken Kerle mit ihrem Jason-Priestley-Lächeln und den Boy-Band-Dreitagebärten wieder laut los, eindeutig in Richtung unseres Tisches, bis schließlich Ember ausrastet, nicht Luster.
»Haltet die Fresse, verdammt!« brüllt sie, steigt auf ihren Stuhl und zeigt mit ihrem Besteck auf die Männer. »Ich hab ein Messer, und ich schlitz euch auf vom Arsch bis zu den Ohren.« Ich glaube, den Spruch hatte sie von einem aus dem Studiopublikum der Krawalltalkshow Jenny Jones.
{24}»Ganz ruhig, Kleines«, sagt einer von ihnen. »Da hat wohl eine vergessen, ihr Ritalin zu nehmen.«
Als seine bescheuerten Freunde lachen, steht Luster sofort auf.
»Nimm bitte Platz, mein ungebärdiges Kind«, sagt Luster. Ember macht einen Schmollmund und setzt sich widerstrebend hin. Sie legt ihr Messer ab, und ich nehme es ihr weg, für alle Fälle. Dann hören wir Luster zu, dem Sprecher unserer Gruppe.
Gast
Dieser Schwarze mit der riesigen lächerlichen Frisur mustert mich also mit seinem irren Blick, wahrscheinlich hat er sich mit irgendwas zugedröhnt. Da bleib ich erst mal cool.
»Was läuft, Mann?« sage ich.
»Ich entschuldige mich für meine ungestüme Begleiterin. Sie führt eine Art Punky-Brewster-de-luxe-Leben. Sie hatte das Gefühl, daß Sie uns angestarrt und ausgelacht haben. Trifft das zu?«
»Nö, Alter. Wir haben über was anderes gelacht. Mach dir deswegen keine Gedanken.«
»Aber ich mache mir deswegen Gedanken. Sie lügen mich an. Ich bin besorgt, daß Sie so leichthin Lügen erzählen können. Außerdem macht mir Sorgen, daß Sie mich für so dumm halten. Würden Sie mir, um meines Seelenfriedens willen, bitte sagen, warum Sie mich so belügen?«
»Tja … Weil ich es kann, Bruder.« Meine Jungs lachen. Ich bin der King.
{25}»Ist meine Essensgesellschaft so grotesk, daß Sie sich um unsere Gefühle keinen Deut scheren? Wollen Sie mir das damit sagen?«
»Tja, weiß auch nicht, Mann. Hey, verarsch keinen Verarscher.« Das ist mein Motto. Das hab ich in Jahrbüchern immer neben meinen Namen und meine Trikotnummer geschrieben. »Hey – ich spendier dir einen Drink. Vergeben und vergessen, okay?«
Ich versuche, bei diesem Typ ruhig zu bleiben, was ihn aber anscheinend nur noch wütender macht. Er setzt sich neben mich.
»Setz dich doch, mach ruhig?« sage ich.
»Und nun erzählen Sie mir genau, warum Sie uns anstarren und über uns lachen«, sagt er. »Fassen Sie es in Worte.«
»Reg dich ab, Alter«, sagt Jeremy. »Wir wollten doch nicht …«
»Halt dich da raus, Hilfiger. Ich rede mit dem Mann, der vergeben und vergessen will.«
Das bin dann wohl ich. Ich will keinen Streß, sonst müßte ich handgreiflich werden.
»Alter …«
»Glauben Sie, mit der Anrede ›Alter‹ würden Sie Ihre Worte abmildern? Soll ich mich etwa darauf verlassen, daß Sie es ernst meinen, nur weil Sie sich die Zeit nehmen, mich ›Alter‹ zu nennen?«
»Ey, Mann …«
»Geschenkt. Ich erwarte mittlerweile, daß die Leute über unser kunterbuntes Grüppchen lachen. Das setze ich voraus, o du allmächtiger Großkotz. Doch ich würde gern von dir erfahren, warum genau ihr lacht. Kannst du deine {26}Überlegungen in Worte fassen, oder sind sie so hohl, wie ich glaube? Verbirgt sich hinter dem Glitzern deiner Augen ein wenig Hirn? Kann diese Zunge im Duell brillieren? Kannst du einen Mann erleuchten, der nicht nur alles gesehen, sondern sogar alles auf Karteikarten schriftlich festgehalten hat?«
Was soll der Scheiß? Ich hab ja nichts gegen Anderssein und so, aber dieser Typ ist schon ’ne Nummer für sich. Bei dem krieg ich noch die Krise. Der muß sich erst mal beruhigen und sich anhören, wer ich bin.
»Hey, Mann, nimm’s nicht persönlich«, sage ich.
»Nimm’s nicht persönlich? Nimm’s nicht persönlich? Was kommt wohl als nächstes? Nicht böse gemeint? So was kann passieren?«
»Da fällt mir nichts zu ein.«
»Es ist also nichts Persönliches? Du suchst dir demnach irgendwelche x-beliebigen Leute aus und verdirbst ihnen den Abend?«
»Nä, Scheiße, aber wie du selbst gesagt hast, ihr wollt doch, daß Leute über euch lachen. Einfach wenn man euch so zusammen sieht. Das …«
Ehe ich meinen Satz beenden kann, kramt er hinten in seiner Unterhose herum. Dann zieht er ein paar Karteikarten heraus und wirft eine auf den Tisch. Auf ihr steht: MACHT KEINEN SINN.
»Genau. Du hast meine Gedanken gelesen.«
»Man muß kein Hellseher sein, um vorauszusehen, was ein Humanoider als nächstes sagen wird.«
»Ach. Jetzt bin ich also ein Humanoider?«
»Ja. Genau das bist du, ein Humanoider. Du bist {27}irgendein hübsches Gesicht in der häßlichen Menge. Du bist der Polizist im Porzellanladen. Du bist komplett durchprogrammiert. Du bist ein offenes Buch, das man in einem Rutsch durchlesen kann.«
»Du kannst mich mal«, sage ich im selben Moment, als er noch eine Karte auf den Tisch wirft. Darauf steht: DU KANNST MICH MAL.
»Ich wußte, daß du das sagen würdest. Du bist ein stereotyper Mensch. Auf deiner Stereoanlage läuft typische Musik.«
»Na schön. Dann verrat mir doch, was ich höre, Klugscheißer.«
Er mustert mich von oben bis unten, ehe er antwortet.
»Du hörst Eminem.«
»Klar. Na und? Jeder hört Eminem.«
»Ich nicht und meine Begleiter auch nicht. Aber damit bin ich noch nicht fertig. Ich kann dir hier auf der Stelle eine Kurzfassung deiner Lebensgeschichte vortragen.«
In so einer Situation war ich noch nie. Das ist echt krank. Mir fällt nichts ein außer zuzuhören.
Luster
Du wurdest als Unfall in eine Mittelschichtfamilie hineingeboren, die sich für eine Oberschichtfamilie hielt. Du hast ein geordnetes Leben geführt, bis sich deine Scheißeltern scheiden ließen. Davor hieß es Radfahren, Baseball, Schwimmen und Nintendo. Doch nach der Scheidung sind deine Nike Airs auf Abwege geraten. Zuerst hast du dich für die {28}