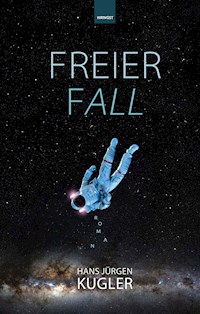
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hirnkost
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Während ein Astronaut als einziger Überlebender allein durch die Unendlichkeit des Weltalls treibt, kämpft sich eine einsame Ameise ohne den Rückhalt ihres Stammes durchs Leben, und ein zurückgezogen lebender Mann reflektiert seine lebenslange Suche nach etwas, das ihm immer wieder aus den Fingern gleitet. Ein nachdenklich stimmender Roman über das Leben, über Liebe, Einsamkeit, Hoffnung und über das unvermeidliche Ende, das uns alle trifft. Wasser hätte er gerne wieder gesehen. Klares, fließendes Wasser, glitzernd in der Sonne. Wasser, das Sternhaufen von sich wirft, verwehend im freien Fall. Das aufspringt wie geworfene Kiesel und sprühende Funken in den Morgen schleudert; Wasser – feucht, kühl, funkelnd. Und vor allem: irdisch. Er sehnte sich nach den in der Tiefe verborgenen Quellen, die unsichtbar den Planeten speisten, Pflanzen sprießen ließen und samtdunkle Moospolster nässten, die Fröschen eine Heimstatt gaben und Vögeln und Insekten … und darüber einen strahlend blauen Himmel, weit und kühl, wie aus hauchzartem, beleuchtetem Glas geschliffen. "Ein Sturz in die Unendlichkeit, eine Reise von der Geburt bis zum Ende und eine tiefgründige Exkursion durch den inneren Kosmos." (René Moreau, EXODUS-Magazin)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FREIERFALL
Während ein Astronaut einsam und allein durch die Unendlichkeit des Weltalls treibt, kämpft eine einsame Ameise ohne den Rückhalt ihres Stammes durchs Leben, und ein zurückgezogen lebender Mann reflektiert seine lebenslange Suche nach etwas, das ihm immer wieder aus den Fingern gleitet.
Ein nachdenklicher Roman über das Leben, über Liebe, Einsamkeit, Hoffnung und über das unvermeidliche Ende, das uns alle trifft.
Hans Jürgen Kugler, geboren 1957. Studium der Philosophie und Germanistik in Freiburg. Autor und Journalist. 2001: SF-Roman Godcula oder die Harmonie der Insekten. 2005: Komödie Aus dem Staub, verschiedene Inszenierungen, Mahnke-Theaterverlag. 2010: Komödie Ganz wie daheim, Reinehr-Verlag. 2015: Von Aftersteg bis Zipfeldobel – Kuriose Ortsnamen in Südbaden, Silberburg-Verlag. 2016: Alles klar, Herr Kommissar? (mit Ute Wehrle), Silberburg. 2021: SF-Roman Von Zeit zu Zeit, Verlag p.machinery. Wiederholt ausgezeichnet beim Wissenschaftler-und-Journalisten-Wettbewerb »Hauptsache Biologie«. Veröffentlichungen in EXODUS-Magazin, PHANTASTISCHE MINIATUREN und in verschiedenen Anthologien. 2020/2021: Gemeinsam mit René Moreau Herausgeber der SF-Anthologien Der Grüne Planet, Pandemie und Macht & Wort (ausgezeichnet mit dem Kurd Laßwitz Preis 2022).
Originalausgabe
© Hans Jürgen Kugler
Copyright der Originalausgabe
© 2022, Hirnkost KG, Lahnstraße 25, 12055 Berlin
http://www.hirnkost.de/
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage Juni 2022
Vertrieb für den Buchhandel:
Runge Verlagsauslieferung; [email protected]
Privatkunden und Mailorder:
https://shop.hirnkost.de/
Cover- und Innenillustration: Mario Franke
Cover- und Innengestaltung: benSwerk
Lektorat: Melanie Wylutzki
Druck: Druck und Werte, Leipzig
ISBN:
PRINT: 978-3-949452-46-8
PDF: 978-3-949452-48-2
EPUB: 978-3-949452-47-5
Hirnkost versteht sich als engagierter Verlag für engagierte Literatur.
Dieses Buch gibt es auch als E-Book – bei allen Anbietern und für alle Formate.
Unsere Bücher kann man auch abonnieren:https://shop.hirnkost.de
INHALT
PHASE I BIS PHASE VI
DAVOR
PHASE I – BEGINNEN
PHASE II – WACHSEN
PHASE III – SICHTEN
PHASE IV – BEGREIFEN
PHASE V – GESTALTEN
PHASE VI – ERINNERN
PHASE IBISPHASE VI
DAVOR
Davor war Nichts
und
aus Nichts kommt nichts
kommt Nichts
kommt nichts
– bis zum Ende
Endlich –
nach unendlich vielen Unendlichkeiten
da Alles noch Nichts war
bleibt nichts
wie es ist
Nichts
hält es nicht aus
nichts zu sein – und wird
– ein Sehnen –
ein Sehnen nach Sein …
… der Rest ist Geschichte.
PHASE I –BEGINNEN
Das All –
endlose Abwesenheit
von allem
Tiefes Dunkel
Nirgendwo
– Licht
nadelstichfein, ungreifbar fern,
kaum wahrnehmbares Aufglimmen
in infiniter Finsternis
Schwereloses Schweben im Dunkel. Keine Nacht, kein Tag, noch nicht einmal Zeit. Kein Außen, kein Innen … wo? Hier, jetzt, und – warm? Nicht warm. Auch nicht kalt: temperatura – ausgeglichen. Warmkalt. Oder auch: lau. Außen wie innen. Geborgen. Lichtlos, schwerelos, fühllos. Ein Organ unter Organen. Ganz im Verborgenen. Wunderbares Reich der Finsternis, wo kein Auge nötig ist, noch Atem oder Mund. Und vielleicht: Ewigkeit. Zumindest Ewigkeit im Augenblick, erfülltes, wunschloses Augenblicksglück. Ja, Glück, Zufriedenheit – dieser beseligende Zustand, nach dem es sich das künftige Leben hindurch immer sehnen wird, ein durchdringendes Glück fern aller Betäubung und Träumerei, der wünschbare Zielpunkt aller menschlichen Existenz. Dieses bewusstlose Dasein, umströmt von lebendigen, warm schmeichelnden Quellen, gesättigt, eingenistet in zartes, empfangsbereites Gewebe – Schlaffötus.
Wenn es seiner bewusst wäre, wüsste es, dass es nicht allein ist. Denn da nimmt noch dieses Gebilde Platz (Plazenta nennt man es auch, wird es später einmal erfahren), das gemeinsam mit ihm in dieser organischen Höhle existiert, es nährt und seinen Stoffwechsel reguliert, gewissermaßen die materielle Repräsentation all seiner Bedürfnisse. Die konkrete Manifestation dessen, was es braucht; was es nur ahnen, vielleicht auch riechen und schmecken kann, das es aber niemals sehen, nie begreifen – wovon es niemals etwas wissen wird.
Aber das Fehlen dieses Organs, seines organischen Schattens: Das wird es fühlen – seine Abwesenheit – immer. Die entsetzliche Leere, die sein Fehlen hinterlassen hat, wird sich ihm als eine unerfüllbare Sehnsucht eingeschrieben haben, wird es beharrlich daran erinnern, dass sein Leben niemals vollständig sein wird, nie, zu keinem Zeitpunkt, noch nicht einmal und zuletzt in seinem Tod.
Vielleicht spürt es ja außerhalb seiner Grenzen doch die Anwesenheit dieses Anderen, diese verborgene organische Masse, lebendig wie es selbst, unsichtbar keimend, ein ursprünglicher Schatten wie ein protoplasmatisches Echo seiner selbst. Ein Wesen – An-Wesen – Anwesenheit.
Noch aber kennt es weder Drinnen noch Draußen, nicht Ich, nicht Nicht-Ich, kein Anderes, sondern nur Welt, Wärme, Wasser – ein Wesen: sich selbst. Einheit, abgeschlossen und zirkulär, ruhend und in sich geschlossen – Organismus. Anwesend und vollkommen in seiner Unvollkommenheit. Und: Es wird, und es will kommen – Willkommen!
»Nichts grausamer als eine Geburt!«
– seine erste Lektion.
Aber dabei bleibt es nicht, denn sonst blieben wir alle, woher wir kamen – und damit zurück. Einmal in die Welt getreten, gibt es nur einen Weg: Hinaus! Die Richtung schon festgelegt. Der Weg alles Lebendigen führt von innen nach außen, eine Expansion aus einem Punkt heraus in das Unendliche. Dasein vor der Geburt spielt sich verborgen geborgen in der leiblichen Höhle unserer Mutter ab, einer warmen, elastischen Innenwelt, umhüllt von Dunkel, Schlaf und Stille. Ein Zustand vollkommenen Glücks, in dem jedes Bedürfnis, kaum dass es entstanden ist, auch schon gestillt wird. Homöostase des Begehrens.
Paradiese sind stets nur Übergangsstation, Transit auf dem Weg in die Welt. Denn die Zeit kommt, unausweichlich, die unseren Auswurf in die Außenwelt mit unwiderstehlichem Druck einläuten wird. Wenn sich unsere warme, sanft schattige Höhle in einen engen, atemraubenden Kanal, in eine dunkle, einengende Röhre verwandelt, die drückt und zwängt und uns unwiderstehlich nach außen drängt. Schon sickert Licht wie ein helles Gift in die immer beklemmendere Höhlenwelt, scharfe, hallige Laute dringen von außen in die sonst nur von Herzschlag und pulsierendem Blut klingende Brutkammer. Keiner wird gefragt, ob er geboren werden will, aber zur Welt kommt schließlich jeder, tot oder lebendig …
Angekommen – AngenommenAnGefangen
Tief im All, verloren im Nichts – Licht!
Etwas. Und etwas, das Licht reflektiert.
So weit im Dunkel, so hell im Dunkel.
In der Finsternis glommen schwach ein paar Kontrollleuchten; tiefrote Glut unter der Asche eines erloschenen Feuers. In regelmäßigen Abständen konnte man ein tieffrequentes Brummen vernehmen, wenn man ganz genau hinhörte. Ansonsten aber herrschte absolute Stille. Stille und Dunkelheit, ein traumloser Schlaf …
Der allerdings von einer ganzen Phalanx hoch empfindlicher Sensoren permanent überwacht wurde. Vierfach gesicherte Systeme registrierten jeden einzelnen Herzschlag, zählten jedes einzelne Blutkörperchen, das durch seine Adern floss, zeichneten jeden noch so geringfügigen synaptischen Impuls auf, werteten Atemvolumen und Zusammensetzung der Abluft aus, maßen den elektrischen Widerstand der Haut … Theoretisch hätte nichts schiefgehen können. Außer der Theorie.
In den Kammern zwei bis acht flackerten die Kontrollleuchten kurz auf. Sofort jagte ein stiller Alarm durch das Schiff. Notsysteme wurden hochgefahren, innerhalb weniger Nanosekunden pumpten die Kompressoren frischen Sauerstoff in zusammengesackte Lungen, kreislaufstabilisierende Medikamente wurden injiziert. Alle Systeme meldeten, dass die sofortige Reanimation als letzte Option unabdingbar geworden war. SIE zögerte noch.
Draußen! Die kahlen Wände, das grelle Licht, schockgefrorenes Sonnenfeuer, eine vereiste, erstarrte Explosion, kalt, tödlich, abweisend. Der weite, leere Raum, jedes Geräusch unerträglicher Lärm … Die Kälte! Diese eisige, bittere Kälte, die von überallher ins Fleisch schneidet! Er fühlte sich ausgestoßen, seinem innersten Leib entbunden – ein scharfer, schneller Schmerz unterhalb des Bauches. Blut. Viel Blut.
Da war er nun. War es das? Diese Frage stellte er sich naturgemäß nicht, er konnte sie gar nicht stellen. Dennoch stellt sich diese Frage – denn jeder wird von ihr gestellt.
Lichtpunkt. Silbern schimmernd – nein:
Gleißend!
Gefrorenes Licht.
Jäh blitzende Helligkeit, die das Auge blendet.
LICHT!
Er war angekommen in dieser Welt! Obwohl er sich dessen noch keineswegs bewusst war, schrie er instinktiv erst einmal aus Leibeskräften.
Ausgestoßen
Abgetrennt, abgeschnitten
Amputiert wie ein krankes Glied
Und damit sollte er auch recht behalten. Denn es war wirklich zum Schreien und Davonlaufen. Aber genau dies konnte er nicht, der Gang in das Leben ist letztlich eine Einbahnstraße. Also schreien! Er bewies in kürzester Zeit ein meisterhaftes Talent in dieser Disziplin. Er schrie, wann immer er einen Grund dafür fand. Er schrie auch, wenn er eigentlich keinen Grund dazu hatte. Das war noch schöner. Er mochte seine Stimme. Er mochte den tief in ihm anschwellenden Ton, die Geburt eines Schreies heraus aus seinem Körper. Die Welt existierte, um von ihm angeschrien zu werden. »Aaahh!« Und: »Aahhh!« Und nochmals.
Mit seinem Gebrüll war er in der Lage, die Welt zu verändern. Auf sein Zeichen hin gab sie ihm zu trinken, ernährte ihn. Gab ihm Wärme und Zufriedenheit. Dieses satte Gefühl, wenn sich sein Mund um dieses warme, weiche Fleisch legte! Er würde seine Lippen um diesen zarten, knusprigen Zipfel stülpen … und dann dieser warme, lebendige Strom, der in seinem Innern anschwoll! Trinken! Trinken!
Er schrie.
Trinken! TRINKEN!
Nichts. Seine Stimme verhallte in unaussprechbarer Leere. Er schrie und schrie.
Nichts.
Als ob die Welt weggebrochen wäre. Er schrie und schrie.
Unerhört.
Schreien ist lautes Ausatmen, Schreien bedeutet Leben. Am Anfang ist der Schrei, am Ende das Verstummen.
Dies schien er früh schon kapiert zu haben, ein instinktives, intuitives Wissen vom Lauf der Welt, das ihm mit seiner Geburt an die Hand gegeben wurde. Zu schreien schien ihm die einzig angemessene Art zu sein, sich der Welt gegenüber zu äußern: laut, durchdringend, vernehmbar. Sein Schreien war Schmerz und Triumph zugleich. »Wie du mir, so ich dir!«, tat er der Welt mit seinem Gebrüll kund, und: »Wir sind uns innige Feinde, wir werden eine Weile miteinander auskommen müssen.«
Noch schlief er. Bewusstloses Dahindämmern in todesähnlicher Starre. SIE wachte über ihn, hielt alle Ressourcen im Gleichgewicht, hielt ihn am Leben. Vorläufig. Wog anhand der verfügbaren Daten die anwendbaren Optionen ab, ordnete valide Wahrscheinlichkeiten zu. Optimierte die erzielten Ergebnisse zu einem harmonischen Schwingungsmuster homöostatischen Gleichmuts. Absolut rational. Oder vollkommen gleichgültig.
PHASE II –WACHSEN
Einer fragt sich:
»Wie weise ich den Menschen den Weg zu mir?«
Ein anderer:
»Wie finde ich den Weg zum Menschen?«
Beide sind auf dem Holzweg.
Die absolute Stille.
Der leere Raum.
Stiller Raum. Stilleerraum.
Man hatte ihn nicht gestillt. Das erfuhr er irgendwann später einmal, so ganz nebenbei, und das auch nur, weil er nie danach gefragt hatte. Ungestillt bis an den heutigen Tag blieb auch seine Sehnsucht danach, und er würde es bis in seine entfernteste Zukunft hin sein, wie er nur zu deutlich wusste.
Wenn es das nur wäre! Ein wenig verweigerte Milch ganz zu Anfang seines jungen Lebens. Nur ein wenig nicht verabreichte Lebenskraft.
Er konnte seiner Mutter keinen Vorwurf daraus machen, sie hatte es nicht in böswilliger Absicht getan. Mehr so aus Versehen. Weil es so Mode war. Weil es hygienischer war, wie es damals hieß. Und auf Hygiene hatte man in diesen Tagen sehr viel Wert gelegt. Ein Überbleibsel aus dem gerade überstandenen Krieg, in welchem es von Hygienikern nur so wimmelte. Rassenhygiene. Denn man hatte in dieser finsteren Zeit panische Angst und noch viel mehr rasende Wut auf alles mögliche »Ungeziefer«, wie sie es nannten: Juden, Zigeuner, Russen, Kommunisten; im Grunde auf die ganze übrige Welt. Die sie damals auch fast ganz zugrunde gerichtet hatten. Auch deshalb gab es für ihn keine Milch. Aus hygienischen Gründen. Schließlich sollte da ein rundum gesundes Kind heranwachsen in einer rundum runderneuerten Welt.
»Wirtschaftswachstum« hieß das Zauberwort damals. Und das nahm sein Vater sehr persönlich und sehr wortwörtlich. Denn auch er hatte Durst. Großen Durst. Unstillbaren, großen Durst. Und unstillbaren, großen Hass. Seltsamerweise auf ihn. Wohl weil er Fleisch von seinem Fleisch war; und dieser Tatsache wollte er sich einfach nicht beugen. So einen großen Durst hatte er.
Eine kalte Stille,
nackter Raum.
Seine Eltern hatten sich nicht geliebt. Lieber bauten sie ein Haus. Ein Hasshaus. Darin führten sie ihren Krieg. Und er bekam die Kollateralschäden ab. Und war noch stolz darauf, wuchs er doch an seinen Wunden.
Es wäre leichter zu ertragen gewesen, wenn er einen Grund für die unablässigen Attacken hätte erkennen können. Ständig machte er sich Vorwürfe. Eine innere Stimme, die unablässig gehässig auf ihn einhämmerte: Du bist selber und überhaupt an allem schuld. Diesen inneren Krieg konnte er nicht gewinnen, war er doch sein eigener Feind. Eben: selber schuld.
Der Angst entwächst alles Leben
Ihr Atem durchzittert die Welt
Ihr Grund ist das Nichts
Eingekauert in seinem innersten Schlupfwinkel saß die Angst. Ein furchtbares, gefräßiges Ungeheuer, das ihn auf Schritt und Tritt schon begleitete, solange er nur denken konnte. Er vermied es, an sie denken zu müssen, aber er konnte es nicht verhindern, dass er ihre drohende Allgegenwart bei allem, was er tat und dachte, zu spüren bekam. Diese Angst war ebenso ein Teil seines Lebens, ja, seiner selbst, wie es seine Augen, seine Ohren, seine Hände und Füße waren. Er konnte sich ein Leben ohne diese Angst gar nicht vorstellen, wie denn auch? Nicht einmal in seinen Träumen. Ganz im Gegenteil, denn in seinen Träumen war ihm diese Angst gegenwärtiger denn je. In seinen Träumen bekam seine Angst manchmal sogar ein Gesicht, eine Art von zähnefletschender, geifertriefender, starren Maske, aus deren drohendem dunklen Inneren unaufhörlich ein furchtbarer Schrei zu ihm drang, ein grelles, tiefes Grollen, schrill, bedrohlich zischend und machtvoll, überaus machtvoll. Er musste dabei stets an einen Vulkanausbruch denken.
Am Ende der Welt: Er war so voller ängstlichem Hass, dass er die Welt am liebsten am Ende gesehen hätte – eine leere, endlose Wüste, ohne Häuser, ohne Städte, ohne Menschen.
Menschen-los.
Allein mit der Welt
Weltallein
Absoluter Nullpunkt.
Kälter geht es nicht.
Kälter als der Tod.
Er fror. Seine Zähne führten ein Eigenleben. Klapperten eifrig drauflos in kältestarrendem Rhythmus, waren nicht zu bändigen, allenfalls um den Preis des eigenen Lebens.
Es war kalt. Eiseskalt und noch viel kälter; eigentlich schon jenseits des Ertragbaren. Aber was wusste er schon davon, was er ertragen konnte. Was er würde ertragen können, was er noch würde ertragen müssen.
Gierige Kälte. Die Kälte der Gier, dieses alles verschlingende nächtliche Dunkel. Nachts. Nichts.
Sein Körper verkroch sich in sich selbst. Seltsam verkrümmt wie ein Embryo. Eine nachgeburtliche Kältestarre.
Um ihn herum aber gab es keinen Schnee und auch kein Eis. Er lag auf einer frühlingsduftenden blühenden Wiese, und es war beinah sommerlich warm. Aber ihm war so kalt, als ob er nackt und verloren in einen Eissturm geraten wäre. Die Rezeptoren seiner Haut schienen die Wärme nicht an sein Gehirn weiterleiten zu wollen, die von den ihn umflutenden Sonnenstrahlen herrührten. Nichts konnte ihn wärmen, am allerwenigsten diese Sonne. Ihre Strahlen gerieten ihm zu kalten, glitzernden Speeren aus Eis, die ihn durchbohrten.
Das eisige Licht dieses Nachmittags, dachte er. Eislicht, hart, spröde und tödlich. Er verkroch sich in der Kälte; die Kälte verkroch sich in ihm.
Keine Wärme. Kein Licht. Keine Luft. Nichts.
Keine Luft! Nichts fürchtete er mehr, als aus irgendeinem Grund keine Luft mehr zu bekommen.
Ich werde niemals tauchen können, dachte er belustigt. Schon allein die Vorstellung, sich mit einem stählernen Sarg voll flüssiger Luft auf dem Rücken in die Tiefe zu stürzen und womöglich nie wieder aufsteigen zu können, nahm ihm den Atem.
Atemlos lauschte er seinen Gedanken. Atemlos losatmen. Aufatmen … Nichts als Luft. Nichts? Nichts.
Weil er nicht mitspielen wollte, wurde ihm mitgespielt. Und zwar übel. So lange, bis er nicht mehr mitspielen durfte, selbst wenn er noch gewollt hätte. Jeder kleine Schulhoftyrann suchte sich ihn zum Opfer, die kleinen Barbaren peinigten ihn, wo sie nur konnten. Er war unfähig, sich zu wehren. Zuerst wollte er nicht, dann konnte er nicht mehr, die Meute war schon längst über ihm. Seine Angst wuchs ins Unermessliche. Etwas starb damals in ihm, willenlos und resigniert suchte er sein Heil in der Flucht.
Verstoßen! Weil er gegen ihre Regeln verstoßen hatte.
Als ihn der erste Schlag traf, war er zu Tode erschrocken. Er krümmte sich. Er bekam den zweiten Schlag. Er zerbrach nicht. Dann kam der dritte Schlag, er versuchte auszuweichen. Der vierte Hieb traf ihn umso härter. Der fünfte, der sechste brachten schon nichts Neues mehr. Dann kam der siebente Schlag, der hatte ihn fast zu Boden gerissen. Der achte Schlag ging daneben. Tatsächlich. Jeder machte mal Fehler. Der neunte Hieb riss ihm die erste Wunde, Blut floss. Danach kam der harte zehnte Schlag. Der elfte, der noch härter ausfiel. So ging es bis zum fünfzehnten. Danach kam eine Pause, nicht lange. Sein Peiniger war wohl erschöpft. Umso härter fielen dann die nächsten Schläge aus. Der neunzehnte riss ihn endgültig zu Boden, sodass der zwanzigste bis dreißigste auf seinen gekrümmten Leib einprasselten wie das Hämmern einer Maschine. Der einunddreißigste Schlag ging wieder daneben, sein Peiniger taumelte. Im Versuch, das Gleichgewicht wiederzufinden, versetzte er ihm den zweiunddreißigsten Hieb. Der dreiunddreißigste traf schon gezielter. Für die Schläge vierunddreißig bis sechsunddreißig nahm er noch einmal all seine Kräfte zusammen, jeder Aufprall geriet etwas fester. Doch der siebenunddreißigste und der achtunddreißigste Hieb verdienten ihren Namen nicht mehr, sie hätten unter anderen Umständen fast schon als ein kameradschaftliches Knuffen gelten können. Der neununddreißigste Schlag endlich war nur noch zärtliche Berührung. Er erwartete den vierzigsten. Er kam nicht. So hatte er zählen gelernt.
Der Instinktsicherheit, mit der sie in ihm immer wieder nur das Opfer erkannten, war er hilflos ausgeliefert, egal, was er tat oder unterließ. Er bekam stets die Prügel ab, die gerade er nicht verdient hatte. Eines Tages beschloss er, niemals wieder ein Opfer für irgendjemanden sein zu wollen – und wurde folgerichtig ein Opfer seiner selbst. Er zog sich von allen zurück, ließ sich auf niemanden mehr ein, wurde ein rechter Einsiedler. Er verkroch sich in Selbstmitleid, wurde zu der Wunde, die ihm geschlagen. Man hätte mit seinem Beispiel locker eine neue Religion begründen können.
Um nicht länger Sklave zu sein, machte er sich zum Narren. So wurde er zum Sklaven eines Narren.
Daran wuchs er, dass ihn alle Welt kleinhalten wollte.





























