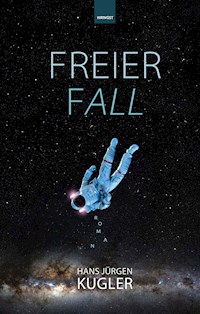3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Die Vergangenheit ist vergangen, aber nicht vergessen. Wie ein Blitz fuhr mir ein Gedanke in den Kopf, brannte sich unauslöschlich in mein Hirn: Es ist völlig bedeutungslos, was geschehen ist und ganz egal, was noch passieren wird – das Einzige, was zählt, ist – hier, jetzt und für alle Zeit." Was zunächst wie ein surrealer Albtraum erschien, erweist sich für Daniel Damberg bei einer Reise an den Bodensee als verstörende Realität: Die Zeit hat sich extrem verlangsamt. Auf einem Kurzurlaub bei Überlingen strandet er mit seiner Freundin Iris in einem Zeitverzögerungsfeld, das die beiden wie eine Brandungswelle verschlingt. Die verstörenden Erfahrungen stellen Daniel und Iris in einen einzigartigen Überlebenskampf – wie macht man zeitverlangsamtes Wasser wieder flüssig, wie steinharte Lebensmittel genießbar? Wie kommuniziert man mit der Außenwelt? Zugleich hängt über dem in der Zeit gestrandeten Paar ein in die Zeitanomalie geratenes Flugzeug fest. Das Unglück scheint nicht aufzuhalten zu sein. Werden die beiden die Katastrophe überleben und je wieder in ihre eigene Normalzeit zurückfinden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Hans Jürgen Kugler
Von Zeit zu Zeit
AndroSF 115
Hans Jürgen Kugler
VON ZEIT ZU ZEIT
AndroSF 115
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: Juni 2021
p.machinery Michael Haitel
Titelbild: Uli Bendick
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
für den Science Fiction Club Deutschland e. V., www.sfcd.eu
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 244 7
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 853 1
1 – Albtraum
Der Wahnsinn begann am Morgen des 6. Juli 2022. Ich wachte früh auf, weil ich jämmerlich fror. In meiner Bude war es eiskalt, und das mitten im Sommer. Ich versuchte die Bettdecke enger um mich zu ziehen, aber das erwies sich als unmöglich. Schlaftrunken schüttelte ich den Kopf. Meine kuschelige Bettdecke lag vollkommen starr und unbeweglich auf mir. Nur eine dünne Schicht, die unmittelbar mit meinem Körper Kontakt hatte, schmiegte sich noch ein wenig an meine Haut. Der Rest war steif wie ein Pappkarton. Und wie mir der Rücken wehtat! Auch die Matratze schien über Nacht hart wie Stein geworden zu sein.
Leicht benommen machte ich Anstalten aufzustehen. Ich wollte die Decke zur Seite werfen und erlebte gleich die nächste Überraschung: Das dämliche Ding bewegte sich keinen Millimeter und klemmte mich regelrecht unter sich ein. Ich atmete tief durch, um meine aufkommende Panik unter Kontrolle zu bekommen. Ein Albtraum?
Ich versuchte es erneut, und diesmal gelang es mir, das störrische Ding Zentimeter um Zentimeter hochzustemmen, bis ich einen schmalen Spalt zwischen mir und der Decke geschaffen hatte, aus dem ich mich herauszwängen konnte. Ich landete hart auf dem Boden und atmete erleichtert aus. Mein Atem schien auf der Stelle schockgefroren zu sein und schwebte wie eine Wolke bewegungslos vor mir. Ich blickte auf mein unheimliches Nachtlager zurück, über dem die Decke schwebte wie an Bindfäden aufgehängt. Jetzt war ich endgültig wach – und zugleich sicher, dass das nur ein Traum sein konnte.
Ich kämpfte mich auf die Beine und ging vor Verwirrung und Kälte schlotternd ins Bad. Der Wasserhahn am Waschbecken klemmte. Mit viel Kraft und Ausdauer bekam ich ihn schließlich auf, hatte aber noch lange kein Wasser. Eingefroren?
Verwirrt blickte ich zum Fenster. Draußen schien hell und klar die Sommersonne, hier drinnen jedoch war es geradezu frostig. Allmählich bekam ich es mit der Angst zu tun.
Ich wollte den Wasserhahn gerade wieder zudrehen, da sah ich im Licht der Morgensonne am unteren Ende des Hahnes etwas hervorglitzern. Neugierig beugte ich mich hinab und konnte beobachten, wie ganz allmählich ein Tropfen aus der Öffnung hervorquoll. Er wurde größer, löste sich vom Hahn und … schwebte in aller Seelenruhe majestätisch in der Luft, bevor er langsam nach unten sank.
Beim nächsten Tropfen das gleiche Spiel. Fast unmerklich bildete sich ein dünner Strahl, der zu einer kräftigen Säule aus Wasser wurde, die in der Luft zu stehen schien und gemächlich dem Waschbecken entgegenwuchs. Dieses Schauspiel wurde von einem grummelnden Geräusch begleitet. Die Vibrationen des tieffrequenten Bebens, das direkt aus der Erde zu kommen schien, konnte ich deutlich in der Bauchdecke spüren. Ich zwickte mich noch einmal kräftig in den Oberarm – kein Zweifel, ich konnte neuerdings in Zeitlupe gucken …
Vorsichtig berührte ich mit den Fingerspitzen dieses »stehende Gewässer«. Seine Konsistenz erinnerte mich an Kunststoff. Ich drehte den Wasserhahn wieder zu und wartete gespannt, was nun passieren würde. Nichts. Eine gefühlte Ewigkeit lang. Dann zeigte sich ein feiner Spalt zwischen Hahn und Wasser. Ganz langsam wurde er größer, und die Wassersäule begann, in sich zusammenzusacken. Es schien ewig zu dauern, bis sich das verbliebene Wasser zu größeren Tropfenansammlungen teilte, die einige Zeit noch in der Luft standen, ehe sie allmählich nach unten schwebten. Endlich auf dem Porzellan des Waschbeckens angekommen, zerplatzten sie zeitlupenartig in sternfunkelnde, kronenartige Ringe, die kleine glitzernde Perlen auf ihren Spitzen trugen und wie fremdartige Pflanzen aus dem Waschbecken emporwuchsen, bis sie in sich zusammensackten und wie überdimensionale Amöben langsam Richtung Abfluss krochen.
Wahnsinn! Ich war von dem ungewöhnlichen Schauspiel so gebannt, dass ich fast die arktische Kälte vergessen hätte. Was auch immer hier drin los war, vielleicht war die Welt draußen ja noch normal? Oder wenigstens wärmer? Immerhin schien die Sonne, also nichts wie raus.
An der Tür die nächste Überraschung: egal, wie kräftig ich daran zerrte – nichts. Als ob sie sich über Nacht in eine tonnenschwere Tresortür verwandelt hätte. Verzweifelt rannte ich zur Balkontür. Zum Glück war Hochsommer und da hatte ich sie gewohnheitsmäßig offen stehen lassen. Ich schwang mich über die Brüstung und landete unsanft auf der Kiesfläche im Garten.
Hier draußen wurde es schlagartig wärmer. Die Sonne strahlte, wie es sich für einen ordentlichen Sommertag gehörte, hell und heiß auf mein Gesicht. Die kalte Luft schien also lediglich auf die Innenräume beschränkt zu sein. Heilfroh, der arktischen Kälte meiner Wohnung entkommen zu sein, sah ich mich um.
Die Landschaft war in einen satten rotgoldenen Ton getaucht. Ich blickte auf die Straße. Alles war ruhig. Die Szenerie, die sich mir bot, hatte was von einem Standbild. Auf dem gegenüberliegenden Gehweg standen ein paar Leute wie Schaufensterpuppen herum, die auf ewig mitten in der Bewegung erstarrt zu sein schienen. Ein Pärchen ging, oder vielmehr stand, Hand in Hand auf dem Bürgersteig. Der Mann hatte seinen linken Fuß etwas in die Luft gestreckt, wie um einen Schritt nach vorn zu tun. Sie blickten einander an. Die Frau hielt ihren Mund leicht geöffnet, weil sie wohl gerade etwas sagen wollte. Ein tiefer, gedehnter Brummton war zu hören, der aus ihrem Mund zu kommen schien.
Ein eiskalter Schauer kroch mir langsam das Rückgrat hoch. Von nacktem Grauen erfüllt sah ich mich Hilfe suchend um. Mitten auf der Straße stand ein blauer Toyota. Ich wunderte mich, warum dieser Idiot hier mitten auf der Fahrbahn parkte, da bemerkte ich, dass sich dieses Auto doch bewegte. Nur ganz wenig, aber dennoch deutlich zu erkennen. Es fuhr buchstäblich im Schneckentempo.
Dieser Anblick nahm mich so gefangen, dass ich mir um ein Haar eine Fliege ins Auge gerammt hätte, die direkt vor meiner Nase in aller Seelenruhe stoisch ihre Bahn zog. Und zwar ebenfalls im Zeitlupentempo, ich konnte deutlich das langsame Auf und Ab der gläsernen Flügel erkennen. Schnell trat ich einen Schritt zurück und der Brummer schwebte wie an einer unsichtbaren Schnur gezogen gemächlich an mir vorüber.
Allmählich dämmerte es mir: Ich hatte in meinem Leben genügend Science-Fiction-Romane gelesen, um zu wissen, was los war: gar kein Zweifel – Zeitdehnung! Die Welt um mich herum hatte sich aus irgendeinem Grund verlangsamt. Oder ich mich in ihr beschleunigt. Was auf dasselbe hinauslief.
Davon zu lesen war eine Sache, es am eigenen Leib zu erfahren eine ganz andere. Heiße Panik stieg in mir auf und mit einem Mal fühlte ich mich verdammt einsam. Was, wenn dieser Zustand anhielt – bis in alle Ewigkeit gar? Die in diesem Fall ziemlich lang werden könnte.
Ich betrachtete noch einmal die Fliege. In den letzten zwei, drei Sekunden war sie vielleicht gerade mal ein paar Fingerbreit vorangekommen. Wie schnell flog so eine Stubenfliege für gewöhnlich? Und wie hoch lag eigentlich die Schlagfrequenz ihrer Flügel?
Ich hatte keine Ahnung. Hoch vermutlich. Hätte ich im Biologieunterricht bloß besser aufgepasst, dann hätte ich daran abschätzen können, in welchem Maß sich die Welt um mich verlangsamt hatte.
Ich überquerte die Straße, um mir das in ewiger Innigkeit verbundene Pärchen genauer anzusehen. Der linke Fuß des Mannes hatte mittlerweile Bodenkontakt, während der rechte nur noch mit der Zehenspitze den Boden berührte. Die Frau hatte den Mund wieder geschlossen, der tiefe Brummton aus ihrer Kehle war zu einem hauchenden Laut verebbt.
Kein Zweifel, das waren keine Schaufensterpuppen. Beide zeigten eindeutig Leben, wenn auch um ein Vielfaches verlangsamt. Solange ich einigermaßen in Bewegung blieb, musste ich für die beiden ja unsichtbar sein. Vielleicht spürten sie kurz einen Windhauch, wenn ich um sie herumhuschte. Vielleicht auch nicht. Würde ich lange genug auf einer Stelle stehen bleiben, könnten sie eventuell schattenhaft meine Kontur erahnen. Wie ein Gespenst, das schneller wieder aus dem Gesichtsfeld verschwindet, als es aufgetaucht war.
Ich entschloss mich zu einem kleinen Spaziergang in den nahe gelegenen Park. Auf dem Weg dorthin musste ich hin und wieder einigen Insekten ausweichen, die wie festgeleimt mitten in der Luft schwebten. Hauptsächlich Fliegen und kleinere Mücken. Einmal konnte ich von allen Seiten sehr schön eine Wespe begutachten, die eine fette grüne Raupe mit ihren Beinen gekrallt hatte und wohl auf dem Weg zu ihrem Stock war.
Diese extrem verlangsamte Welt hatte ihre eigenen, nicht ganz ungefährlichen Tücken. Ich war mit der Hand nur ganz kurz an ein Grasbüschel gekommen, schon hatte ich mir an den rasiermesserscharfen Halmen einen tiefen Schnitt geholt, aus dem das Blut hervorquoll. Weit kamen die paar Tropfen indes nicht; kaum dass sie die Haut meines Körpers verlassen hatten, schwebten sie als rote Kügelchen regungslos in der Luft. Also Vorsicht!
Das Gras, auf dem ich stand, war hart und starr wie Kristall. Aber ganz egal, wie fest ich auch darauf herumtrampelte, es brach nicht, kein Hälmchen splitterte. Erst wenn ich einige Zeit auf einer Stelle stehen blieb, konnte ich spüren, vielmehr erahnen, wie sich die Grashalme allmählich dem Gewicht beugten. Zum Glück war die Wiese erst frisch gemäht worden.
Gegenüber entdeckte ich einen jungen Mann mit seinem Hund, beide wie ein Standbild in die Landschaft hineingemeißelt. Der Mann hielt den rechten Arm in gestreckter Haltung, den Oberkörper nach vorne gebeugt. Ein paar Meter vor ihm hing ein kleiner Ast in der Luft, den er gerade geworfen hatte. Sein Hund, eine gewöhnliche Promenadenmischung, war eben vom Boden abgesprungen und schwebte nun wie gebannt in der Luft, das Maul aufgerissen, um das Stöckchen zu packen.
Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kam ich auf die Idee, das Stöckchen zu nehmen und es dem Hund genau in dem Moment auf den Kopf fallen zu lassen, wenn er danach schnappen wollte. Ich nahm den kleinen Ast … aber der blieb wie festgemauert in der Luft hängen und war einfach nicht von der Stelle zu bewegen. Ich zog mit aller Kraft an diesem lächerlichen kleinen Ast, aber das verdammte Ding rührte sich keinen Millimeter. Erstaunlich! Das Ästchen verhielt nicht nur einfach stur in der Luft, sondern beschrieb in aller Ruhe seine einmal eingenommene Parabelbahn. Ich konnte beobachten, wie sich der Kopf des Hundes langsam seinem Stöckchen näherte, bis er es schließlich zu fassen bekam.
Offensichtlich beharrten die Dinge störrisch auf ihrer eigenen Zeit. Die Dinge verschwinden ja nicht einfach aus der Welt, bloß weil ein unglaublich in der Zeit beschleunigtes unsichtbares Wesen wie ein Verrückter daran zerrt. Tatsächlich müsste ich meine Energie, mit der ich das Stöckchen ein Stückchen zur Seite schieben wollte, erst allmählich seinem eigenen Zeitablauf anpassen, bis der gewollte Effekt hätte eintreten können. Und das konnte dauern – wie lange, wusste ich nicht. Ebenso wenig, wie viel Energie ich aufbringen müsste, um unter diesen Umständen auch nur ein Staubkorn entgegen seiner Eigenzeit zu bewegen.
Ich nahm jetzt besser den Gehweg. Solange man sich nicht bewegte, schien eigentlich alles ganz wie gewohnt zu sein. Die Luft war warm und absolut windstill. Ein ganz normaler Sommertag, könnte man denken. Bis auf die seltsamen Geräusche. Ein bedrohliches Dröhnen hing in der Luft, das an die tiefsten Pedaltöne einer Orgel erinnerte. Ganz in der Nähe hörte ich einen eigentümlich knarzenden Laut, als wenn ein Brett aus einem Holzboden gestemmt würde. Der Laut kam offensichtlich von dem Rotkehlchen auf dem Zweig vor mir. Das Vögelchen saß bewegungslos mit aufgesperrtem Schnabel und geplustertem Gefieder auf seinem Ast, als ob es ein Exponat im Naturkundemuseum wäre. Kein Zweifel, dieses tiefe Knarzen, das es von sich gab, musste die um ein Vielfaches verlangsamte Version seines zirpenden Balzrufes sein. Vorsichtig, um nicht an ein unerwartet im Weg schwebendes Objekt zu stoßen, drehte ich mich um und ließ meinen Blick erneut über diese eigenartige, erstarrte Welt schweifen.
Wie aus dem Nichts packte mich nackte Angst. So faszinierend das alles auch sein mochte, so verstörend war es auch. Ich wollte nur noch weg und rannte einfach drauflos. Allzu weit kam ich nicht. Schon nach wenigen Hundert Metern musste ich anhalten und nach Luft schnappen. Diese dicke, zeitverlangsamte Luft eignete sich wohl nicht zum hektischen Einatmen. Allmählich beruhigte ich mich. Meine kopflose Flucht hatte mich mitten in den Park geführt.
Der See darin lag still und klar direkt vor mir und glänzte in der Sonne. Die gekräuselte Oberfläche war ein sicheres Zeichen dafür, dass sehr wohl eine Brise wehen musste, wovon wegen der Zeitverlangsamung natürlich nichts zu merken war. Zögerlich trat ich vor und berührte mit der Schuhspitze vorsichtig die Wasseroberfläche. Dann setzte ich den ganzen Fuß auf. Wie ich es mir gedacht habe – das Wasser hatte gar keine Zeit, unter mir nachzugeben. Ich stand sicher und fest auf dem glitzernden Untergrund. Großartig!
Auch wenn mir nicht so ganz wohl bei der Sache war, machte ich einen weiteren Schritt vorwärts. Ohne das Wellenmuster auf dem See hätte man denken können, auf einer Eisfläche spazieren zu gehen. Nach einer Weile ging ich in die Knie und befühlte vorsichtig eine der Wellen.
Dabei fielen mir zuerst die enormen Temperaturunterschiede auf. Die sonnendurchflutete obere Wölbung fühlte sich warm an, ganz im Gegensatz zu den verschatteten Bereichen in den Wellentälern, die so eisig waren, dass ich mir fast daran die Finger verbrannt hätte.
Ich richtete mich wieder auf und spazierte mit großen Schritten weiter. In der Mitte des Sees blieb ich stehen, stemmte die Hände in die Hüften und blickte mich um. Ich fühlte mich großartig. Mir wurde klar, dass ich in meinem beschleunigten Zustand anstellen konnte, was ich nur wollte, die Menschen würden noch nicht einmal bemerken, dass ich da wäre. Losgelöst von den Fängen der Zeit wäre alles möglich. Die ganze Welt lag mir zu Füßen!
Doch da war noch diese Sache mit der Eigenträgheit der Dinge. Ich wollte mich gerade in Richtung Ufer aufmachen, aber ich konnte meinen Fuß nicht mehr bewegen. Ich steckte fest! Ich zog und zerrte an meinem Fuß – zwecklos.
Festgefroren in der Zeit. Ich hatte zu lange auf derselben Stelle verharrt und nicht gemerkt, wie ich Millimeter für Millimeter allmählich in die Wasseroberfläche eingesunken bin. Alles eine Frage der Zeit. Ich wollte allerdings nicht herausfinden, wie lange es wohl dauern würde, bis mich der See vollständig verschlungen hatte. Und das genüsslich in Zeitlupe.
Jetzt ganz ruhig! Noch war ich nicht tiefer als vielleicht ein, zwei Millimeter eingesunken. Was allerdings tief genug war, um mich ein für alle Mal hier mitten auf dem See festzuhalten. Erneut zerrte ich mit aller Kraft an meinem Bein, aber keine Chance. Mit Gewalt war da nichts zu machen. Es gab nur eine Lösung: Ich musste versuchen, meine Schuhe auszuziehen und schauen, dass ich von hier wegkam. Und zwar schnell.
Ich vollführte also eine formvollendete Rumpfbeuge und machte mich an meinen Schnürsenkeln zu schaffen. In der Hektik verhedderte ich mich noch und zog den Knoten fester. Ich atmete einmal tief durch und zwang mich zur Ruhe. Endlich hatte ich es geschafft. Ich schlüpfte aus meinen Turnschuhen und machte mich im wahrsten Sinn des Wortes auf die Socken, und zwar so schnell wie möglich zurück ans Ufer.
Dabei achtete ich sorgsam auf jeden meiner Schritte. Der schmale Sandstreifen am Uferrand bedeutete keine Gefahr, ich hütete mich aber davor, einem der kristallharten Grasbüschel zu nahe zu kommen. Nach ein paar Metern drehte ich mich noch einmal um und schaute nach meinen Schuhen. Für einen Außenstehenden musste es ein seltsamer Anblick sein, wenn sich plötzlich ein Paar alte Nikes wie aus dem Nichts auf dem See materialisieren und gemächlich vor sich hin dümpelten.
Allmählich verspürte ich ein zunehmend trockenes Gefühl im Mund. Kein Wunder, ich war nun schon einige Zeit in der brennenden Sonne unterwegs – wie lange eigentlich? Bestimmt schon ein paar Stunden, zumindest gefühlt. Aber in »Wirklichkeit« – also in der anderen, der Weltzeit? Vielleicht nur ein paar Sekunden. Zu dumm, dass ich zu Hause nicht auf die Uhr geschaut hatte.
Die Sonne brannte unbarmherzig. Mir wurde schlagartig klar, dass ich sehr bald ein ernsthaftes Problem haben würde, wenn dieser Zustand noch lange anhielte. Durst! Und nirgends flüssiges Wasser. Ach du Scheiße. Ich musste schleunigst von hier weg und eine Gegend finden, die noch nicht von dieser seltsamen Zeitverzerrung heimgesucht worden war.
Aber zuerst einmal brauchte ich neue Schuhe. Ich beschleunigte meine Schritte, wobei ich tunlichst darauf achtete, auf dem Asphalt zu bleiben. Das Auto, das ich heute Morgen vor der Haustür gesehen hatte, war mittlerweile schon um die Ecke gebogen und einige Meter weitergekommen. Das junge Paar, das Händchen haltend den Gehweg entlangspazierte, war auch schon ein gutes Stück weiter. Diesmal hielt die Frau den Mund geschlossen, während der Mann offensichtlich etwas zu dem Gespräch beitrug. Das schloss ich jedenfalls aus dem fast schon unhörbar tiefen Grollen, das aus dessen Mund zu kommen schien.
Zu Hause angekommen ging ich nach hinten in den Garten und setzte mit einigen großen Storchenschritten vorsichtig über den Rasen. Dann die große Herausforderung – Einstieg über den Balkon. Ich versuchte, mit den Händen ausreichenden Halt an den Brettern der Verkleidung zu finden, um mich daran hochziehen zu können. Mein erster Versuch war ein schmerzhafter Fehlschlag, aber ich hatte ja genug Zeit zum Üben. Und etwaige unliebsame Zuschauer meiner Bemühungen brauchte ich auch nicht zu fürchten. Nach ein paar Versuchen hatte ich den Bogen raus und den Ellenbogen auf die Balkonbrüstung legen können, sodass ich den Oberkörper daran hochstemmen und mich endlich auf den Balkon ziehen konnte.
Drinnen war es immer noch bitterkalt wie in einem Kühlhaus. Aber ich hatte auch nicht vor, mich lange zu Hause aufzuhalten. Ich holte mir ein zweites, bequemes Paar Turnschuhe und schlüpfte hinein. Die widerspenstigen Schuhbändel konnte ich später noch festzurren. Dann ging ich ins Bad. Wie ich schon befürchtet hatte, brauchte ich all meine Kraft, um den störrischen Wasserhahn überhaupt zu bewegen.
Dann die altbekannte Nummer: Es dauerte wieder einige Minuten, bis sich überhaupt der erste Effekt meiner Bemühungen einstellte und ein erster Tropfen unten am Hahn erschien. Also kein Wasser, zumindest kein flüssiges. Mit der Cola im Kühlschrank das Gleiche: ein kompakter schwarzer Block, der zu nichts zu gebrauchen war.
Ich hatte gar keine Wahl, ich musste raus aus dieser Eisbude. Irgendwo musste es doch Wasser geben, ganz einfach nur fließendes, flüssiges Wasser, das man trinken konnte. Ich suchte ein paar leere Plastikflaschen zusammen. Die Kälte erinnerte mich daran, für alle Fälle noch einen Pullover einzupacken. Einen Regenschirm konnte ich mir sicherlich sparen. Dafür steckte ich noch mein Taschenfernglas und eine Taschenlampe ein. Ich warf noch einen Blick auf die Küchenuhr: 8:23. Ich versuchte, mir die Zahl zu merken.
Nachdem ich alles in einem kleinen Wanderrucksack verstaut hatte, kletterte ich über den Balkon nach draußen, wobei ich darauf achtete, einen respektvollen Abstand zum Oleander zu wahren. Ich war froh, wieder in der Sonne zu sein.
Hinter dem Haus hatte ich meinen Wagen geparkt. Den Versuch zumindest war es wert. Aber sinnlos. Ich war noch nicht einmal in der Lage, nur die Tür zu öffnen. Das Ding beharrte stur auf seiner Eigenzeit und blieb bockig in seiner Parkbucht hocken. Das Gleiche galt für das Fahrrad – egal, wie lange und wie heftig ich daran zerrte, es blieb wie einzementiert in seiner Ecke stehen. Also blieb mir nur noch die Möglichkeit, zu Fuß zu gehen.
Ich konnte nur hoffen, dass diese Zeitblase räumlich begrenzt war und irgendwo dahinter wieder normale Verhältnisse herrschten. Wenn nicht, hatte ich ohnehin keine Chance mehr und wäre spätestens nach einer Woche jämmerlich verdurstet.
Da ich die Gegend in Richtung des Sees schon erkundet hatte und weit und breit keine Anzeichen für eine normal beschleunigte Welt entdecken konnte, ging ich diesmal nach Süden, der Stadt zu. Dort würde ich es am ehesten merken, wenn, wann und wo sich die Welt wieder normalisieren sollte. Möglicherweise war diese seltsame Zeitblase ja nicht vollkommen homogen. Vielleicht gab es Lücken darin, Zonen, in denen die normale Zeit galt. Ich würde es nie erfahren, wenn ich nicht danach suchte.
Auf der Hauptstraße erwartete mich der nun schon gewohnte Anblick: Autos, die mitten auf der Straße zu stehen schienen, ein paar Fußgänger auf dem Gehweg, die wie lebensechte Schaufensterpuppen mitten in der Bewegung festgefroren waren. Ein Radfahrer, der jeden Moment umzukippen drohte. Und über dieser unwirklichen Szenerie hing ein bedrohliches Brausen und Grollen, die gewohnte Geräuschkulisse einer Stadt, auf ein Vielfaches nach unten gestimmt. Das erinnerte mich daran, dass ich keine Zeit zu verlieren hatte. Paradoxerweise, wie ich angesichts der erstarrten Welt um mich herum feststellte. Aber mein Körper bestand ebenso hartnäckig auf seiner eigenen Zeit und brauchte dringend Wasser.
Ich nahm den Weg über die Brücke entlang des Flusses. Ich hoffte, von einem erhöhten Standpunkt aus eher eine Zone ausmachen zu können, auf der noch Normalbedingungen herrschen mochten. Von der Brücke aus hatte ich einen weiten Blick über die halbe Stadt. Nur der Schwarzwald im Osten begrenzte mein Sichtfeld. Weit und breit keine Bewegung, die Welt lag still und starr vor mir wie in Glas gegossen. In Richtung Flugplatz hing eine Cessna im Landeanflug erstarrt in der Luft. Keine allzu guten Aussichten!
Ich folgte dem stadteinwärts führenden Radweg. Das Ufergebüsch war gespickt mit funkelnden Insekten, denen ich ständig ausweichen musste. Direkt vor mir hing eine blaue Prachtlibelle. Der schimmernde Leib glänzte wie Stahl und man konnte genau das komplizierte Muster verfolgen, mit dem sie ihre Flügel geschäftig auf und ab schlagen ließ. Für entomologische Studien hatte ich jedoch keine Zeit, ich musste zusehen, dass ich Land gewann und irgendwo Wasser fand.
An manchen Stellen war der Radweg so dicht an den Fluss herangebaut, dass er nach starken Regenfällen regelmäßig überflutet wurde. Mitten im Fluss stand ein Fischreiher, aufs Äußerste angespannt, starr und bewegungslos wie eine Statue. Selbst unter diesen außergewöhnlichen Umständen eigentlich nichts Besonderes, wenn man es recht bedachte. Ich verharrte kurz, um die schimmernde Oberfläche des Flusses näher in Augenschein zu nehmen. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen und setzte vorsichtig einen Fuß auf die durchsichtige, schimmernde Oberfläche – das Wasser schien auch hier fest und begehbar zu sein. Im Gegensatz zum See konnte man hier deutlich die kraftvollen Vibrationen spüren, mit denen der Fluss vorwärtsdrängte. Ich hatte nicht vor, meine Experimente mit zeitretardiertem Wasser fortzusetzen, und zog meinen Fuß schnell aus der möglichen Gefahrenzone.
Unterwegs musste ich mich durch einen Pulk Radfahrer hindurchschlängeln. Der Mann an der Spitze des Pelotons hatte sich so halsbrecherisch in die Kurve gelegt, dass er jeden Moment umzukippen drohte. Ein anderer nuckelte gerade an seiner Trinkflasche, was mich an meinen quälenden Durst erinnerte. Ich beschleunigte meine Schritte und sah zu, dass ich wieder Schatten fand.
Je näher ich der Stadt kam, desto mehr Bäume säumten den Radweg. Ich musste mich vor ein paar tief hängenden Zweigen in Acht nehmen, deren rasiermesserscharfe Blätter mich ernsthaft hätten verletzen können.
An manchen Stellen hing eine Menge Flugsamen in der Luft, ich hatte Mühe, dem Zeug auszuweichen, denn die Dinger waren von einer zähen, gummiartigen Konsistenz und ließen sich nicht so einfach zur Seite schieben.
Mit der Zeit tauchten zwischen den Bäumen die Umrisse der ersten Gebäude auf. Aber auch hier: alles totenstarr. Plötzlich – für den Bruchteil einer Sekunde schien das Licht etwas von dem intensiv rotgoldenen Schimmer einzubüßen und wirkte irgendwie blasser, kälter. Ich zuckte zusammen. Mir war, als hätte ich gerade außerhalb meines Sichtfeldes eine Bewegung wahrgenommen.
Ich fuhr herum und sah einen ziemlich großen braun gefärbten Schmetterling, der in Augenhöhe unbeweglich in der Luft klebte. Ich hätte schwören können, dass er bis eben noch nicht an dieser Stelle gewesen war. Entweder hatte ich ihn vorhin nicht bemerkt, oder aber …
Neue Hoffnung keimte in mir auf. Ich nahm den Schmetterling genauer unter die Lupe. Ich brauchte eine Weile, um zu erkennen, wie sich die Flügel ganz langsam senkten. Von hektischem Herumflattern keine Spur. Wahrscheinlich doch eine Sinnestäuschung. Vermutlich bildete sich mein Gehirn mangels entsprechender Reize schon Bewegungen ein, wo keine waren. Schließlich war es alles andere als natürlich, in einer Umgebung zu leben, in der die Zeit um ein Vielfaches verlangsamt war.
Subjektive zehn Minuten später hatte ich den Aufgang zum vorderen Stadttor erreicht. Oben bot sich mir das vertraute Bild: eine Straßenbahn, Autos an den Ampeln, Fußgänger und Fahrradfahrer – alles vollkommen bewegungslos. Ich schlängelte mich an den Statuen der Passanten vorbei, um in die Innenstadt zu gelangen. Beim Überqueren der stadteinwärts führenden Ringstraße begutachtete ich interessiert die gewaltige Dieselwolke, die ein altersschwacher osteuropäischer Lkw beim Anfahren gerade ausstieß – ein großes schwarzes Kissen, das geradezu greifbar über dem Auspuff schwebte. Der Verkehr war nicht zum Aushalten: Das tieffrequente Grollen des Motorenlärms war so heftig, dass es mir schon regelrecht Magenkrämpfe bereitete.
Ich suchte mit den Augen die Spitze des Münsterturmes, da ließ mich ein seltsames Flimmern in der Luft erneut zusammenzucken. Wieder hatte ich das Gefühl, für den Bruchteil einer Sekunde eine Bewegung wahrgenommen zu haben. Einem Instinkt folgend beeilte ich mich, von der Kreuzung runterzukommen. Diesmal beschloss ich, auf Nummer sicher zu gehen, und überquerte die nächste Straße an der grünen Ampel.
Ich war gerade noch ein paar Schritte von der gegenüberliegenden Straßenseite entfernt, als das Licht schlagartig eine kalte, blaugraue Tönung annahm, Licht der späten Dämmerung, als ob die Sonne mit einem Schlag verschwunden wäre. Dann ging alles sehr schnell – viel zu schnell.
Das magenkrampfende Brausen des Verkehrs um mich herum schraubte sich in immer höhere Frequenzbereiche hinauf, und in die starren Gestalten auf den Bürgersteigen kehrte plötzlich wieder Leben ein. Die stecken gebliebene Zeit schnellte los wie ein Sprinter nach dem Startschuss.
In Sekundenbruchteilen war das Normalmaß allerdings bei Weitem überschritten, die Ampel sprang auf Rot, und wie eine Herde wildgewordener Büffel jagten die Autos auf mich zu. Motorenlärm, Hupen und quietschende Bremsen jaulten auf. Menschen hasteten in unglaublicher Geschwindigkeit an mir vorbei. Die rasenden Autos nahm ich nur noch als verwischte Schatten wahr, die an mir vorbeihuschten. Ein Autofahrer konnte gerade noch ausweichen. Ich war vor Schreck so gelähmt, dass ich fast die nächste Grünphase verpasst hätte, in der ich mich gerade so auf die andere Straßenseite hechten konnte.
Irgendwie schaffte ich es, mich in den nächsten Hauseingang zu quetschen und den Ansturm der Schatten an mir vorbeiziehen zu lassen. Die Luft war erfüllt von einem schmerzhaft grellen Kreischen und Pfeifen, schlimmer noch als bei einer Kreissäge. Ich presste mir krampfhaft die Hände auf die Ohren.
Dann ebbte der Lärm urplötzlich ab. Das schrille Kreischen fiel auf erträglichere Frequenzen zurück, schnellte dann wieder kurz nach oben, nur um erneut herabzusinken. Die verschwommenen Schatten verdichteten sich kurzzeitig zu verhuschten Gestalten, die hastig vorübereilten, lösten sich dann jedoch in körperlosen Dunst auf.
Es schien, als hätte die Zeit angefangen zu fluktuieren. Langsame und schnelle Perioden wechselten einander in immer kürzeren Intervallen ab. Wie in einem Film ruckelte die Welt mal im Zeitraffer ein Stückchen vor, stoppte dann und wann unvermittelt, bis der Ablauf in einer atemberaubenden Sequenz noch ein ordentliches Stück vorwärts spulte, nur um dann endgültig (?) mit halbwegs normaler Geschwindigkeit weiterzulaufen.
Halbwegs normal? Keine Ahnung. Noch einmal ein rasches Aufblitzen schemenhafter Wesen, dann war es vorbei. Die Passanten gingen wieder in gewohnter Geschwindigkeit ihrer Wege. Das schrille Kreischen während der Fast-Forward-Episoden hatte sich in die gewohnte Geräuschkulisse einer Stadt zurückverwandelt und auch das Licht entsprach endlich wieder ganz dem eines gewöhnlichen sonnigen Sommertages. Es schien ausgestanden zu sein. Hoffentlich.
Ich blieb noch ein paar Minuten in dem Hauseingang stehen und beobachtete das Geschehen um mich herum. Dann trat ich vor und mischte mich unter die Passanten. Ein herrliches Gefühl, einfach unter Menschen zu sein. Wieder ganz normale Dinge zu tun, ohne befürchten zu müssen, sich an jedem stinknormalen Busch am Wegesrand die Extremitäten aufzuschlitzen.
2 – Regeneration
»Verrätst du mir, wo du das Zeug herhast?«, fragte Tobias, nachdem ich ihm meine Geschichte erzählt hatte. Was hätte er auch sonst sagen sollen? Ich hätte ihn vermutlich exakt das Gleiche gefragt, wenn er mir so eine irrsinnige Story aufgetischt hätte.
Inzwischen war es Herbst geworden. Je länger die aufwühlenden Ereignisse zurücklagen, desto unglaubwürdiger erschien es mir jetzt, dass sie überhaupt stattgefunden hatten. Seit diesem verstörenden Erlebnis gab es für mich keinen Morgen mehr, an dem ich nicht befürchtete, in einem Albtraum aufzuwachen. Kein Morgen, an dem ich nicht die Augen aufgeschlagen und als Erstes ängstlich auf den Sekundenzeiger der Uhr geblickt hätte.
Ich weiß bis heute nicht, was sich da an jenem Tag eigentlich abgespielt hatte – falls sich das alles überhaupt wirklich ereignet hatte. Die einzig schlüssige Erklärung wäre, dass ich an diesem Tag einem komplexen Wahn verfallen sein musste, und ich eine Episode multipler Halluzinationen erlebt hatte. Oder einen schlechten Traum. Aber es war kein Traum. Die blasse Narbe an meinem rechten Zeigefinger erinnert mich noch heute an meine Begegnung mit der in der Zeit erstarrten Botanik. Wahnsinnig war ich jedenfalls nicht –, aber das glaubt vermutlich jeder Wahnsinnige von sich.
Ob durchgeknallt oder nicht, das Leben musste irgendwie weitergehen. Und es ging weiter. Es dauerte seine Zeit, aber allmählich verblasste die Erinnerung an die verstörenden Erlebnisse. Die Angst verkroch sich in den Gewohnheiten des Alltags. Jeder Tag, jede Stunde, jede Minute, die in meinem Leben ganz normal verliefen, empfand ich als Segen. Man lebt! Mal mehr, mal weniger, aber es ging doch irgendwie immer weiter.
Die Schlaflosigkeit blieb weiterhin ein Problem für mich; da ich aber allein lebte und als Kleinunternehmer selbstständig arbeitete, konnte ich meinen Alltag entsprechend aufteilen. Die Aufträge, die hereinkamen, arbeitete ich wie sonst auch ab, keine besonderen Herausforderungen.
Hin und wieder übernahm ich auch ein paar Termine für die Zeitung. Einige Lokalredakteure schätzten meine Fachkenntnisse auf dem Gebiet der klassischen Musik. Das Zeilengeld war zwar miserabel, aber ich sah es pragmatisch. Auf diese Weise konnte ich einige Konzerte besuchen, die ich meinem Budget sonst vielleicht nicht zugemutet hätte. Und übermäßigen Sozialkontakt musste ich hier auch nicht befürchten. Ich setzte mich irgendwo an den Rand, von wo ich noch ein paar gute Fotos machen konnte und zottelte nach dem Schlussakkord wieder ab.
Mehr Einkommen erzielte ich mit Korrekturarbeiten. Ich hatte während meines Studiums genügend Erfahrungen sammeln können, arbeitete routiniert und konzentriert, meine Auftraggeber wussten meine Zuverlässigkeit zu schätzen und versorgten mich regelmäßig mit Aufträgen. Davon ließ sich ganz gut leben, und ich konnte meine Zeit selbst einteilen. Manche Romane waren entgegen aller Erwartung wirklich gut geschrieben, sodass ich mich nicht wie so oft gelangweilt durch die Seiten quälen musste. Es gab Schlimmeres, als bei schönem Wetter gemütlich auf dem Balkon zu sitzen, ein Buch zu lesen und dafür auch noch bezahlt zu werden.
Mit der Zeit gewöhnte ich mich auch wieder daran, mein selbst gewähltes Exil zu verlassen, und begann damit, alte Freundschaften neu zu beleben. Eines Abends nach dem dritten Glas Wein rief ich aus einer spontanen Laune heraus meinen Kumpel Tobias an, mit dem ich vor einigen Jahren in einer WG gelebt hatte.
»That’s right, you heard right, the Secret Word for tonight is …«