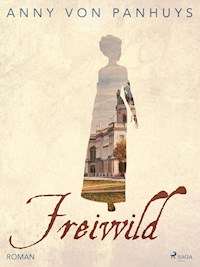
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Inge Leonhard muss nach dem Tod der guten alten Baronin Hardberg, bei der sie als Gesellschafterin und Pflegerin in Stellung gewesen war, das Gut Hardberg verlassen und ängstigt sich vor einer beruflich unsicheren Zukunft. Wie gut, dass Hans von der Linden, der Bruder der neuen Gutsherrin, sie liebt und sie heiraten will. Leider muss die Beziehung vorerst geheim gehalten werden, da die stolze Schwester, Baronin Stefanie Hardberg, die Beziehung auf keinen Fall gutheißen würde. Ein der Geliebten zum Abschied unbedacht gegebener Kuss bringt das Unglück in Gang – der Kuss wurde von der Baronin von fern beobachtet. Sie lässt Inge zu sich kommen und zeigt ihr einen Liebesbrief, den angeblich Hans an eine andere Frau geschrieben hat. Was Inge nicht weiß: Sie geht lediglich einer von der Baronin geschickt eingefädelten Intrige auf den Leim. Zutiefst verletzt verlässt Inge ohne Abschied Gut Hardberg, geht nach Holland und tritt von dort die Reise ins ferne Batavia an, wo sie eine Stelle als Gesellschafterin finden soll. In Ostasien trifft sie die jungen Mädchen Liesel Möller und die verarmte "Bettelkomtesse" Margret Ifflingen, denen das Schicksal ebenfalls übel mitgespielt hat. Denn die jungen hübschen, unverheirateten Mädchen sind Freiwild, auf die skrupellose, entsetzliche Jäger ihre Jagd machen … Aber nicht alle Männer sind skrupellos, und der über Inges plötzliches Verschwinden untröstliche Hans von der Linden hat sich bereits auf die Suche nach der Verschwundenen gemacht … Ein packender, sozial anklagender Roman über die Liebe, den Verlust und die Wechselfälle des Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anny von Panhuys
Freiwild
Roman
Saga
Freiwild
© 1931 Anny von Panhuys
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711570135
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Inge Leonhard sass heute zum letztenmal in den mit Kissen reich gepolsterten Korbsessel ihres hübschen Zimmers von Hardberg.
Sie hatte den rechten Ellbogen aufs Knie gestützt und das Kinn in die hohle Hand gepresst. Die Augen hielt sie geschlossen, während sie sann: Wie sich ihr Leben nun wohl weiter gestalten würde? Die gute alte Baronin Hardberg, bei der sie, seit dem Tod der Eltern, als Gesellschafterin und Pflegerin in Stellung gewesen, war vor Wochenfrist gestorben und kaum ruhten die irdischen Reste der lieben alten Dame in der Familiengruft, da überreichte ihr der Sohn der Verstorbenen ein Vierteljahrsgehalt und bat, in einigen Tagen Hardberg zu verlassen, da man das Zimmer, das sie bisher bewohnt, dringend benötige. Er schenkte ihr als Andenken an die Tote eine kleine abgenützte Silberbrosche, die von der alten Dame fast ständig getragen worden war und an der die Erinnerung an eine rührende Liebesgeschichte hing, die ihr die alte Dame einmal, in besonders weicher Stimmung, erzählt hatte.
Sie hatte sich über die Brosche gefreut, obwohl sie genau wusste, den Erben war jedes andere Stück aus dem Schmuckkasten der Verstorbenen für sie zu wertvoll gewesen. Was wussten Menschen, wie Baron Hardberg — der keine der guten Eigenschaften seiner verstorbenen Mutter besass — und seine Frau, eine geborene Baronesse von der Linden, von Pietät? Sonst hätten sie gerade die bescheidene Brosche über alles ehren müssen.
Doch vielleicht kannten sie die Geschichte der unscheinbaren kleinen Silberbrosche überhaupt nicht. Aber Pietät war dennoch ein Wort, für das weder der Baron, noch seine Frau, auch nur das geringste Verständnis besassen.
Die alte Dame hatte vor ihrem Sterben mehrmals geäussert, sie würde ihre liebe Inge für ihre aufopfernde Pflege nach ihrem Tode mit einer Summe bedenken, die sie vor äusserster Not zu schützen vermöge, und sie hätte bereits mit Sohn und Schwiegertochter darüber gesprochen. Hätte sie lieber nicht mit ihnen darüber gesprochen und statt dessen ihren letzten Willen niedergeschrieben. Denn die beiden hochmütigen Ichmenschen dachten nicht daran, den Wunsch der Toten zu respektieren.
Zum Glück besass sie ausser dem Vierteljahrsgehalt, das man ihr ausgehändigt, noch einige Ersparnisse. Aber wie lange würde das vorhalten, wenn man davon leben musste.
Es sollte jetzt so schwer sein, eine leidlich annehmbare Stellung zu finden. Man hatte ihr das in dem Stellenvermittlungsbureau im benachbarten Eisenach gesagt, wo sie vorgestern gewesen.
Sie hob mit lebhaftem Ruck den feinen Kopf und in ihren grossen blauen Augen war ein wundersames Leuchten.
Was brauchte sie zu grübeln und sich zu grämen? Hans von der Linden, der Bruder der jetzigen Gutsherrin, liebte sie ja.
Er war Inspektor auf Hardberg und hing etwas von Schwager und Schwester ab. Die beiden machten alle möglichen Heiratspläne für ihn, aber er erzählte ihr die Pläne lachend wieder und versicherte ihr immer aufs neue, nie von ihr lassen zu wollen und sie sofort zu heiraten, sobald er eine Inspektorstelle gefunden, wo er genügend verdiene, um ein eigenes Heim zu gründen.
Es war noch sehr früh am Morgen und die wundervolle reine Luft der ersten Tagesstunden floss breitwellig durch das offene Fenster. Inge erhob sich. Es trieb sie ins Freie. Vielleicht kehrte Hans zeitig von seinem Morgenritt über die Felder zurück und sie konnten allein Abschied nehmen und noch ein wenig von der Zukunft reden, ihrer gemeinsamen Zukunft.
Im allgemeinen war ja zwischen ihnen alles besprochen. Vorerst wollte sie sich in Eisenach in der kleinen Pension einmieten, die ihr Hans empfohlen hatte, und dort abwarten, bis sie eine passende Stellung fand. Eines Tages würde sie Hans von der Linden dann aus der Abhängigkeit erlösen.
Inge trug ein einfaches weisses Waschkleid und weisse Leinenschuhe. Ein schwarzes Schleifchen am Halsausschnitt und ein schmales schwarzes Band um den weichen Strohhut, war das äussere Zeichen ihrer Trauer um die gute alte Dame, die gestorben war.
Sie verliess das Herrenhaus durch die Hintertür und gelangte durch den Park ins Freie.
Die Hochsommersonne sandte ihre Goldstrahlen nieder und ihr Leuchten wandelte den Tau in den Blumenkelchen am Wege in blitzende Brillanten.
Inge hatte trotz der Sorge um ihre nächste Zukunft plötzlich ein wundervolles Glücksgefühl im Herzen. Wie herrlich schmückte der Herrgott doch die Welt! Genügte so eine köstliche, reine, sonnengolddurchtränkte Morgenstunde nicht schon, um alle Aengste, wie Spukgestalten in grauem Dämmerlicht geboren, zu vernichten?
Inge schritt langsam einen Wiesenpfad entlang. Ueber den nicht allzu fernen Bergen segelten schneeweisse Wolkenschiffe auf blauem Himmelsmeer, fremden unirdischen Gestaden zu und Lerchenjubel zog in die Weite, stieg auf zum Firmament in hellen Dankesliedern.
Inge wanderte singend dahin.
Wie oft war sie morgens diesen Weg geschritten.
Dort drüben das Tannenwäldchen hatte sie das erstemal in den Armen des Geliebten gesehen, und hinter jenem Kastanienbaum, auf der schmalen, grünen Bank, hatte sie oft gesessen und auf ihn gewartet, wenn er von seinem Morgenritt heimkehrte. Ein Plauderviertelstündchen hatten sie sich dann gegönnt, und Seligkeit im Herzen war sie danach an ihr Tagewerk gegangen.
Sie hielt die Rechte schützend vor die Augen, die Sonne hinderte sie am Weitschauen. Ein glückliches Lächeln legte sich um den frischen Mädchenmund, denn drüben am Wäldchen her sprengte ein Reiter, und ehe Inge auch nur den schnelleren Schlag ihres Herzens zur Ruhe zwingen konnte, war der Reiter ganz nahe gekommen und vom Pferd herabgesprungen, nur ein einfacher Lattenzaun trennte die beiden Liebenden.
„Hans!“ Voll Zärtlichkeit sprach Inge den Namen.
Der schlanke, blonde Mann lachte mit blitzenden Zähnen.
„Mädelchen, hast du keine Ruhe mehr im Hause gehabt? Lieb Mädelchen, heute müssen wir Abschied nehmen.“ Er reichte ihr einen Strauss Feldblumen. „Da, selbstgepflückt!“ Er bog sich über den Zaun, umschlang die zarte Gestalt. „Mädelchen, der Abschied wird mir schwer, aber wir werden uns ja bald wiedersehen, wo wir ungestörter und traulicher plaudern dürfen als hier.“
Das Pferd stand brav und abwartend, steckte seinen Kopf durch die Umzäunung und schnupperte an dem Feldblumenstrauss.
Inge blickte den Mann hingebend an.
„Ich hatte vorhin ganz tolle Zukunftsangst, schilt mich feige, Liebster. Ich glaube ja an dich und freue mich so sehr, so sehr auf den Tag, der uns auf immer vereinigen wird.“
Sie bemerkte den leisen Schatten, der über seine Stirn flog, und ahnte seine Gedanken, die sicher mit seiner hochmütigen Schwester zusammenhingen.
Doch gleich lächelte er wieder.
„Mein Mädelchen, vorläufig wollen wir mal von der allernächsten Zukunft reden. Ich werde dich also in Kürze, sagen wir übermorgen, in der Pension, die ich dir nannte, besuchen und dann wollen wir weiteres besprechen.“
Er drückte ihre Hand wie in einem Schraubstock.
„Meine süsse Inge — tausendmal lieber und schöner bist du, als alle die Weibsbilder mit der grossen Mitgift!“
Inge lächelte traurig.
„Du bekommst eine ganz, ganz arme Frau, Hans, deine Schwester wird sicher sehr böse sein, wenn —“
Er unterbrach sie: „Wenn — wenn—! Lass, mein Lieb, wozu uns die wenigen schönen Minuten mit dergleichen verkümmern.“ Er streichelte ihren zarten Arm, den die kurzen Aermel fast freiliessen. ‚Bald komme ich zu dir nach Eisenach, dann reden wir über alles, alles.“
Er nahm ihre Hand und sich weiter über den Zaun neigend, küsste er heiss und ungestüm den jungen roten Mund.
Sie riss sich erschreckt los.
„Hans,“ wir stehen hier allen Blicken preisgegeben. Wenn das jemand gesehen hätte!“
Er lachte sein sorgloses Lachen, das sie so sehr an ihm liebte und wies nach dem Herrenhause hinüber.
„Dort schläft wohl noch alles in guter Ruh, und bis hierher kann man auch kaum gucken.“
Er setzte die Mütze auf, die er lässig auf die Wiese geworfen und, sich aufs Pferd schwingend, rief er zurück: „Leb wohl, Inge, und auf Wiedersehn! Ich muss noch aufs Vorwerk. Nachher, beim Frühstück, dürfen wir uns ja doch nur offiziell verabschieden! Also, mein Lieb, ich besuche Dich übermorgen.“
Bald waren Reiter und Pferd ihren Blicken entschwunden, und langsam schritt Inge wieder den Weg zurück, den sie gekommen.
Halb wehmütig, halb froh gestimmt durch die Begegnung mit dem Geliebten, betrat sie ihr Zimmer und legte alles zur Abfahrt zurecht. In einer Stunde wurde gefrühstückt, danach würde gleich der Wagen vorfahren, sie nach Eisenach zu bringen. Hoffentlich fand sie von dort aus bald Stellung, bis der Geliebte soweit war, sie zu seiner Frau zu machen. Er liebte sie aufrichtig, alles würde gut werden!
Es klopfte. Ohne ein Herein abzuwarten, trat die Baronin Hardberg ein. Sie trug ein überreich mit düsterem Krepp besetztes Kleid und man hätte ihre schlanke Blondheit wohl schön nennen können, wenn das blasse Gesicht nicht gar so statuenkalt gewesen wäre.
„Fräulein Leonhard, ich möchte noch eine Kleinigkeit mit Ihnen besprechen,“ begann sie halblaut, als fürchte sie Lauscher an der Tür, „möchte Ihnen ganz im Vertrauen etwas sagen — Frau zu Frau — weil — nun, weil Sie mir vielleicht leid tun.“
Inge machte grosse erstaunte Augen. Sie tat dieser marmorkalten Frau leid, deren Herzlosigkeit höchstens von der ihres Mannes noch überboten werden konnte? Das war etwas, was sie nicht begriff.
Die Baronin Stefanie Hardberg nickte ihr zu.
„Sie tun mir wirklich leid, Fräulein Leonhard.“ Sie liess sich auf einen Stuhl nieder. „Ich stand heute zufällig sehr früh auf, weil ich starkes Kopfweh hatte und trat hinaus auf den Balkon. Weil mich nun etwas in der Ferne interessierte, was ich nicht zu deuten wusste, holte ich mir meines Mannes Feldstecher und durch das Glas sah ich —“
Sie brach ab, musterte fast neugierig die dunkelrot erglühende Inge. Fuhr dann fort: „Was ich sah, werden Sie sicher ebenso gut wissen, wie ich, und es erübrigt sich, davon zu sprechen. Wichtiger dünkte es mir, Ihnen mitzuteilen, dass mein Bruder bereits seit einiger Zeit heimlich mit einer jungen Dame unserer nächsten Nachbarschaft verlobt ist, und Sie zu warnen, da Sie nach meiner Ansicht zu schade sind, seine Geliebte —“
„Nicht weiter!“ fiel ihr Inge mit blitzenden Augen ins Wort, „Hans wird mich heiraten und es ist nicht wahr, dass er an die Verlobung mit einer Anderen denkt.“
Stefanie Hardberg lachte kurz auf.
„Sie tun mir wirklich leid, Fräulein Leonhard, und meinem leichtsinnigen Bruder möchte ich Unannehmlichkeiten ersparen, sonst hätte ich mich nicht eingemischt. Ich verstehe, wie schrecklich meine Offenheit auf Sie wirken muss, aber Sie wissen nun wenigstens die Wahrheit und sind gewarnt. Es wäre mir allerdings unangenehm, wenn Sie hier im Hause meinem Bruder eine Szene machen würden —“
Inge warf stolz den Kopf zurück.
„Dergleichen liegt mir nicht, gnädige Frau. Es genügt mir, sofort still beiseite zu treten, wenn mir Hans bestätigt, dass er heimlich verlobt ist oder Sie mir es beweisen.“
„Kennen Sie die Handschrift meines Bruders?“ fragte Stefanie Hardberg sehr schnell.
Inge verneinte.
In den Augen der Baronin leuchtete es auf.
„Schade! — Aber trotzdem macht es wohl nichts. Ich fand nämlich gestern in seinem Papierkorb, den ich immer selbst entleere, eine Karte, die Ihnen als Corpus delicti genügen dürfte.“ Sie erhob sich. „Ich bin in wenigen Minuten damit zurück.“
Sie eilte so schnell sie nur konnte in ihr Wohnzimmer, wo ihr Schreibtisch stand und entnahm demselben ein kleines Briefpaket. Es waren die zusammengebundenen kühlen Liebesbriefe ihres Mannes vor und während der Verlobungszeit. Der Inhalt der ersten Karte, auf rosafarbenes Papier geschrieben, würde ihr jetzt gute Dienste leisten, ein Band für immer zerreissen, das sie nicht wünschte.
Sie hing mit schwärmerischer Liebe an dem Bruder und da Reichtum in ihren Augen, da sie eine arme Baroness gewesen, das höchste Erdenglück bedeutete, wünschte sie eine reiche Heirat für ihn, der ein armer Junker war.
Inge Leonhard war keine Schwägerin nach ihrem Geschmack. Sie zog die Karte aus dem Umschlag, den sie beiseite legte, überzeugte sich, dass der Inhalt so lautete, wie er ihr im Gedächtnis haftete, und freute sich, dass kein Datum vorhanden war. Auch dessen hatte sie sich erinnert.
Sie eilte zurück, fand Inge Leonhard noch genau in derselben Haltung, wie sie von ihr verlassen worden war.
„Hier!“ sie reichte ihr die grossformatige Briefkarte hin und beobachtete das junge Mädchen während des Lesens aufmerksam.
Inge sah eine grosse, steilragende Männerschrift, las mit schmerzhaft pochendem Herzen und schwerem Atem:
Hardberg am Montag.
Mein schönes Lieb!
Nun hast du dich mir versprochen und ich werde in wenigen Tagen zu deiner Mutter kommen, dich von ihr fürs Leben zu erbitten. Wir beide gehören zu einander, davon bin ich seit längerer Zeit überzeugt und ich weiss, unsere Ehe wird glücklich werden im vornehmsten Sinne der Gesellschaft, der wir beide entstammen und angehören. Nimm innigen Dank, weil du mein werden willst und dafür die Versicherung meiner Liebe und unwandelbaren Treue.
Dein Hans.
Wie hätte Inge auch nur im entferntesten auf die Vermutung kommen können, diese rosafarbene Karte wäre von einem anderen Manne als Hans von der Linden geschrieben. Wie hätte sie jetzt daran denken können, dass Baron Hardberg gleichfalls Hans mit Vornamen hiess und die beiden Schwäger sich oft scherzhaft Hans I und Hans II anredeten.
Das alles fiel ihr nicht ein. Sie las nur die Worte, die wie glühende Tropfen auf ihr Herz fielen.
„Sie haben mich überzeugt, Frau Baronin,“ sagte sie mit zuckenden Lippen,“ so weh Sie mir taten durch die Wahrheit, darf ich doch nicht verkennen, Sie leisteten mir wirklich einen Dienst, für den ich Ihnen Dank schulde.“
„Und was werden Sie jetzt anfangen?“ fragte Stefanie Hardberg gespannt und versuchte mitleidig zu blicken.
Inge Leonhard presste die Lippen aufeinander, um den Schmerzenslaut, der sich ihr entringen wollte, zu unterdrücken.
Diese kalte herzlose Frau sollte sie nicht schwach sehen.
Nach einem Weilchen sagte sie: „Was ich tun werde, weiss ich nicht, jedenfalls nichts gegen Herrn Baron von der Linden, seien Sie ganz beruhigt. Doch bitte ich Sie, gnädige Frau, dafür zu sorgen, dass ich Herrn von der Linden nicht mehr sehen brauche. Ich meine, ich möchte weder am Frühstück teilnehmen, noch mich offiziell verabschieden. Ich meine — —“
Stefanie Hardbergs Gesicht verriet nichts von der Genugtuung, die sie über das Gelingen ihrer schnell, fast impulsiv gesponnenen Intrigue empfand. Sie liess Inge nicht aussprechen, sagte fast weich: „Sie armes Mädel, ich kann mit Ihnen fühlen und möchte wiederum meinen Bruder auch nicht gerade verdammen. Er ist arm, ewig möchte er auch nicht von meinem Manne abhängig sein. Aber nichts davon, reden wir von Wichtigerem. Sie wollen nicht mehr mit meinem Bruder zusammentreffen, ich verstehe das, und ich werde Ihnen deshalb sofort das Frühstück aufs Zimmer bringen lassen. Inzwischen soll auch das Auto vorfahren. Bis mein Bruder zurück ist, sind Sie fast in Eisenach.“ Sie reichte ihr die Hand. „Zürnen Sie mir um meiner Offenheit willen nicht, Fräulein Leonhard, doch glauben Sie mir, es ist auf alle Fälle gut so für Sie und meinen Bruder!“
Inge schwieg, Hochmut lag in diesem Augenblick wie eine starre Maske auf dem schönen Frauenantlitz und stiess sie ab.
Die Baronin verliess das Zimmer und ein Mädchen brachte gleich darauf das Frühstück. Inge genoss nur eine Tasse heissen Kaffee, dann zog sie den grauen Staubmantel über das weisse Kleid, setzte den Hut auf und war eben damit fertig geworden, als ein Diener kam, um ihr Gepäck hinunter ins Auto zu tragen.
Mit bitterem Lächeln musste Inge denken, dass sie der Herrin von Hardberg garnicht schnell genug fortkommen konnte.
Trotzdem wollte sie ihr dankbar sein, denn sie dünkte sich zu schade für die zweifelhafte Stellung, die ihr Hans von der Linden in seinem Herzen hatte geben wollen. Mochte er glücklich werden mit der Anderen, der er die Versicherung seiner Liebe und unwandelbaren Treue gab.
Sie sass dann im Auto und fuhr durch den wundervollen Sonnenmorgen wie eine Träumende. In ihrem Kopf war alles verworren. Nur das Eine wusste sie, sie würde die ihr durch Hans von der Linden empfohlene Pension nicht aufsuchen, sondern gleich mit dem nächsten Zuge nach Berlin reisen, wo die Gelegenheit, eine neue Stellung zu finden, doch wohl grösser war als in der Provinz.
Sie kaufte sich am Bahnhof mechanisch ein paar Berliner Zeitungen, sass dann in einem Abteil dritter Klasse und lehnte mit geschlossenen Augen in einer Ecke.
Wer sich mit ihr im Abteil befand, sie hätte es später nicht zu sagen gewusst, sie war verstört und für alle äusseren Eindrücke unempfindlich.
Gegen zwei Uhr landete der Zug in der Halle des Anhalter Bahnhofs, und von einem Gepäckträger geführt, betrat sie ein grosses, nahe dem Bahnhof gelegenes Hotel, fuhr mit dem Fahrstuhl vier Treppen hoch, fand sich dann in einem netten sauberen Zimmer und atmete nach Stunden zum ersten Male etwas auf.
Jetzt durfte sie wenigstens weinen, ungestört ohne Furcht vor neugierigen und fremden Blicken, weinen.
Sie warf sich auf das Bett und drückte das brennende Antlitz in die kühlen Kissen, denen ein herber scharfer Seifenduft anhaftete und liess ihr Leid in Tränen ausströmen, wollte damit die Liebe zu einem Unwürdigen ertränken und vermochte es doch nicht.
Ich verachte dich! zuckte es von ihren Lippen und ihr törichtes Herz bekannte dennoch über Scham und Schmerz hinweg: Ich liebe dich!
Endlich erhob sie sich mit wankenden Knieen und erfrischte ihr Gesicht mit kühlem Wasser, bürstete über ihr kurzes weichwelliges goldbraunes Haar.
Sie verspürte etwas Hunger und ihr fiel ein, sie hatte ja heute, ausser einer Tasse Kaffee, nichts zu sich genommen und jetzt war es bereits vier Uhr. Sie wollte ausgehen, eine Kleinigkeit essen, dann eine Stellenvermittlung aufsuchen und sich zugleich nach einer billigen Pension umsehen.
Da lagen die Berliner Zeitungen, die sie in Eisenach gekauft hatte, auf dem Tisch. Sie schlug den Annoncenteil auf. Sicher waren darin Stellenvermittlungsbüros und Pensionen empfohlen.
Eine ganz grosse Annonce hob sich unter den anderen hervor, unwillkürlich war ihr Auge darauf gefallen.
Da stand in dicken Buchstaben:
Dame, in Holländisch-Indien lebend, geborene Deutsche, sucht zum sofortigen Eintritt eine Gesellschafterin und eine Zofe bei hohem Gehalt. Eintritt sofort. Näheres bei Frau Smits, zur Zeit —
Inge konnte einen Ruf des Staunens nicht unterdrücken. Da war doch wahrhaftig das Hotel angegeben, in dem sie selbst wohnte.
Wenn das kein Wink des Schicksals war!
Denn was gab es für sie jetzt Besseres als ins Ausland zu gehen und je weiter fort von hier, desto besser.
Die Verdienstmöglichkeiten hier in Deutschland waren zur Zeit schlecht, das wusste sie. Viele Menschen wanderten in der schwer und schwerer werdenden Nachkriegszeit aus, und wer im Ausland festen Boden fand, pries sich glücklich.
Bei ihr kam noch hinzu, dass ihr die Heimat verleidet war für lange, lange. Vielleicht für immer.
Sie sah nach, wenn diese Frau Smits zu sprechen war.
Es hiess von zwölf bis vier Uhr.
Es war eben vier und sie konnte es immerhin noch versuchen.
Sie fuhr mit dem Fahrstuhl ins Vestibül hinunter und erkundigte sich nach der Dame.
Ein Boy übernahm es, sie anzumelden. Die Betreffende wohnte im ersten Stock.
Sie durfte eintreten.
Eine schmale Frau mit scharf gebogener Nase und sehr nüchtern blickenden Augen, stand vor ihr, sah sie prüfend an, sagte freundlich: „Sie wollen sich sicher wegen der ausgeschriebenen Stellung vorstellen, mein Fräulein, nicht wahr?“
Inge neigte den Kopf.
„Jawohl, gnädige Frau!“
„Schön — dann nehmen Sie, bitte, Platz.“
Eine knochige Hand, mit mehreren grossen Brillantringen besteckt, wies auf einen Stuhl.
Frau Smits hatte ebenfalls Platz genommen und begann eine Art Verhör nach Inges Vergangenheit. Sie las das Zeugnis der Baronin Hardberg, hörte interessiert zu, als ihr Inge erzählte, sie stünde allein auf der Welt, sei mündig, und könne Stellung annehmen, wohin sie wolle, auch nach Holländisch-Indien.
„Keinen Menschen haben Sie, der nach Ihnen fragt, ist das wirklich wahr?“ fragte die Dame teilnahmsvoll.
Inge nickte und ihr Herz krampfte sich in wildem Weh zusammen, als sie an Hans von der Linden denken musste.
Die Dame strich leicht über Inges Rechte.
„Wenn man so jung ist, wie Sie, pflegt man noch nicht so ganz ohne Menschen zu sein, die etwas Einfluss auf einen haben. Ich bitte Sie, mich nicht für zudringlich zu halten, wenn ich Sie frage: Wollen Sie vielleicht deshalb gern ins Ausland, weil Sie eine unglückliche Liebe hier zurücklassen?“
Die schönen blauen Mädchenaugen füllten sich mit Tränen.
Das war ihre Antwort, die von der Aelteren gut verstanden wurde.
Nach einem Weilchen sagte Frau Smits leise: „Aber wird nicht nach der ersten längeren Eisenbahnfahrt die Reue kommen? Eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen Liebenden ist eigentlich noch kein Grund, so weit fortzugehen, trotzdem ich überzeugt bin, Sie würden sich in der gebotenen Stellung sehr wohl fühlen.“
Inge schüttelte fast trotzig den Kopf.
„Es handelt sich bei mir um keine Meinungsverschiedenheit, der Mann, der mir von Liebe sprach, wird eine Reiche heiraten —“
Sie stockte. Weshalb erzählte sie dieser fremden Frau von ihrem Herzeleid. Ein fremder Mensch konnte dafür kein richtiges Verstehen haben.
Frau Smits zog sacht ihre Hand von der Inges zurück.
„Dann haben Sie recht weit fortzugehen. Draussen wartet sicher irgendwo das Glück auf Sie.“ Ihre Miene verwandelte sich, hatte wieder ein gleichmütiges Aussehen. „Eigentlich habe ich heute kaum noch auf Bewerberinnen für die ausgeschriebene Stellung gewartet. Gestern waren ein paar Dutzend junge Damen hier, drei kamen als Gesellschafterin in die engere Wahl — ich werde allen dreien abschreiben. Sie gefallen mir besser und können wir jetzt den geschäftlichen Teil erledigen. Ich engagiere Sie im Auftrage meiner Schwester, Frau Wouwerman, in Batavia. Sie ist die Witwe eines Kaffeeplantagenbesitzers und Sie werden bei ihr ein Leben in Reichtum und Bequemlichkeit führen. Ihre Passpapiere wollen wir gleich morgen Vormittag besorgen. Ich bitte Sie, mich zu diesem Zweck abzuholen.“
Sie nannte dann die monatliche Entlohnungssumme, die Inge aufhorchen liess.
So gut zahlte das Ausland?
Sie begriff, dass sich so viele um die glänzende Stellung bemüht hatten und dachte, dass sie eigentlich grosses Glück gehabt, diese Stellung sofort zu erhalten.
Sie unterschrieb, was ihr Frau Smits vorlegte und verabschiedete sich dann mit tiefer Verneigung. Diese Frau Smits musste wohl auch sehr reich sein, denn die Ringe und Ohrgehänge, die sie trug, repräsentierten schon allein ein stattliches Vermögen.
In der Nachbarschaft fand Inge ein Restaurant, wo sie eine Kleinigkeit ass und dann suchte sie wieder ihr Hotelzimmer auf und versuchte ein wenig zu lesen.
Aber ihre Gedanken irrten ab. Flogen bald nach Hardberg zurück und dann wieder voraus in die fremde weite Welt, die sie erwartete. Nach Indien, dem Wunderland, dem Garten des Ostens.
Gestern noch, ja noch heute vormittag, hatte sie nicht im entferntesten daran gedacht, Deutschland zu verlassen — nun war schon alles fest abgemacht, irgendwo weit, weit von hier, fuhr sie als Gesellschafterin.
Sie würde eine fremde Sprache lernen müssen, und in dem Lande, jenseits des Meeres zu vergessen suchen, wie jämmerlich sie der Mann betrogen, an den sie mit ganzem Herzen geglaubt hatte.
Tränen überströmten ihre Wangen — mochte er glücklich werden, sehr, sehr glücklich, obwohl er es nicht um sie verdient hatte.
Inge löste die kleine Silberbrosche vom Kleid. Sie wollte das schlichte Andenken an die herzensgute, vornehme alte Baronin Hardberg werthalten. Immer, immer.
Sie dachte daran, was die Verstorbene einmal in einem traulichen Dämmerstündchen davon erzählt hatte.
Sie blickte auf die Brosche nieder.
Zwei silberne Hände fassten einander und hielten gemeinsam eine etwas steife, silberne Rose.
Inge war es, als sähe sie die alte Baronin in dem bequemen Lehnstuhl am Kamin, in dem die Buchenscheite knackten und knisterten, als höre sie ihre weiche, müde Stimme erzählen von der Jugendliebe zu einem armen kleinen Gutsbesitzer, und erzählen von den Eltern, die dieser Liebe mit aller Kraft wehrten und es erreichten, dass der Liebende eines Tages seinen Hof verkaufte und auswanderte.
Wohin?
Die arme alte Dame wusste nichts genaues. Sie hatte dann lange geweint, erzählte sie, und sich der eigenen Schwäche geschämt, die nicht den Mut besessen, sich gegen eine ganze Welt zu dem Geliebten zu bekennen. Und dann hatte sie den Mann geheiratet, den ihr die Eltern bestimmten und war ganz glücklich mit ihm geworden.
Dennoch, ihre reine schöne Jugendliebe hatte sie nie vergessen können, und als liebe Erinnerung daran trug sie fast täglich die kleine Silberbrosche, die er ihr einmal geschenkt und die noch von seiner Mutter stammte.
Inge betrachtete die Rückseite der Brosche, da war etwas ungeschickt ein Herz eingeritzt und die Worte: Für immer!
Die alte Dame hatte wehmütig gelächelt, als sie darauf aufmerksam machte und dazu gesagt: Dies „Für immer!“ sollte einmal ein ständiges Beisammensein bedeuten, nun ward es zum Abschiedswort.
Inge legte die Brosche, die ein wehmütiger kleiner Alltagsroman umspann, sorgfältig zu ihren wenigen anderen Wertsachen und begab sich zu Bett.
Sie sehnte sich nach tiefem, festem Schlaf.
Der heutige Tag bedeutete eine vollständige Wandlung ihres Lebens, und Furcht vor der unbekannten Zukunft beengte ihre Brust.
Wieder kamen ihr die Tränen und sie weinte und weinte um ihr verlorenes Glück, bis sie der Traumgott sanft in seine Arme nahm und sie noch einmal zurückführte nach Hardberg.
Sie sah die schlanke Gestalt Hans von der Lindens über den Lattenzaun der Wiese gelehnt, während sein braunes Pferd an dem Feldblumenstrauss schnupperte, den sie in Händen hielt. Sie fühlte den heissen Kuss des Mannes, seinen heissen, leidenschaftlichen Abschiedskuss und war im Traum noch einmal glücklich, unendlich glücklich.
Liesel Möller wickelte sich vor dem kleinen Stehspiegel, der vor ihr auf dem Küchentisch stand, die langen hellblonden Haarsträhnen von den Lockenwickeln. Ihre Mutter, eine verkümmerte, früh gealterte Frau, stand am Herd und brühte Kaffee auf.
„Ich will nu man jehn un Schrippen holen, Liesecken,“ sagte sie und hastete fort.
Das junge Mädchen am Tisch hatte die bleiche Farbe der Grosstadtmenschen, die wenig Luft und Licht kennen, aber ihr Gesicht war von wundervoll feinem Schnitt und die grossen dunkelbraunen Augen waren ein schroffer und doch prachtvoller Gegensatz zu dem lichten weissblond flimmerndem Haar.
„Liesecken!“ machte das junge Mädchen der Mutter nach. „Ach, ich kann das garnicht mehr hören.“ Sie nickte ihrem Spiegelbild zu. „Bist schön, Liesel Möller und draussen in der Fremde fliegt das Glück. Jeder kann es fangen, der es nur richtig versteht.“
Sie kämmte die aufgerollten Locken aus, die nun das Gesichtchen wie eine Gloriole umgaben. Eine Puderbüchse stand bereit und ein paar Tupfer damit stumpften die Blässe des Näschens und der Wangen noch mehr ab. Der dunkelrote Stift, der danach an die Reihe kam, färbte die Lippen brennender. Weisser noch wirkten dahinter die kleinen gleichmässigen Zähne, die Liesel in dem trüben Spiegelglas bewunderte.
Liesel erhob sich und reckte ihr schmales Figürchen, warf dann ein hübsches dunkelblaues Kleid über, das ihr gut stand, dem aber jedes kundige Auge sofort die Billigkeit ansah.
Sie zupfte daran herum und warf die Lippen auf. „Dummes Gelump!“
Nun, das würde ja bald alles ganz anders werden. Als Zofe der reichen Dame drüben in Indien konnte sie sich anders kleiden. Eigentlich eine Frechheit von ihr, sich als Zofe anzubieten, und sie konnte doch eigentlich nichts weiter, als nähen und bügeln. Als besseres Hausmädchen musste man das ja können. Aber diese Frau Smits, die sie zu ihrer Verwandten nach Batavia mit hinübernahm, hatte ihr gesagt, frisieren brauche sie nicht können, da ihre zukünftige Brotherrin das Haar in einfachen Scheiteln trage.
Liesel Möller vollführte einen Sprung, der jeder Tänzerin Ehre gemacht hätte. Sie war ja so übervoll von Freude, über ihr grosses Glück.
Ach bald war es soweit! Sie sollte hinaus in die weite, weite Welt und bekam für wenig Dienste sehr viel Geld.
Allerlei phantastische Ideen glitten durch ihren Kopf.
Die Mutter kehrte zurück, schob das frische Gebäck auf den Küchentisch, wo es nun friedlich neben Kamm und Bürste lag.
Liesel sah die Mutter verträumt an.
„Du, Mutter, hast du schon mal was von ’nem Maharadscha gehört?“
Die alternde Frau hätte beinahe die Tasse fallen lassen, in die sie eben Kaffee hatte giessen wollen.
„Madratschka — Liesecken, nee, in mein’m janzen Leben hab ick davon noch nischt jehört, un es hört sich ooch mächtich unheimlich an.“
Liesel lachte hell und laut.
„Mutter, du bist auch zu dumm und ungebildet,“ sagte sie mit herzerfrischender Offenheit. „Ein Maharadscha ist ein indischer Fürst und man kennt ihn an dem Seidenschal, den er um seinen Kopf gewickelt hat. Turban nennt man das. Und er hat soviel Geld und Juwelen in seiner Schatzkammer, dass man halb Berlin damit pflastern könnte, und wenn er ein schönes Mädchen sieht, verliebt er sich in sie und macht sie zu seiner Frau.“
„Wat du allens weesst, mein Liesecken,“ murmelte Frau Emma Möller im Tone höchster Anerkennung.
Liesel lachte. „Für die Bildung gibts doch Kinos!“ Sie machte wieder verträumte Augen.
„Mutter, vielleicht sieht mich in Indien auch ein Maharadscha, und macht mich zu seiner Frau.“
Emma Möller schüttelte den Kopf.
„Was du dir allens zusammendenkst! Aber offen gesagt, Kind, ick jloobe, ick könnte mir dadrüber janich freuen. Weil det doch ooch nischt is, die Frau von eenem Indianer zu sind.“
Liesel lachte wieder hell auf.
„Mutter, du verwechselst Indianer mit Inder. Nee — ’n Indianer möchte ich auch nicht. Aber Inder sind schöne Menschen und ihre Hautfarbe nicht viel anders, als wenn sich hier die Herren im Sommer ordentlich von der Sonne verbrennen lassen.“
„So?“ staunte Frau Möller, sagte dann leise: Mächen — Liesecken, willst du et dir nich lieber noch mal ieberlegen mit det Wechjehn? Denk doch, det is so unmenschlich weit, wo de hinwillst, un underwegs kann det Schiff was passieren. Und wie die Madam is, wo du hinkommst, weesst du ooch nich. Du findest hier widder ’ne jute Stellung, un wenn Vater ooch nich ville vadient und mein bissken, wat se heutzutage de Waschfrau’n jeben, nich sehr rechend, is et doch jenuch for uns alle, bis du widder underkriechst. Un denn, Fritze Lehmann, der junge Budiker von der Ecke, meent et ehrlich. Denn wärst de die Frau von ’nem jediejenen Jeschäftsmann.“
Liesel hatte mehrmals versucht, die Mutter zu unterbrechen, doch war es ihr nicht gelungen.
Jetzt aber riss sie rasch das Wort an sich.
„Mutter, du verstehst nicht, warum ich fort möchte, kannst es auch gar nicht verstehen, weil du dir nie Mühe gegeben hast, über die Atmosphäre der Gegend, in der wir wohnen, hinauszudenken. Berlins Norden, äusserster Norden. Ich mache dir und Vater ja keinen Vorwurf. Ihr seid mit eurem Lebenslos zufrieden. Ich aber nicht.“ Sie warf das Köpfchen zurück. „Sieh mich an, Mutter, bin ich nicht hübscher als so und so viele andere Mädchen, und Schönheit ist Macht in der Welt. So habe ich gelesen. Ich will nicht mein ganzes Dasein als Zimmermädchen zubringen, immer wieder grundlos von hässlichen, eifersüchtigen Frauen gekündigt werden. Und ich will nicht die Frau von so einem Budiker werden, nachher hinterm Ladentisch stehen müssen und Saufbrüder bedienen.“ Sie stampfte mit dem Fuss auf. „Nein und tausendmal nein! Ich will Glück haben in der Welt und ich glaube nun mal daran, dass ich es in Indien finde.“
Frau Emma Möller zerdrückte eine Träne. Was sollte sie noch sagen? Sie hatte immer ihrem schönen Kind den Willen getan und ihr Mann auch.
Ausserdem war Liesel seit ein paar Tagen mündig, und liess man sie nicht mit Erlaubnis fort, dann ging sie ohne.
Unbestimmte Furcht umkrallte das Herz der Mutter, aber sie war gleich darauf wieder ruhig. Es würde ihrem Kind schon gut gehen in der Fremde, Lisecken war ja klug und wusste, was sie wollte.
Frau Emma Möller hatte zehn Kinder gehabt, alle waren sie wieder gestorben, das eine jung, das andere älter. Liesel, das Nesthäkchen, war geblieben und war schön wie die Urgrossmutter, die sehr jung starb und beinahe die Frau eines Grafen geworden wäre.
Sie stellte die Tasse auf den Tisch, schob die Zuckerschale dazu, das Milchkännchen daneben.
„Na, wenn du nu mal nich anders willst, denn mach dir man fertich. Um zehne sollte dir ja woll mit die Holländerin treffen.“
„Ja,“ nickte Liesel, „ein paar Minuten nach zehn am Potsdamer Platz, Ecke Königgrätzerstrasse.“
Sie sprachen nichts mehr, waren beide mit ihren Gedanken beschäftigt.
Liesel trank Kaffee, ass dazu und machte sich dann zum Ausgang zurecht, indem sie das kleine Strohhütchen tief über die Frisur zog. Nur ein paar der blonden Locken baumelten seitlich hervor und lagen über der Stirn.
Sie erreichte den Potsdamerplatz im selben Augenblick, als von der anderen Seite Frau Smits, in strenges Schwarz gehüllt, mit einem hübschen jungen Mädchen erschien.
Frau Smits stellte die beiden vor, nannte die Namen: Liesel Möller, Inge Leonhard, und rief dann ein Auto an.
Die Passangelegenheit wickelte sich verhältnismässig einfach ab und konnte bis zum nächsten Tag alles für die Reise Nötige erledigt sein.
Liesel Möller schwatzte lebhaft und sie verstand es dadurch, sogar ein Lächeln auf Inges ernstes Gesicht zu zaubern.
Frau Smits lud die beiden jungen Mädchen zum Essen ein und ging mit ihnen in ein gutes Restaurant, amüsierte sich anscheinend köstlich, als Liesel Möller ihren Zukunftshoffnungen auf den Maharadscha ungeniert Worte verlieh.
Am nächsten Abend verliess Frau Smits mit ihren beiden Begleiterinnen Berlin.
Man fuhr zweiter Klasse.
Inge sass still in eine Ecke gedrückt, sprach nur, wenn sie etwas gefragt wurde, während Lisel Möller ununterbrochen redete.
Es war ausser den Dreien niemand im Abteil, und Inge dachte ergeben, dass der kleine rote Mund doch schliesslich auch wohl einmal müde werden würde. Sie selbst sann nichts anderem nach, als der herben, bösen Enttäuschung, die sie aus seliger Himmelshöhe in den Abgrund bittersten Leides gestürzt.
Dass Hans so falsch war, niemals hätte sie es geglaubt, ohne den Beweis, den ihr seine Schwester gegeben. Diese Schwester, die ihr niemals besonders gewogen gewesen.
Frau Smits liess Liesel Möller pappeln, sie schien Vergnügen an dem Unsinn zu finden, den der junge, lebensdurstige Mund schwatzte. Sie taute dabei selbst etwas auf, warf ab und zu ein Wort ein.
Halb wie im Traum drang manchmal ein Wort der Unterhaltung in Inges Bewusstsein, unterbrach flüchtig ihre traurigen Gedanken.
Frau Smits erzählte der zierlichen blonden Berlinerin, sie sei schon als ganz junges Mädchen nach Holland gekommen, zusammen mit ihrer Schwester, der jetzigen Frau Wouwerman in Batavia. Sie hätten sich beide sehr bald und sehr gut verheiratet, seien beide Witwe, und sie reise jetzt nach Batavia, wo auch sie früher gewohnt, um mehrere Jahre bei der Schwester zu leben, die dann wahrscheinlich mit ihr zurückkehren würde, um längere Zeit bei ihr in Holland zu bleiben.
Liesel Möller fragte: „Woher aus Deutschland stammen Sie, gnädige Frau?“
„Aus einem ganz kleinen Dorf im Riesengebirge!“ kam es so kurz zurück, dass Liesel Möller darüber nichts mehr zu fragen wagte.
Frau Smits schloss die Augen.
„Ich bin sehr müde und wir wollen ein wenig zu schlafen versuchen, denn wir haben eine weite Reise vor uns.“
Liesel Möller verspürte noch gar keine Lust zum Schlafen, aber was blieb ihr weiter übrig, als wenigstens zu schweigen.
Dieses Fräulein Leonhard schien eine Trauerweide zu sein, kaum dass sie manchmal ein bisschen die Lippen verzog bei den amüsantesten Dingen.
Hübsch war sie ja und gelernt hatte sie wahrscheinlich mehr als sie, denn von einer Gesellschafterin verlangt man natürlich gründliche Bildung.
Ob ihr der Abschied von Deutschland schwer fiel, weil sie so eine Leidensmiene aufsteckte?





























