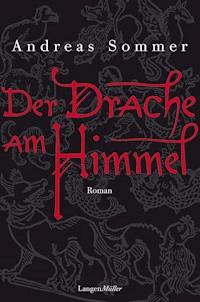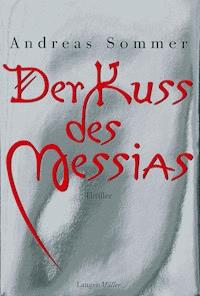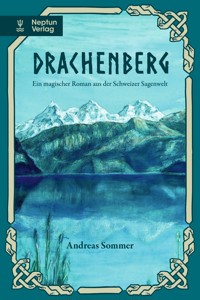14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nathan und Ana sind Fremdlinge von irgendwo. Sie haben einen heiklen Auftrag: die Einheimischen dieser – unserer – Welt zu verstehen. Wie leben und lieben sie? Wonach streben, worum streiten sie? Die beiden nehmen Menschengestalt an, um auf ihrer Mission nicht aufzufallen. Was sie auf ihrer Reise entdecken, befremdet sie. Warum verhungern Kinder auf diesem fruchtbaren Planeten? Warum töten sich Menschen wegen einer unsichtbaren Grenze? Warum prassen die einen, während andere im Elend vegetieren? Schon wollen sie aus Enttäuschung über die Menschheit ihre Expedition abbrechen, als sie auf Menschen stoßen, die auch nicht ganz "von dieser Welt" sind: eine im Verborgenen lebende Sippschaft, unfähig zu hassen oder zu herrschen, denen Besitz und Gier fremd sind. So schöpfen sie neue Hoffnung ... Andreas Sommer betrachtet uns Menschen in seinem neuen Roman mit den Augen von Aliens, die befremdet auf Abgründe und Absurditäten blicken, aber auch die Schönheiten und Chancen unserer Welt erkennen. Eine spannende, humorvolle und zugleich tiefernste Parabel über das Unmenschliche der Menschheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Andreas Sommer
Fremdlinge im Paradies
Gewidmet den sagenhaften Anderen auf Syranam
Distanzierungserklärung: Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
© 2021 Langen Müller Verlag GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Sabine Schröder
Umschlagmotiv: Getty Images
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-7844-8410-5
www.langenmueller.de
Inhalt
Prolog
Glücksbringer
Bettlers Klänge
Berserker und Freund
Das Lächeln der Unversehrten
Die sich selber schmuggeln
Liebe zum Leben
Traumrede vor Isabella
Im Schmelztiegel
Verbannt in die Heimat
Epilog
PROLOG
Am frühen Nachmittag fliegt ein erster Hubschrauber über unser Haus. Kurz nur dürfen wir an Zufall glauben. Dann sind plötzlich böse ratternd zwei über uns. An der Brücke, über die der Weg vom Dorf zu uns führt, parken auf einmal Polizeiwagen. Halb verdeckt durch Bäume und Sträucher stehen sie herum und vermehren sich. Immer, wenn ich hinsehe, sind weitere Fahrzeuge dazugestoßen, darunter auch gepanzerte.
Die wenigen Beamten, die sich aus den Fahrzeugen wagen, stecken in aufgeplusterten Schutzanzügen. Sie tapsen herum wie Außerirdische, die einem Landeplatz zutiefst misstrauen. Bewegen sich, als könne jeder Schritt eine Explosion oder ein Beben auslösen. Sind sie überrascht, uns so schnell gefunden zu haben? Stunden vergehen, und sie haben offensichtlich keine Ahnung, wie sie vorgehen sollen.
»Denn sie wissen nicht, was sie tun«, sagt Louis spöttisch. »Dafür weiß ich, was wir nun tun.«
Sein Vorschlag bringt Ana und mich aus der Fassung. Louis scheint das erwartet zu haben. Er schnürt uns mit weiteren Argumenten ein: »Veras Wagen fällt schon mal aus. Ihn können sie vermutlich orten. Mich nennt man zwar einen Fahrenden, aber ich habe nichts, was fahren könnte. Und jeder dort unten meint euch zu kennen, weil er das Phantombild intus hat.«
Louis’ Vorkehrungen kommen mir unheimlich vor. Wie hat er vorausgesehen, was jetzt abläuft? Ich werde es nie erfahren. Vielleicht habe ich auch seine Intuition unterschätzt. Jedenfalls bin ich sprachlos, als er aus einem Rucksack, den ich noch nie bei ihm gesehen habe, eine täuschend echte Puppe hervorzieht. Sein Plan muss schon festgestanden haben, bevor er zurückgekommen ist.
Während unseres Ringens um die bestmögliche Flucht scheint mir, dass ich endgültig in den Niederungen der hiesigen Gebräuche angekommen bin. So also lebt es sich als Mensch. Verzweiflung muss er aushalten können. Finten und Mut braucht er. Um Rechte und Freiheiten muss er kämpfen. Vermutlich steht dahinter die Einsicht, dass man nur am Leben selbst wachsen kann.
Und so ziehen wir uns alle ins Haus zurück, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Unsere Beobachter sollen sich keinen Reim auf nichts machen können. »Sobald wir loslegen, geht bei denen alles drunter und drüber. Ihr werdet es erleben. Die Umzingelung wird schnell durchlässig.«
Das Tragetuch, aus dem nur ein Köpfchen lugt, macht aus dem Mannsbild Louis einen prächtigen Vater. Aus diesen kräftigen Armen wird keiner ihm das Kind entreißen …
Eine Stunde nach Sonnenuntergang wirft er die Türe auf und schlägt sich sogleich westwärts in die Rebenfelder. Doch den Spähern an den Nachtsichtgeräten entgeht nichts, schon gar nicht ein mächtiger Mann mit Säugling. Binnen Kurzem wird er von Suchscheinwerfern erfasst. Doch Louis lässt sich von diesen Gaffern nicht hetzen. Stattdessen reizt er sie mit gebücktem Schleichen und Hakenschlagen. Er taucht auf und verschwindet, als steuere ihn ein Zufallsgenerator.
An der Brücke unten werden Motoren angeworfen, Wagen in Bewegung gesetzt. Wollen sie dem Flüchtenden folgen, müssen sie sich ins Geflecht holpriger Wege oder gar in die Felder vorwagen. Schon bald stecken einige Fahrzeuge fest und spucken Gestalten aus, die sogleich losrennen. Alles will Richtung Westen. Die Einsatzleitung ist aber doch vorausschauend. Südlich und nördlich der Rebenfelder stoßen Kräfte vor, um den Kindsentführer abzufangen, sobald er die Felder verlassen muss.
»Louis wirkte wie ein Magnet, der über Hunderte von Metern die Häscher magisch anzog«, erinnerte sich Céline, die uns Wochen später Louis Lamberts eigentlich lachhaften Streich schilderte.
Natürlich fassten sie ihn und beschlagnahmten auch die Puppe. Seine närrische Ablenkung ist juristisch die »Vereitelung einer Amtshandlung«. Die Anklage ist bereits erhoben. Doch er hat einen guten, teuren Anwalt, der von gewissen Kreisen im Vatikan bezahlt wird.
Ana und ich haben die Risiken unserer Expedition unterschätzt. Im Rückblick schaudert es mich ob unserer Ahnungslosigkeit – damals, als wir in der Provence ankamen.
Bloß sechzehn Monate ist das her.
Glücksbringer
I
Weiser Rat!
Erde nennen sie unseren Syranam, Sonne ihren ziemlich unbedeutenden Leitstern in jener Galaxie, die bei uns Ofra heißt, bei ihnen aber Milchstraße.
Milch wiederum ist eine weißliche Flüssigkeit, die sie aus den Eutern von Kühen abzapfen. Anderthalb Milliarden dieser spendablen Tiere halten sie sich. (Das ergäbe einen lückenlosen Almauftrieb von der Erdkugel bis hinauf zu ihrem Mond, vierhunderttausend Kilometer entfernt, dabei jeweils sieben Kühe nebeneinander.)
Eigentlich stellen Kühe diese Nährflüssigkeit für ihren Nachwuchs bloß einige Wochen bereit. Sobald das Jungtier nicht mehr an den Zitzen des Muttertieres saugt, versiegt die Fabrikation. Doch weil die Besiedler von Syranam Milch über alles lieben, überlisten sie ihre Kühe. Täglich zweimal massieren sie deren Zitzen. Das lässt die Kuh glauben, ihr Kälbchen benötige immer noch Muttermilch und ihre Milchdrüsen produzieren weiter. Täglich bis vierzig Liter holen Melker aus einer Kuh heraus.
Die halb nackt durchs Zimmer streunende Ana schilderte mir diese Täuschung mit empörter Stimme:
»Welch arglistiges Spiel mit dem Mutterinstinkt ist das denn!«
Auf ihr Urteil ging ich nicht ein, weil ich über die Namensgebung der Galaxie nachsann. Was hatte die Flüssigkeit aus Eutern mit der sich verbrennenden Galaxie zu tun? Auch der Cognitar konnte keinen Zusammenhang herstellen. Nicht zum letzten Mal wurde mir bewusst, wie lückenhaft sein und damit unser Wissen war. Würde ich halt morgen unsere erste Gastgeberin fragen.
Ich mochte Madame Céline. Herzlichkeit scheint ein Grundzug der menschlichen Psyche zu sein. Witwe war sie, Mitte siebzig und rundlich und wohl arm. Sie hatte Schalk in den Augen und den Kopf voller Löckchen in vergilbtem Weiß. Nun verbrachten wir unsere zweite Nacht auf Syranam in ihrem Schlafzimmer, während sie sich mit dem Sofa im Wohnzimmer begnügte. Vergeblich hatten wir uns gegen diese noble Geste gewehrt. Das gehe doch nicht! Sie hatte gelacht und uns mit der Autorität der Hausherrin ins Zimmer gescheucht: »Seit mein Eduard gestorben ist, geht hier alles nach meinem Kopf!«
Ich lag bereits auf ihrem Bett und spürte den Schlaf kommen. Doch meine Begleiterin zog weiterhin ihre Runden um Ohrensessel und dreibeiniges Tischchen, vorbei an Kommode und Schrank. Nach dem brutheißen Tag war es im Zimmer immer noch sehr warm. Ana trug einzig das, was hier als Unterwäsche bezeichnet wird. Weibliche Sapiens tragen zwei Stück, männliche eines. Ihre Funktion war uns noch nicht klar.
Den Duft im Zimmer identifizierte der Cognitar als Lavendel. Ana tourte und redete: Den Kühen würden jedes Jahr 800 Milliarden Liter abgezapft. Nicht alles werde getrunken. Auch festes Essen, als Käse oder Butter bezeichnet, würde daraus hergestellt.
»Im Übrigen sind Kühe nicht die einzigen Nutztiere, die auf Syranam – pardon, der Erde gehalten werden. Auch anderthalb Milliarden Schafe gibt es. Davon verfressen sie die Hälfte. Den anderen scheren sie bloß die Wolle runter.«
»Wozu?«
»Um Kleider herzustellen.«
»Sie kleben Schafhaare zu Kleidern zusammen?«
»Konsultiere den Cognitar, Nathan! Ich weiß es nicht. Dafür das: Jedes Jahr verschlingen sie 140 Milliarden Kilo Hühnerfleisch!«
Unwillkürlich suchte ich einen Vergleich, um mir diese ungeheure Zahl vorzustellen. Ich mochte rund siebzig Kilogramm wiegen. Das würde heißen … ich rechnete. Rund zwanzig Millionen Mal wurde das Gewicht meines Leibes verzehrt. Verblüfft oder erschreckt sah ich an mir herunter. Nackt auf dem Bett liegend hatte ich mir ein Kissen untergeschoben. So fiel mein Blick auch auf meinen Penis. Besonders gelungen war sein Design nicht. Ich hatte aber gelesen, dass er unterschiedliche Aggregatzustände annehmen konnte. So, wie er jetzt aussah, war er keine schmückende Beigabe. Ob der Evolution auf der Erde noch andere Fehlleistungen unterlaufen waren? Es schien mir auf einmal wahrscheinlicher.
Die durch das Schlafgemach wandernde Ana bewarf mich weiterhin mit Wissen aus dem Cognitar. Insgesamt gab es über dreißig Milliarden Nutztiere auf diesem Planeten.
»Jeder Sapiens hält sich also eine kleine Herde aus vier Nutztieren. Milchkuh, Mastgans, Wollschaf, Brathähnchen, Zuchtfisch und andere, die ihm gehören. Die er melkt, schert oder schluckt und verdaut.«
Nutztiere? Ein treffendes, ehrliches Wort, dachte ich. Die Menschen standen also zu ihrem Verhalten. »Ist doch gut, Ana, dass sie ihr Tun nicht verbrämen. Dass sie Tiere benutzen, nennen sie offen beim Namen.«
Da wir uns erst gestern, kurz nach Ankunft, in Sapiens changiert hatten, war ich noch ungeübt darin, Anas Mimik zu lesen. Doch ich täusche mich kaum, wenn ich sage: Sie blickte mich verächtlich an. Dieser neue Gesichtsausdruck löste in mir ein ebenso unbekanntes Gefühl aus, für das ich noch keinen Begriff hatte. Eine Zeit lang suchte ich danach, dann wurde der Drang zum Schlaf stärker.
Ana hatte sich neben mich gelegt, ohne ihre Berichterstattung abzubrechen. Ich bekam noch mit, dass männliche Küken sofort geschreddert wurden. Weibliche konnten wählen, ob sie bald Fleischware werden oder lieber ein paar Jahre lang Eier rauspressen wollten, um erst danach in Suppen zu schwimmen. Mit dem Gedanken, dass diese Wahl widersinnig und das Schwimmen in Suppen makaber sei, schlief ich ein.
II
Selbstverständlich hatten wir uns bei der Ankunft sogleich den Siedlern dieses hübschen kleinen Planeten angepasst. Unsere Mission konnte nur gelingen, wenn wir nicht auffielen. Diese Changierung dauerte knapp zwei Stunden. Edam gab sich den Namen Ana, ich wechselte von Rama zu Nathan. Später erfuhr ich, dass einst ein Weiser diesen Namen getragen hatte. Allerdings war er ein erfundener Mensch. Ana hatte sich dem weiblichen Geschlecht angeschlossen, ich dem männlichen. Von den Schwierigkeiten, die wir uns damit einhandelten, wird noch die Rede sein. Jedenfalls besteht die Population von Syranam je zur Hälfte aus diesen beiden Geschlechtern. Der äußerliche Unterschied ist allenfalls amüsant, der innere dramatisch. Auch darüber wird zu berichten sein.
Als Ana und Nathan begannen wir unsere Suche bei 43.44/3.78, Region Languedoc-Roussillon, in einem Dorf namens St. Anastasie. St. ist das Kürzel für Saint – heilig. Es bedeutet, dass etwas von göttlicher Qualität ist. Wir fanden nie heraus, nach welchen Kriterien dieses Attribut zugesprochen wird. Menschen tragen es ebenso wie Orte, Schriftstücke oder Knochensplitter. Vermutlich wird es willkürlich vergeben. Der Cognitar hatte uns dieses Dorf als »typisch für den Süden Frankreichs« empfohlen. Schön war ein weiträumiger sandiger Platz, beschattet von Platanen, unter denen Männer mit silbernen Kugeln auf ein hölzernes Kügelchen zielten. Ana brachte mich zum Lachen, weil sie das Werfen und Treffen als Fruchtbarkeitsritual interpretierte. Recht lange sollten wir noch zu solch vorschnellen Annahmen neigen.
Mit den zwei neuen Vorwölbungen auf ihrer Brust sah Ana befremdlich aus. Wir skalierten uns auf die Sprache der Männer: Französisch. »Halt drauf, Gaston«, rief einer, »putz den René weg.« Sogleich prallte eine geschleuderte Silberkugel auf eine andere, die fortschnellte. Es geht also nicht bloß um das hölzerne Kügelchen, dachte ich, als ein Mann neben uns trat. Ob uns ein kühler Rosé genehm wäre, fragte er. Er stellte sich als Wirt des Bistros unter den Arkaden hinter uns heraus und wies uns ein Tischchen zu. Ob die Kugeln Namen hätten, fragte Ana ihn.
Wie sie darauf käme? Weil doch der René soeben weggeschlagen worden sei. Das Glucksen und der zuckende Schnurrbart des Wirtes verrieten, dass ihre Vermutung falsch war. Um uns keine weitere Blöße zu geben, bestellten wir das vorgeschlagene Getränk namens Rosé Tavel. Doch inzwischen musste dem Wirt an Ana etwas aufgefallen sein. Jedenfalls musterte er sie, wobei er seine Augenbrauen hochzog (über den Augen platzierte Sicheln aus kurzen Haaren; seine waren sehr ausgeprägt).
»Bestimmt spricht man sie häufig darauf an, Madame. Man könnte direkt meinen, sie seien unsere Milla Jovovich, so sehr gleichen sie der wunderbaren Actrice!« Und mich grinste er an: »Was für ein Glückspilz Sie sind, Monsieur! Immer haben Sie das perfekte Double an Ihrer Seite, sogar nachts!« Seine Sicheln waren noch höher gewandert.
Wir verstanden nicht, worauf er anspielte, fragten aber aus Vorsicht nicht nach. Er ging das Getränk holen. Es mundete uns, und wie! Obwohl wir in den Monaten darauf Weine aus der ganzen Welt kennenlernen würden – dieser erste Schluck Erdenwein blieb der köstlichste. Wir haben uns später das Rezept besorgt, obwohl das provenzalische Terroir nicht leicht nachzumachen sein wird. Wir bestellten zwei weitere Gläser. Die Flüssigkeit musste eine berauschende Substanz enthalten, denn das bange Gefühl, das uns seit Ankunft besetzt hielt, wurde etwas erträglicher.
Eigentlich war diese Mission zu groß für uns. Gewiss, man hatte Ana und mich vorbereitet. Als Blauen Planeten verstanden ihn seine Siedler. War das der Grund, weshalb sie das Grün auszurotten versuchten? Binnen weniger Jahre hatten sie hundert Millionen Hektar Urwald niedergemacht. Rund acht Milliarden Homo Sapiens bewohnten dieses Trabäntchen ihrer Sonne. Sie schienen es zu beherrschen, obwohl ihr Anteil am Gewicht allen Lebens – Bäumen, Tieren, Bakterien – winzig war. Knapp den zehntausendsten Teil machten sie aus. Allein die Termiten hatten mehr Anteil an der Biomasse als alle Sapiens-Menschen zusammen. Im Grunde waren sie eine Randerscheinung des irdischen Lebens.
Unsere Instruktorin hatte uns vor der Abreise mit unzähligen Daten und Statistiken gefüttert. Danach wärmte Syranam sich auf, und die Atmosphäre verschlechterte sich rasant. Von einer gleichmäßigen Besiedlung konnte keine Rede mehr sein. Die Bewohner ballten sich millionenfach dort zusammen, wo die Lebensbedingungen offenbar erträglicher waren. In nur dreißig Jahren hatten sich die Concentration Spots, Städte genannt, verdoppelt. Bereits fünf Milliarden Sapiens lebten derart dicht an dicht.
Ana hatte mit lässiger Geste, einen anderen Gast nachahmend, nochmals zwei Gläser bestellt. »Zum Wohl«, sagte der Wirt. Das traf es bestens. Wir fühlten uns eindeutig wohler. Unsere Aufgabe kam uns weniger erdrückend vor. Eigentlich hatten wir zwei Aufträge erhalten. Wir sollten herausfinden, was mit Orcheus geschehen war. Bei uns gilt er seit achtzig Jahren als verschollen. Sein letztes Lebenszeichen hatte er von Syranam aus übermittelt. Und wir sollten herausfinden, was auf diesem Planeten los war.
»Wir verstehen nicht, was wir messen. Weder das Verhalten der Einheimischen noch das Energiebild sind plausibel«, hatte unsere Instruktorin gesagt. War es vielleicht ein Planet unter Drogen? Doch welcher Art wäre diese Benebelung? »Auch Orcheus war dieser Verdacht schon bekannt. Vielleicht ist er gerade deswegen nach Syranam gegangen.«
Orcheus ist bei uns eine legendäre Gestalt. Manche sehen ihn als Abenteurer oder Eiferer, die meisten aber als Sozialromantiker, um es im irdischen Jargon zu sagen. Doch das wird ihm nicht gerecht. Es ging ihm nie um sich selbst. Er wollte das Gute. Er liebte alles Schöne. Verehrte den Frieden. Er war zutiefst überzeugt, dass unsere leuchtende Zivilisation die Pflicht habe, weniger erhellten Zivilisationen zu helfen.
»Mit Rosé schaffen wir alles«, kicherte Ana, »lass uns nochmals zwei … Füllungen? … bestellen.« Da sie gerade einen neuen Schluckmechanismus entdeckt hatte, gurgelte sie ihr halb volles Glas die Kehle hinunter. »Köstlich! Ich beneide unseren Orcheus, dass er lange vor uns schon davon kosten konnte. Fast könnte das erklären, warum er nie zurückkehrte.«
Anas Lippen glänzten vom Rosé. Sie hatte volle, weiche gewählt, nachdem sie gestern kurz nach Ankunft ein Plakat erblickt hatte. Es zeigte groß ein Frauengesicht, das ihr gefiel. Die Gegenvorschläge des Cognitars verwarf sie. Sie wollte so aussehen wie diese Frau, über deren Kopf Jeanne d’Orléans stand.
Lyon war uns als Ausgangspunkt aber ungeeignet vorgekommen. Voll nervöser Energie war dieser (kleinere) Konzentrationsflecken. Wie viel entspannter war dieses Dorf mit seinen spielenden Männern. Noch immer vollführten sie ihre rituellen Würfe. Doch immer häufiger blickten sie zu uns. Auch dem Wirt fiel es auf, als er uns die dritte Runde brachte. »Vermutlich halten sie Madame für das Original. Falls es Sie stört, bringe ich den Jungs Anstand bei!«, grinste er.
Kaum war er an seinem Tresen zurückgekehrt, trat einer der Werfer an unseren Tisch. Ein kraushaariger, schlanker, wohl hübscher Kerl, soweit ich das beurteilen konnte. So wir ihn richtig verstanden, wollte er sich entschuldigen. Keinesfalls wolle er der Dame zu nahe treten: »Jamais, jamais!« Damals wussten wir noch nicht, dass sich die Bewohner von Syranam häufig für eine ungehörige Handlung entschuldigen, diese dann aber trotzdem ausführen. »Darf ich Sie etwas fragen, Madame? Das muss ich nämlich, weil ich es meinen Kumpels versprochen habe.« Wie unlogisch diese Homo sapiens sind, dachte ich: Er stellt die Frage, ob er eine stellen dürfe, womit er bereits eine unberechtigt gestellt hat.
Sie sei die schönste Frau der Welt, stammelte der Jüngling. Ob sie ihm ein Autogramm auf seinen Unterarm schreiben würde. Er krempelte den Hemdsärmel zurück und hielt Ana einen Schreibstift hin. Mit einem Lachen, das ihre schönen Zähne zur Geltung brachte, setzte meine Begleiterin schwungvoll ANA auf seine Haut.
Sogleich schoss der Wirt hinter seinem Tresen hervor: »Hey, Patrice, du Idiot! Lass meine Gäste in Ruhe, sapperlot! Das ist doch nicht die echte Jovovich!« Er versetzte dem Jüngling einen derben Stoß.
Ana und ich konnten uns seine Grobheit nicht erklären. Zu uns sagte er, wie peinlich ihm Patrice’ Belästigung sei, und er entschuldigte sich gebärdenreich. Damit das klar ist: Er entschuldigte sich für die Bitte des jungen Mannes, nicht etwa für seine handfeste Maßregelung.
Die Sitte von Namenseinträgen auf Unterarmen war uns und blieb: rätselhaft. Doch nun begriffen wir, dass Anas Changierung nach dem Vorbild des Plakates unbesonnen gewesen war. Offensichtlich war sie das Ebenbild einer Frau, die junge Männer dieser Gegend zum Stammeln brachte. Es war fahrlässig gewesen, uns in Menschen zu changieren, bevor wir uns auf Syranams Kultur skaliert hatten.
Drüben bei den Spielern brach Gelächter aus, das in ein Gerangel überging. Der Jüngling wurde verspottet. »Amputiere deinen wertvollen Arm und häng ihn dir übers Bett!«, schrie einer, »Name Milla, Rufname Ana, haha!«, ein anderer. Der Jüngling wehrte sich schließlich mit einem Faustschlag, was den Wirt veranlasste zu intervenieren. Eindeutig griff man hierzulande rasch nach körperlichen Regelungen. Auch deshalb verschwanden wir.
III
Als wir am Nachmittag in einem anderen, eben Célines Dorf unsere Skalierung nachholten, wurde uns klar, dass wir uns der Zechprellerei schuldig gemacht hatten. Doch wie hätten wir bezahlen können ohne Geld? Und ohne Geld läuft auf diesem Planeten gar nichts, erfuhren wir. Alles muss bezahlt werden, denn alles gehört jemandem. Der Wert eines Gutes hängt davon ab, wie viel Begehren es auszulösen vermag. Es kann vollkommen unnütz sein, doch je knapper es vorhanden ist und je mehr Sapiens nach ihm lechzen, desto teurer wird es. Sie nennen das die Gesetze des Marktes. Selbst die Oberfläche des Blauen Planeten ist auf Eigentümer aufgeteilt. 94 von 100 Erdbewohnern haben allerdings keinen Anteil daran.
Ana war empört: »Verstehst du das, Nathan? 94 von 100 Sapiens sind gezwungen, sich ständig auf einem Erdboden zu bewegen, der den anderen sechs gehört! Das ist ja zum Lachen! Vielleicht dürfen auch wir nicht auf diesem Mäuerchen hier sitzen.«
»Vermutlich können nur jene Boden besitzen, die viel von ihm verstehen«, gab ich zu bedenken.
»Ja? Und wie erklärst du dir, dass selbst die Ufer der Seen und Meere nur ganz wenigen gehören?«
»Vielleicht ist damit eine Pflicht verbunden. Sie müssen dafür sorgen, dass niemand ins Wasser fällt und ertrinkt.«
Der Blick, den Ana mir zuwarf, war nicht besonders respektvoll. Aber erstmals nahm ich wahr, dass ihre menschliche Mimik mich zu faszinieren begann.
Drei Stunden verbrachten wir mit unserer kulturellen Skalierung auf jenem Mäuerchen am Rande einer Weide, auf der vier schwarze und zwei weiße Pferde grasten. Sie rupften friedlich vom Weidengras. Jedes der Tiere gesellte sich mal zum einen und mal zum anderen. Die Farbe des Fells beeinflusste offensichtlich ihre Sympathien nicht.
Das fiel uns aber nur auf, weil wir vom Cognitar über weiße, schwarze, rote und gelbe Menschen orientiert wurden. Es herrsche ein großes Misstrauen zwischen den Rassen. Es basiere auf einem Rassendünkel. So hätten weiße Sapiens eine Rassentrennung praktiziert. Eine Theorie namens Apartheid hatte Regeln festgelegt. Danach durfte ein schwarzes Kind weder in der Schule noch im Bus neben einem weißen sitzen. Weiße Menschen hatten rote zuhauf getötet und schwarze als Sklaven zu handelbaren Gütern gemacht.
Ana und mir schien das wenig plausibel. Der Cognitar räumte ein, dass sein Wissen lückenhaft sei. Nervend genug! Vor allem, weil sein Nichtwissen uns manchmal hämisch vorkam. Als wolle er uns mit seinen Lücken reizen. Nun wusste er nicht, was unter Ku-Klux-Klan zu verstehen sei. Er hatte dazu nur ein Bild einer Gestalt im weißen Umhang, eine spitze Mütze auf dem Kopf und eine Art Serviette mit Augenlöchern vor dem Gesicht. Konnte es sich um einen Menschen handeln, der sich seines Äußeren schämte? Etwa, weil er eines Unfalls wegen entstellt war?
In uns keimte die Vermutung, dass die Zivilisation der Sapiens voller eigenartiger Phänomene war. Frauen sind in vielen Ländern den Männern untergeordnet. Sogar Schläge sind erlaubt. Ana vermochte das nicht zu glauben: »Das hieße ja, dass die Männer dümmer sind als die Frauen«, sagte sie, »denn niemand bei Verstand praktiziert solchen Unsinn.«
Bald zog Ana sich zurück, um ihr Erscheinungsbild neu zu justieren, während ich mir weiteres Wissen zuführte. In manchen Ländern taten sich Paare aus Liebe zusammen, in anderen auf Geheiß der Eltern. Dass dreißig Milliarden Nutztiere für den Sapiens lebten, konnte allerdings nicht stimmen. Im eben vergangenen Jahr hatte er nämlich mehr als fünfundsechzig Milliarden geschlachtet, um selber zu überleben. Auch hatte er Scharen frei lebender Tiere wie Löwen, Nashörner, Gnus oder Elefanten binnen hundert Jahren auf ein Viertel reduziert. Warum? Weil er sich vor ihnen ängstigte? Um Platz für seine nützlichen Tiere zu schaffen? Weil er ihnen die Freiheit missgönnte?
Freiheit! Ja, die Menschen Syranams hatten sie als kostbares Gut längst entdeckt. Alle Völker hatten im Konzentrationsspot New York eine weise Charta unterschrieben. Es war das heilige Versprechen, jedem einzelnen Sapiens Freiheit und Wohlergehen zu gewährleisten. Dennoch schrieben in der Hälfte aller Länder Despoten oder Diktatoren den Menschen vor, was sie zu denken oder zu glauben hatten. Die Widersprüche wollten nicht enden.
Die schönste aller Regungen, die Liebe, priesen sie in Gedichten: Welch Glück, geliebt zu werden – zu lieben, Götter, welch ein Glück. Aber wenn ein Thomas mit einem Eduard die Liebe pflegte oder eine Eliane mit einer Nathalie das Liebesglück fand, war ihnen das zuwider. Ob der Homo sapiens das Wesen der Liebe gar nicht begriffen hatte? Warum versuchte er, sie in Kategorien zu pressen wie Gottesliebe, Nächstenliebe, erotische Liebe, Mutterliebe, romantische Liebe, selbstsüchtige Liebe …? Bei aller Fantasie konnte ich mir die Kombination von Selbstsucht und Liebe schlicht nicht vorstellen. Hatte der Homo Sapiens vielleicht ein verwirrtes Naturell?
IV
Um es mit dem Ausruf zu sagen, den ich vormittags gehört hatte: Sapperlot! Die neu changierte Ana stand vor mir. Sie hatte sich auf meine Körperlänge gestreckt. Schmaler nun um die Hüften, ebenso im Gesicht. Lippen weniger füllig. Wangen konturierter und Kinn entschlossener. Und ihre beiden Vorwölbungen waren weniger aufgepolstert. Statt heller Locken langes dunkles Haar. Braune anstelle grüner Augen (schade, dachte ich).
Mit ausgebreiteten Armen und tänzelnden Schritten drehte sie sich langsam um ihre Achse. Schön, wie ihr die Haare über den Rücken flossen. Auch ihre Halbkugeln unterhalb desselben waren nun kompakter. Die Form wurde von der engen Hose nett betont.
»Weh dir, du guckst mir auf den Hintern!«, rief sie, als es schon geschehen war. Mein Gehirn hatte bereits eine mir unerklärliche Reizwirkung festgestellt. Das gestand ich ihr. Sie regierte mit wissenschaftlicher Neugier: »Mein Arsch bewirkt in deinem Gehirn einen Reiz? Welcher Art?«
»Schwer zu sagen. Eine Art Reflex. Nicht unangenehm.«
»Ein erfreulicher Reiz also. Erheitert er dich?«
Hatte er mich erheitert? Nein. Was denn? Eher verwirrt. Mich genötigt, hinzuschauen. Vielleicht war es weniger Reiz als optische Falle. Doch zu welchem Zweck? Die Evolution hatte mit dieser Polsterung bestimmt etwas erreichen wollen. Zugleich wurde mir klar: Indem wir uns in Menschenkörper changiert hatten, würden wir auch mit dessen Regungen konfrontiert werden. Diese Erkenntnis war beängstigend.
»Du kannst die Wirkung also nicht beschreiben. Wollen wir einen Versuch machen? Ich gehe langsam vor dir her, du beschaust dabei meine hinteren Backen und rapportierst mir, was du feststellst.«
Doch ich verspürte Widerwillen. Ein solches Experiment wollte ich nicht. Es würde wichtigere Regungen geben, die wir zu verstehen hatten. Zudem fühlte ich mich von Anas Forscherinnengehabe wie vorgeführt.
»Nein, heute nicht«, sagte ich.
»Schade«, sagte sie. »Es stört mich nämlich nicht.« Plötzlich wirkte sie verlegen. Und mir schoss durch den Kopf, dass wir ahnungsloser waren, als es für unsere Expedition gut war.
Der Rundgang durch das neue Dorf erleichterte Ana. Wer uns begegnete, grüßte freundlich. Als auch zwei Burschen ohne jedes Aufhebens vorbeigingen, hielt sie die Prüfung ihres neuen Äußeren für bestanden. Auf ein Hotel stießen wir nicht. Erst um achtzehn Uhr würde das Bistro öffnen. Ein vernachlässigtes Haus war zum Verkauf angeschrieben, eine EPICERIE mit Brettern verrammelt. Fermé pour toujours, verkündete ein Pappkarton.
Doch daneben standen die Flügel eines Holztores weit offen. Mitten im Innenhof lehnte eine Leiter am Feigenbaum. Die ältere Frau auf halber Höhe winkte uns zu, und wir winkten zurück. Doch sie gestikulierte weiter, bis wir verstanden, dass sie uns herbeiwinkte. Es seien wie jedes Jahr mehr als genug, rief sie. Bereits standen zwei volle Körbe beim Stamm. Sie stieg herunter und bot uns aus ihrer Beuteltasche eine Handvoll Früchte an.
Als Ana und ich nach einem ersten Bissen gleichzeitig »köstlich« riefen, lachte sie: »Ihr versteht euch ja prächtig!« Dann musterte sie uns lange und gab uns das Ergebnis freimütig bekannt: »Ihr passt zusammen. Aber verheiratet seid ihr nicht. Lange kennt ihr euch auch nicht. Und ihr seid nicht aus der Gegend.«
Ihre direkte Art gefiel und erheiterte uns. Und natürlich wollten wir wissen, woraus sie ihre Schlüsse gezogen habe.
»Als Sie, Madame, in die Feige bissen, hat Ihr Freund Sie mit großem Vergnügen betrachtet. Es schien, als ob er Ihr Gesicht ganz neu entdecke. Also kennt ihr euch noch nicht gut. Und niemand in der Gegend trägt solche Schuhe wie Sie, Monsieur.« Es waren halbhohe grüne Stiefel; das einzige Schuhwerk, das mir der Cognitar zu materialisieren vermocht hatte. Bei Ana war er großzügiger gewesen, als sei weibliches Schuhwerk wichtiger.
»Stimmt, wir kommen nicht aus der näheren Umgebung«, sagte Ana, die eine Gabe hat, wahrheitsgetreu zu schwindeln.
Die Löckchen der Dame waren zweifellos echt, wirkten aber wie eine lustige Perücke. Gebräuntes Gesicht. Makellos die Reihen kleiner Zähnchen, die ständig aufblitzten. Ich mochte Céline sogleich; ihren Namen erfuhren wir, als wir mit ihr anstießen. Da hatten wir bereits eine Führung durch ihr Haus hinter uns und ihre Lebensgeschichte erzählt bekommen.
In der Küche hatte Ana die Alte spontan umarmt, als Céline zwei bleiche Scheiben in den Ofen geschoben und dabei den Tod ihrer beiden Brüder erwähnt hatte: »Vor Paris gefallen, als die Nazis kamen. Zumindest waren sie beisammen.«
Céline ließ die tröstende Umarmung nur kurz zu. »So ist das Leben«, sagte sie und wand sich aus Anas Armen. »Auch meinen Großpapa hat der Krieg eingesackt. Er erstickte in Verdun, wissen Sie, im Gaskrieg.«
Und ihr Mann, fragten wir uns. Sie aber erzählte nur, dass ihre Tochter Charlotte Lehrerin am Lycée in Alès sei. Dreimal habe Charlotte geheiratet. »Der Erste wollte nicht, der Zweite konnte nicht. Doch mit dem Dritten hat es geklappt. Jetzt bin ich zweifache Großmutter.« (Offenbar tauschten die weiblichen Sapiens ihre Partner so lange aus, bis sie sich als Erzeuger bewährt hatten.)
Die Enkelin studierte Physik in Paris und ihr Enkel schrieb an der Universität in Montpellier seine philosophische Doktorarbeit. »Guillaume. Über Apollinaire schreibt er. Er besucht mich häufig.«
Ganz konnten wir Célines Biografie nicht einordnen. Im Cognitar waren keine Einträge zu Nazis, Verdun oder Gaskrieg – seine Wissenslücken waren größer als befürchtet. Zu Paris meldete er nur eine mehrere Hundert Meter aufragende Eisenkonstruktion, deren Zweck uns unbekannt war. Vermutlich war es eine Antenne.
V
Auf dem Terrässchen bekamen wir erneut einen Rosé aus einer Kellnerei in Roquemaure. Céline wies uns auf seine erdbeerene Note hin. Dazu servierte sie uns eine Spezialität der Region. Etwas unbescheiden meinte sie, niemand mache diese Quiche à la veuve so gut wie sie. Nun, die sämige Füllung aus Käse, Pilze und Kräutern war wirklich ausgezeichnet.
Was den besonderen Goût ausmache, fragte Ana.
»Genial, nicht? Ein paar satte Tropfen Feigenschnaps.«
Dass ihr Eigenlob nicht eitel, sondern wehmütig war, verstanden wir erst, als sie den Erfinder des Rezeptes nannte: Eduard, ihren vor neun Jahren verstorbenen Mann. Witwe war sie also, veuve auf Französisch. Sie waren ein Leben lang zusammengeblieben, und es war gut gewesen. Jetzt ruhte er auf dem Friedhof vor dem Dorf.
Mit wenigen Worten machte sie ihn lebendig: Geduldig, lustig, feinfühlig. Sie könne die misslungenen Tage mit Eduard an einer Hand abzählen.
»Na, übertreiben will ich nicht. Ich meine die schlechten Tage pro Jahr. Doch es hat mich nie verunsichert, wenn wir als Liebende mal aus dem Takt gerieten. Stundenlang ging uns die Sprache aus. Aber mit Zeichen kamen wir uns wieder näher. Wie nebenbei stellte er Feldblumen auf den Esstisch. Ich brachte ihm einen Kaffee in die Epicerie nebenan. Oder er opferte sein Mittagsschläfchen, um heimlich den Verschluss meiner Schmuckschatulle zu flicken. Das Schönste aber war, wenn er mir seinen Coq au vin machte, ein Gedicht! Damit heilte er bei mir jede Verletzung. Stimmt doch, Eduard (sie blickte nach oben). Er hatte Lungenkrebs. Doch er konnte von seinen Gauloises bleues einfach nicht lassen. Im Morphium ist er verdämmert.
Aber du hast gespürt, dass ich bei dir war, Eduard, nicht wahr (wieder blickte sie nach oben). Einmal hat er mit Rauchen aufgehört. Doch er wurde sofort dicklich. Das hasste er. Und es machte ihm Angst – was ich gar nicht mitbekam –, ich würde ihn nicht mehr begehren. Ich erfuhr es erst nach seinem Tod aus einem Brief, den er seiner Schwester geschickt hatte. Oh, nein, Eduard, ich habe dich nicht weniger geliebt. Du hast mich ja auch nicht weniger geliebt, als ich meine Dummheit machte.«
Diesmal blickte sie nicht nach oben. Dafür schwieg sie.
Zum ersten Mal seit unserer Ankunft verspürten wir das Gefühl der Ergriffenheit. Dank Cognitar hatten wir zumindest Friedhof verstanden: Ein Sammelplatz toter Sapiens, entweder leiblich oder als Asche. Dort, in einem Sarg oder einer Urne, die vergraben wurde, fand er seinen Frieden. Wozu diese Verheißung? Weil der Sapiens im Leben keinen finden konnte? Doch wie sollte Asche so etwas wie Frieden empfinden? Frieden genießen war doch etwas für Lebende. Oder bildeten die Erdlinge sich ein, ihr Bewusstsein bliebe auch nach dem Rückzug des Lebens aus ihrem Körper erhalten?
Uns sind jegliche Spekulationen fremd. Sie führen leicht zum Aberglauben. Wir glauben sowieso kaum etwas. Wir wollen erkennen und begreifen, nicht bloß glauben. Wenn wir etwas nicht zu durchschauen vermögen, weichen wir nicht in Vermutungen aus. Sondern wir forschen weiter. Auch deswegen waren wir auf die Erde gekommen.
Ihre Zivilisation verstanden wir einfach nicht. Was unsere Forscher bislang zusammengetragen hatten, war widersprüchlich. Zwar konnten wir schon lange ein entwickeltes Bewusstsein auf Syranam nachweisen. Doch die Träger dieses Bewusstseins schienen sich seiner selten zu bedienen. Das jedenfalls war das Fazit früherer Expeditionen gewesen. Culom-Ban, unserer renommiertester Forscher, hatte von einer »blutrünstigen, dummen Zivilisation« gesprochen. (Wobei unser Forschungsrat seine Beweisführung als voreilig abgelehnt hatte.)
Aus diesen Gedanken schreckte ich auf, als sich Ana höchst gewunden nach Célines Dummheit erkundigte. Die fasste nach Anas Hand: »Mein Mädchen! Es gibt doch nur eine wirkliche Dummheit. Aus Eigensucht den Liebsten zu verletzen.«
Ich spürte, dass Nachfragen zu forsch wäre, aber Forschung heißt wohl nicht zufällig so, denn Ana blieb hartnäckig: »Was haben Sie denn verbrochen?«
Céline blinzelte. Kniff den Mund zusammen. Sah plötzlich mich an und lächelte: »Ihre Freundin scheint ahnungslos, Monsieur. Offenbar hatten Sie nie eine Affäre.«
Mit dem Begriff konnte ich nichts anfangen und kraulte mir das Kinn. Laut Cognitar signalisiert diese Geste Nachdenklichkeit.
Ana grinste mich an und kam mir zu Hilfe: »Wir wissen beide nicht, was eine Affäre ist.«
»Ihr Glücklichen!«, rief Céline, was zumindest ein Hinweis war, dass eine Affäre unglücklich machte.
Meiner Forscherin genügte das nicht: Ob es hier verbreitet sei, etwas zu tun, obwohl es einen unglücklich mache?
»Hier? Scherzen Sie? Überall! Auf der ganzen Welt, das wissen Sie doch. Wir vergiften mit Abgasen die Luft oder mit Rauchen unsere Lungen. Und jammern dann, dass wir krank werden. Wir Menschen sind so. Etwas willensschwach. Wir lassen unserem Willen eben gerne freien Auslauf … Deshalb heiße er freier Wille, sagt Guillaume, mein philosophierender Enkel. Auch sagt er: Es trifft zu, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Eine Krone ist bekanntlich schwer. Jeder König bekommt bei der Krönung Beulen ab. Und nichts anderes macht der Mensch als Krone der Schöpfung: Er lastet schwer auf ihr und verbeult sie.«
Ihren Enkel zu zitieren, bereitete Céline offensichtlich Wohlbehagen. Ana legte ihr den Arm um die Schultern. Ich aber stellte fest, dass wir in Céline die erste brauchbare Zeugin gefunden hatten. Die Alte würde uns in das Wesen des Sapiens einführen können. Weder verurteilte sie seine Art, noch machte sie sich etwas vor. Eine Beobachterin mit fast achtzigjähriger Praxis. Auch ihr philosophierender Enkel schien ein unbestechlicher Geist zu sein. Vielleicht ließe sich sogar ein Treffen vereinbaren. Der Vergleich des Sapiens mit einem Beulenmacher amüsiert mich – ich stehe nun mal auf die heitere, nicht auf die verbissene Analyse.
»Tiens, ich rede wieder Mal zu viel«, sagte Céline. »Eine typische Witwenkrankheit. Das kommt davon – Céline, du Schwatzbase! – wenn du nichts fragst. Darf ich überhaupt?«
»Ich höre Ihnen gerne zu«, sagte ich etwas berechnend.
»Mich dürfen Sie alles fragen«, sagte Ana.
»Was hat Sie beide in dieses verlorene Nest geführt? Wir sterben nämlich aus. Nur Engländer und Schweizer mit überflüssigem Geld kaufen sich noch Häuser, um hier ihren Urlaub zu verbringen. Und wissen Sie, woraus der besteht? Aus Renovieren! Tag und Nacht klopfen sie alten Verputz von den Wänden und klatschen neuen dran. Oder sie schlagen zusätzliche Fenster in die Mauern. Die verriegeln sie dann für elf Monate, bis sie wiederkommen, um sich ein zweites Badezimmer einzubauen. Dabei braucht kein Mensch zwei Badezimmer. Was also wollt ihr beiden hier? Früher gab es in der Kapelle noch einen sehenswerten Heiland, doch der ist uns vor einigen Jahren gestohlen worden.«
Heil-Land? Einer, der das Land heilt? Einer ihrer spirituellen Anführer? War dieser Name nicht im Liedgut vorgekommen, das Culom-Ban zurückgebracht hatte? Seine Sammlung war bei uns wissenschaftlich ausgewertet worden. Am häufigsten wurden Natur, Liebe und ein Krippenfest namens Weihnachten besungen. Verschwommen erinnerte ich mich an ein Traumlied über eine White Christmas und an die Hymne auf einen Mann, der in Regennächten Marmor, Stein und Eisen zu zerbrechen pflegte.
»Er wird besungen als einer, der den Himmel aufreißt!«, sagte Ana, die offenbar besser gespeichert hatte, was unsere Instruktorin uns vorgespielt hatte.
»Wer?«, fragte Céline.
»Eurer Heil-Land.«
»Wer behauptet das?« Für mich war offensichtlich, dass Céline gleich in Lachen ausbrechen würde. Doch Ana wagte sich noch weiter vor, und ich ahnte, dass wir uns gleich blamieren würden.
»Er reißt doch sogar die Himmelstüre ab.«
Céline hielt sich nicht mehr zurück. Sie lachte, dass ihre Löckchen zitterten. Es lag kein Hohn in ihrem Ausbruch. Nur die reine Freude der Clownin versprühte sie.
Doch jäh war sie wieder ernst und spießte uns mit einem eindringlichen Blick auf: »Gebt es zu! Ihr habt keine Ahnung, wer der Heiland ist. Von welchem Planeten seid ihr zwei eigentlich?«
VI
Erschraken wir? Ja! Wir kannten die Phrase von einem anderen Planeten ja nicht. Wir verstanden sie wörtlich und fühlten uns entlarvt. Für diesen Fall hatte man uns den sofortigen Rückzug empfohlen.
»Vermutlich ist das Bewusstsein der Siedler auf Syranam noch im Stadium der Selbstüberschätzung«, hatte unsere Instruktorin gesagt. Sie betrachten sich als Sonderfall im Kosmos. »Nirgendwo sonst gibt es ein Bewusstsein wie das ihre, schon gar keines, das dem ihren überlegen ist.«
Wir hatten den strikten Auftrag, unser Inkognito zu bewahren. Erkunden sollten wir, ohne aufzufallen. Keinesfalls den Stolz des Sapiens auf seine Errungenschaften verletzen. Ihm jegliche Einbildung lassen. »Und vermeidet unter allen Umständen, dass sie euer Erbgut untersuchen könnten. Denn das müsste sie erschüttern. Und dann wären gefährliche Reaktionen nicht auszuschließen!«
Wir waren also wohlversorgt mit Warnungen angereist. Doch sie basierten auf theoretischen Annahmen. In der Praxis saßen wir einer herzensguten alten Dame namens Céline gegenüber. Genossen Guiche à la veuve nach dem Rezept ihres geliebten Eduards. Waren träge und selig von Wein, Geschichten und sirrenden Grillen. Mit einem sofortigen Abgang hätten wir Céline vor den Kopf gestoßen.
Ana musste ähnlich empfunden haben. Statt Rückzug wagte sie die Flucht nach vorn: »Sie haben natürlich recht, Céline. Auf unserem Planeten weiß man nichts von eurem Heil-Land.«
Céline schüttelte ihren Kopf, aber um zu verhindern, dass sich ein Falter auf ihre Löckchen setzte. »Übertreiben müssen Sie nicht, Madame! Wer den Heiland nicht kennt, ist noch längst kein Außerirdischer. Sonst wären es viele von uns!«
Sie schaffte es, mit Seufzern durchmischt zu lachen. Ana und ich hatten also Grund zur Erleichterung. Zu offensichtlich war das Missverständnis. Wir waren weder entlarvt noch in Gefahr. Im Grunde war das Intermezzo bedeutungslos. Doch uns war bewusst geworden, wie verwundbar unser Halbwissen uns machte, wie schnell unsere Mission in Gefahr geraten könne. Und doch würden wir, um Verbündete zu bekommen, Menschen wie Céline ins Vertrauen ziehen müssen. Aber wem vertrauen? Menschenkenntnis wäre nötig. Doch wie solche erwerben, ohne vertrauensvoll auf Menschen zuzugehen?
»Sie sehen erschöpft aus, Monsieur«, vernahm ich Céline. »Habe ich Sie mit meinem Geschwätz ermüdet? Sie können sich gerne etwas hinlegen. Man soll sich nie übermüdet ins Auto setzen!«
»Wir haben keines«, murmelte ich.
»Donnerwetter. Halt doch von einem anderen Planeten.«
Sie lachte und erklärte uns fröhlich, dass wir heute von hier nicht mehr wegkämen; der letzte Bus sei längst aus Collorgues abgefahren. Und sie bot uns an, gemeinsam ein Abendessen zu kochen und bei ihr zu übernachten. Sie nehme das Sofa und stelle uns gerne ihr breites Bett zur Verfügung. Unsere Widerrede war, wie bereits erwähnt, vergeblich.
Wir waren ihr keine große Hilfe, zu ungeschickt handhabten wir die Rüstmesser. Verstohlen schälte sie unsere Kartoffeln und Rüben nach. Doch während sie die Federn vom frisch geschlachteten Huhn rupfte, das sie bei der Nachbarin erbettelt hatte, erläuterte sie uns ihre Lebensmaxime. Eine gute Arbeit zu haben und jemanden zu lieben, der einen auch liebe, sei wichtig für ein zufriedenes Leben.
»Aber glücklich wirst du erst, wenn du das Tanzen dazunimmst. Notfalls kann es Singen sein.« Dabei malträtierte sie das Federvieh und hatte augenscheinlich ihren Spaß dabei.
Uns begann zu dämmern, auf welche Art sich Nutztiere nützlich zu machen hatten. Dann, während sie das bleiche Tier mit einer Paste aus Olivenöl, Honig und Gewürzen bestrich, fragte sie uns nochmals, weswegen wir hier seien.
Ana sah mich fragend an, und ich gab ihr nickend mein Einverständnis: Ja, wagen wir uns aus der Deckung! Ana verstand mich und sagte: »Wir suchen einen Freund.«
»Orcheus heißt er«, ergänzte ich. »Er ist verschollen.«
Die Alte musterte uns, als müsse sie unsere Glaubwürdigkeit begutachten.
»Orcheus? Noch nie gehört. Seit wann vermisst ihr ihn?«
»Seit Langem«, wich ich aus. Orcheus war ähnlich lange verschollen, wie Céline alt war – rund achtzig Jahre. Es müsste ihr herzlos vorkommen, dass wir ihn erst jetzt suchten.
»Ihr meint nicht etwa Orpheus oder Odysseus?« Sie lachte. »Dann würde ich euch nämlich raten, in Griechenland zu suchen.«
Aus unserer kulturellen Skalierung bei der Pferdewiese wussten wir, dass Odysseus ein Krieger und Abenteurer gewesen war. Ein Grieche namens Menelaos war von seiner schönen Frau Helena verlassen worden. Nach Troja zog sie mit ihrem ebenso schönen Paris. Der eifersüchtige Menelaos scharte seine Freunde, darunter Odysseus, um sich. Mit Krieg wollte er seine Helena zurück ins Ehebett holen. Ein Hauen und Stechen hob an, das zehn Jahre dauerte. Tausende verloren bei dieser Fehde ihr Leben. Doch im offenen Kampf war der Krieg nicht zu gewinnen. Erst als Odysseus eine Idee hatte, wie man die Trojaner hinterrücks meucheln könnte, siegten die Griechen. Seine Hinterlist machte ihn zum Helden …
Diese Metzelei hatte uns einen schalen Geschmack hinterlassen. Eigentlich konnte die Geschichte gar nicht stimmen. Weil ein Mann und eine Frau sich aneinander freuten, würden sich Tausende Sapiens gegenseitig massakrieren? Wohl kaum!
Nein, ein Odysseus sei unser Orcheus nicht, erklärte ich Céline. Ein Abenteurer zwar auch, doch erfüllt von einer netteren Mission. »Er wollte den Menschen mit neuen Ideen den Frieden bringen. Er verstand sich als Glücksbringer. Deshalb brach er immer wieder zu langen Reisen auf. Und tatsächlich hat er andernorts Erfolg gehabt.«
Das Wort Glücksbringer goutierte Céline nicht.