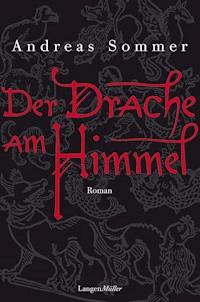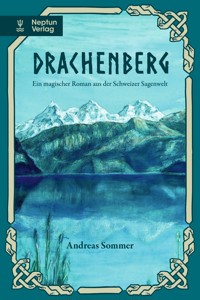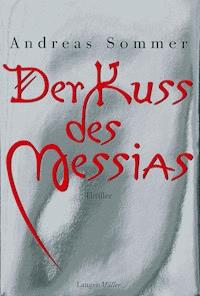
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Roman sprengt alle Konventionen: Er ist Thriller und märchenhafte Prophezeiung, Liebesdrama und apokalyptische Vision - spirituell und erotisch, teuflisch und poetisch. Und er ist die raffiniert erzählte Geschichte von Wahnsinn und Sinn unseres Lebens. Als Sohn einer malischen Prostituierten, die in ihrer Heimat Opfer religiösen Wahns geworden ist, kommt Joshua zur Welt. Dreißig Jahre später steht derselbe Joshua vor dem einstürzenden Petersdom in Rom, um eine ungeheuerliche Botschaft zu verkünden. Die ganze Welt wird Zeuge. Noch gäbe es eine Rettung, wenn er die Prophezeiung erfüllt. Doch das Opfer, das er dafür bringen müsste, wäre übermenschlich. In einem nervenzerreißenden Thriller erzählt Andreas Sommer vom Kampf zwischen gierigen und liebenden Menschen und die Sehnsucht nach einer menschlicheren Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 658
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Andreas Sommer
Der Kuss desMessias
Thriller
LangenMüller
Selten tritt dem Weisen das Schicksal in den Weg.
Seneca
Ich liebe Joshua!
Nada
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.langen-mueller-verlag.de
© für die Originalausgabe: 2007 LangenMüller in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München © für das eBook: 2013 LangenMüller in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Erster Teil:
Wahnsinn
Weihnachten
Kälbchen
Nebelhorn
Davids Sohn
Maras Berichte
Soufflé
Weltdorf
Maras Berichte
Gebete
Polterabend
Maras Berichte
Regenbogen
Täubchen
G-Saite
Maras Berichte
Mann
Maras Berichte
Warten
Drachen
Zweiter Teil:
Der Pilger
Vorspann: Philadelphia
Gewand
Maras Berichte
Mistral
Kuss
Maras Berichte
Rom
Maras Berichte
Chaos
Maras Berichte
Joshua
Maras Berichte
Erster Teil: Wahnsinn
Weihnachten
Nie kommt sie an: Im weihnachtlichen Schaufenster schiebt sich die Lokomotive, vier schuhkartongroße Waggons im Schlepptau, über ihr endloses Gleis. Nach der Geraden entlang der Glasscheibe biegt der Zug ins Tunneldunkel des verzuckerten Berges, taucht wie selbstverständlich wieder auf und tuckert beim Wäldchen am Hexenhaus vorbei, wo Hänsel und Gretel die Hexe gerade in den Ofen stemmen. Nur puppengroß sind die beiden, aber für die Hexe sieht es böse aus. Im ersten Wagen sitzt ein bisschen steif der Nikolaus und winkt mit seinem mechanisch animierten Arm, auf und ab, auf und ab. Keine Sekunde vergisst er sein Lächeln. Violett, blau, rot und gelb glänzen die Pakete in den Waggons hinter ihm. Auf der Bergspitze hat das schöne Schneewittchen seine Zwerge um sich geschart. Hans im Glück jongliert mit seiner goldenen Kugel, von durchsichtigen Plexiglasstäben in der Schwebe gehalten. Wie froh er lacht! Das Dornröschen, bereits wachgeküsst, strahlt seinen Prinzen an, augenfällig überzeugt, dass hundert Jahre Warten sich gelohnt haben … Brav und ewig zieht der Zug seine Runden, ob es dem halb nackten Teufel passt oder nicht – der lehnt grinsend am blau bespannten Hintergrund. Passend zu seinen drei goldenen Haaren stößt er einen goldenen Dreizack rhythmisch vor und zurück. Man traut ihm zu, dass er sich ein Paket aufspießt, führe des Nikolaus’ Zug nur ein klein wenig näher vorbei. Ach, und dort: Aschenputtel, die Arme! Hockt, den Kopf schüttelnd, am Boden und fingert mühselig nach den Erbsen. Aber Sankt Nikolaus hält nicht, muss fahren und fahren, winken, winken, Runde um Runde …
Es ist Abendverkauf, zehn vor neun, die Geschäfte werden bald schließen. Kaum jemand lässt sich noch zum Staunen verleiten. Die Erwachsenen hasten vorbei, jede Minute zählt, und das kleine Mädchen, das stillstehen und schauen möchte, wird von der Mutter weitergezerrt – noch den Schal für Schwester Emilie bei Kalberer.
Um neun Uhr zwei passiert es, von niemandem bemerkt. Der Dreizack in Teufels klammer Hand springt aus der Halterung und senkt sich um einige Zentimeter. Wie der Weihnachtsmann auf seiner nächsten Runde vorbeikommt, verfängt sich ein Zacken an seinem Ärmel. Nikolaus schwankt bedenklich. Er kann sich zwar im letzten Moment losreißen, aber nun lehnt er unerlaubt weit aus seinem Gefährt. Von stoischer Lebenshaltung, grüßt er trotz arger Schräglage weiter. Offensichtlich weiß er nicht, dass kein Unglück allein kommt. Es kommt aber der Tunneleingang, wo sich sein winkender Arm verklemmt und es ihn auf den Rücken wirft. Der Zug reißt ihn ins Dunkel. Dort geschieht Weiteres, keine Zeugen sehen es. Jedenfalls kommt Nikolaus barhäuptig heraus und sein Arm schleift neben dem Wagen dahin. Erste Passanten bleiben stehen, die Ansammlung wird rasch größer.
Jemand lacht schallend. Nikolaus’ mitgeschleppter Arm wird dem nah am Gleis platzierten Hänsel zum Verhängnis. Gnadenlos erfährt er, wie schnell einem der Boden unter den Füßen weggerissen werden kann. Er kippt aufs Gleis und zieht auch seine Schwester ins Elend. Beim Publikum steigt die Heiterkeit. Ein Dicker ist bereits außer Atem vor Lachen. Der Junge neben ihm, der mit erschrockenen Augen zusehen muss, wie es Gretel aufs Gesicht schlägt, weint. Aber der Dicke ist lauter.
Um Viertel nach neun erhält Sophia Weißner, die im Dachstock der Grands Magasins Bonnard Entwürfe für die Osterschaufenster skizziert, den Anruf vom Rayonchef der Parfümerie im Erdgeschoss.
»Gott sei Dank, du bist noch im Atelier! Musst kommen, sofort! Im Schaufenster beim Westeingang läuft eine Katastrophe.«
In dieser Minute stößt David Amiesch, der im Camera Schlöndorffs Film Die Blechtrommel gesehen hat, zu diesem kreischenden Aufmarsch. Vor drei Stunden bereits war er hier vorbei und verspätet zur Vorstellung gekommen, weil er die Märchenwelt ausgiebig bewundert hatte; als Puppenspieler kreiert er selber Figuren. Aschenputtels traurige und des Teufels hämische Mimik hatten ihn entzückt. Die Zerstörung, die unaufhaltsam fortschreitet, macht ihn starr vor Entsetzen; auch nervt ihn das schadenfrohe Gelächter. Eine anrührende Märchenwelt wird hinter der Scheibe zerfetzt. Wie kann man das nur komisch finden und höhnisch kommentieren? Unbarmherzig schaufelt die Lokomotive den Hänsel über den Schienenstrang, um ihn nach der Kurve von sich weg über Aschenputtels gekrümmt liegenden, aufgerissenen Leib zu stoßen. »Immer feste drauf, geile Stellung«, dröhnt einer der Voyeure und wird mit Gewieher belohnt. Der hinterste Waggon ist mittlerweile aus den Schienen gesprungen und umgekippt, bleibt aber angekuppelt und wird daher weiter mitgeschleppt. Ein letztes Paket kullert dem Prinzen in die Beine und bringt ihn zu Fall. Den Kopf verdreht, als sei ihm von Mörderhand der Garaus gemacht worden, läuft der Weihnachtsmann langsam aus. Er hinterlässt eine Spur aus Sägemehl und Holzwolle …
Das Amüsement der Menge ob des Spektakels ist groß, und die Spannung steigt. Wird der nachholpernde Wagen, der jedes Mal am Tunneleingang anschlägt, bei der nächsten Runde das Schneewittchen vom Berg schütteln? »Jjjaaaaaaah … nnneein!«, stöhnt die Meute, als die Schwankende im letzten Moment die Balance wahrt.
»Gleich wirst du die Bescherung sehen«, keucht Hondrich und drängt sich und Sophia durch die Gaffenden, die soeben mitbekommen, wie die Lokomotive gespenstisch lautlos den Kopf des im Tunneleingang verkeilten Schneewittchens abreißt. Die Menge grölt und klatscht.
Sophia schubst einen Mann beiseite, der ihr die Sicht versperrt.
»Ich bin von Bonnard«, schreit sie.
»Entschuldigung«, hört sie ihn brummen. Dann sieht sie das groteske Chaos, das über Weihnachten hereingebrochen ist. Zwei Zwerge kullern vom Berg auf die Lokomotive, die sich festgefahren hat.
»Der Teufel steht noch!«, kreischt jemand.
»Wann geht’s wieder los?«, ruft eine Frau durchs Gelächter, offenbar im Glauben, das Geschehen sei eine raffiniert automatisierte Show.
Sophia könnte weinen. Ein weiterer Zwerg stürzt ab. Wie ausgeblutet liegt Nikolaus’ Stoffhülle schlaff auf dem Waggon. Sie könnte wirklich heulen, aber irgendwie gönnt sie diesem blutrünstigen Publikum nicht, dass es ihre Gefühle mitbekommt.
»So lacht doch alle, lacht euch alle tot«, schreit sie empört, wendet sich um und prallt gegen den Mann, der ihr vorhin die Sicht verstellt hatte. In seinen Augen stehen Tränen.
»Warum lachen Sie nicht, Sie Gefühlsdussel?«, herrscht sie ihn an. »Wohl zu sensibel, um zu lachen!«
»Bin ich, ja!«, sagt der Unbekannte. Er rückt nicht zur Seite und blickt sie an. Sophia starrt zurück. Sie ist verblüfft und misstrauisch zugleich. Ob sich in seiner Antwort Zynismus verbirgt? Doch in seinen blauen Augen liegt – was? Etwas wie Betrübnis? Sie entzieht sich diesen Augen. Aufgewühlt und den Tränen nah, fühlt sie sich zu unsicher, um dem Blick standzuhalten.
»Ach, lassen Sie mich durch!«, herrscht sie ihn nochmals an.
»Haben Sie damit zu tun?«, fragt er, ohne wegzurücken.
Hastig sagt sie: »Ja, das ist mein Job hier, aber bitte lassen …«
»Sie sind wunderschön, die Figuren. Und Aschenputtels Gesicht ist meisterhaft. Ich war am frühen Abend schon da.«
Sophia stutzt und blickt wieder auf. Wirklich blau, die Augen, verdammt gute blaue Augen, denkt Sophia, und sagt abwehrend:
»Ich hab es für Kinder gemacht, das Arrangement!«
»Das sieht man’s. Meine Kindheit will nicht enden.« Er lächelt. »Den Teufel find ich noch bravouröser, der Beste!«
Dass er unter den zwei Dutzend Figuren ihren Favoriten hervorhebt, beeindruckt sie. Im Ausdruck dieser Figur liegt eine Vitalität, die vergessen macht, dass die Gesichtszüge eigentlich starr sind. Diese blauen Augen können schauen, gut schauen, schießt es ihr durch den Kopf, und sie hätte sich ein Lächeln gegönnt, wenn der Menge nicht im selben Augenblick ein kollektives »Ohhh!« entwichen wäre. Was ist jetzt noch passiert? Ich ertrage keine Schadenfreude mehr! Aber da sieht sie, dass die Beleuchtung im Schaufenster erloschen ist. Irgendjemand muss den Schlüssel gefunden oder die Schaltuhr überlistet haben. Ein Geschiebe vom Fenster weg setzt ein, das Menschenknäuel drängt auseinander. Durch das Gerangel zweier Burschen erhält sie einen Stoß, und unversehens wird sie in den offen hängenden Mantel ihres Gegenübers gepresst. Sophia! Schon auf Tuchfühlung, was?, spottet ihre innere Stimme. Es ist aber nicht Tuch, sondern warmer Körper, was sie wahrnimmt.
»Sorry«, sagt sie und ärgert sich sofort, weil sie den Gebrauch dieses Wortes peinlich findet.
»Endlich ist das Licht aus, gut!«, sagt der Mann. »Ich heiße David.«
Er hält ihr förmlich und etwas linkisch, weil der knappe Raum zwischen ihnen nichts Eleganteres zulässt, die Hand hin. Flüchtig streift Sophia seine Finger.
»Weißner … Sophia«, murmelt sie und der schnelle Einfall, sich sofort umzudrehen und der Begegnung hier und jetzt ein Ende zu setzen, wird von der beruhigenden Einsicht ausgehebelt, dass jetzt er dran ist … Er muss etwas sagen. Aber ja keine Anmache!
»Schauen Sie mal, das Mädchen, schau, Sophia!«, sagt er.
Nasenspitze und Handflächen an der Scheibe, starrt ein Kind mit roter Kappe ins dunkle Innere. Unbeweglich steht und starrt es:
»Nikolaus tot, alles tot.«
Einige Meter entfernt wartet der Vater, vermutlich der Vater, ohne jedes Zeichen von Ungeduld, als gelte es, dem Kind alle Zeit der Welt zu geben, bis es sich vom geliebten verstorbenen Großvater verabschieden könne.
»Nikolaus tot, alles tot«, sagt das Kind.
»Ich müsste eine Plane vorhängen«, murmelt Sophia und spürt eine Erleichterung, die ihr unsinnig bedeutsam vorkommt: Keine Sprüche! Recht gut, der Kerl … Was bin ich arrogant! Prüfe ihn, ob er als Braten taugte. Wie die Hexe den Hänsel. Ich möchte …
Derweil überlegt sich David – scheinbar beobachtet er konzentriert das Kind – ob er die größte Dummheit seines Lebens wagen soll. Ob er dieser Frau jetzt, jetzt gleich sagen soll, dass er soeben alle seine Ansichten, was Liebe auf den ersten Blick angeht, entsorgt hat. Vorhin war sie nah daran gewesen, wegzulaufen, das hatte er genau gespürt. Er ist zweiunddreißig und seine Instrumente für Situationen wie diese wären eigentlich ganz passabel. Die witzige Wendung, die sie zum Lachen reizen könnte, oder die einfühlsame Frage, aus der sich das Gespräch weiter ziehen ließe – er hätte sie schon bei der Hand. Er hört doch seinen Einflüsterer, der ihm Vorschläge unterbreitet, die zumindest Zeitgewinn einbrächten. Aber da ist eine zweite Stimme, die ihn mit exaltierter Unvernunft traktiert: Das ist ein großer Augenblick, David. Du stehst der Liebe deines Lebens gegenüber. Mist. Kitschiger Nonsens! Aber sein Einspruch wirkt nicht. Im Gegenteil befällt ihn plötzlich die Angst, das Schicksal könnte ihn als zu leicht befinden und das Angebot zurückziehen …
Er schaut Sophia an: ein grüner Blick. Halt mich aus, sagt er. Klar ist ihr Gesicht. Sei ehrlich, fordert es. Ihr Mund ist schön. Meine Küsse sind nicht harmlos, macht er kund. Was bin ich für ein tumber Trottel, denkt er.
Aber das gnädige Schicksal hat offensichtlich den Entschluss gefasst, David zu erlösen. Es setzt ein Zeichen: Sophias Lippen zeigen ein Lächeln. Es beruht auf Sophias Einsicht, dass Sankt Nikolaus’ Chaos keinesfalls zufällig, sondern in der Absicht inszeniert wurde, dass sie diesen David kennenlernen soll. Im Übrigen riecht er gut. Und seine Stimme tut ihr wohl. Und sein Blick war eindeutig verwirrt. Sie lächelt und sagt:
»Das reine Chaos!«
David muss sich räuspern und deutet aufs Schaufenster:
»Dort drin?«
Sophia schüttelt den Kopf, aber sagt: »Ja, ich muss es zuhängen. Ist mir schleierhaft, wie das passieren konnte … Schön, dass du nicht mitgelacht hast.«
Sie wird rot, jedenfalls glaubt sie das zu spüren.
»Ach, ich könnte dir helfen. Ich meine, beim Zuhängen.«
Sophia zögert. Zu lächerlich! Seine Hilfe anzunehmen bedeutet doch nicht alle Welt! Warum kann sie die Vorstellung nicht verscheuchen, sie entscheide jetzt, ob sie ihn für immer in ihr Leben einlassen wolle …Was ist bloß mit mir los?
»Macht mir nichts aus, im Gegenteil«, bekräftigt David.
»Also, gehen wir! Mir macht es auch nichts aus«, lacht sie, von plötzlicher Heiterkeit erfasst, »im Gegenteil.« Und schnuppe ist mir, ob ich rot anlaufe, denkt sie.
Die Rayons des Erdgeschosses liegen bereits im Dunkeln. Die wenigen Nachtspots reißen harte Schlagschatten auf die Lauffläche zwischen den Korpussen. Sophia lotst David zum Aufzug. Aus den Gestellen der Papeterie taucht Pagano auf, der Nachtwächter. Alle lieben sie Enrique Pagano, dessen Musettes auf dem Akkordeon jedes Betriebsfest bei Bonnard zumindest musikalisch retten. Er spielt gut, aber er übt ja auch in vielen nächtlichen Dienststunden, geborgen zwischen Damenmänteln und Sportjacketts; Einbrecher wären zwar gewarnt, aber ihre kriminelle Energie könnte sich bei diesen herzergreifenden Tönen niemals entfalten …
Der Lichtstrahl seiner Stablampe wischt über ihre Schatten. Wie er Sophia erkennt, salutiert er mit pompöser Gebärde. Und weg ist er. Sie steigen in den Aufzug.
»Joshua! Es war wirklich eine Fahrt senkrecht in den siebten Himmel!«, wird es David fünfzehn Jahre später seinem Sohn schildern. Lachend wird er es sagen, weil Joshua, der dreizehnjährige Joshua, amüsant erzählte Geschichten bevorzugt, aber in Davids Herz wird schmerzhafte Wehmut sein.
»Ich kann mir dich gar nicht verliebt vorstellen«, wird Joshua zurückgeben, »ich stelle mir das peinlich vor.« Pein wird David heraushören und wird sich erinnern, dass es schön, aber auch peinigend gewesen war, weil er nicht fassen konnte, was ihm geschah.
Vier weitere Jahre später wird derselbe Joshua, nun siebzehnjährig, von Sophia in Bastide d’Anglois deren Version der Fahrt hören: »Ich sprach kein Wort, er keines. Auf meiner Stirn spürte ich seinen Atem, und ich dachte bei mir, dass die Liebe einen Atem hat. Es war alles zu mächtig für mich.« Dieses Mal wird es Joshua sein, den die Wehmut quält und der nach langem Nachsinnen sagen wird:
»Trotzdem hast du meinen Vater verlassen.« Sophia wird in langes Grübeln versinken, bis sie antworten wird:
»Vielleicht weil ich feige war. Weil mir meine Mutter tausendmal geschmeichelt hatte, wie vollkommen mein Gesicht sei. Vielleicht, weil ich Angst vor dem Schlimmsten hatte … Auch wegen Davids erster Frau, du weißt es ja. Aber vielleicht musste es sein, damit du, Joshua, auf die Welt kommen konntest!«
»Scheiß drauf«, wird Joshua sagen, um mit dieser Grobheit seiner Gefühle Herr zu werden.
Grell überfällt sie das Licht, wie sie aus dem dunklen Korridor ins Atelier treten. Spots an den Balken bestrahlen einen überlangen grünen Tisch. Am entfernten Ende der Platte thront pompös und blau ein meterhoher Osterhase und starrt ihnen entgegen.
»Ach, hab ich mir gedacht!«, grinst David.
»Was?«
»Dass du schon einen Freund hast! Und schön ist er auch!«
Sophia eilt am Tisch entlang zum Hasen. »Ich stelle euch einander vor«, ruft sie, legt den Arm um ihn und ihren Kopf an sein Riesenohr: »David, das ist Eduard, unter Freunden Edi, und, Edi, das ist David, mein …«, um anzuhängen, um tatsächlich anzuhängen: »… mein Mann.«
»Oh«, sagt David, zögert, murmelt: »Du bist mutig.«
»Verrückt.«
»Bist du nicht … Frau«, erwidert David.
Stumm stehen sie da, weit auseinander, zwischen ihnen die grüne Tischfläche übersät mit Folien und Papieren, Tuben, Stiften, Pinseln und Scheren … Schließlich murmelt Sophia mit Blick zum Hasen:
»Edi, verrate es mir. Ist der dort auch verrückt?«
»Frag doch mich!«, ruft David.
»Fragen? Dich? Was? Wo?«
»Alles! Auf halbem Weg!«
Sophia lacht. Einen Stuhl hinter sich her ziehend, bewegt sie sich auf David zu, der einen Hocker packt und ihr entgegenkommt.
»Da wären wir«, sagt er.
Sie berührt seine Hand, schweigt und überlegt –
»Das Aschenputtel. Der Teufel. Wieso hast du sie so genau betrachtet?«
»Berufskrankheit. Man beobachtet die Konkurrenz.«
Sophia guckt verblüfft. »Moment! Ach, David! Du bist David Amiesch vom Puppentheater am Stadtwall?«
»Der, ja. Die Leitpuppe.«
»Das muss ich erst verkraften. Du brauchst meine Köpfe nicht zu loben, ich hab das nie gelernt.«
»Deine sind besser als meine.«
»Nein.«
»Doch. Viel besser.«
»Meinetwegen. Glaube es trotzdem nicht. Dann frage ich dich: Bist du bescheiden?«
»Nicht wirklich. Auf meine Stücke bilde ich mir was ein, aber nicht auf die Puppen und Marionetten.«
»Aber du hast Erfolg, ich habe darüber gelesen … dein Weihnachtsspiel!«
»Erstaunlich! Wird schon Tradition, dass sie es am Vierundzwanzigsten bringen. Ein Puppenstück im Fernsehen als Quotenbringer, ich fasse es immer noch nicht.«
»Ich habe nur gelesen, dass du die Geschichte – Kleine Mär im Advent, gell? – ganz anders erzählst. Sehr provokativ. Aber gesehen hab ich es nicht.«
»Ach, du bist die, die immer abschaltet.«
»Was ist mit den drei Weisen? Sie raten dem Kind ab, der Messias zu sein?«
»Ja, sind eben weise. Nächste Frage bitte …« In Davids Mimik zeigt sich Unbehagen. Ob es ihm peinlich ist, dass sein Erfolg als Erstes aufs Tapet gekommen ist? Aber wenn ihm das Thema unangenehm ist, dann – Sophia gibt sich einen Ruck.
»Jetzt wird es ernst«, sagt sie. »Bist du verheiratet oder sonstwie verbandelt?«
»Nicht mehr«, sagt David.
»Mmh, geschieden?«
»Meine Frau ist gestorben.«
Um Mitternacht weiß Sophia einiges. Dass seine Frau vor vier Jahren an Leukämie gestorben ist. Dass er sie während acht Monaten gepflegt hat. Dass er keine Freundin hat. Dass er, wann immer er weg kann, im Languedoc ein Einsiedlerleben führt und eine Ruine renoviert. Dass er gerne kocht. Panik davor hat, dereinst eine Brille tragen zu müssen. Zweimal bei einer Prostituierten war! Davon träumt, ein Theaterstück, ein richtiges Stück für richtige Schauspieler, zu schreiben. Dass er zweiunddreißig ist.
Aber eigentlich hat sie noch mehr erfahren, nämlich das, was sie spürte: seinen Humor, federleicht, weil ohne Sarkasmus! Nirgends eine Spur von Besserwisserei. Die Ernsthaftigkeit, mit der er sich seinen widersprüchlichen Wesenszügen stellt. Dass er die Menschen mag, lieber gibt als nimmt. Und dass er aus einer sinnlichen Mischung von Melancholie und Lebenslust besteht. Letzteres entzückt sie …
Im Übrigen ist er schlank, fast hager. Seinem Gesicht gibt das entschlossene Konturen, verstärkt durch klar gezogene Brauen. Ein leichter Schwung läuft über seine Nase. Seine Lippen wirken weich, wenn sie ruhen, aber fest, wenn sie Silben formen. Sophia befindet, dieser Mund müsse eine Folge seiner angenehmen Stimme sein, die seinen Lippen diese reizvolle Konsistenz einmassiert hätte.
Unvermittelt erinnert sie sich an die Plane, die zu holen sie hierher gekommen waren. Sie möchte das Fenster unbedingt noch diese Nacht verhängen, sagt sie David.
»Ich könnte es für dich machen, damit du das Desaster nicht nochmals anschauen musst«, erwidert er. Sie wehrt ab. Aber erledigen möchte sie es gerne sogleich. Aufstehend ruft sie dem Hasen zu: »Und dann darf er mich verhören, gell, Edi?«
Erst als die Tücher gespannt sind, knipst sie die mitgebrachte Spotlampe an und lässt sich neben dem Teufel nieder. Der steht, als sei nichts gewesen. Im märchenhaften Bühnenbild wirken die zerfetzten Figuren umso massakrierter. Abgeschlachtet liegen sie herum. Es sind nur Puppen, besänftigt sie sich und nimmt das Aschenputtel auf den Schoß. Dessen einst belebte Mimik mutet jetzt maskiert an. David setzt sich neben sie. Unter Paketen zieht er den Hänsel hervor, setzt ihn sich aufs Knie, pustet ihm Sägemehl vom Wams und studiert sein Gesicht. Kein Wort fällt. Man könnte meinen, nicht nur David und Sophia, sondern auch Hänsel und Aschenputtel schwiegen. Einige Minuten verstreichen. Da dreht Hänsel, von Davids Hand geführt, seinen Kopf zu Aschenputtel und spricht mit der von David geliehenen Stimme:
»Das war brutal. Aschenputtel? Hörst du mich? Lebst du noch?«
Ob sie Davids Animation rührt oder erschreckt? Sophia weiß es nicht. Jedenfalls scheut sie davor zurück, auf sein Spiel einzugehen. Die Zerstörung bedrückt sie zutiefst. Unzählige Stunden hat sie an den Figuren gearbeitet. Aber das ist es gar nicht! Es ist die Zerstörung, die hier um ihrer selbst willen triumphiert hat. In dieser zermalmten Miniaturwelt spiegelt sich, was sie an der großen Welt ängstigt: Gewalt gegen das Leben, Lieblosigkeit allüberall … Wie sich die Menge ergötzte! Aber er nicht, David nicht! Stand mit Tränen da. Und wie zärtlich er den Hänsel zum Leben erweckt. Der ist mittlerweile von Davids Knien gerutscht und neigt sich teilnahmsvoll dem Aschenputtel entgegen.
»Sag was, Aschenputtel! Bist du schlimm verletzt?« Dabei deutet er auf den aufgerissenen Leib. Jetzt gelingt Sophia der Einstieg. Sie lässt Aschenputtel zusammensinken.
»Au, auuu! Fast wäre ich gestorben! Aber ich will nicht klagen. Das Schneewittchen! Schau! Den vergifteten Kamm hat es überlebt, aber jetzt ist sein Kopf ab!«, klagt Sophias Stimme für die Puppe.
»Schrecklich! Der Hexe hätte ich es ja gegönnt. So ungerecht geht’s zu in der Welt, zum Verzweifeln. Aber deine Wunde, Aschenputtel, die braucht Behandlung! Warte mal …« – David gibt dem Hänsel die Schleife eines Pakets in die Hand –, »da, ein Verband! Lass mich, das hilft. Musst fest dran glauben, dann tut es gut.«
»Oh! Ah! Danke! Wie wohl mir das tut! Ein Doktor bist du ja!«
»Bin ich nicht! Auch kein Prinz! Weiß schon, dass da einer ist! Wird dir schöne Kleider schenken und schöne Schuhe. Kann ich nicht. Bin arm.«
»Schäm dich, Hänsel, so von mir zu denken. Darauf schaue ich nicht. Auf ganz anderes kommt’s mir an.«
Davids Stimme gibt Hänsels Skepsis wieder: »Man weiß ja nie. Hab bis heut eher das Gegenteil erfahren.«
»Dann frag mich doch, David … Hänsel, mein ich, wenn du wissen willst, wie ich es mit den Prinzen halte. Brauchst mir nichts unterzuschieben!«
»Also gut. Sei’s drum. Fragen will ich gern.«
David bettet die Figur auf seinen Schoß, blickt Sophia an und fragt mit normaler Stimme:
»Wie also steht es mit den Prinzen in deinem Leben, Sophia?«
»Nur kleine!« – sie weist sie auf die Figur vor dem Dornengestrüpp –, »wie den da. Aber einmal hatte ich wirklich einen aus dem Adel. Am Bombardement seiner Briefe und Geschenke gemessen war er leidenschaftlich in mich verliebt. In München, da bin ich aufgewachsen. Neunzehn war ich. Meine Mutter war ganz begeistert und ich zumindest geschmeichelt. In allem war er schnell. Wie er redete, wie er sein Cabrio fuhr, und kaum hatte er von mir gehört, dass ich ab und zu einige Ferientage bei Verwandten in Montresa verbrachte, kaufte er sich dort ein luxuriöses Chalet. Sieben Schlaf-, sieben Badezimmer. Für mich als sein Schneewittchen. Es war ja auch sein siebter Wohnsitz! Und wir kannten uns gerade mal zwei Monate. Im Wirbel, den er verursachte, wurde ich einfach mitgerissen. Partys, Amüsement, dahin, dorthin. Er war auch wirklich lustig! Stellte mich seiner Familie vor, mit allem Drum und Dran. Sein Vater gestand mir, seinen Sohn noch nie so glücklich gesehen zu haben. Achtundzwanzig war er, sprach davon, dass er jetzt eine Familie gründen und Kinder haben wolle, und nach fünf Monaten machte er mir tatsächlich einen Heiratsantrag. Ich wich aus, aber war doch sehr beeindruckt, im Übrigen auch deswegen, weil er mich nie bedrängte, mit ihm zu schlafen.«
Sophia überlegt, ob sie noch mehr erzählen soll, aber sie endet knapp: »Dann machte ich Schluss.«
»Du? Warum? Ganz plötzlich?«
»Weil ich eine Mimose bin, deshalb!«
»Ich weiß von Mimosen nur, dass sie keine Dornen haben, um sich zu schützen.«
»Willst du es wirklich wissen? Eigentlich ging es um eine Bagatelle. Er erwischte im Rinnstein eine Pfütze und bespritzte eine ältere Frau auf dem Gehsteig. Die war auffallend klein gewachsen.«
»Du meinst, er fuhr absichtlich in die Pfütze?«, fragt David.
»Nein, das nicht. Aber er blickte in den Rückspiegel und sagte: ›Da hilft auch Begießen nicht, die bleibt klein.‹«
David hat wieder die Szene vor Augen, wie sie ihn inmitten schadenfroher Zuschauer außer sich vor Empörung angeschrien hatte: »So lachen Sie doch auch!« Deine Radikalität, Sophia, wie mich die anzieht. Empfindsam und verbindlich, wie du bist …
Er hört Sophia sagen: »Das hätte ich dir nicht erzählen sollen. Ich bin einfach überempfindlich. So kann man nicht leben, nicht in der Wirklichkeit.«
»Man könnte … wir könnten es trotzdem versuchen.«
»Nein, ich war so überheblich. Ich bin nicht stolz auf mich. Er meinte das ja nicht böse, witzig wollte er sein, es rutschte ihm bloß mal so raus. Aber ich ertrug es einfach nicht. Nicht von dem Menschen, dem ich ein Leben lang verbunden sein würde.«
David schaut Sophia an, als ob sie ihm ein Versprechen gegeben hätte. Dieser kleine braune Fleck beim Ohr! Noch gar nicht bemerkt. Deine Verletzlichkeit …
»Schau mich nicht so an!«, begehrt sie auf.
»Gilt das Verbot ab sofort?«
»Ach, komm! Du weißt schon! Was siehst du überhaupt?«
»Uns«, sagt David.
Schritte eines Spätheimkehrers oder Frühaufstehers hallen aus den Arkaden hinter der verhängten Scheibe; es schlägt zwei Uhr.
»Uns«, hatte David gesagt, und Sophia überlegt, warum ihr dieses waghalsige uns so angemessen vorkam und woher ihre Gewissheit kommt, David immer schon gekannt, nur nicht von ihm gewusst zu haben.
In den nächsten Tagen stürzen sie aufeinander zu. Die Tage sind endlos lang, weil beide ignorieren, dass ein Tag mit Nacht nur vierundzwanzig Stunden umfasst. Sie wandern durch ihre Vergangenheit, tanzen durch ihre Gegenwart, schweben durch ihre Zukunft. Ein Mann, eine Frau, die Liebe.
David hilft Sophia, die Märchenwelt des Schaufensters wieder auferstehen zu lassen. Und Sophia kommt nicht aus dem Lachen heraus, wie sie Davids widerspenstigen Daumen beobachtet, der missmutig abgespreizt jede Unterstützung beim Zunähen von Nikolaus’ wieder schön gerundetem Bauch verweigert.
»Er kann nichts dafür«, verteidigt ihn David, »er kriegte zu wenig Liebe. Man verbot mir, ihn in den Mund zu stecken.«
»Schlimm, der arme Daumen.« Ihr Bedauern ertrinkt in einem neuerlichen Lachanfall, bis sie es wagt, sich auf Davids Schoß zu setzen – es ist das erste Mal, dass sie das tut –, seine Hand zum Mund führt und den Daumen verschlingt. Es dauert nur Sekunden, bis sie wieder aufspringt.
Kurz danach öffnet sie ihm ihr Mädchenzimmer in München, in dem sie daumenlutschend wach lag, gepeinigt von Todesangst, weil auf einem Röntgenbild ihrer Lunge nicht erklärbare Schatten entdeckt worden waren. Vierzehn war sie. Lange Winterwochen über fand sie bis in die Morgenstunden keinen Schlaf. Häufig setzte sie sich ans Fenster, das auf einen Innenhof ging, und zwang sich zu Einträgen ins Tagebuch. Auch Gedichte schrieb sie. Aber wenn sie sich selbstbeobachtend wahrnahm, wie sie da saß und sinnend am Stift knabberte, das in die Schwärze der Nacht weisende Fenster vor sich, wuchs das Gefühl von Verlassenheit ins Unerträgliche und sie flüchtete zurück ins Bett. Nur einen Trost gab es, und den entdeckte sie erst gegen Frühjahr. Öffnete sie das Fenster, schwebten in der Morgendämmerung semmelweiche Düfte aus der Backstube der Bäckerei gegenüber zu ihr hinauf. Dann endlich schlummerte sie ein und verschlief, denn Sarah, ihre Mutter, ging früh aus dem Haus.
»Wusste Sarah von deinen Nächten?«, fragt David.
»Meine tüchtige ehrgeizige Mutter? Meine reibungslos funktionierende Mutter? Die Ärzte hatten ja gesagt, wir sollten uns keine Sorgen machen! Man müsse das beobachten, eine akute Bedrohung sei allerdings gegeben! Weißt du, David, mit zwölf hatte ich mir mal boshaft zusammengereimt, dass allein erziehend, wie meine Mutter ja war, wohl meinte, das Kind möglichst allein zu lassen …«
Auf einem späteren Röntgenbild war plötzlich nichts mehr zu sehen. Sie war zwar erleichtert, aber auch enttäuscht, denn ihre Ängste waren zum idealen Nährboden geworden für schwermütige Fantasien über ihr tragisches Schicksal. Ein Bild zog sie magisch an: Sie lag bleich und bildschön auf dem Sterbebett, da ging die Tür auf und ihr unbekannter Vater trat hinzu, auch er schön, aber blass vor Reue. Nun war sie gesund, nichts von Bedeutung war gewesen, die Ängste im Rückblick nur melodramatisch. Das Schicksal hatte ihr sozusagen die besondere Wendung verweigert. Zwei Jahre lang streunte sie herum, mehr eine verwilderte Katze denn eine junge Frau. Aber eigentlich fühlte sie sich als Indianerin, von üblen Mächten in die Mauern der Stadt verbannt; sie trug Trauer, als drei demonstrierende Sioux nach wochenlangen Scharmützeln um Wounded Knee von Soldaten niedergeschossen wurden. Dann lief im Palace am Marienplatz Einer flog übers Kuckucksnest: In Zeitlupe durchbricht der Indianer die Mauer in die Freiheit.
»Ich saß zehnmal in diesem Film, und jedes Mal, wenn ich herauskam, fühlte ich mich ein Stück erwachsener. Wie der würde ich sein. Nichts und niemand würde verhindern können, dass ich frei würde. Ich müsste bloß wollen! Ich war wie verwandelt. Weißt du, was ich dann tat?«
»Du hast dir ein Ziel gesucht. Oder hattest du insgeheim schon eines?«
»Hundert Punkte für dich! Ja, ich setzte mir ein Ziel. Zum Theater als Bühnenbildnerin. Und ich setzte mich hin und lernte wie besessen.«
»Du willensstarkes Monster!« David grinst.
»Ich glaube, das bin ich. Macht es dir Kummer?«
»Ja. Nein. Ja, doch. Ich weiß es nicht. Ich bin nun mal viel langsamer als du.«
»Ja, das bist du«, meint Sophia und wiederholt es leise, als ob sie die einzelnen Silben überprüfen müsste. Sie schaut auf die Uhr: zehn Minuten vor zwölf. Dann legt sie ihre Arme um seinen Hals und küsst David, küsst ihn zum ersten Mal verlangend und hört erst auf, als Mitternacht erreicht ist – vom zehnten Tag ihrer Liebe.
Wieder ist Mitternacht vorbei, als sie eine Woche später das Atelier im Dachstock verlassen und in den Aufzug steigen. Ein Schild preist die neu eröffnete Ausstellung im zweiten Stockwerk: Wohnlandschaften zum Träumen.
»Lass uns da aussteigen«, sagt Sophia.
»Wo?«
»Bei den Träumen!«
»Ja, Fee!« David drückt den Zweiten.
Sie stoßen auf Pagano, der auf einem Salontischchen seinen Imbiss ausgebreitet hat und ihnen kauend zuzwinkert. Um ja keine Spuren zu hinterlassen, hat er Nostrano, Birnen, Brot und Messer mit einem Tüchlein unterlegt.
»Von der Liebe allein werde ich nicht satt, so wie ihr!«, strahlt er ohne jegliche Anzüglichkeit und blickt verzückt auf die vorm Mund bereite Salamischeibe:
»Aber ihr kriegt schon was, ich bin kein Unmensch.« David und Sophia mögen ihn als Mitverschworenen ihrer langen Nächte oben im Dachstock. Natürlich hatte er mitbekommen, dass sie häufig bis in die Morgenstunden blieben – David malte an Hintergründen für ein neues Stück, Sophia an Rieseneiern. Einige Male hatte er ihnen belegte Brote und Getränke gebracht und zugeschaut. Und erst letztes Mal, beim Aufbruch zu seinem Rundgang, hatte er gleichsam seinen Segen gesprochen: »Fleißiges Paar, gutes Paar. Alles Glück euch!«
Er teilt eine Birne und streckt ihnen die Hälften hin:
»Gleich bin ich fertig, und ihr könnt euch in diesen Wohnträumen neu einrichten, bei so vielen Überstunden reicht’s sicher bald. Finito Nostrano mio.«
Wie sich seine Falten zum Schmunzeln bündeln …
Sophia und David schlendern durch die Ausstellung. Im spärlichen Nachtlicht hocken die Sofas und Sessel fettleibig da. Umso genüsslicher ist es, sich in die Polsterungen zu werfen. Sie bereden gespielt ernsthaft, welche Anschaffungen für den gemeinsamen Hausstand vonnöten seien. David verteidigt mit Vehemenz seinen »Favoriten«, ein mit beigem Velours bezogenes Monster:
»Wenn ich Karriere machen will, muss ich auch zu Hause etwas darstellen.« Sophia muss ihm wohl oder übel Recht geben – und kontert mit scheinheiliger Begeisterung für die verspiegelte Bar in der Wohnwand: »Gastfreundschaft misst sich an der Auswahl der Liqueurs.«
Bei den Betten schwärmt David für die Bettstatt mit Messingumrandung, Sophia plädiert für Holz, ausschließlich Holz.
»Im Übrigen will ich sowieso mein eigenes Bett.« Sophias Tonfall verrät, dass diese Bemerkung nicht zum Spiel gehört.
»Ernsthaft? Immer?« Auch David lässt seine Rolle fallen.
»Nicht immer, aber manchmal werde ich allein sein wollen.«
»Verstehe«, murmelt er. Da ist sie wieder, die Erinnerung an die schmerzhaften Nächte an der Seite seiner todkranken Frau. In den langen Monaten, bevor sie in die Klinik kam, waren sie beide zu dahinvegetierenden Wesen verkümmert. Seine Frau schlief wenig und schlecht, und wenn sie schließlich wegdämmerte, verharrte er selber oft stundenlang in einem diffusen Zustand, dösend und doch wach, weil er auf ihren Atem und ihre Bewegungen achtete. Wie hatte er sich nach einem eigenen Bett in einem eigenen Raum gesehnt, aber nur schon, sich diesen Wunsch einzugestehen, wäre ihm als Verrat vorgekommen.
»Verstimmt? Habe ich dich …?« Sophia sucht seine Hand.
Er beginnt zu erzählen. Eine Laterne, direkt vorm Fenster an einem die Gasse überspannenden Drahtseil befestigt, beleuchtet sein Gesicht. Sophia weiß einiges über jene Zeit, die fünf Jahre zurückliegt: vom Verlauf der Krankheit, von Tagen der hoffnungsvollen Befunde und solchen der niederschmetternden. Aber es war eher ein Stenogramm der Krankengeschichte gewesen. Jetzt redet er von sich. Davon, wie klein er geworden war. Davon, im Glauben zu leben, versagt zu haben. Dass er Mühe hatte, den körperlichen Verfall seiner Frau zu ertragen, und dass er sich dessen schämte. Dass sein Mitfühlen gegen Ende hin zu einem bloßen Reflex verkümmerte, gesteuert vom Willen, die Katastrophe mit Anstand hinter sich zu bringen.
Lange schaut sie ihn schweigend an. Der Schatten seiner Nase flackert auf der Wange, weil sich die Laterne vorm Fenster im Wind bewegt.
»Danke, dass du mir das erzählst«, sagt sie. »Du brauchst mir nicht zu versprechen, ein Held zu sein.« Sie kramt einen Schokoriegel aus der Jacke und teilt ihn. Stumm essen sie.
»Ich war mal dick. Als ich an der Mappe für die Kunstschule arbeitete. Zeichnen war gleichbedeutend mit Riegel mampfen. Kommst du mit? Ich will dir etwas zeigen.«
Sie lotst ihn in den vierten Stock. Eine sirrende Erregung hat sie gepackt. So nah fühlt sie sich ihm, dass ihr die Luft schwer und schwül vorkommt. Plötzlich ist das Nachtlicht von Flüstereien und Ahnungen durchzogen. Zeit, Liebe, Zeit. Held, Zeit. Aber wie sie dem Aufzug entsteigen, mutiert das Flüstern zum hintergründigen Kichern: eine romantische Hochzeit empfängt sie, gegeben von zwei Schaufensterpuppen mit makellosen, aber starren Visagen. Er im Frack, sie in Tüll und Taft. Verwunderlich, dass keine Hochzeitsgesellschaft zugegen ist. Was jedoch nicht fehlt, ist die dreistöckige Festtorte aus Plastik, präsentiert auf einer korinthischen Säule aus Styropor, obenauf als zuckerne Miniaturen das Brautpaar. Als Sophia in ihrem Fundus zufällig Torte und Säule entdeckt und dem Paar beigestellt hatte, geriet die Modistin des Mode-Rayons in Rage und verwahrte sich wütend dagegen, dass sie, Sophia, »immer und alles mit hämischer Ironie begösse, nur weil sie keine Romantik ertrage«. Aber Patron François Bonnard, zur Schlichtung beigezogen, hatte Sophia zugezwinkert, um anschließend die Modistin vom herzerweichenden Zusatznutzen der Torte zu überzeugen.
Im Lift malt sich Sophia aus, wie spöttisch David auf den Kitsch reagieren wird. Aber er sagt nüchtern:
»Einen Frack? Nie! Aber die Torte darf ruhig fünfstöckig sein.« Kein Zweifel, er meint es ernst. Und schlagartig erscheint ihr seine Bemerkung nur zwingend: Die Wohnung ist eingerichtet, also planen sie die Hochzeit. Sicherheitshalber erkundigt sie sich:
»Welche Torte?«
»Unsere Torte!« David schaut sich um. »Ich möchte einen blauen Blazer aus fein geripptem Manchester.«
»Und ich ein Kleid aus indischer Seide!«
»Passen wir so zusammen?«
»Eher nicht«, meint Sophia.
»Dann passe ich mich an!«
»Nein, ich passe mich an.« Sophia lacht.
»Dir passt nur nicht, dass ich mich anpasse. Tue ich aber, ob es dir passt oder nicht, verdammt noch mal!«, insistiert er.
Sophia schiebt ihm die Hände auf die Schultern, als Zeichen, dass sie das Spiel abbrechen will.
»Glaubst du, dass wir mal so streiten werden?«
»Klar. Aber nicht so. Anders.«
»Wie anders?«
»Verschlungener. Ein Knäuel, das sich in sich selbst verwickelt. Parthenogenetisch, sozusagen.« Davids Gesicht gibt sich allwissend.
»Ah! Genau! Und was heißt das?«
»Wenn man mit sich selbst schläft, sich selbst befruchtet.«
»Das gibt es?«
»Ja. Irgendwie furchterregend. Das heißt, wir streiten gegen uns selbst, stelle ich mir vor.«
»Ich will aber gegen dich streiten!« Sophia drängt sich an ihn, ganz nahe ist ihr Gesicht. »Und mit dir schlafen.« Sie haucht auf Davids Lippen, als ob sie sie aufwärmte, um sie gleich besser küssen zu können. Die erste Berührung ist bloß ein Stippen gegen seine Zurückhaltung, die sie in Kürze verscheuchen wird … Ein kleiner Biss in seine Unterlippe gesetzt und sie stürzen in einen endgültigen Kuss, innig schamlos, trunken und süchtig. Kein Atmen, kein Denken. Nur Küssen. Erregend und ewig. Es gibt keinen Grund, anzunehmen, dass die einzigen Zeugen, die Puppe im Frack und die Frau im Taft, auch nur ihre Mienen verzogen hätten.
Wie sie sich voneinander lösen, taucht Sophia in eine dunkle Passage ab. Sie kommt zu Herrenkleidern. Befühlt Stoffe. Glaubt, sich beruhigen zu müssen. Rupft einen Blazer vom Bügel, tastet nach dem Schild. Und preist aus dem Dunkeln ihren Fund an:
»Hier! Ich hab deinen Blazer. Achthundert!«
»Wir müssen sparen«, ruft David zurück. »Kinder sind teuer.«
Er hört sie lachen. Und aus dem Dunkeln ihr entschlossener Zuruf:
»Laura und Joshua!«
»Was?«
»So heißen meine Kinder!« Sophia taucht wieder auf. »Ich meine die ersten beiden. Bei drei und vier kommst du zum Zug bei den Namen.«
David schlüpft in die Rolle eines Mannes, den nichts zu erschüttern vermag: »Vier! Gut, scheint mir angemessen. Ruinös, doch angemessen. Aber Joshua? Nein, zu biblisch. Das tun wir dem Knaben nicht an!«
»Bitte!«, sagt Sophia. »Joshua muss sein!«
Herumstreunen. Ein anderes Stockwerk. Die Campingabteilung. Auf einem grünen Kunstrasen ist ein Zelt aufgebaut. Von weit weg hören sie, wie Pagano übermütige Triller in schwermütige Klänge webt. Ums Zelt herum ist alles wie in Wirklichkeit, bis zur hölzernen Kelle im Pfännchen auf dem Gaskocher. Die Eingangsplane des Zeltes ist zurückgebunden, das Lager zubereitet aus Schaumstoffmatten und Schlafsäcken.
»Zelten? Nichts für mich«, murmelt Sophia. Die Anspannung in ihrer um Nuancen raueren Stimme überträgt sich sogleich auf David. Noch ist geheim, was soeben wortlos geklärt wurde. Er zieht sie ins Zelt. Noch während sie auf den Schaumstoff sinken, befällt sie beide drängendes Verlangen – schließlich konnten sie nicht ahnen, dass jener lüsterne Geist hier auf sie gewartet hat. Sie umschlingen sich, küssen sich, packen und fassen sich so lustvoll, wie es ihre jählings schamlosen Hände nur vermögen. Dass David so unerwartet seine Zurückhaltung abgelegt hat: wie erregend für Sophia! Dass er sein hartes Geschlecht gegen ihren Schoß drängt: nur köstlich! Wie fest sich seine Schultern anfühlen. Wie rund seine Pobacken. Krallen wünscht sie sich … Er soll so gierig sein, wie er will, nichts wird sie erschrecken, sie will alles und will ihn jetzt. Später, erst später möchte sie den Spuren ihrer Hände folgen, jede Faser seiner Haut entdecken können. Aber jetzt will sie nur seinen erhitzten Körper auf sich und seine Lust in sich.
Sie zerrt ihn aus Jacke und Hemd, ohne seinen Mund freizugeben, saugt sich noch fester an Lippen und Zunge. Lässt ihn nur frei, um ihm die Hosen von den Schenkeln zu ziehen und über die Füße zu rupfen. Sie beißt ihn in die große Zehe. Erst beim Abstreifen seines Slips nimmt sie sich mehr Zeit, weil es sie verlangt, die Vorfreude noch zu steigern, ihn zur Gänze nackt und sein Glied entblößt zu sehen. Gerade und fest ragt es im Halbdunkel aus den Schamhaaren, und hart schlägt er gegen ihren jeansbespannten Schoß, als sie sich auf ihn wirft. Bluse und BH hat sie sich weggerissen. Dieses Gefühl! Diese wunderbare Hitze aus seiner festen Brust an ihren Brüsten! Sie wühlt seinen Mund auf mit küssenden und beißenden Lippen, und David umschlingt sie endgültiger. Er schmeckt ihr! Ganz verrückt macht sie sein Geruch! Hundert gleichzeitige Hände hat er. Die schlingern durch ihre Haare, streicheln ihren Rücken, greifen um ihre Backen, die der Stoff straff nachformt. Dafür setzt sie jetzt ihre Bisse überall hin, auf Schultern, in die Kuhle des Schlüsselbeins, in seinen Hals. Sie schnuppert wie ein erregtes Tier nach einer Beute. Zurück an seinem Mund, frisst sie ihm sein Stöhnen weg und David, der dafür und dagegen irgendetwas tun muss, setzt klatschende Schläge auf ihren Po.
Schließlich grätscht Sophia über ihn und gerät in einen Taumel, überflutet von verzögerten flackernden Bildern. Ihre Hände, die seine Brust kratzen. Ihre Haarsträhne, die sich über Davids Stirn kringelt. Eingefroren bleiben einzelne Eindrücke hängen, als widersetzten sie sich der Verschmelzung mit dem nächsten Bild. Seine Eichel, die glänzend aus ihren umrundenden Fingern stößt. Ihre Brustwarze zwischen seinen kosenden Fingerkuppen.
Irgendwann ist David über ihr und zieht ihr Jeans und Slip fort. Ein Sekundenbild – der Schimmer auf den Zauberlippen – bleibt unter seinen Lidern hängen und blendet sich auch über die nachdrängenden Eindrücke. Sie zieht ihn zu sich hinunter. Er kommt in sie, dringt langsam ein, kommt noch tiefer, und fast zeitgleich werden sie ruhig. Ihre keuchenden Atemstöße. Sie horchen auf. Pagano übt an melancholischen Akkorden, deren letzter dunkel und lang gezogen ausklingt. Nochmals setzt er an, und nochmals. Sophia vermeint plötzlich, das Schnaufen des Blasebalgs zu hören. Ihre Lust hat die Farbe gewechselt. Aus grellem Gelb und Orange ist sie zu schwerem Rot geronnen.
Davids Küsse sind so weich und träge, wie er sich in ihr bewegt. Gleichmäßige Stöße in Zeitlupe ohne spürbaren Übergang vom Hinaus zum Hinein. Jeder macht ihre Lust noch schwerer. Das ist wunderbar! Das hat sie noch nie erfahren. Diese Wonne, diese sinnliche Gewissheit, dass jede Zelle ihres Körpers gefüllt ist von Lust, bereit, sich bei der kleinsten Erschütterung zu ergießen.
David hat seine Hände an ihre Schläfen gelegt. Küsst ihre Lider, wartet, küsst sie wieder, ihre Augen zu verführen, sich zu öffnen und seinen Blick aufzunehmen. Sie lässt ihn warten, weil ihr der Gegensatz so lustvoll vorkommt zwischen der kitzelnden Leichtigkeit seiner Küsse und der schweren Fülle in ihrem Schoß und weil sie sich in diesem Augenblick innig geliebt fühlt wie noch nie in ihrem Leben. Sie könnte auch weinen. Du. Mit dir fallen, fallen … Was bin ich schwer und gierig und sehnsüchtig. Ob ich dir zu schwer bin?, denkt David; seine Bewegungen werden noch langsamer. Da hört er Sophia:
»Hör nicht auf, hör nie auf.«
»Ich liebe dich, Sophia. Ist es gut für dich?«
»Du tust mir sündhaft wohl«, flüstert sie.
Es endet in einem Rausch, in einem Sprudel irrlichternder Empfindungen – Minuten hemmungslos süßer Zumutungen, in denen Sehnsucht und Gier ineinander fließen. Und daran werden sie sich später beide erinnern können: Alles war wahr. Alles war Lust. Sophias reitender Schoß auf seinem Geschlecht. Davids harte Hände an ihren Brüsten. Nichts war mehr harmlos. Nicht ihre reißenden Nägel auf seinen Schultern, nicht Davids Schrei, als sein Samen hinausschießt, Sophia zusammensinkt und mit süchtiger Zunge den Schweiß von seiner Brust leckt, um dann mit wühlendem Haarschopf den Speichel zu trocknen. Wenn das kein Beweis ist, dass … wenn das endlos nachrieselnde wohlige Schaudern nicht Zeichen dafür ist, dass alles …
Pagano wird irgendwo durch eine Etage ziehen, jedenfalls ist seine Musik verstummt. Die Welt meldet sich zurück. In der Gasse scheppert ein Abfallkübel. Ein Auto surrt vorbei.
»Komm mit, ich möchte mit dir einschlafen. Komm mit zu mir!«
»Es geht nicht, ich habe einen Arbeitstag.«
»Es muss gehen, Sophia.«
»Ich weiß. Ich komme mit.«
Auf der Fahrt zu Davids Wohnung, an ihn gelehnt, der schweigend fährt, nötigen die vorauseilenden Gedanken Sophia, sich auszumalen, was gleich sein wird. Wie sie an Davids Bett stehen und sich ausziehen werden, wie sie ihn betrachten wird, wie sie nackt unter die Decke schlüpfen und wie sie … Sie nickt ein. Wie er sie vor dem Haus weckt, merkt sie, dass die Müdigkeit mittlerweile ihren ganzen Körper durchdrungen hat und so schnell nicht mehr weichen wird.
In der Unterwäsche schlüpft sie unter die Decke. Davids warmer Körper gleitet hinzu. Er zieht die Decke über ihre nackten Schultern, setzt Küsse in ihr Haar und sie kuschelt sich an seine Schulter. Dann lässt sie sich fallen und schläft ein.
Wie sie erwacht, schläft er noch, bäuchlings und das Gesicht im Kissen geborgen. Sie steht auf, vermeidet sorgsam jedes Geräusch und geht in die Küche. Sie kennt die Wohnung. Sie mag sie, obwohl sie seine Manie, die Requisiten auf Möbeln und Ablagen in schnurgerade Reihen zu stellen, insgeheim wunderlich findet – eine Manie, zu der sie in seinem Wesen keine Entsprechung findet. Sie macht sich einen Tee. Dann ruft sie bei Bonnard an und meldet sich krank, wobei sie genau spürt, dass man ihr nicht glaubt; nichts könnte ihr gleichgültiger sein. Sie tätigt sofort einen zweiten Anruf, den ersten gibt es bereits nicht mehr. Es ist ihr Reisebüro. Ob es morgen einen Flug nach – sie überlegt erst jetzt – nach Florenz, nein – alle Romantik dieser Erde will ich – doch besser nach Venedig gäbe. Ja, für zwei Personen, ja Hotel auch. Sie bucht. Als sie einhängt, steht David nackt auf der Schwelle.
»Mit wem fliegst du?«
In seiner Schlaftrunkenheit misslingt ihm der ironische Ausdruck, mit dem er seine Mimik ausstaffieren wollte. Es wirkt nur unbeholfen. Sie muss lachen: »Mit dem besten Mann von allen.«
»Schade«, sagt er ernsthaft, »ich wäre gerne mitgekommen.«
Als sie in Venedig ankommen, hängen die Wolken tief über der Lagune.
Kälbchen
Im August, wenn der Himmel wochenlang wolkenlos bleibt, verbrennt allmächtig die Sonne die Weiden und das Buschwerk der Hecken. Kein Gewölk, kein Wind, nur Hitze. Tag für Tag werden die Wiesen noch gelber und die Sträucher noch dürrer. Die Leutsche, die noch an Pfingsten den Bodmersteg ins Tal reißen wollte, ist zum Rinnsal verkommen. Kleine Tümpel im Bachbett bleiben sich selbst überlassen, ihr Wasser verdunstet. Zwei Kühe liegen träge wiederkäuend im Schatten des Stegs: beglotzen ungerührt einen zuckenden Winzling, der sich auf den austrocknenden Steinen zu Tode zappelt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!