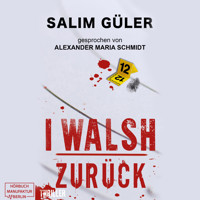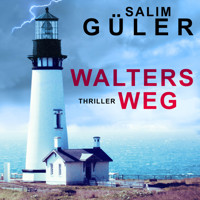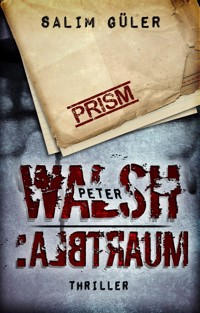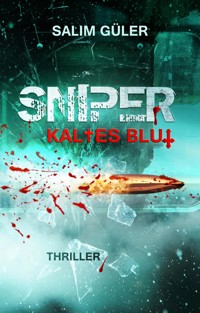2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Du bist wie eine Rose, meine Prinzessin, deine Dornen sind voller Gift. Ich aber bin nur an deinen Blüten interessiert.«
Während ganz Deutschland in den Weihnachtsvorbereitungen steckt, erschüttern brutale Morde die Stadt Köln.
Ein psychopathischer Mörder bringt junge blonde Frauen um, indem er sie skalpiert und enthäutet.
Kann die Kölner Kripo um Lasse Brandt den Mörder schnappen oder wird es für weitere junge Frauen eine tödliche Weihnacht geben?
Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt ...
Bisher erschienene Köln-Krimis:
Fall 1: Die Stillen müsst ihr fürchten - Tatort Köln
Fall 2: Fürchte die Nacht - Tatort Köln
Fall 3: Dann war Stille - Tatort Köln
Fall 4: Wenn Tote nicht schweigen - Tatort Köln
Fall 5: Sterben ohne Tod - Ein Köln - Lübeck Krimi
Fall 6: NIEMAND - Tatort Köln
Alle Tatort Köln Krimis sind in sich abgeschlossen und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Kontakt:
facebook.com/salimgueler.autor
salim-gueler.de
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
SALIM GÜLER
Fürchte die Nacht
– Tatort Köln: Krimi
1. Auflage Dez 2015
Autor: Salim Güler
Lektorat: Christiane Saathoff, www.lektorat-saathoff.de
Covergestaltung: Irina Bolgert
Erstveröffentlichung: 2015 als E-Book
Copyright © 2015 by Salim Güler
INHALTSVERZEICHNIS:
INHALTSVERZEICHNIS:
Das Buch
Der Autor
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Eine Bitte
Das Buch
Während ganz Deutschland in den Weihnachtsvorbereitungen steckt, erschüttern brutale Morde die Stadt Köln.
Ein psychopathischer Mörder bringt junge blonde Frauen um, indem er sie skalpiert und enthäutet.
Kann die Kölner Kripo um Brandt und Aydin den Mörder schnappen oder wird es für weitere junge Frauen eine tödliche Weihnacht geben?
Der Autor
Salim Güler, aufgewachsen in Norddeutschland, studierte in Köln Wirtschaftswissenschaften und promovierte an der TU-Chemnitz. Er arbeitete lange Zeit in der freien Wirtschaft, zuletzt als Pressesprecher.
Schon als Schüler begann er mit dem Schreiben von selbsterfundenen Geschichten und diese Leidenschaft ließ ihn bis heute nicht los.
In seinen Romanen finden sich immer wieder gesellschaftlich aktuelle Themen, die er geschickt in eine fiktive und hoch spannende Geschichte einzubetten versteht.
Seine Bücher landen regelmäßig in den Bestsellerlisten der Verkaufs-Charts.
Salim Güler ist sehr am Austausch mit seinen Leserinnen und Lesern interessiert und freut sich daher über jeden Kontakt, entweder über Facebook oder über seine Homepage.
www.salim-gueler.de
https://www.facebook.com/salim.gueler.autor
Kapitel 1
Voller Inbrunst sang er mit. Immer wieder nur diesen Song von Laura Branigan aus den Achtzigern: Self Control. Eine quälende Dauerschleife. Unablässig tönte das Lied aus den Lautsprechern und sie war gezwungen, diesem Irrsinn beizuwohnen. Dann fing der Song von vorne an und es kam wieder seine Lieblingszeile über die Nacht. Ja, die Nacht war er. In der Nacht konnte er sich dem hingeben, wonach er sich tagsüber so sehr sehnte. Konnte er frei sein.
»Bitte lassen Sie mich gehen«, flehte die junge Frau, die angekettet auf einem Metalltisch lag.
»Du Schlampe, du hast alles kaputt gemacht«, brüllte er. Er stellte die Musik ab und hörte auf zu tanzen. Sie hatte seine Stimmung zerstört. Statt der Freude und der Lust am Tanzen hatte die Wut wieder Besitz von ihm ergriffen.
Er schaute zu dem großen Spiegel und betrachtete sein Spiegelbild. Er war eigentlich ganz zufrieden mit dem, was er sah. Eigentlich!
Er trug die typische Kleidung, die man zu der Zeit Laura Branigans getragen hatte – das jedenfalls glaubte er. Seidig schimmernd schmiegte sich der eng anliegende blaue Ganzkörperanzug an seinen Körper. Er verband solche Bilder in seiner Erinnerung mit dieser Zeit, dabei war er damals noch ein kleiner Junge gewesen.
Als Branigan ihren großen Hit gelandet hatte, war er acht Jahre alt. Dennoch erinnerte er sich daran, als wäre es erst gestern und er ein aktives Mitglied dieser Zeit, dieser Szene gewesen. Doch das entsprach nicht der Wahrheit. Ein anderes Bild, das er mit Wucht beiseiteschieben wollte, erinnerte ihn daran.
Zum Glück hatte er inzwischen endlich akzeptiert, wer er wirklich war, dadurch hatte sich sein Leben grundlegend verändert. Alles hatte einen Sinn bekommen, einen Sinn, für den er jahrzehntelang gekämpft hatte. Er hatte sich allen Widrigkeiten gestellt und jetzt spürte er, dass die Qualen, Demütigungen und Entbehrungen sich auszahlten. Hartnäckigkeit und Ausdauer hatten ihn diese dunklen Jahre ertragen lassen. Schon bald würde nichts mehr so sein, wie es war.
Diese Gewissheit besserte seine Laune wieder und er bewegte sich glücklich vor dem Spiegel. Griff sich mit beiden Händen an den Kopf, wiegte sich wie ein Ausdruckstänzer hin und her. Sein schütteres Haar, das am Hinterkopf etwas länger war, schwang im Takt seiner Bewegungen mit. Er machte einen Schritt zurück, seinen kleinen Bauch sah er im Spiegel nicht. Er sah einen John Travolta, der beweglich wie eine Gazelle war.
Den Ekel, den die junge Frau empfand, bemerkte er nicht einmal. Er schaltete die Musik wieder an und versuchte, in ihr aufzugehen. Immer wieder kreisten seine Gedanken um die Musik, diese wunderbare Zeit und seine Träume. Seine Bewegungen wurden immer ausdrucksvoller, aber er verlor nie den Takt.
Schweiß rann von seiner Stirn. Er machte sich nicht die Mühe, ihn wegzuwischen. Er liebte seinen Körper, seinen Geruch und seinen Schweiß. Er schmeckte nach Lust und Sex.
Und dann fing er wieder an mitzusingen. Er tat, als hätte er ein Mikro in der Hand, drehte sich im Kreis, fuhr sich mit der Hand ans Stirnband und spielte damit. Da er sich noch immer drehte, konnte er die Geschwindigkeit nicht kontrollieren und das Stirnband fiel herunter.
Er brach den Tanz ab, suchte das Stirnband, spürte aber, dass noch etwas anderes nicht stimmte. Als er sich bückte, sah er unbeabsichtigt in ihre Augen.
Er kannte ihren Namen nicht, wollte es auch nicht. Sie war schließlich nur Mittel zum Zweck. Er brauchte sie, das alleine war schon Ehre genug für diese nutzlose Person.
Hatte sie ihm vielleicht doch ihren Namen genannt und er hatte es einfach verdrängt? Bildete er sich nur ein, ihren Namen nicht zu kennen?
Obwohl die junge Frau nicht mehr schrie, sah man, dass die Angst sie kontrollierte. Gewaltige Angst. Er stellte die Musik aus und fühlte sich plötzlich nackt, als hätte sie sein Geheimnis gelüftet, bevor die Zeit reif dafür war.
»Zeit zum Spielen«, sagte er und versuchte seinen Ärger herunterzuschlucken. Er hasste es, wenn etwas Unvorhergesehenes, Ungeplantes passierte. Es machte ihn unsicher und wütend zugleich. Das heruntergerutschte Stirnband und der Augenkontakt mit der jungen Frau gehörten dazu.
Er trat an den Tisch, berührte mit seiner rechten Hand das glänzende kalte Metall. Dann wanderte seine Hand weiter und berührte die nackte junge Frau an den Beinen.
Sie hatte schöne Beine. Ihre Haut fühlte sich gut an. Er streichelte ihre langen Beine, erreichte ihren Oberschenkel, stoppte kurz.
Noch immer schien die Frau nicht in der Lage zu sein, ein Wort zu sprechen. Noch immer schien sie starr vor Angst.
»Was ist los mit dir?«, fragte er daher. Sein Tonfall hatte etwas pervers Fürsorgliches. »Freust du dich nicht?«
Er grinste und fuhr sich voll Vorfreude mit der Zunge über die Lippen. Seine Hand wanderte zu ihrem Intimbereich.
Wieder hielt er inne. Er spielte mit der Hand an ihrer intimsten Zone. Drückte ihre Schamlippen zusammen. Sie war rasiert und er musste zugeben, dass ihm ihr Intimbereich gefiel. Er wirkte wie gezeichnet. Die Schamlippen standen nicht vor.
»Das könnte ein Chirurg nicht besser machen«, bemerkte er und hoffte, dass sie die anerkennenden Worte zu schätzen wusste.
Sie schluckte, dann fing sie leise an zu weinen. Anscheinend hatte sich die Schockstarre gelöst.
»Wieso weinst du?«, fragte er irritiert.
»Bitte lassen Sie mich gehen«, flehte sie schluchzend.
»Ah, kann die Raupe doch sprechen?« Er senkte seinen Kopf nach links. Seine rechte Hand spielte noch immer mit ihren Schamlippen.
»Bitte ...«
»Tzzzz ....«, unterbrach er sie und hielt seinen linken Zeigefinger vor die Lippen. »Keine Angst, ich will dir nicht wehtun. Ich bin kein Vergewaltiger«, versuchte er sie zu beruhigen. Er nahm seine rechte Hand von ihrem Körper und legte sie auf ihre Lippen. Sie hatte schöne volle rote Lippen. Er hatte sie selbst geschminkt. Die Farbe war ein wenig verwischt, das lag aber nicht an ihm, sondern an ihr. Warum hatte sie sich auch wehren müssen?
Noch immer schluchzte sie. Er wischte ihr die Tränen vom Gesicht.
»Nicht mehr weinen. Du bist so schön.« Er streichelte ihr Gesicht, versuchte sie zu trösten, doch sie weinte noch immer.
»Bitte lassen Sie mich gehen. Ich werde niemandem etwas sagen«, flehte sie erneut. Dabei war ihr Wille schon längst gebrochen, sie schien es aber nicht akzeptieren zu wollen.
»Halts Maul«, brüllte er plötzlich und schlug ihr mit der Faust ins junge unschuldige Gesicht. Er traf ihre Nase, die sofort zu bluten anfing.
Das Mädchen schrie vor Schmerz und er fluchte: »Verdammt, siehst du, das kommt davon, du elende Schlampe.«
Er schlug sie wieder. Diesmal schrie das Mädchen nicht. Tränen rollten leise ihr Gesicht herunter.
»Wieso musst du mich so wütend machen? Ich will nicht wütend sein! Ich hasse doch Gewalt. Begreifst du es nicht!? Du bist meine Entjungferung. Kannst du nicht einfach still sein und die Freude mit mir teilen?«
Er schäumte vor wütender Erregung, sabberte fast. Seine Hand fuhr nervös zum Skalpell.
Er nahm es auf und führte es an den Kopf der jungen Frau.
Jetzt fing sie wieder an zu schreien. Sie brüllte aus voller Kehle, doch niemand würde sie hören.
»Sei still!«, rief er, schlug ihr wieder ins Gesicht, doch sie versuchte sich zu wehren, hörte gar nicht mehr auf zu schreien. Versuchte ihren Kopf zu bewegen. Doch das gelang ihr nicht, denn ihr Kopf war fixiert. Er klebte ihren Mund mit Klebeband zu, dann grinste er und näherte sich mit dem Skalpell ihrem Kopf.
Seine Augen wurden groß, das Schwarz der Pupillen verlieh seinem Blick etwas Wahnsinniges.
Er fühlte eine unglaubliche Energie, als er das Skalpell an ihre Stirn drückte und sie lebendig skalpierte.
Kapitel 2
2. Dezember
»Jungs, das ist kein schöner Anblick«, grüßte Alexander Rech seine Kollegen. An seinem Gesichtsausdruck erkannte Lasse Brandt, Polizeikommissar bei der Kripo Köln, dass er nicht scherzte. Der Jeck, der eigentlich immer einen lockeren Spruch auf Lager hatte, war aschfahl. Was immer unter diesem Leichentuch lag, musste großen Eindruck auf Rech gemacht haben, der als langjähriger Leiter der Spurensicherung wahrscheinlich schon alle möglichen Leichen gesehen hatte.
»Ganz ehrlich, Junior würde ich den Anblick ersparen.« Rech schaute zu Brandts jungem Partner Emre Aydin hinüber.
»Alles gut«, versuchte Aydin die eigene Anspannung herunterzuspielen, doch Brandt sah ihm an, dass Rechs Satz Eindruck bei ihm hinterlassen hatte. In den letzten Monaten hatten die Kollegen Aydin immer wieder Junior genannt. Nicht nur, weil er der neue Kollege bei der Kölner Mordkommission war, sondern auch, weil er mit seinen sechsundzwanzig Jahren der Jüngste im Team war.
Brandt und Aydin hatten sich verspätet. Sie hatten in Frankfurt eine Kriminalpolizistentagung besucht und waren durch den Anruf ihrer Chefin quasi aus der Tagung herausgerissen worden. Kristina Bender, die Leiterin der Mordkommission K-11, wollte, dass die beiden den Fall übernahmen, daher war ihnen nichts anderes übrig geblieben, als sofort loszufahren.
Brandt beugte sich über die Leiche und wollte gerade die Plane zur Seite ziehen, als er aufsah und fragte: »Lag sie hier?«
»Nein, in der großen Mülltonne«, erklärte Rech und zeigte auf eine große Industrietonne, die in der Nähe stand.
»In einer Tonne? Wer steckt eine Leiche in eine Mülltonne?«, fragte sich Aydin laut. Sein Blick war auf das Leichentuch gerichtet.
»Der gleiche Psycho, der ihr das angetan hat«, kommentierte Rech wenig begeistert.
Brandt ließ seinen Blick kurz über die Tonne und die Umgebung schweifen. Er glaubte nicht, dass die Person hier ermordet worden war. Sie befanden sich im Industriegebiet in Porz Wahn. Das Gelände lag ein wenig zurückversetzt und wenn der Täter die Dunkelheit genutzt hatte, um die Leiche in der Tonne zu entsorgen, war es ziemlich wahrscheinlich, dass ihn niemand dabei gesehen hatte.
Leider, dachte Brandt enttäuscht.
Er zog die Einmalhandschuhe noch einmal hoch, dabei saßen sie schon gut. Er ertappte sich bei dem Gedanken, dass er das Leichentuch eigentlich lieber nicht zur Seite schieben wollte. Er wollte nicht sehen, was darunter lag. Aber es war sein verdammter Job, also musste er es tun.
»Du schaust erst, wenn ich es dir gestatte, klar?«, sagte er in Richtung Aydin.
»Mein Gott, ist ja gut. Ich bin doch kein Kind«, reagierte sein Partner ungehalten, dabei schien er nicht zu verstehen, dass Brandt ihm einfach eine wahrscheinlich sehr unangenehme Situation ersparen wollte.
Er und Aydin waren inzwischen ein recht gut eingespieltes Team. Seit ihrem ersten gemeinsamen Fall vor einigen Monaten hatte sich ihr Verhältnis deutlich gebessert. Brandt musste sich eingestehen, dass Aydin sehr talentiert war und vermutlich in einigen Jahren ein unheimlich guter Kriminalpolizist sein würde. Vor allem seine Loyalität wusste Brandt sehr zu schätzen. Aydin war zwar manchmal noch recht naiv und sah viel zu oft das Gute im Menschen, aber welcher Polizist tat das nicht zu Beginn seiner Karriere?
Brandt zählte bis drei und schob dann das Leichentuch zur Seite. Rech hatte nicht übertrieben, es kostete ihn viel Mühe, ruhig zu bleiben. Sein Magen rebellierte, aber er unterdrückte den Brechreiz.
»Scheiße, was ist das?« Aydin schien die Stimme zu versagen.
»Verdammt ...«, schimpfte Brandt, sah dann aber, wie Aydin sich umdrehte und seinen gesamten Mageninhalt lautstark von sich gab.
»Ich habs doch gesagt, sieht übel aus«, schien sich Rech verteidigen zu wollen.
»Was ist das?«, wollte Brandt wissen, dabei hatte er schon eine dunkle Vermutung.
»Sie wurde gehäutet.«
»Gehäutet?«, fragte Aydin und wischte sich den Mund ab.
»Ja, aber nicht nur das. Sie wurde ganz offensichtlich auch skalpiert.«
»Skalpiert? Du scherzt ...«
»Siehst du mich lachen?«, konterte Rech.
»Scheiße, wer macht so was?«
»Das ist euer Job, minge Fründ«, stellte Rech klar und für einen kleinen Augenblick war wieder diese kölsche Leichtigkeit da, die Brandt so an ihm mochte. »Allerdings ist ihm das nicht an allen Stellen gelungen.«
»Was ist ihm nicht gelungen?«, wollte Brandt genauer wissen.
»Das Häuten. Es gibt Stellen, an denen die Haut noch am Körper klebt. Es gibt auch Rissstellen. Ich vermute, dass er sie im Liegen gehäutet hat. Tiere werden eigentlich hängend gehäutet, um solche Risse zu vermeiden. Das ist auch auf Menschen übertragbar.« Rech betonte den letzten Satz so, dass seine Abscheu gegen den Vergleich unmissverständlich war.
»Was für Rissstellen?« Diesmal war es Aydin, der fragte.
»Da sie vermutlich lag, müssen diese Risse beim Abziehen der Haut vom Körper entstanden sein.«
»Geht das überhaupt?«, unterbrach Aydin.
»Da bekommt ‚jemandem das Fell über die Ohren ziehen‘ plötzlich eine andere Bedeutung«, bemerkte Rech sarkastisch, um jedoch gleich hinzuzufügen: »Warum sollte das nicht gehen? Was bei Tieren geht, geht auch beim Menschen. Die Haut ist mit einer durchschnittlichen Fläche von zwei Quadratmetern zwar das größte menschliche Organ und mit zehn Kilogramm auch das schwerste. Aber mit einem guten Skalpell und etwas Übung ist das im Bereich des Machbaren. Schon in der Antike war das Hautabziehen eine besonders qualvolle Foltermethode.«
»Hat sie dabei noch gelebt?«, fragte Aydin angewidert.
»Kann ich noch nicht genau sagen. Aber der starre Blick der Augen lässt das fast vermuten. Ich hoffe, in einigen Tagen mehr darüber sagen zu können.«
»Was meinst du, wie lange ist sie schon tot?« Je länger Brandt die Tote betrachtete, desto schlechter wurde ihm. Es erinnerte ihn ein wenig an ein Plastinat, nur war es tausendmal ekliger. Diese Leiche hatte nicht mehr viel mit einem Menschen gemein. Man sah schon erste Zerfallserscheinungen. Allerdings stank die Leiche noch nicht stark.
»Wegen der Kälte ist es schwer, eine genaue Aussage zu treffen. Totenflecken können wir auch nicht bestimmen. Die Tote hat zu viel Blut verloren. Ohne Haut ist das sehr kompliziert. Ich vermute, sie ist seit zwei Tagen tot. Aber nagel mich bitte nicht drauf fest. Das muss sich die Gerichtsmedizin genauer anschauen.«
»Wer hat die Leiche gefunden?«
»Ein Obdachloser«, antwortete Rech und zeigte hinter Brandt.
Dort stand ein Mann neben zwei Kollegen. Sie unterhielten sich.
»Komm«, sagte Brandt zu Aydin. Beide gingen auf den Obdachlosen zu.
»Moin, Moin«, sagte Brandt.
»Wann lernst du endlich, dass wir in Köln ‚jode Dach‘ sagen?«, erwiderte Bock mit einem Grinsen. Brandt und er kannten sich schon seit einigen Jahren und es war wie ein Running Gag. Sie trafen sich nicht oft, aber wenn, dann grüßte Brandt ihn immer so, wie man es nun mal in Hamburg tat.
Als gebürtiger Hamburger tat er sich noch immer mit einigen kölschen Gepflogenheiten schwer, sodass er es sich herausnahm, auch in Köln seine Heimat zu pflegen. Allerdings waren diese Marotten eher spielerischer Natur. Brandt war kein eisenharter Verfechter von irgendwelchen Gebräuchen oder Traditionen.
»Wenn du mich zum Fischessen einlädst«, grinste Brandt.
Bock hasste Fisch.
»Sie haben die Leiche gefunden?«, fragte Brandt an den Obdachlosen gewandt.
»Ja, Herr Kommissar«, antwortete der Mann pflichtbewusst. Ihm war anzusehen, dass er nicht ganz nüchtern war.
»Haben Sie getrunken?«, fragte Aydin. Brandt warf ihm einen mahnenden Blick zu.
»Vielleicht ein oder zwei Schnäpschen. Bei der Kälte …«, antwortete der Obdachlose.
»Was haben Sie in dieser Gegend zu suchen?«
»Ich bin gern allein und abends stör ich hier keinen und muss auch vor niemandem Angst haben.«
Nun sah Brandt auch den Grund für diese Antwort. »Wurden Sie zusammengeschlagen?« Das Gesicht des Mannes zeigte deutliche Spuren einer Schlägerei.
»Früher hab ich mich gewehrt, aber das hats nur schlimmer gemacht. Inzwischen lass ich es mir einfach gefallen, dann verlieren diese jungen Wilden schnell das Interesse«, schien der Obdachlose die Schläge verharmlosen zu wollen.
»Wieso zeigen Sie die Idioten nicht an?«, hakte Aydin nach.
In Gedanken schüttelte Brandt nur den Kopf. Aydin schien in einigen Bereichen einfach noch nicht begriffen zu haben, wie das echte Leben funktionierte, oder er wollte es in seiner Naivität einfach nicht.
Brandt musste an sich selbst denken. Damals hatten auch ihn seine Ideale zur Polizeiarbeit geführt. Die Vorstellung, die Welt besser machen zu können. Inzwischen sah er sich eher als einen Schuster, der versuchte, die Löcher zu stopfen, die immer größer wurden.
»Was soll das denn bringen? Nee, nee, ich geh diesen Idioten lieber aus dem Weg …«, antwortete der Obdachlose. Seine Stimme zeugte von Resignation und Frust.
»Also haben Sie hier eine Schlafstelle gesucht?«
»Ja, genau«, bestätigte er, fuhr sich mit der rechten Hand kurz an die Nase und fügte hinzu: »In den Tonnen ist oft Karton, der schützt gut vor Kälte.«
»Und tagsüber gehen Sie zurück in die Stadt?«, wollte Brandt wissen. Das Industriegebiet lag immerhin über 15 Kilometer von der Innenstadt entfernt. Brandt konnte sich schwer vorstellen, dass der Obdachlose im Industriegebiet bettelte. Und irgendwie musste er ja an Geld kommen, für Alkohol und Essen.
»Nicht immer. Wenn ich genug geschnorrt hab, bleib ich auch mal ’n paar Tage hier. Ich brauch nich viel.«
Aydins Blick fiel auf die Plastiktüte in der Hand des Obdachlosen, aus der eine Kornflasche hervorlugte.
»Ich weiß, was Sie denken«, reagierte der Obdachlose auf Aydins Blick. »Aber glauben Sie mir, ich trink wirklich nur zwei drei Schluck am Tag, damit mir nich kalt wird.«
»Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie in der Tonne nach Kartons gesucht und stattdessen die Leiche gefunden haben?«, fragte Brandt und ging auf die Bemerkung nicht ein. Warum auch?
Ihn interessierte es nicht, ob der Mann Alkoholiker war oder nicht. Irgendwann in seinem Leben schien er den falschen Weg eingeschlagen und ihn nicht mehr verlassen zu haben. Sicherlich gab es dafür Gründe, aber Brandt war kein Seelsorger, sondern ein Kommissar, der einen brutalen Mord aufzuklären hatte.
Als Polizist durfte er Einzelschicksale nicht zu sehr an sich heranlassen, Distanz war der Schlüssel zu Erfolg und Seelenfrieden.
»Ja, sie lag unter zwei Kartons. Sie können sich vorstellen, was ich für’n Schreck gekriegt hab. Zuerst hab ich gedacht, ich täusch mich. Aber als ich die Leiche angefasst hab, wusste ich, dass sie echt ist.« Der Mann schluckte, als würde er versuchen, einen Brechreiz zu unterdrücken. »Wie können Menschen nur so was Schreckliches machen?«
»Wie haben Sie die Polizei angerufen?« Brandt konnte sich schwer vorstellen, dass der Mann ein Handy besaß.
»Ich bin an die Straße und hab so lange um Hilfe geschrien, bis jemand angehalten hat. Der hat dann die Polizei gerufen. Kurze Zeit später waren Ihre Kollegen schon da«, erklärte er und zeigte auf die beiden Streifenpolizisten.
»Was ist mit dem Anrufer?«
»Der ist weitergefahren.«
»Haben Sie die Leiche bewegt?«, wollte Brandt wissen. Wer der Anrufer war, war zunächst unwichtig, schließlich hatte dieser nur sein Handy zur Verfügung gestellt. Im Zweifelsfalle würden sich die Daten über die Zentrale ausfindig machen lassen.
»Nee, ich bin doch nich verrückt. Ich hab sie nich mal berührt.«
»Das stimmt. Die Leiche war noch in der Tonne, als wir kamen. Danach haben wir die Zentrale benachrichtigt, die alles in die Wege geleitet hat«, bestätigte Bock.
»Ist Ihnen sonst irgendetwas Verdächtiges aufgefallen?«, fragte Brandt.
»Ehrlich gesagt – nee, da war nix.«
»Denken Sie bitte nach. Sie sagten, Sie sind öfter hier. Ist Ihnen in den letzten Tagen oder Wochen irgendein Fahrzeug oder eine Person aufgefallen?«
Für Brandt war es mehr als wahrscheinlich, dass der Täter diesen Ort bewusst ausgesucht hatte. Und das bedeutete auch, dass der Täter den Ort kannte.
Entweder arbeitete er hier in der Nähe, fuhr öfter an diesem Ort vorbei oder er hatte recherchiert, wo er eine Leiche ohne großes Aufsehen entsorgen konnte.
»Tut mir leid, da war wirklich nix.«
»Konzentrieren Sie sich bitte. Jede noch so unwichtig erscheinende Information kann uns diesem brutalen Mörder etwas näher bringen. Vielleicht sah die Person wie ein Bauarbeiter aus, der aber immer wieder um die Mülltonne herumspaziert ist. Nicht auffällig, damit er glaubt, nicht aufzufallen, aber dennoch auffällig, weil er das über Tage oder Wochen getan hat. Oder ein Auto, das öfter hier in der Gegend rumfuhr. Denken Sie bitte nach«, forderte Brandt den Obdachlosen erneut auf.
Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass der Mann nichts gesehen hatte. Ein Blick auf die Flasche sagte ihm aber, dass es wohl leider doch im Rahmen des Möglichen war.
»Nein, ich hab nix gesehen. Kann ich gehen?«, beharrte der Mann. Seine Augen bewegten sich auffällig schnell zwischen den Beamten hin und her. Ein klares Zeichen, dass er ziemlich nervös und unsicher war.
»Sie wissen, dass Sie sich strafbar machen, wenn Sie Informationen nicht weitergeben?«, drohte Brandt und schaute den Obdachlosen streng an.
Irgendetwas verschwieg dieser Mann.
Der Obdachlose wippte leicht in den Knien, seine rechte Hand bewegte sich kurz zur Tüte, berührte die Flasche, doch dann zog er sie wieder zurück.
Er atmete hörbar und dann antwortete er ängstlich: »Vielleicht hab ich doch was gesehen.«
Kapitel 3
»Wo sind Sie mit Ihren Gedanken?«, fuhr ihn sein Vorgesetzter an.
»Ich ... ich«, versuchte er ängstlich eine Entschuldigung herauszubringen. Seine Haltung entsprach seiner Tonlage. Sie hatte was Demütiges, sich selbst Erniedrigendes an sich.
Er wollte keinen Streit, keine Auseinandersetzung. Er wollte nur in Ruhe gelassen werden.
»Dann machen Sie Ihre Arbeit ordentlich, verdammte Scheiße.«
Er wagte nicht zu antworten, sondern begab sich gleich wieder an seine Arbeit. Sein Vorgesetzter blickte ihn noch immer skeptisch an, verließ dann aber den Raum.
Erst jetzt wagte er wieder zu atmen. Er schwitzte, seine Achseln und sein Rücken waren klitschnass. Ganz zu schweigen von seinen Händen. Das Schweißproblem begleitete ihn schon seit Jahrzehnten. Er mochte gar nicht daran denken, denn es erinnerte ihn daran, wie oft er von seinen Klassenkameraden deswegen gequält worden war. Du Stinker, Stinktier, Büffel, Pferd oder Spast waren nur einige Schimpfwörter, die ihn bis zum Schulabschluss begleitet hatten.
Er hatte damals gehofft, dass es vorbei sein würde, wenn er erwachsen wäre, genau wie die andere Sache. Die geheime, von der niemand wissen durfte.
Doch leider hatte er sich getäuscht. Auch die Erwachsenen machten ihre Späßchen auf seine Kosten. Als ob das Schwitzen nicht genug wäre, hatte die Natur ihn auch noch mit einem etwas zu langen Oberkiefer gesegnet, wodurch sich ein breiter Streifen seines Zahnfleisches zeigte, sobald er seinen Mund aufmachte. Noch heute nannten ihn Kollegen und Bekannte abschätzig »Pferd«. Deswegen versuchte er möglichst wenig zu lachen oder zu sprechen.
Bis zum heutigen Tag hatte er nicht verstanden, warum Menschen so böse und hinterhältig sein konnten. Was brachte es ihnen, über andere Menschen, die sie nicht näher kannten, zu urteilen? Sie fertigzumachen, obwohl die anderen ihnen nie etwas getan hatten!
Er selbst war nicht so gemein. Er wollte nur glücklich sein, aber sie ließen ihn nicht. Jahrzehntelang hatte er dieses Spiel mitgespielt und sich verkrochen wie ein Feigling, weil er jeder Konfrontation aus dem Weg gegangen war.
Aber gestern, gestern endlich war er aus diesem übergroßen Schatten herausgetreten. Wie konnte sein Chef da von ihm erwarten, dass er mit seinen Gedanken bei seiner dämlichen, eintönigen Arbeit war?
Seine Gedanken waren bei Desiree. So hieß das junge Ding, das er lebendig skalpiert und gehäutet hatte. Sie hatte ihm ihren Namen tatsächlich genannt, aber er weigerte sich, ihren Namen auszusprechen oder ihn gar in Gedanken zu nennen. Sie war für ihn nur der Engel, der seine einsame, bittere Welt aufgebrochen hatte. Eine Welt voller Enttäuschungen, Ablehnungen und Niederlagen. Was gestern geschehen war, fühlte sich gut an. Verdammt gut. Zum ersten Mal glaubte er zu wissen, was es hieß, zu leben, zu atmen und wirklich frei sein zu können.
Er wusste, dass er noch einiges vor sich hatte. Aber er war bereit, diesen Weg zu gehen. Er war ein geduldiger, ein sehr geduldiger Mensch.
Natürlich war das erste Mal immer etwas Besonderes, das wusste er, dennoch hoffte er, dass er die Intensität, den Genuss konservieren könnte, dass er bei der nächsten Auserwählten das gleiche Glücksgefühl haben würde.
Und dann würde er auch noch besser sein. Das Häuten bei Desiree war etwas komplizierter gewesen, als er es sich erhofft hatte, dabei hatte er vorher geübt.
Durch die Gedanken an sein großes Ziel verstrich die Arbeitszeit schneller und er hatte endlich Feierabend.
Gegen 18 Uhr verließ er seine Arbeitsstätte und machte sich auf den Heimweg. Bei einem Bäcker machte er kurz Halt. Als er eintrat, verschlug es ihm fast den Atem.
»Hallo«, grüßte die junge Bäckerin.
»Hallo«, stotterte der Mann. Noch immer war er unfähig, ein vernünftiges Wort zu sprechen.
Ob die junge Frau das bemerkt hatte oder nicht, konnte er nicht einschätzen, da sie noch immer sehr freundlich wirkte. Er hatte bei dem Bäcker ab und an Brötchen und Brot gekauft, aber die junge Frau war ihm hier noch nicht begegnet.
»Wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie.
»Ein Brot«, antwortete der Mann und versuchte wieder Haltung zu gewinnen.
»Welches?« Die junge Frau lächelte noch immer.
Der Mann schätzte sie auf höchstens siebzehn oder achtzehn.
»Ein Roggenmischbrot.« Allmählich bekam er etwas Selbstsicherheit zurück. »Das da vorne.« Er zeigte auf ein Brot.
»Das ganze?«
»Ja.«
»Geschnitten?«
»Ja, bitte.«
Sie nahm das Brot und legte es in die Schneidemaschine. Dabei hatte sie ihm den Rücken zugewandt. Ihr langes blondes Haar fiel glatt den Rücken herunter. Es glänzte seidig.
Perfekt!
Nachdem das Brot geschnitten war, verpackte sie es und reichte es dem Mann. Dabei berührten sich ganz kurz ihre Hände. Sie hatte sehr zarte Hände. Perfekte Hände, und sie machten einen sehr gepflegten Eindruck. Er beneidete sie, vor allem um ihre Jugend und ihre schöne, makellose Haut.
»Möchten Sie noch etwas anderes?«, fragte die junge Frau.
Der Mann bestellte noch süßes Gebäck und Brötchen, dabei brauchte er außer Brot eigentlich nichts, aber er wollte sie im Gespräch halten. Er musste mehr über sie erfahren.
»Sicherlich haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke besorgt?«, fragte er freundlich. Er versuchte seine Nervosität zu überspielen. Ihr Lächeln brachte ihn um den Verstand. Wie gerne hätte er sie an sich gedrückt und ihr Haar gestreichelt.
Sicherlich würde ihr das gefallen, dachte er.
»Ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin immer der Last-Minute-Einkäufer«, gestand sie. »Und Sie?«
»Sie haben ja noch ein paar Wochen. Ich habe schon alles gekauft. Ich liebe Weihnachten. Ein schön geschmückter Tannenbaum, Kerzen, der Duft nach Zimt und süßem Gebäck. Dann Glühwein und natürlich die ganzen schönen Geschenke. Es ist jedes Mal aufregend.«
Einiges, was er ihr gesagt hatte, stimmte, anderes hatte er einfach dazu erfunden in der Hoffnung, dass ihr diese Worte gefallen würden. Er liebte Weihnachten in der Tat, auch alles drumherum. Er kaufte Geschenke, allerdings verschenkte er sie nicht. Genauso wenig bekam er Geschenke.
Die Wahrheit war, dass er niemanden hatte, dem er etwas schenken konnte, und es niemanden gab, der ihn zu Weihnachten besuchen oder beschenken würde.
»Ja, ich liebe das auch. Vor allem das beschenkt Werden.« Ihre Augen leuchteten auf.
»Na, dann lassen Sie sich reich von Ihrem Freund beschenken«, schlug der Mann vor. Er wurde immer selbstbewusster. Die eingefallenen Schultern erhoben sich und seine Haltung war nun deutlich gerader, aber noch immer leicht gebeugt.
»Schön wärs. Ich will von dem Idioten nichts mehr wissen.« Sie runzelte die Stirn.
»Darf ich fragen, warum?«
»Der Idiot hat mit Katrin rumgeknutscht und die hat es mir per WhatsApp geschickt. Diese Schlampe.«
»Dann war er es nicht wert. Sie finden schon einen Mann, der Sie zu schätzen weiß.«
»Ich weiß nicht. Ich will erst mal nichts von Jungs wissen«, entgegnete sie und er glaubte gesehen zu haben, wie sie ihm kurz zugezwinkert hatte.
In Wirklichkeit hatte sie nur eine Wimper wegzwinkern wollen.
Der Mann fühlte sich geschmeichelt. In Gedanken hatte er sich schon längst für sie entschieden.
»Sind Sie alleine hier?«, fragte er, da er keine Kollegen sehen konnte.
»Meine Chefin ist gerade austreten«, sagte sie und kicherte.
Trotz ihrer Schönheit machte sie einen schüchternen und leicht unsicheren Eindruck.
Oder spielt sie das nur?, überlegte der Mann.
»Sind Sie in der Ausbildung?«
»Ja, mein erstes Lehrjahr.«
»Und dann schon so fleißig«, lobte er sie.
»Danke. Möchten Sie zahlen?«
»Ja, gerne.«
Die Auszubildende nannte ihm die Summe, er zahlte und verabschiedete sich. In kurzer Entfernung zur Bäckerei bog er ab, ging zu einer Mülltonne und warf das Gebäck und die Brötchen hinein.
Das Mädchen ging ihm nicht aus dem Kopf. Konnte das Zufall gewesen sein?
Er wollte nicht daran glauben. Es musste Schicksal gewesen sein. Desiree hatte er auch wie zufällig entdeckt und sie hatte ihn sehr glücklich gemacht. Sie war für eine höhere Sache gestorben. Konnte diese Ehre auch diesem Mädchen zustehen?
Ja. Sie war perfekt. Sie war jung, hatte strahlend blondes langes Haar. Ihre Haut war makellos. Sie stank nicht nach Zigaretten, also war ihre Haut unbelastet. Das nahm er jedenfalls an.
Sicher hatte sie auch keine anderen Verunreinigungen am Körper, davon war er überzeugt.
Er durfte sie sich nicht entgehen lassen. Er nahm seinen Rucksack vom Rücken und warf einen Blick hinein.
Alles drin. Er grinste.
Ermuntert von der gestrigen Euphorie, hatte er heute eigentlich vorgehabt, seinen Chef zu töten. Glücklicherweise hatte er diesen Gedanken schnell verworfen. Wer weiß, ob er sonst diesem Engel begegnet wäre.
Es ist kein Zufall. Jetzt war er sich ganz sicher.
Er versteckte sich hinter einem Baum, von wo aus er die Bäckerei sah, ohne von dort entdeckt werden zu können, und wartete, dass der Engel Feierabend machte. Er war so erregt und voller Vorfreude, dass er die Kälte gar nicht bemerkte.
Und dann sah er sie, wie sie sich von ihrer Chefin verabschiedete und in seine Richtung marschierte.
Sie trug eine für die Jahreszeit viel zu dünne Jacke.
Ihre Haare, die sie nun zu einem Zopf gebunden hatte, schwangen mit ihrem sexy Schritt. Er konnte es gar nicht abwarten, diese Haare zu berühren. Er schaute noch einmal kurz in alle Richtungen, sah aber niemanden außer ihr. Vorsichtig folgte er ihr.
Inzwischen war es schon sehr dunkel und es kamen ihnen kaum Passanten entgegen. Er erhöhte sein Tempo, weil sie gleich eine Unterführung erreichten. Sein Herz schlug wie verrückt. Er musste diese Gelegenheit nutzen, Vorsicht hin oder her. Er wollte sie haben und noch heute Abend ihr Haar streicheln.
Es trennten ihn nur noch wenige Schritte von diesem Engel. Sie hörte Musik und schien ihn gar nicht zu bemerken.
Dann berührte er sie kurz an der Schulter.
»Ja ...«, wollte sie erschrocken sagen. Doch zu mehr kam sie nicht, denn er hatte schon längst das Tuch mit Chloroform auf ihren Mund gedrückt.
Kapitel 4
3. Dezember
Brandt und Aydin hatten die Person ausfindig gemacht, die der Obdachlose in den letzten Tagen gesehen hatte. Egal, was man über den Obdachlosen denken mochte, aber dank ihm war es der Polizei gelungen, ein sehr gutes Phantombild des Unbekannten aus dem Industriegebiet zu erstellen. Und anhand dieses Bildes hatten sie innerhalb weniger Stunden die Identität des Mannes festgestellt.
Er hieß Thorsten Kruse und war bei der Polizei kein unbeschriebenes Blatt, was ihn als Tatverdächtigen noch mehr in den Fokus rückte. Ob es eine heiße Spur war oder nicht, vermochte keiner von ihnen zu sagen. Die Spurensicherung versuchte noch mit Unterstützung der Gerichtsmedizin den Tathergang zu rekonstruieren.
Die Kollegen der Informationsbeschaffung waren dabei, die Identität des Opfers zu klären, was bis jetzt gar nicht so einfach war. Keine der bisher als vermisst gemeldeten Personen kam in Frage.
Bender hatte für 14 Uhr ein Meeting anberaumt, um die weiteren Schritte und erste Ergebnisse zu besprechen.
Jetzt waren Brandt und Aydin auf dem Weg zu dem Verdächtigen aus dem Industriegebiet. Der Mann wohnte in Porz Eil.
»Na, da bin ich mal gespannt«, sagte Aydin, nachdem Brandt den Wagen geparkt hatte und beide ausstiegen.
»Vielleicht ist er auch gar nicht da.« Brandt betätigte die Klingel neben dem Namen des Mannes.
»Hallo«, ertönte es aus dem Lautsprecher.
»Guten Tag. Kriminalpolizei Köln, spreche ich mit Thorsten Kruse?«, antwortete Brandt.
»Ja, warum? Was wollen Sie von mir?«
»Herr Kruse, das würden wir Ihnen gerne persönlich sagen. Machen Sie bitte die Tür auf.«
»Und was, wenn Sie nicht von der Kriminalpolizei sind?«, erwiderte Kruse.
Brandt rollte mit den Augen und warf Aydin einen genervten Blick zu. Der konnte sich ein Lachen nicht verkneifen.
»Herr Kruse, wir haben keine Zeit für diese Spielchen. Wir sind von der Kripo. Machen Sie bitte die Tür auf, dann können wir uns auch gerne ausweisen.«
»Ich weiß nicht. Man hört ja ganz schlimme Sachen«, beharrte Kruse auf seinem Standpunkt.
Brandt presste die Lippen zusammen. Der Tag fing sehr gut an!
Er wollte etwas sagen, aber Aydin kam ihm zuvor: »Herr Kruse, dann kommen Sie doch bitte zur Haustür, damit wir uns ausweisen können.«
»Ich weiß nicht«, war seine noch immer abwehrende Reaktion.
»Sie kommen jetzt runter oder wir brechen die Tür auf und nehmen Sie mit aufs Revier. Dann können Sie in der Zelle überlegen, ob wir von der Kripo sind oder nicht.« Jetzt platzte Brandt der Kragen. Kaum hatte er es ausgesprochen, summte es an der Haustür.
»Warum nicht gleich so«, brummte er und betrat den Hausflur. »Was ist so lustig daran?«
»Nichts, nichts ... alles gut«, verteidigte sich Aydin und hob abwehrend die Hände. Sein breites Grinsen verriet allerdings, dass es ihm schwerfiel, nicht in lautstarkes Gelächter auszubrechen.
Kruse wohnte im zweiten Stock. Seine Wohnungstür war noch geschlossen.
»Der verarscht uns doch!«, fluchte Brandt. Er betätigte die Klingel.
»Sind Sie von der Kripo?«, hörten sie nach kurzer Zeit eine Stimme fragen.
»Ja, Kripo Köln. Wollen Sie endlich die Tür aufmachen?« Brandt war kurz davor, zu explodieren.
»Können Sie mir beide Ihren Ausweis vor den Spion halten? Ich will nur ganz sichergehen.«
Brandt schluckte die Wut herunter, nahm seinen Ausweis und hielt ihn vor den Spion. Aydin ebenfalls.
»Und jetzt machen Sie bitte die Tür auf«, wurde Brandt laut.
Es dauerte noch eine gefühlte Ewigkeit, bis ein Klickgeräusch verriet, dass Kruse endlich die Tür öffnete.
»Was möchten Sie von mir?«, fragte Kruse sichtlich verunsichert.
Am liebsten ein Geständnis, wäre es fast aus Brandt herausgeplatzt.
»Können wir das im Wohnzimmer besprechen?«, fragte er stattdessen.
»Ich habe aber nicht lange Zeit.«
Brandt trat einfach in den Flur, dabei drängte er Kruse ein wenig zur Seite. Damit hatte dieser nicht gerechnet, er zuckte kurz zusammen.
»Aber nur fünf Minuten«, sagte Kruse in gebeugter Haltung, sein Blick war zu Boden gerichtet. Offensichtlich fühlte er sich von Brandt eingeschüchtert. Er ging ins Wohnzimmer, die Beamten folgten ihm.
Kruse war minimal größer als Brandt, allerdings deutlich beleibter. Er hatte schütteres Haar. Dass bald nur noch ein Kranz davon übrig bleiben würde, war nicht zu übersehen. Sein rundliches Gesicht und die schmalen Augen passten zu seiner ängstlichen Gesamthaltung. Seine blasse Haut verriet, dass er entweder selten das Haus verließ oder die Sonne mied. Dass eine so helle Haut nur Veranlagung war, wollte Brandt nicht glauben.
Das Wohnzimmer erweckte wie der Flur den Eindruck, dass hier ein Mensch wohnte, der mit den alltäglichen Dingen des Lebens deutlich überfordert zu sein schien. Überall lagen Sachen herum. Gläser standen neben leeren Cola- und Bierflaschen auf dem Tisch. Zeitungen lagen auf dem Boden herum, benutzte Teller und Besteck auf dem kleinen Esstisch.
»Sauber machen ist nicht Ihre Stärke, oder?«, kommentierte Brandt diesen unappetitlichen Anblick.
Er mochte keine Unordnung und Schmutz schon gar nicht. Für einen Mann war er sehr penibel. Seine Wohnung war genauso sauber und ordentlich wie sein Schreibtisch. Immer wieder verpasste er Aydin einen Rüffel, weil sein Schreibtisch mit Akten oder anderen Dingen zugemüllt war.
Im Gegensatz zu ihm selbst war Aydin eher ein unordentlicher Mensch, aber das war bei Weitem kein Vergleich zu Kruse.
»Ist das strafbar?«, reagierte Kruse gereizt. Es entsprach so gar nicht seiner bisherigen Haltung.
»Strafbar nicht, aber ungesund.«
Kruse nahm auf der abgenutzten braunen Couch Platz. Er schob einige Zeitschriften zur Seite. In seiner grauen alten Sporthose, die seit Wochen nicht mehr gewaschen worden zu sein schien, machte er einen sehr ungepflegten Eindruck.
Er nahm eine Zigarettenschachtel aus der Hosentasche, zog eine Zigarette heraus und zündete sie an. Seine Hände zitterten. Auf dem Couchtisch lag noch eine Packung mit Tabak und Blättern zum Selberdrehen, was Brandt merkwürdig fand, glaubte er doch, dass Menschen, die selbstgedrehte Zigaretten rauchten, niemals fertige in die Hand nehmen würden.
Warum bist du nervös?, dachte Brandt angewidert.
»Können Sie bitte erst rauchen, wenn wir hier raus sind?«, bat er daher.
»Das ist mein Zuhause. Hier kann ich rauchen, wann es mir passt«, ignorierte Kruse die Bitte und zog genüsslich an der Zigarette.
Gibt dir die Kippe Selbstbewusstsein? Brandt versuchte seine Wut herunterzuschlucken.
»Das mit eben war nicht so gemeint. Aber ich habe vorhin aus dem Fenster nur Ihren türkischen Kollegen gesehen. Und man kann heutzutage ja nicht vorsichtig genug sein«, plapperte Kruse jetzt drauflos und warf Aydin einen prüfenden Blick zu.
»Wie meinen Sie das?«, fragte nun Aydin.
»Na, das mit den ganzen Asylanten. Diese Verbrecher gehen jetzt von Tür zu Tür und betteln. Halten einem einen Zettel hin, dass man ihnen Geld geben soll. Aber alles nur Taktik. Die wollen sehen, ob jemand zu Hause ist, damit sie dich ausrauben können. Diese verdammten Schmarotzer.«
»So pauschal können Sie das nicht sagen«, erwiderte Brandt, »aber deswegen sind wir nicht hier.« Er wollte auf keinen Fall eine politische Diskussion mit Kruse vom Zaun brechen, der in seinen Augen das Abbild eines Versagers war.
»Ich habe nichts getan. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Ich bin clean.«
Kruse hatte sich inzwischen die zweite Kippe angezündet. Noch immer zitterte seine Hand, als er das Feuerzeug hielt.
»Kennen Sie die Spedition Kraus?«
»Nein, sollte ich?«
Die Antwort kam schnell, viel zu schnell, als dass sie wahr sein konnte.
»Wo arbeiten Sie?«, mischte sich Aydin wieder in das Gespräch ein.
»Ich arbeite als Hausmeister. Warum?«
»Beantworten Sie nur unsere Fragen«, erhob Brandt seine Stimme.
»Ich sagte doch, ich arbeite als Hausmeister.«
Kruse war inzwischen wie gewandelt, das Ängstliche, Unterwürfige schien wie weggeblasen. Selbst seine Körperhaltung war wesentlich selbstbewusster. Seine Schultern, sein Rücken waren aufrecht.
»Wo genau?«, wollte Brandt wissen.
»Bei Gruber Logistik.«
»In Porz Wahn?«
»Ja, warum?«
»Und dann wollen Sie uns sagen, dass Sie die Spedition nicht kennen?«
»Nein, warum sollte ich?«
»Die sitzen zufällig im gleichen Industriegebiet«, kam Aydin Brandt zuvor.
»Da sind viele Firmen. Ich weiß noch immer nicht, was Sie von mir wollen.« Kruse zog hastig an seiner Zigarette. Asche fiel auf die Couch. Er wischte sie mit der Hand weg, verrieb sie dabei aber mehr.
»Herr Kruse, entweder sprechen wir offen miteinander oder wir nehmen Sie mit aufs Revier. Es gibt Zeugen, die Sie auf dem Firmengelände gesehen haben.« Brandts Geduld war bereits überstrapaziert.
»An welcher Straße liegt denn diese Firma? Vielleicht komme ich daran vorbei, wenn ich zur Bushaltestelle laufe. Mit dem Mindestlohn kommt man nicht gerade weit. Ich bin ja nur ein anständig arbeitender Bürger und kein Asylant, dem man alles hinterherschmeißt.«
»Ein letztes Mal, was haben Sie auf dem Firmengelände gesucht? Sie wurden in den letzten Tagen mehr als einmal dort gesehen. Ich werde keine weitere Lüge dulden.«
Brandt glaubte nicht, dass Kruse an dem Firmengelände vorbeikam, wenn er zur Bushaltestelle ging. Er hatte mit Aydin gestern das Industriegebiet abgesucht, hatte auch mit Kollegen von Kruse gesprochen. Die Bushaltestelle lag in der genau entgegengesetzten Richtung. Kruses Kommentar zu den Asylanten ignorierte er einfach. Das war Stammtischgeschwätz, was ihn fürchterlich aufregte.
»Vielleicht war ich ja da. Wenn ich den Bus verpasse, gehe ich ein wenig spazieren und kaufe mir auch mal eine Currywurst am Imbiss in der Nähe. Gut möglich, dass ich an der Spedition vorbeigekommen bin. Ich achte nicht auf Firmenschilder.«
»Nicht nur vielleicht, Sie wurden mehrmals auf dem Firmengelände gesehen. Dafür mussten Sie die Straße verlassen und das Firmengelände betreten. Warum?« Aydin machte wie Brandt einen genervten Eindruck.
»Warum interessiert Sie das? Ja, vielleicht war ich auf dem Firmengelände. Mein Gott, ist das schlimm? Wollen Sie mich deswegen verhaften?«, platzte es aus Kruse heraus.
Der ängstliche und feige Kruse gefiel Brandt viel besser als der störrische und sich widersetzende.
»Sind Sie eigentlich noch in Behandlung?«, fragte Brandt daher und änderte die Taktik.
»Was?« Kruses Augen wanderten zwischen Brandt und Aydin hin und her.
»Bei Ihnen wurde laut Polizeiakten ein stark ausgeprägter Exhibitionismus diagnostiziert. Es war Teil Ihrer Bewährungsauflagen, dass Sie sich in Behandlung begeben mussten.«
»Das ist fünf Jahre her. Seitdem bin ich clean. Natürlich war ich in Behandlung. Einmal Verbrecher, immer Verbrecher«, motzte Kruse, wagte dabei aber weder Brandt noch Aydin anzuschauen.
»Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht«, spottete Brandt. Er wollte Kruse von seinem hohen Ross herunterholen, ihn zu einem Fehler zwingen. Und das ging nur, wenn er nervös und ängstlich wurde.
Brandt glaubte nicht, dass jemand wie Kruse wirklich geheilt werden konnte. Irgendwann würde sein böses Ich wieder erwachen. Diese ganze Psychologenscheiße war für ihn eine Folge falsch interpretierter Idealvorstellungen. Seine langjährige Berufserfahrung sagte ihm einfach, dass nicht jeder Mensch gleich war.
Es gab und würde immer Menschen geben, die das Böse in sich trugen, die nicht aus ihrer Haut konnten, anderen Menschen zu schaden oder ihnen nach dem Leben zu trachten. Wie ein Kinderschänder immer ein Kinderschänder bleiben würde, würde ein Vergewaltiger immer ein Vergewaltiger bleiben. Bender mochte diese Einstellung gar nicht.
»Rufen Sie meine Psychologin an. Sie hat mir attestiert, dass ich geheilt bin. Es war ein Fehler, dafür habe ich bezahlt. Ich würde es nicht wieder tun.«
Kruse hatte inzwischen einige Zigaretten geraucht. Die letzte in einer Geschwindigkeit, dass Brandt annahm, dass Kruse extrem nikotinabhängig war.
»Wer einmal eine junge Frau vergewaltigt, wird es wieder tun«, platzte es aus Brandt heraus.
»Ich habe sie nicht vergewaltigt«, widersprach Kruse. Seine Augen waren weit aufgerissen, seine Kiefer fest zusammengepresst.
»Wenn nicht ein Passant gekommen wäre, hätten Sie Ihre feige Tat vollendet«, erwiderte Brandt.
»Das stimmt nicht. Ich habe an stark psychologischem Exhibitionismus gelitten. Ich konnte nicht anders, ich musste ihr meinen Penis zeigen.«
»Und Sie haben sie an sich gedrückt.«
»Weil sie geschrien hat. Ich wollte, dass sie nicht mehr schreit.«
»Leider hat Ihnen der Richter geglaubt. Ich hingegen glaube Ihnen nicht. Für mich sind Sie noch immer ein gefährlicher Mann.«
»Ich bin kein Vergewaltiger. Ich war ...«, brüllte Kruse. Seine Augen zuckten, Speicheltröpfchen fielen aus seinem Mund und auf seine dreckige Sporthose.
»Was haben Sie auf dem Firmengelände getrieben?«, fragte Aydin, der anscheinend den Gesprächsinhalt auf das Wesentliche lenken wollte.
»Nichts, wirklich. Ich habe nur die Zeit totgeschlagen.«
»Ein letztes Mal, was haben Sie dort getrieben?«, drängte Brandt.
»Nichts, mir nur die Zeit vertrieben.«
Brandt war hin und her gerissen. Natürlich war nicht strafbar, was Kruse getan hatte. Aber er war überzeugt davon, dass Kruse log. Nur ohne Beweise – was hätte da eine Verhaftung gebracht? Außer Ärger mit Bender. Sie schien ohnehin ein Herz für Außenseiter zu haben. Sie mochte es nicht, wenn man Personen aufgrund von Vermutungen verhaftete. Es mussten schon wichtige Anhaltspunkte vorliegen, bevor sie so einer Vorgehensweise zustimmte.
»Dann werden Sie sicherlich auch nichts dagegen haben, wenn wir uns kurz umschauen?«
»Warum?«
»Sie haben doch nichts zu verbergen«, kam Aydin Brandt zu Hilfe.