
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Versehentlich berühmt! Klassenreise zur Fashion Week – Harriets beste Freundin Nat wittert die Chance ihres Lebens: Vielleicht wird sie endlich als Model entdeckt! Doch dann wird ausgerechnet Harriet selbst (Streberin, Klassenbeste, null Komma null Interesse für Mode) von einer Modelagentur entdeckt. Okay, versuchen kann sie es ja mal, oder? Vielleicht ist das ja die Gelegenheit, sich neu zu erfinden! Doch als dann noch der unfassbar gutaussehende Nick ihr Shootingpartner wird, ist klar: Das kann nur in einem Desaster enden! Band 1 der internationalen Bestsellerserie – jetzt auf Netflix! »Intelligent, beherzt und urkomisch.« The Bookseller »Genial!« MaximumPop »Weise, lustig und wahrhaftig.« Autor James Henry »Ein Kleinod und Wohlfühl-Buch, das Leser*innen zum Lächeln bringt und mit hocherhobenem Haupt zurücklässt.« Books for Keeps »Eine einzigartige Geschichte voller Humor.« The Guardian
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Holly Smale
Geek Girl
Über dieses Buch
Versehentlich berühmt!
Klassenreise zur Fashion Week – Harriets beste Freundin Nat wittert die Chance ihres Lebens: Vielleicht wird sie endlich als Model entdeckt! Doch dann wird ausgerechnet Harriet selbst (Streberin, Klassenbeste, null Komma null Interesse für Mode) von einer Modelagentur entdeckt. Okay, versuchen kann sie es ja mal, oder? Vielleicht ist das ja die Gelegenheit, sich neu zu erfinden! Doch als dann noch der unfassbar gutaussehende Nick ihr Shootingpartner wird, ist klar: Das kann nur in einem Desaster enden!
Band 1 der internationalen Bestsellerserie – jetzt auf Netflix!
»Intelligent, beherzt und urkomisch.« The Bookseller
»Genial!« MaximumPop
»Weise, lustig und wahrhaftig.« Autor James Henry
»Ein Kleinod und Wohlfühl-Buch, das Leser*innen zum Lächeln bringt und mit hocherhobenem Haupt zurücklässt.« Books for Keeps
»Eine einzigartige Geschichte voller Humor.« The Guardian
Außerdem von Holly Smale bei Fischer lieferbar: Die Valentines – verdammt berühmt.
Band 1: Happy Girl
Band 2: Perfect Girl
Band 3: Rebel Girl
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de/kinderbuch-jugendbuch
Biografie
Holly Smale war als Jugendliche ziemlich unbeholfen, ein bisschen streberhaft und schüchtern und verbrachte einen Großteil ihrer Teenager-Jahre in der Toilette der Umkleide, um sich zu verstecken. Mit 15 wurde sie völlig überraschend von einer Londoner Top-Modelagentur entdeckt und verbrachte die nächsten zwei Jahre damit, über Laufstege zu stolpern, knallrot anzulaufen und teure Dinge zu ruinieren, die sie nicht ersetzen konnte. Sie studierte englische Literatur an der Bristol University, gab das Modeln auf und entschloss sich Schriftstellerin zu werden – mit riesigem Erfolg: Ihre Serie über das Geek Girl Harriet wurde in über 30 Sprachen übersetzt, verkaufte sich weltweit über drei Millionen Mal und erfolgreich von Netflix als Serie verfilmt.
Inhalt
[Widmung]
Definition Uncool
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
Für meinen Großvater.
Meinen liebsten Streber.
Uncool <Adjektiv> · Umgangssprache, Jugendsprache
jemand, der hoffnungslos unmodern ist und zudem ungeschickt im Umgang mit anderen Menschen
jemand, der zwanghaft begeistert ist
jemand, der auch als Streber bezeichnet wird
jemand, der das Bedürfnis hat, das Wort »uncool« im Lexikon nachzuschlagen
Synonyme: verhärtet, verspannt; angestrengt, ängstlich, befangen, blockiert, gehemmt, gezwungen, nicht frei/locker, nicht natürlich, schüchtern, steif, unfrei, unnatürlich, unsicher, verklemmt, verlegen; abscheulich, ärgerlich, entsetzlich, furchtbar, katastrophal, schlimm, unangenehm, unerfreulich, unfair; (gehoben)übel; (umgangssprachlich)blöd, fies, gemein, grässlich, gräulich, verheerend; (salopp)zum Kotzen; (emotional) scheußlich; (umgangssprachlich emotional) fürchterlich; (scherzhaft)fürchterbar; (abwertend) infam, widerlich; (umgangssprachlich abwertend)mies, schauderhaft, schofel, schrecklich.
1
Ich heiße Harriet Manners, und ich bin uncool.
Ich weiß, dass ich uncool bin, weil ich es gerade im Wörterbuch nachgeschlagen habe. Ich habe einen kleinen Haken neben sämtliche Symptome gesetzt, die mir bekannt vorkamen, und es sieht so aus, als hätte ich sie alle.
Was mich – und an dieser Stelle sollte ich unbedingt ganz ehrlich sein – nicht besonders überrascht hat. Die Tatsache, dass auf meinem Nachttisch ein Wörterbuchliegt, ist schon das erste Indiz. Die Tatsache, dass daneben ein Bleistift vom Naturhistorischen Museum und ein Lineal liegen, damit ich interessante Einträge ordentlich unterstreichen kann, ein weiteres.
Oh, und dann noch die Tatsache, dass das Wort UNCOOL in roten Buchstaben außen auf meiner Umhängetasche steht. Das ist gestern passiert.
Es sieht so aus, wenn auch nicht so ordentlich:
UNCOOL
Ich war das nicht. Das ist ja wohl offensichtlich. Wäre ja bescheuert, so was mit meiner eigenen Tasche anzustellen. Wenn ich meinen Besitz verunstalten wollte, würde ich eine prägnante Zeile aus einem guten Buch wählen oder eine interessante Tatsache, die nicht vielen Menschen bekannt ist. Und ich würde es definitiv nicht in Rot draufschreiben, eher in Schwarz oder in Blau oder vielleicht in Grün. Ich bin kein großer Fan der Farbe Rot, selbst wenn Rot das langwelligste Licht ist, das vom menschlichen Auge wahrgenommen werden kann.
Um ganz offen zu sein: Ich weiß nicht, wer sich auf meiner Tasche verewigt hat – obwohl ich natürlich so meinen Verdacht habe –, aber die Handschrift ist nicht zu identifizieren. Die Schreiberin oder der Schreiber hat letzte Woche in der Englischstunde eindeutig nicht zugehört, als wir erklärt bekamen, dass die Handschrift ein wichtiger Ausdruck der eigenen Persönlichkeit ist.
Egal, die Sache ist und bleibt die, dass meine Tasche, der anonyme Schmierfink und das Wörterbuch einer Meinung sind, woraus ich nur schließen kann, dass ich wohl tatsächlich uncool bin.
Ich glaube, so was nennt man auch Ironie.
2
Jetzt wo ihr wisst, wer ich bin, wollt ihr bestimmt auch wissen, wo ich lebe und was ich so mache, richtig? Personen, Handlung und Ort – das macht eine gute Geschichte aus. Das habe ich in einem Buch mit dem Titel »Was gute Geschichten ausmacht« gelesen, verfasst von einem Mann, der im Augenblick keine Geschichte auf Lager hat, der aber genau weiß, wie er sie erzählen wird, sobald ihm irgendwann eine einfällt.
Also.
Im Augenblick ist Dezember, ich liege im Bett – unter ungefähr vierzehn Decken – und mache nichts – abgesehen davon, dass ich mit jeder Sekunde mehr schwitze.
Also, nicht dass ihr euch Sorgen macht oder so, aber ich glaube, ich bin richtig krank. Ich habe feuchte Hände, mein Magen ist in Aufruhr, und ich bin deutlich blasser als noch vor zehn Minuten. Außerdem ist mein Gesicht von etwas befallen, was man nur als … Ausschlag bezeichnen kann. Kleine rote Punkte, völlig willkürlich verteilt, ganz und gar unsymmetrisch auf Wangen und Stirn. Und ein großer auf dem Kinn. Und einer direkt am linken Ohr.
Ich werfe noch einen Blick in den kleinen Handspiegel, der auf meinem Nachttisch liegt, und dann seufze ich, so laut ich kann. Es besteht nicht der geringste Zweifel: Ich bin eindeutig schwer krank. Es wäre nicht gut, andere, mit womöglich weniger starkem Immunsystem, mit dieser gefährlichen Infektion anzustecken. Ich muss diese Krankheit einfach allein durchstehen.
Den ganzen Tag. Ohne irgendwohin zu gehen.
Schniefend schiebe ich mich noch ein bisschen tiefer unter meine Bettdecke und werfe einen Blick auf die Uhr an der Wand gegenüber (ein raffiniertes Stück: Die Ziffern sind auf die Unterkante gemalt, als wären sie gerade runtergefallen. Allerdings muss ich, wenn ich es eilig habe, raten, wie spät es ist).
Und dann schließe ich die Augen und zähle im Geiste rückwärts:
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 …
An dieser Stelle geht wie immer, auf die Sekunde, die Tür auf, und das Zimmer explodiert. Überall Haare, Arme, Tasche und Mantel. So eine Art Mädchenbombe.
Und vor mir steht, wie durch einen punktgenauen Zauber, Nat.
Nat – um das mal festzuhalten – ist meine beste Freundin und wir harmonieren so perfekt, dass es ist, als hätten wir ein Gehirn, das bei der Geburt geteilt wurde. Oder (und das ist eher wahrscheinlich) zwei Gehirne, die kurz danach eine wundersame Verbindung eingegangen sind.
Kennengelernt haben wir uns allerdings erst, als wir fünf Jahre alt waren, also ist das rein metaphorisch gemeint, sonst wären wir ja beide tot.
Was ich sagen will: Wir sind ein Herz und eine Seele. Wir sind ein und dieselbe. Wir sind wie ein perfekter Bewusstseinsstrom, wir haben uns noch nie gestritten.
Wir arbeiten perfekt zusammen, in bedingungsloser Synergie. Wie zwei Delfine in Sea World, die exakt im selben Augenblick hochspringen und einander den Ball zuspielen.
Egal. Nat macht einen Schritt ins Zimmer, sieht mich an, hält inne und stemmt die Hände in die Hüften.
»Guten Morgen«, krächze ich unter den Decken und dann fange ich an, heftig zu husten. Menschlicher Husten ist im Allgemeinen hundert Stundenkilometer schnell, und ohne eitel sein zu wollen, möchte ich doch behaupten, dass meiner mindestens hundertzehn oder hundertfünfzehn erreicht. Es ist ein richtig schlimmer Husten.
»Vergiss es«, fährt Nat mich an.
Ich höre auf zu husten und sehe sie mit großen fragenden Augen an. »Hm?«, meine ich unschuldig. Und dann fange ich wieder an zu husten.
»Ich meine es ernst. Vergiss es ganz einfach.«
Ich habe keine Ahnung, was sie meint. Von dem Fieber ist sicher mein Gehirn angeschwollen.
»Nat«, sage ich schwach, schließe die Augen und lege die Hand an die Stirn. Ich glaube, ich bin an etwas ganz Schrecklichem erkrankt. Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Eine leere Hülse. »Ich habe schlechte Nachrichten.« Und dann schlage ich ein Auge auf und linse im Zimmer herum. Nat hat immer noch die Hände in die Hüften gestemmt.
»Lass mich raten«, sagt sie trocken. »Du bist krank.«
Ich setze ein mattes, aber tapferes Lächeln auf. So ein Lächeln, wie Jane es Lizzy in Stolz und Vorurteil schenkt, als sie eine ganz böse Erkältung erwischt hat und ganz tapfer ist. »Du kennst mich so gut«, sage ich liebevoll. »Es ist, als wären wir eins, Nat.«
»Und du hast völlig den Verstand verloren, wenn du glaubst, ich würde dich nicht augenblicklich an den Füßen aus dem Bett zerren.« Nat kommt ein paar Schritte näher. »Außerdem will ich meinen Lippenstift wiederhaben«, fügt sie hinzu.
Ich räuspere mich. »Lippenstift?«
»Den, mit dem du dir die Punkte ins Gesicht gemalt hast.«
Ich mache den Mund auf und klappe ihn wieder zu. »Das ist kein Lippenstift«, sage ich mit Piepsstimme. »Das ist eine gefährliche Infektion.«
»Dann hast du eine gefährliche Infektion mit Glitzereffekt, der zufällig perfekt zu meinen neuen Schuhen passt.«
Ich rutsche noch ein bisschen weiter unter die Bettdecke, bis nur noch meine Augen rausgucken. »Infektionen sind heutzutage sehr fortschrittlich«, erwidere ich möglichst würdevoll. »Manchmal sind sie extrem reflektierend.«
»Und enthalten winzige Goldplättchen?«
Ich hebe trotzig das Kinn. »Manchmal.«
Nat zieht die Nase kraus und verdreht dazu die Augen. »Richtig. Und dein Gesicht schwitzt weißes Talkumpuder aus, was?«
Ich schnüffle kurz. Oh, Sch… – sugar cookies. »Wenn man krank ist, muss man unbedingt für eine trockene Umgebung sorgen«, erkläre ich ihr so lässig wie möglich. »In einem feuchten Milieu können sich leicht Bakterien entwickeln.«
Nat seufzt wieder. »Steh auf, Harriet.«
»Aber …«
»Raus aus dem Bett.«
»Nat, ich …«
»Raus. Sofort.«
Ich richte den Blick voller Panik auf meine Daunendecke. »Aber ich bin nicht fertig! Ich hab noch meinen Schlafanzug an!« Einen letzten verzweifelten Versuch mache ich noch. »Nat«, sage ich, indem ich eine andere Taktik einschlage und mit ernster, tiefer Stimme spreche. »Du verstehst das nicht. Was meinst du, wie du dich fühlst, wenn du dich irrst? Wie willst du damit leben? Ich könnte sterben.«
»Ja, stimmt, du hast recht«, pflichtet Nat mir bei und macht noch zwei Schritte auf mich zu. »Du stirbst. Dich trennen buchstäblich nur noch zwei Sekunden vom Selbstmord, Harriet Manners. Und wenn das passiert, werde ich sehr gut damit leben können. Und jetzt steh auf, du Schaupielerin.«
»Ich bin krank.«
»Bist du nicht.«
»Ich sterbe!«
»Tust du nicht.«
Und bevor ich was tun kann, stürzt Nat sich auf mich und reißt mir die Decken weg.
Schweigen macht sich breit.
»Ach,Harriet«, sagt Nat schließlich traurig und zugleich triumphierend, doch darauf kann ich nun wirklich nichts mehr erwidern.
Denn ich liege vollständig bekleidet im Bett, mit Schuhen. Und in einer Hand halte ich eine Schachtel Talkumpuder und in der anderen einen leuchtend roten Lippenstift.
3
Okay, ich habe also ein bisschen gelogen.
Genauer gesagt, zwei Mal.
Nat und ich harmonieren ganz und gar nicht miteinander. Wir sind definitiv eng befreundet, und wir verbringen definitiv unsere ganze Freizeit miteinander, und wir lieben uns heiß und innig, aber es gibt jetzt, da wir fast erwachsen sind, doch den einen oder anderen Augenblick, wo unsere Interessen und Vorlieben ein ganz kleines bisschen auseinanderdriften.
Oder eher, nun ja – ein ganzes Stück.
Was uns nicht daran hindert, unzertrennlich zu sein. Wir sind beste Freundinnen, weil wir uns gegenseitig oft zum Lachen bringen − einmal hat Nat so gelacht, dass ihr der Orangensaft aus der Nase spritzte (auf den weißen Teppich ihrer Mutter – wir haben dann ziemlich schnell aufgehört zu lachen). Und weil ich mich daran erinnere, wie sie mit sechs im Ballettsaal auf den Boden gepinkelt hat, und weil sie der einzige Mensch in der Welt ist, der weiß, dass auf der Innenseite meiner Kleiderschranktür immer noch ein Dinosaurier-Poster hängt.
Aber in den letzten zwei Jahren hat es definitiv hier und da Punkte gegeben, wo unsere Wünsche und Bedürfnisse … ein klein wenig aneinandergeraten sind.
Was der Grund ist, warum ich behauptet habe, ein wenig kränker zu sein, als ich mich heute Morgen gefühlt habe (nämlich gar nicht besonders krank).
Genau gesagt: Mir geht’s großartig.
Und es ist auch der Grund, warum Nat ein wenig bissig zu mir ist, als wir so schnell, wie meine Beine mich tragen, zum Schulbus rennen.
»Weißt du«, sagt Nat und seufzt, als sie zum zwölften Mal stehen bleiben muss, damit ich aufholen kann, »manchmal finde ich dich einfach unglaublich, Harriet. Letzte Woche habe ich mir mit dir diesen dämlichen Dokumentarfilm über die Russische Revolution angesehen, und der hat ungefähr hundert Stunden gedauert. Da ist doch das Mindeste, was du tun kannst, an diesem Schulausflug teilzunehmen, um mit mir zusammen einen Blick hinter die Kulissen der Modeindustrie zu werfen und Textilien aus Konsumentenperspektive zu betrachten.«
»Shoppen«, schnaufe ich und halte mir die Seiten, um nicht auseinanderzubrechen. »Man nennt es Shoppen.«
»Das steht so nicht auf dem Handzettel. Egal. Es ist ein Schulausflug: Irgendwas Pädagogisches muss dran sein.«
»Nein«, keuche ich, »ist es nicht.« Nat bleibt wieder stehen, damit ich sie einholen kann. »Es ist nur shoppen.«
Und – um fair zu sein – glaube ich, da habe ich nicht ganz unrecht. Wir fahren zur Clothes Show Live nach Birmingham. Die vermutlich so heißt, weil man sich dort Klamotten ansehen kann. Live. In Birmingham. Und man kann die Klamotten kaufen. Und danach mit nach Hause nehmen.
Was man normalerweise shoppen nennt.
»Das wird lustig«, sagt Nat ein paar Meter vor mir. »Die haben da alles, Harriet. Alles, was man sich nur wünschen kann.«
»Ehrlich?«, frage ich sarkastisch, was mir schwerfällt, denn inzwischen laufe ich so schnell, dass mein Atem anfängt zu pfeifen. »Etwa auch einen Triceratops-Schädel?«
»Nein.«
»Ein lebensgroßes Modell des ersten Flugzeugs?«
»… Wahrscheinlich nicht.«
»Oder ein Manuskript von John Donne, zu dem sie kleine weiße Handschuhe reichen, damit man es wirklich anfassen kann?«
»John Wie-bitte?«, fragt Nat mit einem kleinen Schnauben, und dann denkt sie darüber nach. »Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass sie so etwas haben«, räumt sie ein.
»Dann haben sie nicht alles, was ich mir wünschen kann, oder?«
Wir sind endlich am Bus, und ich verstehe es einfach nicht: Wir sind beide dieselbe Entfernung gelaufen, wir haben beide dieselbe Energie verbraucht. Ich bin kleiner als Nat, also muss ich weniger Masse bewegen, in derselben Geschwindigkeit (im Durchschnitt). Und doch schnaufe ich – gegen alle Gesetze der Physik – mit hochrotem Kopf, während Nat nur ein wenig glüht und immer noch ganz entspannt durch die Nase ausatmen kann.
Manchmal ist Naturwissenschaft einfach vollkommen blödsinnig.
Panisch hämmert Nat an die Bustüren. Wir sind – dank meiner ausgezeichneten Schauspielkünste – wirklich ziemlich spät dran, und es sieht beinahe so aus, als würde die Klasse ohne uns abfahren. »Harriet«, fährt Nat mich an und dreht sich zu mir um, als die Türen dieses schmatzende Geräusche von sich geben, als würden sie küssen. »Zar Nikolaus II. wurde 1917 von Lenin gestürzt.«
Ich blinzle überrascht. »Ja«, sage ich, »stimmt.«
»Glaubst du wirklich, das würde mich interessieren? Nein. Genau. Es gehört nicht mal zu unserem Prüfungsstoff. Ich hätte es nie erfahren müssen. Jetzt bist du dran, ein paar verdammte Schuhe in die Hand zu nehmen und Ah und Oh für mich zu sagen, denn Jo hat Garnelen gegessen, und weil sie allergisch ist auf Garnelen, ist sie krank geworden und konnte nicht mitkommen, und ich sitze nicht sieben Stunden allein in einem Bus. Okay?«
Nat atmet tief durch, und ich senke den Blick beschämt auf meine Hände. Sie hat recht. Ich bin eine sehr selbstsüchtige Person.
Ich bin auch eine sehr funkelnde Person: Meine Hände sind mit winzigem Goldflitter bedeckt.
»Okay«, sage ich leise. »Tut mir leid, Nat.«
»Ich verzeihe dir.« Die Bustüren gleiten endlich auf. »Und jetzt steig in diesen Bus und tu wenigstens für einen Tag so, als hättest du das winzigste, allerkleinste Fünkchen Interesse an Mode, okay?«
»Okay«, antworte ich, und meine Stimme wird noch leiser.
Denn, falls ihr es noch nicht begriffen habt, dann will ich euch jetzt verraten, was Nat und mich trennt:
Ich habe noch nicht einmal das winzigste, allerkleinste Fünkchen Interesse an Mode.
4
Oh, bevor wir in den Bus steigen, wollt ihr vielleicht ein bisschen mehr über mich erfahren.
Vielleicht auch nicht. Vielleicht denkt ihr: Erzähl einfach weiter, Harriet, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Annabel sagt das dauernd. Erwachsene haben, soweit ich es überblicke, selten den ganzen Tag Zeit.
Egal, wenn ihr – wie ich – beim Frühstück den Text auf Müslischachteln und im Bad das Kleingedruckte auf Shampooflaschen lest und den Busfahrplan studiert, auch wenn ihr längst wisst, wann der Bus fährt, dann folgen hier noch ein paar Informationen:
Meine Mutter ist tot. Das ist normalerweise der Teil, wo die Menschen komisch gucken und davon anfangen, dass es nach Regen aussieht, aber da ich drei Tage alt war, als sie starb, vermisse ich sie so in der Art, wie man Figuren aus einem Roman liebt. Es fühlt sich unwirklich an.
Ich habe eine Stiefmutter, Annabel. Sie und mein Vater haben geheiratet, als ich sieben war. Sie lebt und sie ist Anwältin. (Ich muss diese beiden Eigenschaften so deutlich hervorheben, denn ihr würdet nicht glauben, wie oft sich meine Eltern über diese beiden Tatsachen streiten. »Ich lebe«, schreit Annabel dann. »Du bist Anwältin«, schreit mein Vater zurück. »Wen willst du auf den Arm nehmen?«)
Mein Vater ist im Marketing tätig. »Nicht in der Werbung«, sagt Annabel immer auf Dinnerpartys. »Ich schreibe Werbung«, erwidert mein Vater dann jedes Mal frustriert. »Ich stecke so tief in der Werbung, wie man drinstecken kann.« Und an dem Punkt stampft er immer davon, um sich in der Küche noch ein Bier zu holen.
Ich bin ein Einzelkind. Dank meiner Eltern bin ich zu einem einsamen Leben verdammt und werde nie jemanden haben, mit dem ich mich auf dem Autorücksitz kabbeln kann.
Nat ist nicht nur meine beste Freundin. Sie hat sich diesen Titel selbst gegeben, obwohl ich gesagt habe, das sei ein bisschen überflüssig, denn sie ist auch meine einzige Freundin. Das könnte daran liegen, dass ich dazu neige, die Leute auf Grammatikfehler aufmerksam zu machen und ihnen Sachen zu erzählen, die sie nicht interessieren.
Und Listen anzulegen. Wie die hier.
Nat und ich haben uns vor zehn Jahren kennengelernt, als wir fünf waren, also sind wir jetzt fünfzehn. Ich weiß, das hättet ihr auch selbst rausgekriegt, aber ich kann nicht davon ausgehen, dass alle Leute gern kopfrechnen, nur weil ich es gern tue.
Nat ist schön. Als wir klein waren, haben Erwachsene ihr öfter die Hand unters Kinn gelegt und gesagt: »Die hier, die wird noch eine richtige Herzensbrecherin«, als könnte sie sie nicht hören und würde nicht längst überlegen, wann sie am besten damit anfinge.
Ich nicht. Ich wirke auf Menschen wie ein Erdbeben auf der anderen Seite der Erdkugel: Wenn ich Glück habe, kann ich darauf hoffen, dass mal eine Teetasse auf dem Unterteller klirrt. Und selbst das ist dann eine Überraschung und alle reden noch tagelang darüber.
Das ist so ungefähr das, was ihr im Augenblick wissen müsst. Nach und nach wird noch das eine oder andere durchsickern – wie die Tatsache, dass ich Toast nur in Dreiecken esse, weil es dann keine klitschigen Kanten gibt, und dass mein Lieblingsbuch die erste Hälfte von Große Erwartungen und die letzte Hälfte von Sturmhöhe ist –, aber das braucht ihr jetzt noch nicht zu wissen.
Möglicherweise braucht ihr das auch gar nicht zu wissen. Das letzte Buch, das mein Vater mir gekauft hat, hatte eine Knarre auf dem Umschlag.
Egal, die letzte charakteristische Eigenschaft, die ich beiläufig vielleicht schon erwähnt habe, ist:
Mit Mode habe ich absolut nichts am Hut.
Hatte ich noch nie und werde ich auch wohl nie haben.
Bis zum Alter von ungefähr zehn bin ich damit durchgekommen. Bis dahin gab es so etwas wie einen individuellen Kleidungsstil eh nicht: Entweder trugen wir die Schuluniform oder einen Schlafanzug oder einen Badeanzug oder waren für die Weihnachtsaufführung in der Schule als Engel oder Schafe verkleidet, und für Tage, an denen wir ausnahmsweise nicht in Schuluniform in die Schule kommen durften, mussten wir extra was kaufen gehen.
Und dann schlug wie ein riesiger, rosa glitzernder Vorschlaghammer die Pubertät zu. Plötzlich gab es Regeln, und es war wichtig, sie zu brechen − oder auch nicht. Plötzlich musste man sich auskennen mit Rocklängen und Hosenschnitten und Lidschattenfarben und Absatzhöhen und wie lange man riskieren konnte, ohne Mascara rumzulaufen, bevor die Leute einen als Lesbe beschimpften.
Plötzlich teilte sich die Welt in die, die’s draufhatten, und die, die jämmerlich versagten. Und die, die dazwischensteckten und beim besten Willen den Unterschied nicht erkannten.
Leute, die weiße Socken und schwarze Schuhe trugen, die es toll fanden, Haare an den Beinen zu haben, weil es nachts so schön flaumig war. Leute, die das Schafskostüm bitter vermissten und es insgeheim gern in die Schule angezogen hätten, auch wenn gerade nicht Weihnachten war.
Leute wie ich.
Wären die Regeln logisch gewesen, hätte ich mein Bestes getan, um mitzuhalten. Ich hätte mir ein Kreis- oder Liniendiagramm gezeichnet und mich − wenn auch grollend − an die wesentlichen Dinge gehalten. Aber so ist Mode nicht, Mode ist wie ein glitzernder Goldfisch. Versucht man, sie am Hals zu packen, rutscht sie einem aus den Händen und schießt in eine ganz andere Richtung davon, und je verzweifelter man danach hascht, umso bescheuerter wirkt man auf andere. Bis man auf dem Boden rumrutscht und alle über einen lachen und der Goldfisch irgendwo unter einem Tisch verschwunden ist.
Also habe ich es – schlicht und ergreifend – gar nicht erst versucht.
Das Gehirn hat eh nur eine begrenzte Aufnahmefähigkeit, also bin ich zu dem Schluss gekommen, ich hätte dafür keinen Platz. Tatsachen wie die, dass Kolibris nicht laufen können oder dass ein Teelöffel voll Neutronensternen viele Milliarden Tonnen wiegt oder Elfenblauvögel die Farbe Blau nicht sehen können, interessieren mich eh viel mehr.
Nat dagegen hat die andere Richtung eingeschlagen. Und plötzlich hatten das Schaf und der Engel – die ganz glücklich in den Feldern um Bethlehem herumgetollt waren – nicht mehr viel gemeinsam.
Was unserer Freundschaft offensichtlich nicht geschadet hat. Sie ist immer noch das Mädchen, dessen erster Milchzahn in meinem Apfel stecken geblieben ist, und ich bin immer noch das Mädchen, das sich im Kindergarten einen ihrer Sonnenblumenkerne in die Nase steckte und nicht mehr rausbekam.
Doch manchmal – hier und da – wird die Kluft zwischen uns so groß, dass es scheint, als würde eine von uns durchrutschen.
Heute fühlt es sich sehr danach an, als wäre ich diesmal diejenige.
5
Egal.
Langer Rede kurzer Sinn: Ich bin nicht gerade begeistert, hier zu sein. Ich habe aufgehört zu jammern, aber sagen wir mal, ich drehe mich nicht unaufhörlich im Kreis und pupse in Abständen wie unser Hund Hugo, wenn er vor Freude ganz außer sich ist.
Ich habe sogar zwei Jahre lang extra den Werkunterricht besucht, um nicht an solchen Ausflügen wie heute teilnehmen zu müssen. Zwei Jahre lang habe ich mir unabsichtlich die Daumen abgeschmirgelt und bin beim Knirschen von Metall auf Metall zusammengezuckt, nur um mich vor so was wie heute drücken zu können. Und dann isst Jo Garnelen und kotzt ein bisschen und ZACK: Hier bin ich.
Egal, der erste Schritt in den Bus verläuft ereignislos: Ich bin direkt hinter Nat. Der zweite Schritt ist nicht ganz so erfolgreich. Der Bus fährt los, bevor wir uns gesetzt haben, und ich werde leicht zur Seite geschleudert. Dabei trete ich einen hübschen weichen grünen Schulrucksack durch die Gegend, wie ich noch nie in meinem ganzen Leben einen Fußball getreten habe.
»Idiot«, zischt Chloe, als sie sich ihn zurückholt.
»Bin … bin ich nicht«, stammle ich, und meine Wangen glühen. »Ein Idiot hat einen IQ zwischen 50 und 69. Ich glaub, meiner ist ein bisschen höher.«
Doch beim dritten Schritt ufert die ganze Sache zur Katastrophe aus. Denn jetzt erblickt der Fahrer eine Entenfamilie auf der Straße und tritt so hart auf die Bremse, dass ich den Gang runtersegle. Ich packe instinktiv zu, um nicht mit dem Gesicht auf dem Boden zu landen – eine Kopfstütze, eine Schulter, eine Armlehne, ein Sitz.
Ein nacktes Knie.
»Iiiih«, höre ich eine angeekelte Mädchenstimme schreien, »sie fasst mich an.«
Das Mädchen starrt mich an, als hätte sie mich gerade ausgekotzt. Alexa.
6
Menschen, die Harriet Manners hassen:
Alexa Roberts
Alexa.
Nemesis, Widersacherin, Gegnerin, Erzfeindin. Wie auch immer man jemanden nennen will, der einen abgrundtief hasst.
Ich kenne sie drei Tage länger als Nat, und ich weiß immer noch nicht, was sie eigentlich für ein Problem mit mir hat. Der einzige Schluss, zu dem ich gekommen bin, ist der, dass ihre Gefühle mir gegenüber sehr dem ähneln, was ich über Liebe gelesen habe: leidenschaftlich, ziellos, unerklärlich und vollkommen unkontrollierbar. Sie kann nicht anders, als mich zu hassen, so wie Heathcliff auch nicht anders konnte, als Cathy zu lieben. Es ist ihr Schicksal, basta.
Was ganz nett wäre, wenn sie nicht so gemein wäre.
Und ich nicht so einen Horror vor ihr hätte.
Ein paar Sekunden lang starre ich Alexa im totalen Schock an. Ich klammere mich immer noch an ihr nacktes Knie wie ein verängstigtes Affenbaby an einen Baum. »Lass los«, fährt sie mich schließlich an. »Du meine Güte.«
Ich lasse los und krieche davon, verzweifelt bemüht, mich aufzurichten. Es gibt ungefähr 13.914.291.404 Beine auf der Welt – mindestens die Hälfte davon steckt in Hosenbeinen –, und ich muss ausgerechnet ihres erwischen?
»Iiih«, erklärt sie mit lauter Stimme jedem, der es hören will, »glaubt ihr, ich hab mir was gefangen? O Gott, ich spüre es schon …« Sie kauert sich auf ihren Sitz. »Nein … das Licht … es tut weh … ich spüre, wie ich mich verändere … Plötzlich möchte ich meine Hausaufgaben machen … Zu spät!« Damit schlägt sie die Hände vors Gesicht, zieht sie wieder weg, schielt, schiebt die Zähne vor und zieht die hässlichste Grimasse, die ich je im öffentlichen Personenverkehr gesehen habe. »Neeeeein! Ich habe mich angesteckt! Ich … ich … ich bin ja …. so … laaaaangweilig!«
Die Leute fangen an zu kichern, und von irgendwo links dringt leiser Applaus an mein Ohr. Alexa verbeugt sich zweimal, zieht noch eine Grimasse und wendet sich dann wieder ihrer Zeitschriftenlektüre zu.
Meine Wangen sind hochrot, meine Hände zittern. Meine Augen fangen an zu brennen. Eine ganz normale Reaktion auf eine rituelle Demütigung. Eines möchte ich an dieser Stelle ganz klarmachen: Es macht mir nichts aus, uncool zu sein. Uncool zu sein, ist völlig in Ordnung. Klar, es ist nicht besonders beeindruckend, aber es ist ziemlich unaufdringlich. Ich könnte den ganzen Tag einfach in Ruhe uncool sein, wenn die Leute mich bloß in Ruhe ließen.
Das Problem ist, dass sie das nicht tun.
»Jetzt mal im Ernst, Alexa«, wirft Nat mit lauter Stimme ein paar Meter hinter mir ein. »Hast du als Kind feuchte Farbe geschnüffelt oder was?«
Alexa verdreht die Augen. »Huch, Barbie spricht. Lauf und spiel mit deinen vielen Schuhen, Natalie. Das hat nichts mit dir zu tun.«
Inzwischen krame ich fieberhaft in meinem Hirn nach einer passenden Bemerkung: etwas Beißendes, Scharfes, Brennendes, zutiefst Verletzendes. Etwas, womit ich Alexa eine milde Ahnung von dem Schmerz verschaffen könnte, den sie mir Tag für Tag zufügt.
»Du bist doof«, sage ich mit der leisesten Stimme, die ich je gehört habe.
Ja, denke ich, das sitzt.
Sie hat mich nicht mal gehört.
Und dann recke ich das Kinn so hoch, wie ich es kriege, gehe den Rest des Gangs runter, ohne hinzufallen, und sinke auf den Sitz neben Nat, bevor die Knie unter mir nachgeben.
Ich sitze ungefähr drei Sekunden auf meinem Platz, als der Morgen prompt beschließt, noch mehr den Bach runterzugehen. Ich habe nicht mal Zeit, vorher mein Kreuzworträtsel aufzuschlagen. So schnell geht alles.
»Harriet!«, sagt eine Stimme und über der Kopfstütze des Vordersitzes taucht ein kleines strahlendes blasses Gesicht auf. »Du bist hier! Du bist wirklich, tatsächlich, tatsächlich hier!«
Als wäre ich der Weihnachtsmann und er wäre sechs und ich wäre gerade den Schornstein runtergeklettert.
»Ja, Toby«, sage ich zögernd. »Ich bin hier.« Und dann wende ich mich zu Nat um und blicke sie finster an.
Denn es ist Toby Pilgrim.
Toby »Meine Knie geben nach, wenn ich laufe«-Pilgrim. Toby »Ich bringe meinen eigenen Bunsenbrenner mit in die Schule«-Pilgrim. Toby »Ich trage Hosenspangen an den Hosenbeinen und hab nicht mal ein Fahrrad«-Pilgrim.
Nat hätte mir sagen müssen, dass er hier sein würde.
Ich reise jetzt mit meinem eigenen Stalker nach Birmingham.
7
Also. Ich habe eine Theorie.
Stellt euch vor, ihr seid ein Eisbär und findet euch plötzlich mitten im Regenwald wieder. Da gibt es fliegende Eichhörnchen, Affen und schrillgrüne Frösche, und ihr habt keine Ahnung, wie ihr hergekommen seid und was ihr als Nächstes tun sollt. Ihr seid einsam, ihr seid verloren, ihr habt Angst, und alles, was ihr – mit absoluter Gewissheit – sagen könnt, ist, dass ihr hier nicht hingehört.
Und jetzt stellt euch vor, ihr stoßt auf einen anderen Eisbären. Und ihr seid so froh, einen anderen Eisbären zu sehen – irgendeinen Eisbären –, dass es vollkommen egal ist, was dieser Eisbär für einer ist. Ihr lauft diesem Eisbären hinterher, nur weil er kein Affe ist. Oder ein fliegendes Eichhörnchen. Er ist der einzige Grund, warum es okay ist, ein Eisbär mitten im Regenwald zu sein.
Also, so ist das mit Toby. Ein Langweiler, über alle Maßen glücklich, dass er inmitten einer Welt voller normaler Menschen einen anderen Langweiler gefunden hat. Ganz aus dem Häuschen bei dem Gedanken, dass es noch jemanden gibt wie ihn.
Es geht ihm nicht um mich. Es geht ihm nur um meine gesellschaftliche Stellung.
Beziehungsweise darum, dass ich keine habe.
Lasst mich eines hier und jetzt klarstellen: Ich werde mich nicht in jemanden verlieben, nur weil er aus demselben Holz geschnitzt ist wie ich. Ausgeschlossen.
Da bin ich lieber allein.
Oder verfalle einer unerwiderten Liebe zu einem Papagei. Oder zu einem dieser kleinen Affen mit gestreiften Schwänzen.
»Harriet!«, sagt Toby noch einmal, und ein ganz klein bisschen Popel hängt ihm aus der Nase. Er wischt ihn prompt mit dem Ärmel seines Pullovers ab und strahlt mich an. »Ich kann’s nicht glauben, dass du mitkommst!«
Ich bedenke Nat mit einem wütenden Blick, und sie grinst, blinzelt und wendet sich wieder ihrer Zeitschrift zu. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich im Augenblick nicht gerade das Gefühl, besonders mit ihr zu harmonieren. Ja, irgendwie ist mir danach, ihr mit meinem Kreuzworträtsel eins überzuziehen.
»Ja«, sage ich und versuche, ein wenig abzurücken. »Wie es aussieht, musste ich.«
»Aber ist das nicht toll?«, keucht er und klettert in seiner ungezügelten Begeisterung auf die Knie, um mich zu beeindrucken. Ich sehe, dass auf seinem T-Shirt ein Spruch steht: Am schönsten ist es auf 127.0.0.1. »Von allen Bussen der Welt steigst du ausgerechnet in meinen. Hast du gemerkt, was ich gemacht habe? Das ist ein Zitat aus Casablanca, allerdings hab ich das Wort Kaschemmen durch Bussen ersetzt.«
»Hast du, ja.«
Nat stößt ein kleines amüsiertes Prusten aus, und ich kneife sie unauffällig ins Bein.
»Weißt du, was ich heute Morgen gelernt habe, Harriet? Ich habe gelernt, dass der Begriff Faustregel ursprünglich aus der Medizin kommt. Bei Obduktionen haben Ärzte festgestellt, dass wenn man bei einer Leiche mit deren Hand eine Faust bildet, diese recht genau der Größe ihres Herzens entspricht. Ich kann dir das Buch ausleihen, wenn du willst. Allerdings ist auf Seite 143 ein Pizzafleck, um den du rumlesen musst.«
»Ähm. Gut. Danke.« Ich nicke verständnisvoll und dann hebe ich mein Kreuzworträtsel vors Gesicht, damit Toby kapiert, dass das Gespräch beendet ist.
Er kapiert’s nicht.
»Und«, fährt er fort und schiebt meine Zeitschrift runter, um mich richtig ansehen zu können. »Weißt du, was wirklich unglaublich ist?«
»Was?« Witzig, aber wenn Toby sich so benimmt, begreife ich plötzlich, warum ich andere manchmal so nerve.
»Also, hast du gewusst, dass …« Der Bus schwenkt schaukelnd auf die mittlere Spur. Toby schluckt. »… dass …«, fährt er fort und leckt sich über die Lippen. Der Bus fährt schwankend wieder auf die rechte Spur. »… dass …« Tobys Gesicht wird augenblicklich grün, und er räuspert sich. »Nicht dass du denkst, ich ließe mich leicht ablenken, Harriet«, fährt er plötzlich mit Piepsstimme fort, »aber mir ist plötzlich nicht gut. Ich hab’s nicht so mit Fahrzeugen, besonders nicht mit solchen, die fahren. Erinnerst du dich noch an den Aufsitzmäher in der ersten Klasse?«
Ich sehe ihn entsetzt an, und neben mir hört Nat augenblicklich auf zu grinsen. »O nein«, sagt sie mit tiefer Stimme. »Nein, nein.« Offensichtlich erinnert sie sich auch noch daran.
»Also, Harriet«, fährt Toby fort und leckt sich wieder die Lippen. Seine Farbe wird noch komischer. »Ich glaube, wir müssen den Bus anhalten.«
»Toby«, fährt Nat ihn in tiefem, warnendem Tonfall an, »atme durch die Nase ein und aus durch den …«
Doch es ist zu spät. Der Bus macht noch eine ruckartige Bewegung, und Toby wirft mir – wie in Zeitlupe – einen zutiefst entschuldigenden Blick zu.
Und dann kotzt er mir in den Schoß.
8
Ja.
Falls ihr euch wundert. Das hat Toby auch auf dem Aufsitzmäher in der ersten Klasse gemacht. Genau das, außer dass er seinen Horizont diesmal im wahrsten Sinne des Wortes erweitert und Nat ebenfalls getroffen hat.
Sie ist gar nicht begeistert.
Ich meine, ich bin auch nicht gerade begeistert. Ich bin nicht scharf darauf, vom Mageninhalt anderer Menschen getroffen zu werden. Aber Nat ist alles andere als glücklich.
Sie ist sogar so unglücklich, dass sie Toby immer noch anschreit, als der Bus zweieinhalb Stunden später vor der Clothes Show auf dem Messegelände in Birmingham vorfährt. Und Toby erzählt uns beiden immer noch, dass es ihm jetzt viel besser geht: »Ist es nicht witzig, dass man sich gleich wieder gut fühlt, sobald man mal gekotzt hat?«
»Nicht zu fassen!«, schimpft Nat und stapft über den Parkplatz. Wir tragen jetzt beide Sportklamotten. Ein Glück, dass zwei von den Jungen direkt nach dem Schulausflug Fußballtraining haben und Miss Fletcher sie – nach langem Protest – überreden konnte, uns für den Tag ihre Trikots zu leihen. Und so tragen wir jetzt orangefarbene Fußball-T-Shirts, grüne Fußball-Shorts und weiße Kniestrümpfe.
Also, mir gefällt’s. Ich fühle mich darin sehr sportlich.
Nat ist nicht ganz so begeistert. Wir hatten natürlich keine anderen Schuhe dabei und meine Turnschuhe sehen dazu ganz normal aus, aber Nats rote hochhackige … na ja, nicht so.
»Weißt du, wie lange ich heute Morgen gebraucht habe, um mein Outfit zusammenzustellen?«, fährt sie Toby an, als wir uns dem Eingang nähern.
Toby denkt darüber nach, als wäre es keine rhetorische Frage. »Zwanzig Minuten?«, meint er. Nats Gesicht färbt sich in Richtung Puterrot. »Dreißig?« Nats Kiefer zuckt. »Anderthalb Stunden?«
»Sehr lange!«, brüllt sie. »Sehr, sehr lange!« Nat sieht an sich hinunter. »Ich hatte ein funkelnagelneues Kleid ausgesucht und meine lieblingshochhackigen und Leggins von American Apparel, Toby. Weißt du, was die kosten? Und ich habe ein Parfüm von Prada aufgelegt.« Sie reibt den grünen Nylonstoff der Shorts zwischen den Fingern. »Und jetzt trage ich ein Fußballtrikot von den Jungs und rieche nach Kotze!«
Ich tätschle ihr so tröstlich wie möglich den Arm.
»Wenigstens war meine Kotze schokoladig«, sagt Toby fröhlich. »Ich hatte Choco Krispies zum Frühstück.«
Nat knirscht mit den Zähnen.
»Egal«, fährt Toby unbekümmert fort, »ich finde, ihr seht toll aus. Ihr tragt denselben Look. Das ist ultratrendy.«
Nat schürzt die Lippen, ballt die Hände zu Fäusten und zieht die Augenbrauen dicht zusammen. Als würde man zusehen, wie jemand eine Flasche mit einem kohlesäurehaltigen Getränk schüttelt, ohne sie zu öffnen. »Toby«, sagt sie mit einem leisen Zischen. »Verschwinde. Augenblicklich.«
»Okay«, meint Toby. »Irgendwohin im Speziellen?«
»Irgendwohin. Verschwinde einfach. SOFORT.«
»Toby«, sage ich leise und fasse ihn am Arm. Ich bange wirklich um seine Sicherheit. »Ich glaube du gehst besser schon mal rein.« Ich werfe einen Blick auf Nat. »So schnell du kannst«, füge ich hinzu.
»Aha.« Toby denkt ein paar Sekunden darüber nach und nickt. »Aha. Verstehe. Kein großer Fan von Kotze, Natalie? Nein. Eher nicht. Dann sehen wir uns später.«
Und er verschwindet durch die Drehtür – nicht ohne mir über die Schulter etwas zuzuwerfen, was bedenklich nach einem Augenzwinkern aussieht.
Sobald er fort ist und in Sicherheit und ich weiß, dass Nat ihm nicht mehr den Kopf abreißen und an einen Taubenschwarm verfüttern kann, wende ich mich zu ihr um.
»Nat«, sage ich vorsichtig. »So schlimm ist es doch gar nicht. Ehrlich. Wir riechen gut. Und wenn du meinen Mantel überziehst, sieht niemand, was du anhast. Er ist länger als deiner.«
»Du kapierst es nicht.« Plötzlich löst sich ihre ganze Wut in Luft auf, und sie ist nur noch kreuzunglücklich. »Du kapierst es einfach nicht, Harriet.«
Ich finde, Nat unterschätzt mein Einfühlungsvermögen. Was schade ist, denn ich bin ein sehr empathischer Mensch.
Em-pa-thisch. Nicht pa-the-tisch.
»Logisch kapier ich es«, sage ich beruhigend. »Du magst Fußball nicht. Das ist mir schon klar.«
»Darum geht es doch gar nicht. Verstehst du das nicht, Harriet? Heute ist ein ganz wichtiger Tag. An dem es ganz besonders wichtig ist, gut auszusehen.«
Ich glotze sie verständnislos an. Nach ein paar Sekunden verdreht Nat die Augen und schlägt sich frustriert mit der Hand an die Stirn. »Sie sind da drin.«
Ich schaue auf die Drehtüren. »Wer?«, flüstere ich entsetzt und überlege ein paar Sekunden. »Vampire?«
»Vampire?« Nat sieht mich bestürzt an. »Harriet, du musst endlich mal ein paar anständige Bücher lesen.«
Ich weiß gar nicht, was sie da redet. Dass ich viele Bücher über Dinge besitze, die es in der wirklichen Welt eigentlich nicht gibt, heißt doch nicht, dass ich nicht mit beiden Beinen fest auf der Erde stehe. Denn das tue ich.
»Okay, wer dann?« Geister?
Nat atmet tief durch. »Harriet, ich war’s«, sagt sie und weicht meinem Blick aus. »Ich habe Jo die Garnelen ins Essen getan.«
Ich glotze sie verständnislos an. »Nat! Warum? Warum hast du das getan?«
»Weil ich dich heute brauche«, sagt sie ganz leise. »Ich brauche dich zur Unterstützung. Denn sie sind da drin.« Wieder richtet sie den Blick auf die Türen und schluckt.
»Wer?«
»Modelagenten, Harriet«, sagt Nat, als wäre ich vollkommen idiotisch. »Haufenweise Modelagenten.«
»Oh«, sage ich belämmert und überlege. »Ooooooooh.«
Denn ich kapiere endlich, warum ich hier bin.
9
Wir waren sieben, als Nat beschloss, sie wolle Model werden.
»Himmel«, sagte eine Mutter bei einer Schuldisco. »Natalie. Du wächst zu einer wahren Schönheit heran. Vielleicht kannst du ja Model werden, wenn du mal groß bist.«
Ich war gerade dabei, die Taschen meines Partykleids mit Schokoladenkuchen und Fruchtgummis vollzustopfen, doch da hielt ich inne. »Ein Modell von was?«, fragte ich neugierig. Und meine gierige kleine Hand schoss vor, um sich eine Mini-Biskuitrolle zu schnappen. »Ich habe ein Modell-Flugzeug«, fügte ich stolz hinzu.
Die Mutter bedachte mich mit einem Blick, den ich inzwischen schon gewohnt war.
»Ein Model«, erklärte sie Nat, »ist jemand, Mädchen oder Junge, der absurde Mengen Geld dafür bekommt, dass er Kleider trägt, die ihm nicht gehören, und sich fotografieren lässt.«
Ich schaute Nat an und sah schon, wie ihre Augen anfingen zu glänzen: Die Saat des Traums war gesät.
»Bleibt nur zu hoffen, dass du groß und dünn wirst«, fügte die Mutter bitter hinzu. »Denn wenn du mich fragst, sehen die alle aus wie Aliens.«
An diesem Punkt nahm Nat die Schokoladenkuchen wieder aus ihren Taschen und hockte den Rest des Abends auf dem Fußboden, während ich an ihren Füßen zog, damit ihre Beine länger wurden.
Und ich redete den Rest des Abends unermüdlich über Raumfahrt.
Endlich ist der Tag gekommen.
Acht Jahre Vogue kaufen und keinen Nachtisch essen (Nat, ich nicht, ich esse ihren) und endlich haben wir es geschafft: Wir sind am Ziel von Nats Bestimmung. Ich fühle mich ein bisschen wie Sam in Herr der Ringe, kurz bevor Frodo den Ring in die Flammen des Schicksalsbergs wirft. Allerdings positiver, ja, geradezu magisch gestimmt. Mit nicht ganz so haarigen Füßen.
Doch Nat wirkt gar nicht so enthusiastisch, wie ich erwartet hätte. Sie wirkt eher eingeschüchtert und steif wie ein Brett: In meinen Mantel gehüllt steht sie reglos mitten im Eingang zum Messezentrum und starrt auf die Menschenmenge, als sei diese ein Teich voller Fische und Nat eine sehr hungrige Katze. Ehrlich, ich bin mir nicht mal sicher, ob sie noch atmet. Nach ein paar Minuten bin ich versucht, das Ohr an ihre Brust zu legen, um mal nachzuhören.
Allerdings geht sie es auch ganz falsch an.
Ich weiß – dank der Lektüre vieler Bücher und der Mitgliedschaft in einem Internetforum – sehr viel über Geschichten und Magie, und die grundlegendendste Regel lautet: Es muss überraschend kommen. Niemand ist in einen Schrank gesprungen, um Narnia zu finden. Sie sind nicht den Wunderweltenbaum hochgeklettert, weil sie wussten, dass es ein Wunderweltenbaum war, sie dachten, es wäre bloß ein sehr großer Baum. Harry Potter hat sich für einen ganz normalen Jungen gehalten, Mary Poppins war eigentlich ein ganz normales Kindermädchen.
Es ist die erste und einzige Regel: Magie geschieht dann, wenn niemand damit rechnet.
Doch Nat sucht danach, und je angestrengter sie sucht, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass sie geschieht. Mit ihrem wissenden, lauernden Schwingungen verscheucht sie die Modemagie förmlich.
»Komm«, sage ich und versuche sie abzulenken, indem ich an ihrem (genauer gesagt, meinem) Mantelärmel ziehe. Ich muss ihre Gedanken nur auf etwas anderes bringen, damit die Magie ihre Wirkung entfalten kann. »Lass uns reingehen und shoppen, ja?«
»Mhm.«
Ich glaube, sie hört mich gar nicht mehr. »Sieh mal!«, sage ich begeistert und zerre sie an den erstbesten Stand. »Nat, schau! Handtaschen! Schuhe! Haargummis!«
Nat bedenkt mich mit einem abwesenden Blick. »Du schleifst meinen Mantel über den Boden.«
»Oh.« Ich ziehe ihn wieder über meinen Arm und zerre Nat – mit dem anderen, freien Arm – zum nächsten Stand.

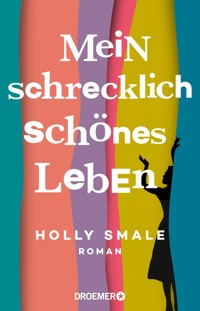


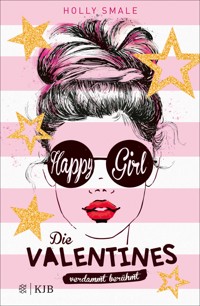













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










