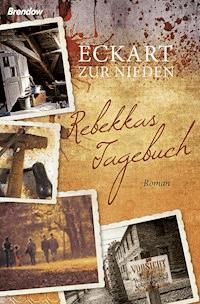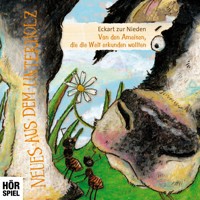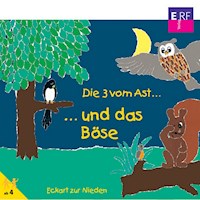Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Markus Tanner, genannt Mecki, gehört zu einer internationalen Bande von Autodieben, die gestohlene Wagen in den Nahen Osten verschachert. Bezahlt wird mit Rauschgift … Mecki will aussteigen. Doch das ist leichter gedacht als getan, denn seine Bande würde dann alles tun, um ihn unschädlich zu machen. Der Diakon und Sozialarbeiter Rolf Degemann, der unter Drogensüchtigen arbeitet, ist seine letzte Rettung. Bei ihm taucht er unter. Degemann bringt ihn sogar aus der Gefahrenzone. Aber er hat sich in der Gefährlichkeit der Bande getäuscht. Sie entführt seinen Sohn und will ihn erpressen. Außerdem kommt sie Mecki bald auf die Spur. Die Ereignisse überstürzen sich, ehe die Polizei eingreifen kann. Rolf Degemann gerät in große Gefahr. Für Mecki wird die Liebe seines Beschützers zur Anfrage an sein eigenes Leben, ja bringt ihn ins Fragen nach Gott, dem Geber dieser selbstlosen Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gefährlicher Ausstieg
Eine Kriminalgeschichte
Eckart zur Nieden
Impressum
© 2014 Folgen Verlag, Wensin
Autor: Eckar zur Nieden
Cover: Eduard Rempel, Düren
Lektorat: Jennifer Rempel, Düren
ISBN: 978-3-944187-60-0
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Gefärhlicher Ausstieg ist früher als Buch im im Christlichen Verlagshaus, Stuttgart, erschienen.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 1
Markus Tanner las noch einmal durch, was er eben geschrieben hatte. »Geschrieben« ist ein schmeichelhaftes Wort. Er hatte es so hastig hingeschmiert, dass er es selbst kaum entziffern konnte.
Dann setzte er seinen Namen unten rechts auf das Blatt. Er schrieb nicht »Mecki«, so wie sie ihn alle nannten, sondern Markus.
Mit zitternden Händen faltete er das Papier zusammen. Dabei knickte er es so schief, dass er es kaum in den weißen Umschlag hineinbekam. Schließlich gelang es. Er befeuchtete die Lasche mit der Zunge und klebte den Brief zu.
Markus steckte den Umschlag in die Innentasche seiner Jacke aus schwarzer Lederimitation, sprang auf, fuhr sich mit den fünf Fingern durch seine dunkelblonden Locken, wie es seine Gewohnheit war, und sah sich noch einmal im Zimmer um.
Auf dem Tisch lag das restliche Geld für die Miete. Daneben ein Zettel mit der Kündigung und der Hausschlüssel. Gut so.
Er griff nach der schweren Reisetasche und hängte sich mit der anderen Hand die Umhängetasche über die Schulter. Dann ging er zum Fenster und sah hinaus.
Der hellgrüne Mercedes stand noch da. »Warum sollte er auch nicht?«, dachte Markus Tanner. »Niemand kann Verdacht schöpfen. Ich habe die Wagen niemals hierher gebracht, wie sie es mir eingeschärft haben. Dies war eine Ausnahme. Das erste und das letzte Mal. Endgültig.«
Markus zwängte sich mit seinen beiden Gepäckstücken durch die Tür. Niemand war im Flur. Möglichst leise ging er die Treppe hinunter. An der Haustür sah er kurz nach beiden Seiten, dann ging er zu dem Wagen hinüber, öffnete die Tür und warf seine Taschen auf den Beifahrersitz. Dann setzte er sich hinein, schloss die Tür und machte sich am Zündschloss zu schaffen. Als der Motor lief, fuhr er davon.
Durch eine Vielzahl von Straßen ging die Fahrt bis in einen der weniger verkehrsreichen Vororte. Dort stellte er den Mercedes in einer Seitenstraße ab, die von einer Doppelreihe prächtiger Linden überdacht wurde. Vor den alten Villen zu beiden Seiten der Allee standen in den Gärten weitere Bäume.
Markus Tanner stieg mit seinem Gepäck aus. Dann sah er sich nach allen Seiten um, beugte sich noch einmal in den Wagen und legte seinen Brief auf den Fahrersitz. Er warf die Tür zu, ohne sie zu verschließen, und ging mit eiligen Schritten die Straße hinunter.
Mittags war der Verkehr durch die Frankfurter Innenstadt immer besonders schlimm.
Rolf Degemann kurbelte die Seitenscheibe seines altertümlichen VW-Käfers wieder hoch. Es war zwar heiß, aber der Auspuffgestank in der Schlange vor der roten Ampel war noch schlimmer. Zum Ausgleich krempelte er die Ärmel seines karierten Hemdes hoch.
»Ob er wohl heute wieder da ist, der junge Mann mit den dunkelblonden Locken?« Rolf Degemanns Gedanken schweiften ab – die Autoschlange bewegte sich sowieso nicht. Er ging noch einmal die verschiedenen Begegnungen mit dem jungen Mann durch, dessen Namen er nicht einmal kannte.
Es musste wohl zwei Wochen her sein, dass er zum ersten Mal in der Teestube aufgetaucht war. Einer der freiwilligen Helfer, die jeden Tag viele Stunden opferten für Gespräche mit den »Gästen«, hatte ihn zu Rolf gebracht. Eine Weile hatte der Lockenkopf ihn angesehen und dann gefragt: »Sie sind der Dekan?«
»Der Diakon!« hatte Rolf verbessert und sich bemüht, nicht zu lachen. »Aber du kannst ruhig ›du‹ zu mir sagen. Ich heiße Rolf.« Aber der andere war merkwürdig reserviert geblieben.
Auch nach mehreren Gesprächen an verschiedenen Tagen hatte Rolf nicht gewusst, was der junge Mann denn nun eigentlich wollte. Irgendwie schien er auch nicht so ganz zu der Zielgruppe zu gehören, um die sie sich in der Teestube bemühten: Rauschgiftsüchtige, Alkoholgefährdete, junge Leute, die von zu Hause fortgelaufen waren und in der Großstadt zu versacken drohten. Der Lockenkopf war ordentlicher angezogen und wirkte durchaus nicht heruntergekommen. Seine vielen Fragen waren gezielt und konkret. In machen Dingen war er sehr selbstsicher – ohne das nur vorzuspielen, wie das die anderen oft taten – aber an anderen Stellen war auch seine Hilflosigkeit deutlich erkennbar, und er bemühte sich auch nicht, sie zu verbergen.
Doch es waren interessante Gespräche gewesen, oft bis in die späte Nacht. Aber wer er eigentlich war und was er suchte -, hatte der Diakon und Sozialarbeiter bisher nicht herausbekommen.
Die Ampel schaltete schon wieder auf Rot, ehe die Vorwärtsbewegung bis zu dem alten VW gekommen war. Es ging vierzig Meter weiter, dann standen sie wieder.
Wie gut müssen es die Leute haben, dachte Rolf Degemann, die irgendwo draußen arbeiten. Aber so eine Teestube musste nun mal in der Stadtmitte sein, sonst fanden die nicht hin, die man aufnehmen wollte. Und in der Natur der Sache lag es auch, dass er immer erst um die Mittagszeit mit seinem Dienst begann und dann meistens bis in die Nacht beschäftigt war. Die Rückfahrt war dann nicht so eine Quälerei durch den Verkehr wie die Hinfahrt.
Der große, sehnige Mann mit seinem viel zu kleinen Auto kurbelte das Fenster wieder runter. Diese Hitze war ja kaum auszuhalten!
Ob der Lockenkopf wieder kommen würde? Er hatte sich gestern ganz genau erkundigt, ob er, Rolf, heute da wäre. Mehrmals hatte er nachgefragt, ob das auch ganz sicher sei. Das musste doch einen Grund haben!
Jetzt setzte sich die Autoschlange wieder in Bewegung. Rolf Degemann schaffte es noch. Mit den Augenwinkeln sah er beim Vorbeifahren, dass die Ampel wieder auf Gelb schaltete.
Nun war es nicht mehr weit.
Er bog in die nächste Nebenstraße rechts ein, dann noch einmal nach links – da war das alte Haus.
Rolf stieg aus und öffnete das Schloss und die Kette, die verhindern sollte, dass Fremde sich auf den kostbaren Parkplatz stellten. Er fuhr den Weg bis nach hinten, so dass noch zwei weitere Fahrzeuge der Helfer hinter ihm würden parken können. Da er sowieso immer der letzte war, der nachts das Haus verließ, war es so das Beste.
Als Rolf Degemann am Eingang vorbeifuhr, sah er den jungen Mann schon. Er saß vor der verschlossenen Tür auf den Stufen und hatte Gepäck neben sich stehen.
»Hallo!«, sagte Rolf und reichte dem anderen die Hand. Der nahm sie und lächelte etwas verlegen. »Hallo!«
»Du bist aber früh heute!«
»Ja«, sagte er nur, und Degemann merkte, dass es wohl eine wichtige Sache war, über die er nicht auf der Treppe reden wollte.
Der Diakon schloss auf, ging hinein und öffnete zwei Fenster, um den Geruch von gestern Abend hinausziehen zu lassen. Es sah noch ziemlich wüst aus. Tassen und Gläser standen herum. Tische und Stühle waren so verschoben, dass man nicht mehr erkennen konnte, nach welchem System sie einmal angeordnet gewesen waren.
Rolf begann mit den Aufräumarbeiten und rief über die Schulter: »Hilfst du mir ein bisschen?« Er hatte sehr wohl bemerkt, dass den jungen Mann etwas bedrückte. Aber seine Erfahrung war, dass es sich viel leichter reden lässt, wenn man dabei mit irgendetwas hantiert.
In diesem Fall war es anscheinend anders. Der Lockenkopf sammelte die Gläser ein und sagte nichts. Degemann schien es, als wolle er sich beeilen, damit er schnell fertig würde. »Ach komm«, sagte er darum, »ich habe noch keine Lust zum Aufräumen. Wir setzen uns hin und unterhalten uns ein bisschen. Einverstanden?«
Der andere nickte. Sie zogen zwei Stühle heran und setzten sich neben eines der offenen Fenster.
Da der junge Gast schwieg, meinte Rolf: »Du hast mir überhaupt noch nicht gesagt, wie du heißt. Ich hab' dich schon mal danach gefragt und keine Antwort gekriegt. Du musst es natürlich nicht sagen …«
»Markus Tanner heiße ich.«
Es kam Rolf so vor, als sei der Name wie ein Korken aus der Flasche gerutscht, und nun flossen die Worte immer schneller hinterher.
»Ich hab' ein Problem. Ein ziemlich Großes. Ich bin hergekommen, weil ich hoffe, dass du mir helfen kannst. Und dass du auch willst. Es ist nicht ganz einfach.«
»Wenn ich kann, helfe ich dir gerne.«
»Ich – ich habe Dinge gemacht, die – na ja, die nicht erlaubt sind. Aber ich will aufhören. Ich kann einfach nicht mehr mitmachen. Ich wusste das eigentlich schon immer. Aber was du mir alles so gesagt hast in den letzten Tagen, das hat mich noch bestärkt in meinem Entschluss. Ich muss aussteigen.«
»Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich alles gesagt habe.«
»Du hast nicht Moral gepredigt. Du hast aber davon geredet, dass es eine Chance gibt, neu anzufangen. Durch Gott. So ähnlich hast du's gesagt.«
Er schwieg, und Degemann empfand, dass eine Bestätigung an dieser Stelle nicht nötig wäre. Er nickte nur leicht.
»Ich weiß ja nicht, ob Gott, wenn es den gibt, mir hilft. Aber ich hatte den Eindruck, wenigstens du könntest mir helfen. Ich bin fast jeden Abend hier gewesen, eigentlich nur, um dich besser kennenzulernen. Ich musste sicher sein, dass du mich nicht fallenlässt, wenn ich den Absprung wage.«
Wieder nickte Rolf nur. Als der andere nicht weitersprach, fragte er: »Und jetzt willst du abspringen?«
»Ich bin schon.«
»Du bist schon abgesprungen?«
»Es gibt kein Zurück mehr. Wenn du mich fallenlässt, stürze ich ab.« Seine Stimme zitterte.
Rolf beugte sich vor und stützte die Ellenbogen auf die Knie. »Sprich nicht in Bildern, Markus, sondern sag' mir klar, was los ist. Ich verspreche dir, dass ich alles tun werde, um dir zu helfen.«
»Du bist doch so was ähnliches wie ein Pfarrer, nicht?« – »So was ähnliches, ja.«
»Bei euch gibt es doch ein Beichtgeheimnis?«
»Natürlich. Was du mir erzählst, bleibt ganz unter uns. Du kannst dich darauf verlassen.«
Es war, als wäre damit das schwierigste Problem gelöst, denn Markus Tanner redete jetzt ganz frei.
»Ich hab' zu einer Bande von Autodieben gehört. Nicht kleine Diebe, verstehst du, sondern eine richtige große Organisation. Wir haben teure Wagen geklaut, umgearbeitet und in den Nahen Osten verschoben. Bezahlt wurde mit Rauschgift. Aber über den Dealerring, der da noch dranhängt, weiß ich nichts Näheres.«
»Und die Polizei …?«
»Weiß von nichts. Sag' bitte nicht, ich soll zur Polizei gehen. Das kann ich nicht. Die brummen mir sicher ein paar Jahre auf.«
»Hm«, machte Rolf, und dachte angestrengt nach, wie er dem anderen die Wahrheit sagen könnte, ohne ihn vor den Kopf zu stoßen. »Weißt du, Markus, ich helfe dir gerne. Das kannst du mir wirklich glauben. Wenn ich zum Mitwisser von Verbrechen würde und das für mich behalten und damit decken würde, dann täte ich das zwar ungern. Aber um dir zu helfen, würde ich das tun. Nur – ob dir so wirklich zu helfen ist? Ich meine, es gibt keinen Neuanfang – das willst du doch, einen Neuanfang, nicht? Es gibt keinen Neuanfang, wenn du mit der Vergangenheit nicht klaren Tisch machen willst.«
Markus nickte kaum merklich und schwieg. Erst nach einer Weile sagte er leise: »Ich weiß.« Dann blickte er auf und sah Rolf an. »Lass mir Zeit, bitte! Ich … ich will darüber nachdenken. Ich muss mir erst schlüssig werden.«
»Okay, Markus. Ich dränge dich nicht. Aber was versprichst du dir dann von mir? Wie kann ich dir helfen?«
Der junge Mann blickte wieder zu Boden. »Ich weiß, es ist ein bisschen unverschämt, was ich dich bitten wollte: Kannst du mich verstecken? Kannst du mich ein paar Wochen irgendwo unterbringen?«
»Verstecken? Aber Markus …«
»Sag' nichts! Hör' dir erst bitte alles an, ehe du antwortest!«
Rolf nickte. Der Lockenkopf fuhr nach einigen Augenblicken des Überlegens fort: »Ich war mittendrin. Dreimal war ich selbst im Nahen Osten. Natürlich kenne ich bei weitem nicht alle Geheimnisse der Organisation. O nein, dafür sind die viel zu schlau. Außer ein paar Spitzenleuten gibt es keinen, der die Zusammenhänge kennt, die Namen, die Adressen. Aber ich weiß immerhin so viel, dass ich ihnen ziemlich großen Schaden zufügen könnte. Und das werden sie nicht zulassen. Wenn sie wissen, dass ich abspringe, dann – dann bringen sie mich um.«
»Na, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Hast du da nicht zu viel Angst?«
»Ich hoffe ja auch, dass sie es nicht so weit treiben. Aber was sollten sie sonst mit mir machen? Sie müssen mich zum Schweigen bringen! Außerdem drohen sie es jedem an, der bei ihnen einsteigt.«
»Dir haben sie es also auch angedroht?«
»Natürlich! Zweimal, sehr deutlich! Erst, als ich anfing, für sie Autos zu klauen, und dann, bevor sie mich zum ersten Mal in den Nahen Osten schickten.«
»Du hast also auch Autos geklaut?«
»Das war mein Hauptjob. Ich war ziemlich geschickt dabei. Und da haben sie mir eines Tages telefonisch gesagt, ich hätte die Chance, noch viel mehr zu verdienen. Sie hätten Vertrauen zu mir, dass ich das richtig mache. Na ja, und dann kam die Sache mit der Fahrt durch den Balkan über den Bosporus … Ich muss gestehen, dass mich die Sache nicht nur gereizt hat, weil da viel zu verdienen war. Es war eben ein Abenteuer.«
»Wann war das?«
»Voriges Jahr und Anfang dieses Jahres. Zwischendurch habe ich dann hier immer wieder Autos besorgt. Bis heute morgen. Da hab' ich das letzte gestohlen und abgeliefert.« – »Heute morgen noch?«
»Ich musste doch! Ich habe zwar lange schon die Absicht gehabt aufzuhören. Und der Entschluss wurde immer fester. Aber ich durfte doch keinen Verdacht erregen. Und darum hab' ich heute den letzten Mercedes an dem vereinbarten Punkt abgestellt, in der Lindenallee. Da stellen wir immer die Autos ab, die anderen auch. Abends oder in der Nacht holt sie dann jemand ab. Dann werden sie anders lackiert, die Nummern werden abgeschliffen und neu eingeschlagen, neue Papiere werden ausgestellt …«
»Und du weißt nicht, wo sie das machen?«
»Nein. Ich kenne auch keinen.«
»Hast du ihnen am Telefon gesagt, dass du aufhören willst?«
»Ich hab' einen Brief ins Auto gelegt.«
Degemann stützte das Kinn auf die Fäuste und dachte angestrengt nach. Er hatte in seiner Arbeit schon eine Menge Probleme zu bewältigen gehabt. Aber dieses hier war neu.
Nach einer Weile wurde Markus Tanner unruhig. »Willst du mir nicht helfen? Ich habe mich fest darauf verlassen! Ich habe dir vertraut. Du hast selbst einmal gesagt, Christentum wäre nicht eine Sache frommer Worte, sondern des praktischen Lebens. Und ich hatte den Eindruck: der Mann ist echt, der redet nicht nur so daher, auf den kannst du dich verlassen …«
»Sei still, Markus!« Rolf konnte die Angst in der Stimme des jungen Mannes mitschwingen hören und in seinen Augen sehen. »Ich habe dir versprochen zu helfen, und das tue ich auch. Du kannst dich darauf verlassen. Nur musst du mir ein bisschen Zeit zum Nachdenken lassen.«
Rolf zwang sich selbst zur Ruhe, aber er konnte nicht verhindern, dass er aufsprang und im Raum hin und her ging. Dann blieb er vor Markus stehen.
»Wissen die, dass du in letzter Zeit oft hier warst?«
»Nein. Kann ich mir jedenfalls nicht denken. Ich habe ja allein gewohnt.«
»Hm. Hast du Verwandte?«
»Meine Eltern leben in Heidelberg. Aber wir haben eigentlich kaum Verbindung. Ich hab' früher immer gesagt, das sind richtige Spießer. Inzwischen – na, inzwischen würde ich es vielleicht nicht mehr so ausdrücken. Aber verstehen würden wir uns trotzdem nicht. Außerdem – zu denen kann ich nicht. Die Organisation kennt die Adresse. Da würden sie mich schnell finden.«
»Ich muss mal telefonieren«, sagte Rolf langsam, überlegend. »Ich habe eine Schwester, die lebt auf einem Bauernhof in der Rhön.«
Er ging ins Nebenzimmer, wo das Telefon stand, ließ aber die Tür offen. Markus hörte, wie er wählte.
»Grüß dich, Gisela, hier ist Rolf … Ach, gut, im Großen und Ganzen … Der kommt gut mit in der Schule, macht uns Freude. Natürlich auch mal Sorgen, wo gab's das nicht mit Kindern. Aber wir haben keinen Grund zu klagen, Anke und ich … Danke … Du, Gisela, weshalb ich anrufe: Ich habe eine große Bitte. Bei mir ist ein junger Mann, der… ja, der mal für einige Zeit aus Frankfurt raus muss. Ob der sich mal eine Weile bei euch aufhalten könnte? Er kann in der Dachkammer wohnen, anspruchsvoll ist er nicht. Und wenn ihr eine Arbeit für ihn habt, packt er sicher auch mit an. … Das wäre … Aber frag' erst Klaus, ehe du zusagst. Ich möchte nicht, dass es dann nachher Ärger gibt. Ich meine, er soll auch ein volles Ja dazu haben … Wann kommt er zurück? … Gut, dann rufe ich so etwa in einer dreiviertel Stunde noch mal an, ja? … Okay, bis gleich!«
Markus hörte, wie aufgelegt und neu gewählt wurde. »Rolf ist hier. Du, Andreas, könntest du heute ein bisschen früher kommen? Ich muss nachher unbedingt für etwa zwei Stunden weg … So früh wie möglich … Deine Schulaufgaben kannst du ja hier machen. Um die Zeit kommt meistens noch keiner. Es ist ja nur, dass einer da ist, wenn das Haus aufgeschlossen ist … Okay, ich rechne mit dir. Danke!«
Rolf kam zurück. »Es klappt wahrscheinlich. Ich kriege nachher noch Bescheid.«
»Das wäre prima. Ich helfe gern auf dem Bauernhof. Von Landwirtschaft verstehe ich zwar nichts, aber vielleicht kann ich irgendwas reparieren.«
Beide standen voreinander und sahen sich an.
Dann stieß Markus leise heraus: »Du ahnst gar nicht, Rolf, wie dankbar ich dir bin!«
Zwei Männer standen auf dem Bürgersteig gegenüber der Teestube. Es war noch nicht ganz dunkel, aber die Hitze hatte nachgelassen.
Eine Weile beobachteten sie das Haus. Dann stieß einer den anderen an, und sie gingen hinüber.
Am Eingang sprach sie jemand freundlich an: »Trinkt ihr Tee? Cola? Kommt 'rein!«
Die beiden Männer versuchten, freundlich zurück zu lächeln, was aber nicht besonders gut gelang. Der junge Mann an der Tür hatte den Eindruck, dass es mehr nach verzerrtem Grinsen aussah.
Die beiden Männer – der eine breitschultrig und muskulös, der andere eher schlaksig – sahen sich im Raum um. Offenbar fanden sie nicht, was sie suchten, denn sie setzten sich an einen der Tische und musterten dabei weiter die Menschen, die den Raum füllten.
Der junge Mann, der sie am Eingang begrüßt hatte, zog sich einen Stuhl vom Nachbartisch heran und fragte, während er sich zu den beiden setzte: »Sucht ihr jemanden?«
»Einen jungen Mann«, gab der Schlaksige zur Antwort, »er heißt Mecki.«
»Mecki? Kenne ich nicht.«
»Oder eigentlich: Markus.«
Der Gefragte zuckte die Achseln.
Der Breitschultrige sagte, und es klang fast wie ein Vorwurf: »Er soll aber hier sein. Er wäre oft hier, hat uns jemand gesagt.«
»Wie sieht er denn aus?«
»Na – wie sieht er aus … Also er ist mittelgroß, hat so Locken, den ganzen Kopf voll, nicht ganz schwarz, aber auch nicht richtig blond. Und meistens hat er 'ne Lederjacke an.«
»Ach der! Ja, den kenne ich. Nein, heute ist er nicht da.« – »Und du weißt nicht, wo wir ihn finden können?«
»Er war heute schon mal hier. Aber er ist mit Rolf Degemann weggefahren. Das ist der Diakon, der hier die Leitung hat. Ich weiß nicht, wo sie hingefahren sind.«
Der Dünne bohrte weiter: »Wie können wir denn diesen Rolf Dingsda erreichen?«
»Rolf Degemann. Wenn ihr wartet – er kommt noch mal her, heute Abend. Hat er jedenfalls gesagt.«
»Okay, dann warten wir.«
Damit wandte er sich so deutlich von dem jungen Mann ab, dass nicht zu übersehen war: Er sah die Unterredung als beendet an.
»Mach's gut, Andreas. Und nochmals vielen Dank, dass du gekommen bist!« Degemann drückte dem jungen Mann an der Tür die Hand.
»Nichts zu danken. Ich habe ja meine Hausaufgaben hier machen können. Solange noch kein Betrieb ist, geht das besser als zu Hause. Bei zwei so lebhaften Schwestern ist immer was los, weiß du.«
»Grüß' zu Hause. Ich räume hier schon mal ein bisschen auf, und dann, denke ich, werden die paar Leute auch bald gehen.«
»Ach übrigens, haben die beiden Männer dich gesprochen?«
»Was für Männer?«
»Da waren zwei Männer, die suchten einen gewissen Markus. Das war doch der, der mit dir im Auto weggefahren ist – oder?«
»Die suchten Markus?« Rolf schoss das Blut in den Kopf. »Was hast du, Rolf? Was ist mit Markus und mit den Männern?«
»Hast du ihnen gesagt, dass er hier war?«
»Ja, ich hab' ihn doch gesehen! Ich wußte ja nicht … Hätte ich das nicht sagen sollen?«
»Schon gut. Ich bin schuld. Ich hätte dran denken sollen, dich auf diese Situation vorzubereiten.«
»Aber was bedeutet das alles? Warum sollen sie nicht wissen, dass er hier war?«
»Du, nimm's mir nicht übel, Andreas, aber es ist besser, wenn ich dir das nicht erzähle.«
»Schon gut, Rolf. Ich gehe dann. Und wenn du mal wieder Hilfe brauchst – ein Anruf genügt.«
Rolf nickte nur und wandte sich ab. Ängstliche und wirre Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Er hatte die Befürchtungen von Markus nicht so ganz ernst genommen. »Einen Mitwisser umlegen – das hörte sich so nach dem Chicago der dreißiger Jahre an, aber hier…« Natürlich gab es auch Verbrecherbanden in Frankfurt, aber – nun ja, Rolf konnte es sich einfach nicht vorstellen. »Aber was man sich nicht vorstellen kann, ist deshalb noch lange nicht ausgeschlossen«, dachte er. Und je länger er grübelte, desto mehr zerrannen ihm alle Gegenargumente. Wenn alles wirklich so war, wie Markus gesagt hatte, dann war es nur wahrscheinlich – na ja, zumindest, dass sie ihn kriegen wollten. Und wenn nun diese zwei Männer nach ihm suchten.. .
Andreas fuhr auf seinem Fahrrad davon. Rolf sah ihm nach. Unwillkürlich suchte er mit den Augen die Straße ab. Nichts Auffälliges war zu sehen. Es war auch trotz der späten Stunde noch Betrieb. Eigentlich konnte ihm nichts passieren.
Seine Gedanken wanderten zu Markus. Ein netter Junge! Das hatten auch seine Schwester und sein Schwager gefunden. Schade, dass er in diese Sache hineingeraten war!
Jetzt gingen die letzten Gäste. Sie verabschiedeten sich an der Tür von dem Diakon.
Rolf räumte Flaschen und Gläser weg und schob Tische und Stühle an ihren Platz. Er hatte eigentlich noch einiges Schriftliche zu erledigen, aber das wollte er morgen machen. Saubermachen auch. Eine innere Unruhe zog ihn nach Hause.
Nachdem er sich noch einmal umgeschaut hatte, schaltete er das Licht aus und steckte den Schlüssel von außen ins Schloss.
Plötzlich waren sie da. Einer schlug ihm mit ungeheurer Wucht in die Magengrube, so dass er sich zusammenkrümmte. Der andere packte von hinten seinen linken Arm und drehte ihn auf den Rücken. Ein kräftiger Stoß ließ Degemann in den Flur zurück stolpern. Die beiden Männer kamen nach und zogen die Tür hinter sich zu.
Rolf schleppte sich mühsam zu einem Stuhl. Sein Magen schmerzte entsetzlich, und ihm war speiübel. Der kräftigere der beiden Männer baute sich breitbeinig vor ihm auf, und der andere stellte sich hinter ihn. Die Lampen waren nicht an, aber von der Straße fiel genug Licht durch die Fenster.
»Haben wir die Ehre mit Herrn Degemann?«
Als der Gefragte keine Antwort gab, trat ihm der andere ans Schienbein.
»Wir sind es gewohnt, eine Antwort zu bekommen, wenn wir höflich gefragt haben.«
Degemann nickte.
»Wo ist Mecki?«
Schweigen.
Der Mann packte Rolf bei den Haaren und riss seinen Kopf hoch. »Wo ist Mecki?«
»Ich sage es nicht!« presste Rolf mühsam hervor.
Der Mann schlug ihm ins Gesicht. Blut lief aus der Nase.
»Willst du, dass wir dich fertigmachen?« fragte leise, bedrohlich leise der Hagere. Rolf sah aus den Augenwinkeln, wie er einen Stuhl hob.
In diesem Augenblick schoss er nach vorn und rammte dem Mann vor ihm seine Fäuste in die Magengrube. Aber er hatte nicht mehr die gewohnte Kraft. Der andere stöhnte auf, stürzte aber nicht. Ein ungleicher Kampf. Rolf konnte nur noch unkontrolliert und damit wirkungslos schlagen.
Plötzlich flog die Tür auf, und das Licht ging an. Andreas stand im Eingang. Blitzschnell hatte er die Situation erfasst: »Hilfe! Hilfe!«, schrie er laut zur Straße hin. Dann stürzte er sich auf die drei Männer.
Aber ein Kampf war nicht mehr nötig. Die beiden Schläger sprangen auf und rannten davon. Die Leute, die sich auf dem Bürgersteig zu versammeln begannen, wichen zur Seite. Schnell waren die beiden um eine Hausecke verschwunden.
Andreas beugte sich über seinen Freund. »Ist es schlimm? Soll ich einen Krankenwagen rufen?«
»Nein, nein, nicht nötig!«, keuchte Rolf. »Lass mich nur einen Moment sitzen. Und bring mir bitte ein Papiertaschentuch für meine blutende Nase.«
Der junge Mann wühlte in den Schubladen der Teeküche, brachte ein paar Papierservietten und rief die Polizei an. Er schilderte kurz, was passiert war, legte auf und kam zu dem Sozialarbeiter zurück.
»Sie kommen gleich.«
»Mensch, Andreas, du bist gerade im richtigen Augenblick gekommen.«
»Ich war schon fast zu Hause. Die ganze Zeit ist mir durch den Kopf gegangen, wie du reagiert hast, als ich dir von den beiden Männern erzählte. Schließlich hab' ich's mit der Angst zu tun gekriegt und bin umgekehrt.«
»Vielen Dank! Andreas, sei so gut, und schieb mal ein paar Stühle zusammen, dass ich mich ein bisschen hinlegen kann!« Der junge Mann tat das.
Dann hörten sie das Horn eines Streifenwagens.
»Also noch einmal«, knurrte der Beamte. Es war am nächsten Morgen, und sie saßen in einem unfreundlich wirkenden Büro.
Es fiel Rolf Degemann nicht schwer, die Ungeduld aus der Stimme des Polizisten herauszuhören. »Sie sind sicher, dass der Überfall einzig dem Zweck diente, den Aufenthaltsort des jungen Mannes 'rauszukriegen?«
»Ganz sicher, Herr Inspektor.«
»Sagen Sie Enders zu mir. Ich rede Sie ja auch nicht mit Herr Diakon an.«
Degemann nickte, und damit schien das Gespräch wieder festgefahren zu sein.
Nach einer Weile begann der Polizist von neuem. »Ich fürchte, Herr Degemann, Sie machen sich nicht recht klar, was Ihr Schweigen bedeutet. Sie bringen den Jungen in große Gefahr. Wir können ihn nicht schützen, wenn wir nicht wissen, wo er ist.«
»Aber wenn Sie wüssten, wo er ist, würden Sie ihn nicht nur schützen, sondern auch verhaften und unter Anklage stellen.«
»Das bestreite ich nicht. Es ist unsre Pflicht. Tut mir leid, aber wir haben unsern Job.«
»Und ich habe meinen.«
»Den Job eines Seelsorgers, wie?«
»Das ist zwar kein besonders schönes Wort dafür, aber wenn Sie so wollen – ja.«
»Haben Sie schon mal dran gedacht, dass Sie sich mitschuldig machen, wenn Sie die Aufklärung von Straftaten behindern?«
»Ich weiß, dass ich mich schuldig mache, wenn ich das Versprechen breche, ihn nicht zu verraten. Schuldig an einem jungen Menschen, der im Begriff ist, von einem verkehrten Weg umzukehren.«
Der Inspektor sprang wütend auf, so heftig, dass sein Stuhl hinter ihm polternd an den Heizkörper stieß. Einige Male ging er im Zimmer schweigend auf und ab.
Schließlich blieb er vor Degemann stehen. Seine Augen blickten gar nicht mehr böse, eher hilflos. »Können Sie sich vorstellen, wie frustrierend so ein Beruf ist? Wir wissen seit langem, dass es eine Organisation geben muss, die hinter all den Autodiebstählen steckt. Auch die Rauschgiftsache muss von irgendwem geleitet sein. Nun bekommen wir bestätigt, was wir schon seit einiger Zeit vermutet haben, dass nämlich beides zusammenhängt. Eine größere Organisation, die für die meisten dieser Verbrechen verantwortlich ist. Wir tappen seit Monaten im Dunkeln. Kleine Erfolge, etwa, wenn wir einen Dealer der unteren Garnitur erwischen, enden immer wieder in der Sackgasse.«
Er machte wieder eine Runde durchs Zimmer. »Und dann passiert auf einmal der unwahrscheinliche Glücksfall, dass einer aussteigen will. Die große Chance! Und da kommen Sie mit Ihrem verrückten Beichtgeheimnis!« Er schlug sich mit der flachen Hand an die Stirn und ging wieder auf und ab.
»Ist das etwa christlich?«, fragte er und starrte Degemann ins Gesicht. »Können Sie das verantworten, dass dauernd Verbrechen geschehen? Verbrechen, die Sie verhindern könnten, wenn Sie nur den Mund aufmachen und eine bestimmte Adresse sagen würden!«
Rolf hielt seinem Blick stand und erwiderte ruhig: »Sie sind undankbar! Ich habe Ihnen ja immerhin außer dem Aufenthaltsort und dem Namen des jungen Mannes alles gesagt, was ich weiß. Und damit sind Sie weiter, als Sie vorher waren. Jetzt tun Sie Ihre Pflicht, und ich tue meine.«
Der Kriminal beamte setzte sich erschöpft auf die Schreibtischkante und schaute vor sich auf den Boden. »Ich dachte, ich hätte deutlich genug gesagt, dass es nicht nur meine Pflicht ist. Ich hoffe nicht, Sie denken, nur Sie würden Ihren Beruf ernst nehmen.«
»Das denke ich nicht, Herr Enders. Ich habe sehr wohl gehört, was Sie eben über Ihre Frustrationen gesagt haben. Aber jetzt will ich Ihnen mal etwas über meine erzählen. Seit sechs Jahren arbeite ich in der Teestube. Ungezählte Nächte habe ich mir um die Ohren geschlagen, um Menschen zu helfen, die auf die schiefe Bahn geraten sind. Und das meistens völlig umsonst. Und auch, wenn es manche Erfolge gab – ich weiß nicht, ob Sie das verstehen, aber ich weiß mich von Gott gerufen, nicht nur jungen Menschen aus Alkohol und Drogen und Prostitution herauszuhelfen, sondern sie auch zum Glauben zu führen, damit ihr neues Leben ein Fundament hat. Denn nur dann ist ihnen wirklich geholfen! Aber da gibt es so viele Enttäuschungen. Und nun schickt mir Gott einen jungen Mann, der offensichtlich von der biblischen Botschaft angesprochen ist. Ich werde ihn nicht vor den Kopf stoßen! Ich würde es auch dann nicht tun, wenn ich nicht unter der Pflicht stände, das Beichtgeheimnis zu hüten.«
Der Beamte hatte mit gesenktem Kopf zugehört. Er blickte auch jetzt nicht auf, als er leise sagte: »Gut, Degemann. Sie können jetzt gehen.«
Er sah auch nicht auf, als der andere ihm an der Zimmertür noch einen Gruß zuwarf.
Kapitel 2
Als es klingelte, war Anke Degemann gerade dabei, das Geschirr vom Mittagessen zu spülen. Sie rief darum dem elfjährigen Dirk zu: »Gehst du bitte mal an die Tür?«
»Okay, Mutti!«, rief der, sprang vom Sofa auf, wo er mit einem Buch gelegen hatte, und ging zur Tür.
Draußen standen zwei Männer. Sie wirkten auf Dirk ein bisschen heruntergekommen, aber das erschreckte ihn nicht. Sein Vater hatte oft Besuch von Leuten, die so aussahen. Das brachte sein Beruf mit sich.
»Du bist sicher der Sohn von Rolf Degemann, richtig?«, fragte der Dünnere von den beiden.
»Ja.«
»Komm doch bitte mal mit zu unserem Auto. Ich soll dir was geben von deinem Vater.«
»Ja, ich sag nur eben meiner Mutter Bescheid.«
»Ach komm, ist doch nicht nötig! Nur eben die Treppe 'runter. Wir haben's nämlich eilig, weißt du!«
»Okay.«
Dirk ließ die Tür angelehnt und folgte den beiden Männern die Treppe hinunter.
Er hörte nicht mehr, wie seine Mutter rief: »Wer ist denn da?«
Als Frau Degemann keine Antwort bekam, als sie auch keine Stimmen mehr am Eingang hörte, schüttelte sie das Wasser von den Händen, trocknete sie ab und ging zur Tür.
Merkwürdig, die Flurtür war nur angelehnt. »Dirk!«, rief sie ins Treppenhaus. Aber niemand antwortete. »Dieser ungezogene Bengel! Jetzt hat er sich wieder von seinem Freund zum Spielen abholen lassen, ohne mir Bescheid zu sagen!«
Frau Degemann schloss die Tür und ging ans Fenster. Sie konnte gerade noch sehen, wie ihr Sohn von zwei Männern gewaltsam in ein Auto geschoben wurde.
Das Herz blieb ihr fast stehen.
An den strampelnden Bewegungen von Dirks Beinen konnte sie sehen, dass er sich wehrte. Aber der kräftigere der beiden Männer schob den Jungen ganz ins Auto und setzte sich rechts hinten daneben. Der andere war schon um den Wagen herumgerannt und beim Fahrersitz eingestiegen. Jetzt ließ er den Motor an und brauste mit quietschenden Reifen davon.
Einen Moment lang konnte Anke Degemann überhaupt nichts denken. Dann kam sie zu sich und rannte zum Telefon. Später dachte sie noch manches Mal darüber nach, warum sie nicht gleich die Polizei angerufen hatte. Aber jetzt handelte sie nicht nach Überlegung. Sie rief in ihrer Angst ihren Mann an.
Es klingelte eine halbe Ewigkeit. Anke dachte: »Vielleicht ist er noch gar nicht da. Vielleicht steckt er noch im Stau.« Aber dann kam Rolf an den Apparat.
»Rolf, Dirk ist entführt worden! Eben gerade! Ich hab's vom Fenster aus gesehen. Sie haben – es waren zwei Männer! Sie …«
»Hast du die Polizei gerufen?«
»Nein.«
»Tu das sofort! 110! Ich bin in zwanzig Minuten da!« Anke Degemann legte auf und wählte mit zitternden Fingern neu.
Als Rolf Degemann keinen Parkplatz in der Nähe seiner Wohnung fand, ließ er seinen VW einfach halb auf dem Bürgersteig im Parkverbot stehen, stieg aus, rannte zum Haus und die Treppe hinauf und stürzte in die Wohnung.
Zwei Polizisten standen herum. Seine Frau saß auf der Couch und war bleich wie mit Mehl gepudert.
Rolf setzte sich neben sie und legte den Arm um sie. »Erzähl mir, was passiert ist!«
Stockend berichtete Frau Degemann. Sie war sichtlich um Selbstbeherrschung bemüht, auch wenn sie am liebsten den Tränen freien Lauf gelassen hätte.
»Und Ute?«
»Es ließ sich nicht vermeiden, dass sie mitbekam, was passiert ist. Soweit sie's versteht. Jetzt ist sie im Kinderzimmer. Frau Trebing von gegenüber ist bei ihr, solange ich hier mit der Polizei zu tun hatte.«
Jetzt kam einer der Polizisten herbei. »Wir haben die Klingel und die Türklinke nach Fingerabdrücken abgesucht. Aber das ist nicht sehr vielversprechend. Übrigens: Kommissar Enders will heute noch vorbeikommen. Es kann aber sechs Uhr werden, sagt er.«
»Gut. Wir sind hier.«
Die Polizisten gingen.
Anke Degemann hatte das Gesicht in den Händen vergraben, und jetzt, wo sie allein waren, fing sie an zu schluchzen. »Warum nur? Was wollen die denn von uns? Wir haben doch kein Geld!«
»Die wollen etwas ganz anderes!«
Anke sah auf. »Weißt du denn, was sie wollen?« – »Ich vermute es.«
»Geht es um dieselbe Sache, wegen der sie dich gestern verprügelt haben?«
»Wahrscheinlich.«
»Was ist das für eine Sache? Rolf, du musst es mir erzählen! Ich habe ein Recht darauf!«
Degemann ging eine Weile auf und ab, dann setzte er sich auf die Tischkante.
»Rolf! Bitte!«
»Einiges will ich dir erzählen. Aber nicht alles. Glaub' mir, Anke, es ist besser, wenn du nicht alles weißt!«
»Das verstehe ich nicht! Aber nun fang doch wenigstens an!«
»Die beiden Männer wollten von mir erfahren, wo sich ein junger Mann aufhält, der öfter in der Teestube war.« – »Was ist mit dem?«
»Er hat zu einer Bande von Autodieben und Rauschgiftschmugglern gehört und will da aussteigen. Er befürchtete aber, dass sie ihn umbringen wollen, weil sie natürlich damit rechnen müssen, dass er etwas verrät.«
»Und du weißt, wo er ist?«
»Ja.«
»Und als sie dich verprügelt haben, hast du es nicht verraten?«
»Nein.«
»Und darum glaubst du …«
»Ich weiß es nicht. Aber es kann sein, dass sie mich jetzt erpressen wollen, es ihnen zu sagen. «
Anke sah ihren Mann mit blassem Gesicht und nassen Augen an. »Du musst es ihnen sagen!«, hauchte sie leise, aber bestimmt.
Rolf sah vor sich auf den Teppich und zählte die Muster. Sein Gehirn weigerte sich einfach, sich mit der Frage zu beschäftigen, die da vor ihm stand, und flüchtete darum in diese völlig unsinnige Tätigkeit.
»Rolf!«, rüttelte ihn seine Frau plötzlich mit lauter Stimme wach. »Rolf! Sag doch was! Du musst es ihnen verraten, hörst du? Du musst!«
Rolf versuchte, sich weiter um eine Antwort zu drücken. »Vielleicht ist es ja was ganz anderes.«
»Aber wenn es so ist …«, Anke schrie fast.
»Sie werden einem Kind nichts tun.«
»So? Woher weißt du das? Ich sage dir: Ich lasse es nicht zu, dass du das Leben unsres Kindes aufs Spiel setzt, um so einen Verbrecher zu schützen! Das lasse ich nicht zu!«
»Wir wissen ja noch gar nicht …«
»Er hat es sich selbst zuzuschreiben, wenn er in Gefahr kommt! Er ist ein Gangster! Wer weiß, ob er nicht selbst schon gemordet hat …«
»Anke! Sag das nicht, wenn du keinerlei Anhaltspunkte…«
»Hast du nicht selbst gesagt, er war im Rauschgifthandel? Na, siehst du! Wie viele kommen da um! Das weißt du doch am besten! Jahrelang treten solche Leute alle Moral mit Füßen. Und auf einmal besinnen sie sich auf die christliche Nächstenliebe, die ihnen die frommen Leute schuldig sind, und … «
»Bitte rede nicht so weiter, Anke! Du bist aufgewühlt und weißt darum nicht, was du sagst. Aber denke daran, dass mein ganzer Beruf darin besteht, Bedürftigen zu helfen. Und dass ich sehnlichst oft monatelang darauf warte, dass jemand sich besinnt und umkehren will, und – ja, und an meine christliche Nächstenliebe appelliert. Und wenn er es tut, freue ich mich.«
»Dagegen sage ich ja auch nichts. Aber wenn du zu entscheiden hast, ob dir so ein Mensch wichtiger ist als dein eigenes Kind – ein unschuldiges, elfjähriges Kind – ich hoffe, da musst du nicht lange überlegen!«
Plötzlich stand die Nachbarin in der Tür zum Kinderzimmer.
Rolf sah kaum auf. »Ach, Frau Trebing! Sie habe ich ganz vergessen. Was ist mit Ute?«
»Sie schläft«, antwortete die freundliche ältere Dame. »Es tut mir leid, dass ich Ihr Gespräch mit anhören musste. Entschuldigen Sie, dass ich mich einmische, Herr Degemann. Aber Ihre Frau hat recht. Sie müssen jetzt zuerst an Ihr Kind denken, und an Ihre Frau …«
Degemann machte eine wegwischende Handbewegung. »Ich weiß. Ich hab' ja auch nicht gesagt, dass ich es nicht tun wollte. Es ist nur …« Er vollendete den Satz nicht.
Nach einigen Augenblicken des hilflosen Schweigens sagte die Nachbarin: »Ich gehe dann jetzt, Frau Degemann. Wenn Sie noch irgendwie Hilfe brauchen, rufen Sie mich!«
»Ist gut, Frau Trebing. Ich danke Ihnen.«
In dem Augenblick, als die hilfsbereite Dame die Wohnungstür hinter sich zuzog, klingelte das Telefon. Rolf und Anke schreckten auf und sahen sich an. Flehen lag in ihrem Blick, Verzweiflung in seinem. Erst als es dreimal geklingelt hatte, gab Rolf sich einen Ruck, ging mit großen Schritten zum Apparat, hob mit energischer Bewegung ab und meldete sich knapp: »Degemann.«
Einen Moment lang war gar nichts zu hören. Dann sagte eine Männerstimme, der eine Mischung aus Hass und Häme anzuhören war: »Wir kennen uns doch, Degemann, nicht wahr?«
»Was wollen Sie?«
»Ist das so schwer zu raten? Mecki gegen deinen Kleinen.«
»Wo ist mein Junge jetzt? Ich will mit ihm reden!«
»Die Bedingungen stellen wir!«
»Irrtum. Ihr wollt etwas von mir, und ich will etwas von euch. Also haben wir beide Bedingungen zu stellen.«
»Guck mal einer an, der Herr Diakon markiert den starken Mann!«
»Hör mal, solange ich nicht mit meinem Jungen gesprochen habe und sicher bin, dass es ihm gut geht, solange läuft überhaupt nichts!«
In diesem Moment kam Anke von hinten heran und riss ihrem Mann den Hörer aus der Hand. »Hören Sie!«, schrie sie in die Muschel. »Tun Sie dem Kind nichts! Mein Mann sagt Ihnen, wo der Mann ist, den Sie suchen! Ganz bestimmt! Aber tun Sie dem Jungen nichts, bitte!«
»Na schön, gnädige Frau«, antwortete gedehnt die Stimme am anderen Ende mit unverhohlenem Triumph. »Dann fragen Sie ihn doch mal gleich und sagen Sie's mir dann!«
Anke blickte ihren Mann stumm an. Der sah ihr in die Augen, zornig und traurig und ratlos zugleich, und führte mit langsamer Bewegung die Hand zum Telefonapparat. Dann, kurz entschlossen, unterbrach er das Gespräch.
Seine Frau erschrak und hauchte: »Was tust du da? Was soll das?« Und lauter werdend: »Er wird sich ärgern und seine Wut an dem Kind auslassen! Jetzt hast du alles verdorben!«
»Du warst im Begriff, alles zu verderben! Warum mischst du dich ein? Er glaubt, er kann alles mit uns machen, weil er weiß, wie viel Angst du hast. Verhandeln kann man nur, wenn man …«
»Verhandeln – verhandeln!«, schrie seine Frau. »Ich will nicht verhandeln! Ich will mein Kind wiederhaben!«
»Es ist auch mein Kind, und ich will es auch wiederhaben! Aber ich will es gesund und unversehrt wiederhaben! Wer sagt denn, dass sie Dirk freilassen, wenn ich den Aufenthaltsort des Mannes verrate? Da müssen wir doch sicher gehen! Wir können nicht gleich alle Karten aus der Hand geben!«
Anke ging zum Sofa hinüber und ließ sich hineinfallen. »Du mit deinen nüchternen Überlegungen!«, sagte sie schwach.
»Glaub' mir, Anke, ich verstehe ein bisschen von der Psychologie dieser Leute.«
»Statt uns zu trösten, streiten wir uns.«
»Du hast recht. Und statt Gott um Hilfe zu bitten.«
Die Tür zum Kinderzimmer öffnete sich, und die kleine Ute kam herein. »Mutti, ist Dirk wieder da?«
Anke schüttelte weinend den Kopf. Das Kind ging zu ihr und legte die Ärmchen um sie. »Du musst nicht weinen, Mutti! Der liebe Gott ist stärker als die bösen Männer.«
Degemann setzte sich daneben. »Da hast du recht, Ute. Ganz bestimmt!«
Eine Weile saßen alle drei schweigend da.
»Gut, Rolf«, sagte Anke plötzlich, »du führst die Verhandlungen. Ich verspreche dir, mich nicht mehr einzumischen. Aber du versprichst mir, letztlich nachzugeben und ihnen den Mann auszuliefern!«
Rolf ließ sich Zeit mit seiner Antwort. »Ich muss nachdenken, Anke. Ich muss mir erst klarwerden. Bitte, setz mich nicht unter Druck!«
»Rolf, bitte!«
»Ja, ja, wahrscheinlich muss es wohl darauf hinauslaufen, wenn nicht ein Wunder geschieht, aber …«
Er vollendete den Satz nicht.
»Gibt es denn keine Lösung?«, dachte er immer wieder. Irgendeine Lösung, die mich nicht schuldig werden lässt, so oder so. Aber so sehr er sich auch das Gehirn zermarterte, ihm fiel nichts ein.
Dann klingelte das Telefon erneut.
Die Eheleute sahen sich an, und Rolf murmelte: »Wenn sie das wieder sind, dann haben wir einen ersten kleinen Sieg errungen, glaub' mir!«
Er ging hin und hob ab. »Degemann.«
»Degemann, wenn du glaubst, du könntest dein Spielchen mit uns treiben…«
»Hauptsache, ihr glaubt nicht, ich ließe mit mir spielen. Ich bin ja zu einem Handel bereit. Aber die Bedingung habe ich euch gesagt. Ich will mit meinem Jungen sprechen.«
»Er ist nicht hier. Ich müsste mich erst mit den Leuten in Verbindung setzen, die ihn …
»Tu das!«
»Das kann bis heute Abend dauern. Um so länger muss das arme Kind leiden.«
»Ich warne euch! Tut ihm nicht mehr an, als unbedingt nötig ist, um ihn gefangen zu halten! Das würde unseren Handel wesentlich erschweren. Ich meine es ernst!«
»Na, hör' mal zu, du frommer Heini …«
»Nein, du hörst mir zu! Ihr habt gesehen, dass ich mich in der Teestube geweigert habe, auch unter Schlägen, euch den Mecki auszuliefern. Daran kannst du erkennen, dass es mir ein wirkliches Opfer ist, wenn ich es vielleicht doch tue. Auch wenn du die Gründe wahrscheinlich nicht verstehst. Aber für dieses Opfer will ich einen Gegenwert. Ich verlange, dass der Junge völlig gesund und unversehrt zurückkommt. Ist das klar?«
»Ich hab' nichts dagegen. Uns liegt nichts an dem Bengel, nur an Mecki.«
»Dann sind wir uns ja einig. Also bring beim nächsten Anruf den Jungen ans Telefon!«
»Aber wehe, du verrätst das Versteck von Mecki der Polizei eher als uns …«
»Über Einzelheiten verhandeln wir später.« Kaum war der Satz heraus, legte er auf.
Schweiß stand ihm auf der Stirn, und ihm war schwindelig. Er musste sich auf dem kleinen Tischchen abstützen, auf dem das Telefon stand.
Dann ging er mit schwankenden Schritten zum Sofa zurück und ließ sich fallen. Seine Frau sah ihn schweigend an, und Ute fragte: »Kommt Dirk bald wieder, Papa?«
»Ich hoffe es, mein Schatz.« Und fast wie zu sich selbst fügte er hinzu: »Ich bin sicher, er glaubt mir, dass ich so hart und gefühllos bin, wie ich es ihm vorgespielt habe.« Dann sah er seine Frau an. »Warum auch nicht. Selbst du glaubst es ja.«
Anke legte ihre Hand auf seine. »Rolf …«
Das Kind spürte die tiefe Hilflosigkeit des Vaters, auch wenn es nicht alles verstand. Es löste sich von der Mutter und schmiegte sich an ihn.
»Aber vergiss nicht«, sagte Anke nach einer Weile leise, »unter welcher Bedingung ich dich deine psychologischen Kunststückchen machen lasse! An erster Stelle steht unser Kind!«
Rolf ging nicht direkt darauf ein. »Oder wenn ich die Polizei – aber das ist alles viel zu gefährlich! Sie geben Dirk erst wieder 'raus, wenn sie Mecki haben. Es – es geht nicht anders. Es führt kein Weg daran vorbei.«
Er bekam keine Antwort. Nach einer Weile dachte er laut weiter: »Aber ich muss es ihm erklären. Ich muss mit ihm reden. Vielleicht versteht er mich ja. Vielleicht… vielleicht stellt er sich freiwillig der Polizei. Oder – ja, das tue ich. Ich fahre zu ihm und rede mit ihm!«
Degemann stand auf, ging zum Flur und nahm den Autoschlüssel vom Haken neben der Tür. Dann sah er zurück auf die beiden.
Anke hatte keinen Zorn mehr zur Verfügung. Nur noch Leere war in ihr und Angst. »Warum willst du denn hinfahren und mit ihm reden? Dann flieht er. Und dann kriegen sie ihn nicht und – und unser Kind…« Sie sah dabei nicht auf, und es klang auch nicht wie eine Frage, auf die sie eine Antwort erwartete.
»Ich muss mit ihm reden. Ich habe ihm versprochen, dass ich ihn nicht verrate. Und ich habe mich dabei sogar auf meine Glaubwürdigkeit als Christ berufen. Trotzdem bin ich im Begriff, ihn fallenzulassen. Da muss ich wenigstens wissen, ob er mich versteht. Er soll wissen, dass ich weiß: Ich werde auf jeden Fall schuldig und habe nur die Möglichkeit, das geringere Übel zu wählen.«
Er ging auf seine Frau zu und gab ihr einen zarten Kuss auf die Wange. Sie wehrte sich nicht, aber sie erwiderte ihn auch nicht. »Ich wäre glücklich, wenn du mich auch verstehen könntest.«
Fast tonlos sagte sie: »Was soll ich machen, wenn sie wieder anrufen?«
»Nichts. Ich bin in etwa drei Stunden zurück. Und wenn der Kommissar kommt – du kannst ja die Fragen, die er wahrscheinlich hat, besser beantworten als ich. Notfalls sag ihm, ich könnte ja nochmal in sein Büro kommen.«
Rolf küsste seine Tochter und ging hinaus.
Kapitel 3
»Zentrale an Wagen 12.«
Der Beifahrer in dem rostroten Ascona hob das Mikrofon aus der Halterung am Funkgerät. »Hier Wagen 12.« – »Kommissar Enders will Sie sprechen.«
»Ich höre.«
»Hier Enders«, knatterte es aus dem Lautsprecher, »sind Sie noch dran?«
»Ja. Er ist ca. 500 Meter vor uns.«
»Wo sind Sie?«
»Gleich muss der Rasthof Wetterau kommen.«
»Sehen Sie zu, dass Sie ihn nicht verlieren. Gehen Sie lieber ein bisschen dichter ran! Er hat mit so was keinerlei Erfahrung und wird schon nicht merken, dass er verfolgt wird.«
»Okay.«
Der Polizist achtete darauf, dass das Mikrofon ausgeschaltet war, als er zu seinem Kollegen sagte: »Verlieren! Den alten Käfer! Wenn wir nachher hinter Wetterau ins Tal fahren, wird er ganz stolz sein, wenn er auf 130 kommt.«
»Gib mal her!«, antwortete der Fahrer. Der andere reichte ihm das Mikrofon.
»Chef!«, rief der Fahrer hinein.
»Was gibt's?«
»Entschuldigen Sie mal die dumme Frage, Chef, aber haben Sie noch einen anderen Wagen zur Verfolgung beordert, von dem wir nichts wissen?«
»Unsinn! Natürlich nicht! Wieso?«
»Hier fährt dauernd ein blassgrüner BMW in unsrer Nähe. Ich hab' nicht besonders darauf geachtet, aber ich glaube, der war schon in unsrer Nähe, als wir bei Degemann wegfuhren. Und er fährt immer im gleichen Abstand zu dem VW. Mal ist er hinter uns, mal vor uns. Im Moment sind wir direkt hinter ihm.«
»Wer sitzt drin?«
»Zwei Männer.«
»Verflixt!«
»Wie bitte?«
»Kennzeichen?«
»F – AH – 723«
Eine Weile kam keine Antwort. Die Polizisten blieben instinktiv etwas hinter dem BMW zurück.
Dann krächzte das Gerät wieder. »Wagen 12!«
»Hier Wagen 12«
»Hören Sie, Krämer, haben die beiden in dem BMW schon gemerkt, dass ihr auch den VW verfolgt?«
Der Fahrer sah seinen Kollegen an, der zuckte die Achseln.
»Es scheint nicht so, Chef. Jedenfalls gibt es dafür keinen Anhaltspunkt. Aber genau wissen wir es natürlich auch nicht.«
»Hören Sie zu, ein neuer Befehl: Setzen Sie sich von dem BMW etwas ab und verfolgen Sie ihn. Er soll Sie nicht bemerken.«
»Und der VW?«
»Wahrscheinlich bleiben die beiden hinter dem VW. Aber wenn sie sich trennen, vermutlich erst auf dem Rückweg, dann lasst den VW und hängt euch an den BMW!«
»Okay.«
»Und halten Sie mich auf dem laufenden!«
»Wird gemacht.«
»Ende.«
Die Beamten ließen sich noch weiter zurückfallen.
Eine oder zwei Minuten zockelten sie so dahin. Plötzlich beobachteten sie, wie der BMW schneller wurde.
»Der beschleunigt!«
»Bleib dran, wenn du kannst! Ich sag's dem Chef.« Er hob das Mikrofon an. »Wagen 12 an Zentrale.«
»Hier Zentrale.«
»Kommissar Enders bitte. Aber schnell!«
Es krachte, und dann meldete sich auch schon ihr Kommissar: »Enders.«
»Chef, er scheint uns bemerkt zu haben. Er braust plötzlich los wie 'ne Rakete.«
»Versuchen Sie dranzubleiben! Wenigstens bis er die Autobahn verlässt. Ich lasse an allen Ausfahrten Ablösungen bereitstellen.«
»Wollen's versuchen.«
Krämer drückte das Gaspedal fast durch das Bodenblech.
Das Auto schoss davon. Aber der BMW war schon außer Sichtweite.
Jetzt kam der höchste Punkt beim Rasthof Wetterau.
Unten konnten sie den hellgrünen Wagen sehen. Bergab erhöhte sich ihr Tempo auf 170. Aber sie kamen nicht näher an das verfolgte Fahrzeug heran.
»Da! Er fährt in Butzbach raus!«
»Ich folge ihm. So schnell haben die hier sicher noch keine Ablösung.«
Der BMW war inzwischen verschwunden. Mit hohem Tempo näherte sich der Polizeiwagen der Ausfahrt. Aber auf der rechten Spur knatterte Degemanns Käfer langsam dahin. Krämer schätzte schnell ab, dass er ihn noch überholen könnte, zog nach links, brauste vorbei, bremste scharf ab und lenkte mit quietschenden Reifen in die Ausfahrt.
Degemann musste den Fuß vom Gas nehmen und schüttelte den Kopf. Wahnsinn ist wohl ansteckend, dachte er. Erst der BMW, dann braust der hier auch noch so irrsinnig in die Kurve. Das hätte die Polizei sehen sollen!
Aber weil ihm andere Probleme näherlagen, vergaß er den Vorfall bald.
Die Polizisten mussten sich entscheiden, ob sie nach links in das Städtchen Butzbach oder nach rechts fahren sollten. Krämer entschied sich für links.
»Da hinten ist der Knast.«
»Haftanstalt«, verbesserte sein Kollege.
»Justizvollzugsanstalt«, berichtigte Krämer.
»Da werden sie sich vermutlich nicht verstecken.«
»Gib her, ich sag dem Chef Bescheid.«
Als der Kommissar sich meldete, erstattete er Bericht. »Wir haben sie verloren. Sie sind in Butzbach raus. Jetzt stehen wir hier in der Ortsmitte. Was sollen wir tun?«
»Verflixt!«
»Wie bitte?«
»Fahrt schnell zurück auf die Autobahn und nehmt die Verfolgung von Degemann wieder auf!«
»Okay, Ende.«
Krämer wendete, behinderte dabei einen laut hupenden Pkw, überholte gefährlich knapp einen Traktor und war bald wieder auf der Autobahn. So schnell es der Ascona zuließ, brausten sie Richtung Norden.
Aber sie erreichten Degemanns Käfer nicht mehr. Der musste inzwischen irgendwo abgebogen sein.
Während Ute in der Küche saß und mit unendlicher Geduld die rote Schale von einer Scheibe Edamer abzuziehen versuchte, sprach ihre Mutter am Telefon mit einer guten Bekannten aus der Gemeinde.
»Ich weiß nichts Neues, Inge. Rolf ist weggefahren. Er will mit dem jungen Mann sprechen.«
»Es muss ein furchtbarer Konflikt für ihn sein.«
»Ja«, sagte Anke, aber nur verhalten. Wollte ihre Freundin ihr etwa zu verstehen geben, dass ihr Mann im Recht war, wenn er nicht sofort auf die Forderung der Entführer einging? Aber nein, Inge sagte immer gerade heraus, was sie meinte.
»Wenn ich nur wüsste, wie ich dir helfen könnte, Anke!«
»Betet für uns!«
»Das haben wir schon getan, und wir werden es weiter tun. Ich danke dir für dein Vertrauen, dass du uns eingeweiht hast!«
»Ich musste es einfach jemandem erzählen.«
»Sag mal, Anke, wäre es dir lieb, wenn ich ein bisschen bei euch bliebe? Dann bist du nicht so allein, wenn Rolf weg ist. Unsere Kinder könnte Heinz versorgen.«
»Du, das ist lieb von dir, aber es wird nicht nötig sein. Außerdem weiß ich nicht, ob das – ich meine, wenn die Gangster unser Haus beobachten, schöpfen sie Verdacht, wenn hier fremde Leute aus- und eingehen.«
»Gut, ist recht! Aber wenn du mich brauchst, ruf einfach an!«
»Mach ich, Inge, vielen Dank!«
Sie legte auf und ging in die Küche. Gerade hatte sie die Käsescheibe halbiert, die Ute gern ganz auf ihr Brot gelegt hätte, da klingelte das Telefon.
»Degemann. «
»Hören Sie mal, gnädige Frau, wenn Sie glauben, Sie könnten uns 'reinlegen, dann werden Sie es bereuen! Beziehungsweise, Ihr Sohn wird es bereuen!«
Anke verschlug es die Sprache. »Was … äh … wieso denn?«, brachte sie schließlich mit Mühe heraus. »Wieso 'reinlegen? Was meinen Sie denn?«
»Sie haben die Polente benachrichtigt!«
»Ja, Sie haben doch gar nicht gesagt, dass ich der Polizei nichts sagen sollte! Die war doch auch schon da, ehe Sie das erste Mal angerufen haben!«
»Das meine ich nicht. Sie haben ihr erzählt, dass Ihr Mann zu Mecki fahren wollte! Und da hat sie versucht, uns zu erwischen. Oder vielleicht wollte er gar nicht zu Mecki. Vielleicht wollten Sie uns zusammen mit der Polizei nur in eine Falle locken!«
»Nein, nein! Hören Sie, das ist nicht wahr! Bestimmt nicht! Mein Mann wollte zu diesem Mecki fahren, das stimmt. Aber was die Polizei gemacht hat, weiß ich nicht. Wir haben nichts damit zu tun! Glauben Sie mir!«
»Ihnen glauben? Kein Wort, meine Gnädigste! Es sei denn, Sie beweisen Ihren guten Willen zur Zusammenarbeit.«
»Was soll ich denn tun? Sagen Sie's mir! Ich tue alles, was Sie wollen, aber schonen Sie mein Kind, bitte!«, rief Frau Degemann in den Apparat.
»Na, dann sagen Sie mir doch einfach, wo Mecki ist!«
»Ich weiß es nicht!« Anke war den Tränen nahe. »Bitte glauben Sie mir! Mein Mann hat mir extra nichts gesagt, weil er nicht wollte, dass ich es verrate. Ich würde es tun, bestimmt!«
»Hm, schade, dann wird es Ihr Junge wohl büßen müssen.«
»Nein, bitte tun Sie ihm nichts, bitte!«
Anke schrie es ins Telefon. Ute kam herbeigelaufen und umklammerte weinend ihre Mutter. »Ich kann doch nichts dafür, dass ich nichts weiß. Was ich nicht weiß, kann ich doch auch nicht sagen! Verlangen Sie etwas anderes von mir! Was ich tun kann, will ich tun! Aber mein Junge …«
Die Stimme aus dem Hörer, vorher ironisch und herablassend, wurde jetzt hart: »Denken Sie nach!«
»Wie?«
»Verdammt noch mal, Sie werden doch die meisten Leute kennen, die Ihr Mann kennt! Also – wo könnte er Mecki untergebracht haben? Er war auf der Autobahn Richtung Kassel. Wo kann er da hingefahren sein?«
»Richtung Kassel? Hm, da … ja, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wenn er ihn zu Verwandten von uns gebracht hat …«
»Ich warte. Aber nicht mehr lange.«
»Und Sie versprechen mir, dass Sie Dirk freilassen, wenn ich es Ihnen sage?«
»Wir lassen ihn frei, wenn wir Mecki haben.« Die Stimme klang verärgert und drängend.
»Also, ich glaube, meine Eltern kommen nicht in Frage, die wohnen in Göttingen. Aber vielleicht die Schwester meines Mannes. Sie wohnt auf einem Bauernhof am Fuß der Rhön.«
»Ein Bauernhof? Na prima!«
»Die … die Adresse ist …«
»Moment, ich brauche noch eben einen Zettel.«
Kapitel 4
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 5
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 6
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 7
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 8
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 9
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 10
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 11
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 12
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 13
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 14
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 15
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 16
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 17
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 18
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 19
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 20
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 21
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 22
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 23
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 24
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 25
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 26
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Kapitel 27
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Unsere Empfehlungen
Eckart zur Nieden: Nächte an der Grenze
Folgen Verlag, ISBN: 978-3-944187-08-2
Es war stockdunkle Nacht. Nur ab und zu wurde die tief hängende Wolkendecke vom Wind zerfetzt. Die Umrisse der Berggipfel konnte man mehr erahnen als erkennen. Im Dunkel wurden Bewegungen hörbar – Atmen – Schritte. Oder war es nur eine Täuschung? Da! Schattenhafte Gestalten tauchten aus der Finsternis auf, mehrere Männer hintereinander. Sie schleppten etwas. Der erste schien den Weg mit den Füßen zu ertasten. »Vorsicht!«, rief er leise seinem Nachfolger zu. Dann sprang er einen kleinen Abhang hinab und war verschwunden. Jeder gab den Warnruf flüsternd an den Folgenden weiter. Einer nach dem anderen verschwand wieder in der undurchdringlichen Finsternis. Der Wind schloss den Wolkenvorhang vor der gespenstischen Szene.
Bei Nacht und Nebel schleichen sich Michael und Simon vom Jungscharlager weg und verfolgen finstere Gestalten an der Grenze. Was schleppen die weg? Und wohin?
Eckart zur Nieden: Brandstiftung in Eschenrode
Folgen Verlag, ISBN: 978-3-944187-59-4
Zwei Häuser sind in Eschenrode angezündet worden. Die Fragen „Wer stekct dahinter?“ und „Was geht hier eigentlich vor?“ bewegen den jungen Gemeindepfarrer, denn jedesmal kam ein Mensch dabei ums Leben. Immer deutlicher führt die Spur zu einem Mann, der erst vor einigen Tagen in sein Heimatdorf zurückgekehrt ist. Dreißig Jahre hatte er es nicht mehr gesehen – so ist er erschüttert über die Veränderungen, die er mit seinen Wunschvorstellungen nicht zusammenbringen kann.
Dieser merkwürdige Zeitgenosse bringt in das feste Dorfgefüge Unruhe – allerdings heilsame Unruhe, die in der Erzählung dramatisch gesteigert wird. Die Frage, um die es im Grund geht und die auch das ganze Dorf aufrüttelt, ist die nach dem Halt im Wandel der Zeit, nach dem Sinn des Lebens, nach dem Woher und Wohin und Wofür.
Franz Graf-Stuhlhofer: Naturwissenschaftler und die Frage nach Gott
Folgen Verlag, ISBN: 978-3-944187-32-7
Die Erforscher der Natur, Albert Einstein, Charles Darwin, Leonhard Euler, Carl von Linné und andere, haben auch oft über die Gottesfrage nachgedacht. Ihre Antworten sahen sehr verschieden aus: »Gott ja, aber nicht als Person«; »Gott offenbarte sich in Jesus«; »Wir wissen nicht, ob Gott existiert« - das waren einige der Antworten.
Der Naturwissenschaftshistoriker Franz Graf-Stuhlhofer stellt das Ringen dieser Naturforscher mit der Frage nach Gott dar und erhellt die Hintergründe, die zu den unterschiedlichen Antworten führten. Da die Frage nach Gott letztlich jeden Menschen angeht, vermittelt das vorliegende Taschenbuch hilfreiche persönliche Denkanstöße.