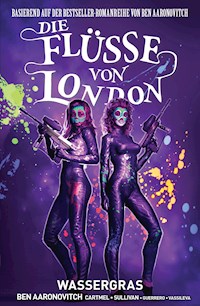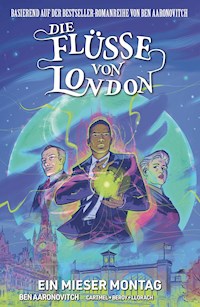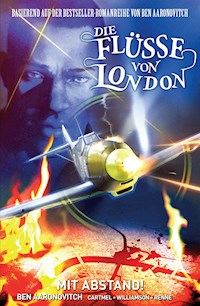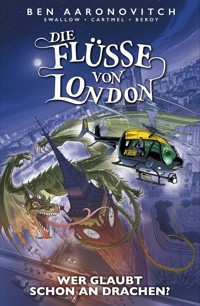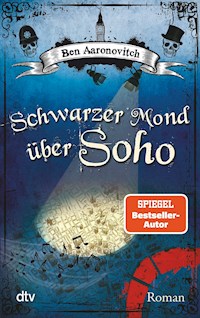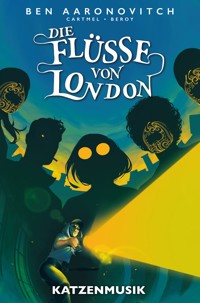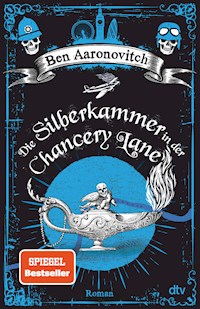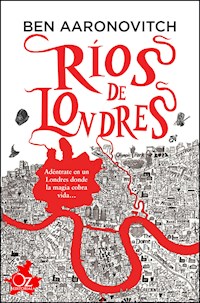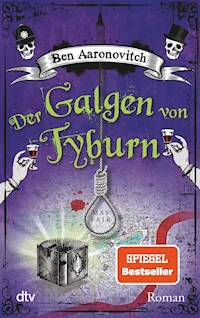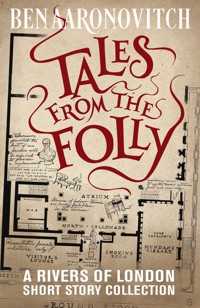7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Flüsse-von-London-Reihe (Peter Grant)
- Sprache: Deutsch
Für alle Fans von Peter Grant Nach dem umwerfenden Erfolg von ›Der Galgen von Tyburn‹ kommt hier Nachschub für alle, die sehnlichst auf Neues aus dem Reich der Flüsse von London warten: Geistersichtungen auf der Metropolitan Line der Londoner U-Bahn! Chaos unter den Pendlern ist die Folge. Police Constable und Zauberlehrling Peter Grant nimmt ‒ mit ein paar guten alten Bekannten ‒ die Ermittlungen auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Ben Aaronovitch
Geister auf der Metropolitan Line
Eine Peter-Grant-Story
Deutsch von Christine Blum
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Bob Hunter, dem immer noch nicht ganz klar ist, wie sehr er dazu beiträgt, mich gut dastehen zu lassen.
Wer auch immer Sie sind, ich habe mich immer auf die Freundlichkeit von Fremden verlassen.
Tennessee Williams, Endstation Sehnsucht
1Ceci n'est pas un métro
Jaget erzählte, er hätte eine Fernsehdoku darüber gesehen, wie Menschen das Fährtenlesen lernen.
»Also, nicht Weiße, ja?«, sagte er. »Die Leute, die im Busch aufwachsen.«
Ganz konkret das südafrikanische Volk der !Xun, allerdings konnte Jaget den Klicklaut nicht aussprechen, bis ich es ihm beibrachte. Ich kann’s auch nur, weil ich einst den romantischen Traum hegte, nach Südafrika auszuwandern, und es mir von jemandem beibringen ließ. Seither hatte ich es zehn Jahre nicht mehr geübt, was bedeutete, dass wir es wahrscheinlich beide völlig falsch machten. Die anderen Passagiere schauten uns jedenfalls ziemlich komisch an – vielleicht hatte es auch damit zu tun, dass wir beide in Uniform waren.
Also, Sergeant Jaget Kumar stolziert ja die ganze Zeit in Uniform herum, um Terroristen, Taschendiebe und Leute, die zu laut Musik hören, besser in Schach halten zu können. Ich hingegen kann normalerweise ganz gut ohne meine stichsichere Metvest leben. Vor allem in der U-Bahn zur morgendlichen Rushhour Ende Juli, wenn in den Läden Mineralwasser zum Megaseller wird. Die S8-Züge sind zwar angeblich klimatisiert, aber bemerken tut man davon wenig bis gar nichts.
Wobei es erstaunlich ist, wie einem so eine Polizeiuniform selbst in der vollsten U-Bahn gute zehn Zentimeter persönlichen Freiraum verschafft. Die anderen Fahrgäste kriechen sich buchstäblich gegenseitig in die Achselhöhlen, um dich nur ja nicht zu berühren. Vielleicht glauben sie, das bringt Unglück oder so was.
»Also«, sagte Jaget. »Die Buschleute lernen das Fährtenlesen von klein auf, ja? Sobald sie laufen können, nehmen die Väter sie mit raus und zeigen es ihnen, und wenn sie erwachsen sind, sind sie Topspezialisten. Da war so ein Junge, der musste einen Wildwechsel nur anschauen und konnte dir sämtliche Viecher aufzählen, die in den letzten Tagen da langgekommen waren.«
»Woher wussten die, dass er sie nicht anschwindelt?«
»Was?«
»Na, das Filmteam«, sagte ich. »Woher wussten sie, dass es stimmt, was er sagte? Vielleicht hatte er das alles komplett erfunden.«
»Warum sollte er?«
»Weil da ’ne Horde Typen mit Kohle und Kameras um ihn herumstand und er sich dachte, das wollen sie bestimmt hören?«
»Also, ich fand’s glaubhaft.«
Ich sagte, ich hätte ein paar Nächte lang eine Wildkamera aufgestellt, dann hätte man die Aussage des Jungen mit den Aufnahmen abgleichen können. Jaget meinte, darum gehe es doch gar nicht.
»Worum dann?«
»Dass Abigail vielleicht deshalb besser im Geisteraufspüren ist als du, weil du sie die letzten Jahre nur das hast machen lassen. So etwa zehntausend Stunden lang.«
»Sie hat auch noch andere Sachen gemacht.«
»Was denn?«
»Weiß ich nicht«, sagte ich. »Und das macht mir irgendwie Sorgen.«
In diesem Moment entstand weiter hinten im Zug Unruhe. Ein schöner lauter Schrei wäre uns noch lieber gewesen, aber nach zwei Stunden in der U-Bahn zur Stoßzeit war uns alles recht.
»Na endlich«, sagte Jaget.
Selbst in Uniform brauchten wir gute fünf Minuten, um uns ans Wagenende durchzudrängen. Als wir im fraglichen Bereich ankamen, taten dort alle hingebungsvoll so, als wäre nichts geschehen.
Ich merkte mir die Gesichter der Umstehenden, falls sie später noch wichtig wurden, und nahm dann die junge weiße Frau im blauen Kostüm aufs Korn, die neben der Tür am Ende des Zuges saß. Sie fiel mir deshalb auf, weil erstens ihr Gesicht etwas gerötet war und sie uns zweitens ständig verstohlene Blicke zuwarf, um sich gleich darauf wieder wahnsinnig für ihren Kindle zu interessieren.
Jaget und ich gingen daran, einschüchternde Präsenz zu zeigen, bis um uns herum genug Platz war, dass ich in die Hocke gehen und sie in meinem besten nicht-bedrohlichen Ton fragen konnte, ob alles in Ordnung sei. Falls es Sie interessiert – dieser freundliche, leutselige Singsang mit beruhigender lokaler Note (in meinem Fall Cockney) ist wohlbedacht. Wir üben das vor dem Spiegel. Es dient dazu, Ihnen zu suggerieren, dass wir total nette, kundenorientierte moderne Polizisten sind, deren absolute Priorität es ist, Ihr persönliches Wohl zu sichern … die aber trotzdem nicht verschwinden werden, bevor Sie nicht den Mund aufgemacht haben. Sorry, so ticken wir nun mal.
Ich überließ dann aber Jaget das Feld, weil es sich technisch gesehen um sein Terrain handelte – vor allem, falls es sich als ganz ordinäre sexuelle Belästigung herausstellen sollte. Er entlockte ihr erst einmal ihren Namen: Jessica Talacre, vierundzwanzig, PR-Frau bei einem kleinen technischen Verlag in der Charterhouse Street.
»Waren Sie das, die gerade geschrien hat?«, fragte er.
»Ich bin nur erschrocken.« Sie verschränkte die Arme. »Jemand hat mich angerempelt.«
Jaget ließ den Blick über die Umstehenden und -sitzenden wandern. »Jemand von diesen Leuten?«
»Ist schon gut«, sagte sie. »War sicher keine Absicht.«
»Aber es war niemand von den Leuten hier, oder?«, fragte ich.
Jessica Talacre sah mich scharf an. »Wieso denken Sie das?«
»War etwas an der Person merkwürdig?«, fragte ich zurück.
»Außer dass es ein Geist war?« Sie blickte trotzig und dann ein bisschen besorgt, ob wir vielleicht Zwangsjacken dabeihatten.
»Was bringt Sie zu der Annahme, dass der Betreffende ein Geist war?«, fragte ich.
»Na, dass er sich vor meinen Augen in nichts aufgelöst hat.«
Ich zog mein Notizbuch heraus und fragte, ob sie ihn beschreiben könne.
»Moment mal«, sagte sie. »Sie glauben mir?«
Seit einiger Zeit waren gehäuft Hinweise eingegangen, dass auf der Metropolitan Line Geister unterwegs waren. Was Jaget pflichtschuldig an mich weitergab, weil für störende Gruselfaktoren die Einheit Spezielle Analysen zuständig ist, auch bekannt als Folly oder »die verdammten Spinner«. Da die ESA eine eher kleine operative Kommandoeinheit ist, bestehend aus Detective Chief Inspector Nightingale und mir, und da sich kein Inspector frühmorgens aus dem Bett bequemt, wenn es nicht mindestens um eine Leiche in der Bibliothek geht, dürfen Sie nur zweimal raten, wer für das Aufnehmen der meisten Fälle zuständig ist.
Als ich Jaget zum ersten Mal begegnete, arbeitete er bei der Abteilung London Underground der British Transport Police. Vor kurzem hatte diese sich neu organisiert und ihn in die protzige Zentrale in Camden versetzt – mit höchsteigenem Büro. Er war nun direkt dem Chief Constable unterstellt und auf dem Papier eine Art mobiler Troubleshooter, in Wirklichkeit aber dafür zuständig, sich um Fälle von abstrusem Scheiß (sprich: Magie) in der U-Bahn zu kümmern. Schuld daran war seiner Meinung nach natürlich ich.
»Wieso denn ich? Du bist doch so wild aufs Erforschen unterirdischer Gänge. Du bist aus völlig freien Stücken da reinmarschiert.«
Immerhin gab er zu, dass seine Arbeit seit der Versetzung recht abwechslungsreich geworden war. Er zeigte mir auch sein brandneues Büro, von dem aus man einen hübschen Blick auf den Parkplatz und den Kanal gehabt hätte, wenn nicht die Jalousien ständig hätten geschlossen sein müssen, damit keiner reinschauen konnte.
»Die breite Öffentlichkeit muss ja nicht mitkriegen, was wir den ganzen Tag so anstellen«, sagte er und überreichte mir einen gelben Ordner voller Papiere. Heutzutage schickt man sich auch bei der Polizei Dokumente normalerweise als Mailanhang, aber im Folly wird bevorzugt auf die gute alte Art gearbeitet. Nur für den Fall, dass unsere Mails geleakt werden – außerdem ist erst die eine Hälfte unserer Belegschaft schon im 21. Jahrhundert angekommen.
»Das hier hab ich von Project Guardian bekommen«, erklärte Jaget. »Mit der Bitte um meinen Rat.«
Project Guardian war eine gemeinsame Initiative von BTP, Transport For London, der Met und der City Police gegen sexuelle Belästigung und aggressives Verhalten im öffentlichen Nahverkehr. Eines ihrer Ziele war, eine höhere Meldungsrate für solche Delikte zu erreichen, was bedeutete, dass man den Opfern das Gefühl vermitteln musste, sie ernst zu nehmen. Wenn also gleich mehrere Anzeigen wegen Belästigung durch »einen Typen, der gar nicht da war« hereinkommen, wirft man die gefälligst nicht in die Tonne. Sondern gibt sie bitteschön an diejenigen weiter, die für genau solche Abstrusitäten zuständig sind – Jaget und mich.
»Ein Typ, der gar nicht da war?«, fragte ich.
Es waren zwei Meldungen von Männern und fünf von Frauen, die entweder den Notruf oder die Hotline von Project Guardian angerufen hatten. Sie gaben an, betatscht, beschimpft und in einem Fall rassistisch beleidigt worden zu sein.
»Alle auf der Metropolitan Line«, bemerkte Jaget.
So richtig abstrus wurde es bei der Nachverfolgung der Angelegenheit. Als Project Guardian sich bei ihnen meldete, bestritten alle sieben Opfer, dass der Vorfall je stattgefunden hatte, und zeigten sich überrascht bis genervt, dass die Polizei etwas von ihnen wollte. Nun kommt es zwar ständig vor, dass Zeugen und Opfer ihre Meinung ändern, vor allem bei Gewalt- und Hasskriminalität. Aber hier lag definitiv ein Muster vor. Ich fragte mich, ob sie eingeschüchtert worden waren.
»Gab es noch weitere Folgemaßnahmen?«, wollte ich wissen.
»Project Guardian war besonders bei Amirah Khalil besorgt, wegen des rassistischen Aspekts.« Jaget zeigte mir das Protokoll ihres Notrufs. Die relevanten Stellen waren markiert.
ANRUFER: Er hat mich dreckiges Sarazenenweib genannt und sich total irre benommen. Ich hab Angst, dass er [unverständlich] zurückkommt. Er hat mich bedroht, da war … [VERBINDUNGAUFANRUFERSEITEABGERISSEN]
»Wir glauben, dass ihre U-Bahn in diesem Augenblick in den Tunnel nördlich von Baker Street einfuhr«, erklärte Jaget. »Sie hat sich nicht wieder gemeldet.«
Aber weil die Frau vom Handy aus angerufen hatte, fand Project Guardian problemlos ihren Namen heraus und fast ebenso schnell ihre Wohnadresse in Watford. Dort bestritt sie wenig später, dass ein solcher Vorfall je stattgefunden oder dass sie die Polizei angerufen hatte.
»Ich hab mit den Jungs geredet, die sie befragt haben. Denen kam es wirklich so vor, als hätte sie keine Erinnerung an den Anruf.«
Ich betrachtete das Foto von Amirah Khalil. Rundes Gesicht, dunkle Augen. Ihre Familie stammte aus Ägypten, aber sie war hellhäutig genug, um als Italienerin oder Spanierin durchzugehen. Sarazenenweib – komische Beleidigung. »Hatte sie in der U-Bahn einen Hijab oder ein Kopftuch an?«
»Wegen der Sarazenin, meinst du? Bei der Befragung trug sie einen Hijab. Daher auch die besondere Sorge.«
Auch einen zweiten Anzeigenerstatter hatte Project Guardian persönlich aufgesucht, einen Jonathan Pickering, Grove Avenue, Pinner. Mr. Pickering war äußerst zeitnah befragt worden, zwei Beamte der BTP hatten sich auf seine eigene Bitte hin nur zehn Minuten nach seinem Anruf an der Station Finchley Road mit ihm getroffen. Nach der Schilderung der Beamten hatte Mr. Pickering recht vage und unsicher auf die Frage geantwortet, warum er an der Finchley Road ausgestiegen war – und als sie seine Aussage aufnehmen wollten, stritt er ab, dass überhaupt etwas vorgefallen war. Daraufhin zeigten sie ihm seinen gespeicherten Anruf. Mr. Pickering behauptete, sich nicht an diesen erinnern zu können, und reagierte überrascht und ungläubig, als er in seiner eigenen Anrufliste die Notrufnummer fand.
Ich las das Protokoll seines Notrufs durch. Mr. Pickering gab klar und deutlich an, er sei von einem »komischen Kerl« belästigt worden, der ihn einen »Zigeuner« nannte und verlangte, er solle »sich gefälligst gerade hinstellen«. Im Protokoll war eine zwei Sekunden lange Pause verzeichnet, dann war zu hören, wie Mr. Pickering andere Passagiere fragte: »Sie haben das doch auch gesehen? Haben Sie das mitbekommen? … Verdammt, es kann doch nicht sein, dass Sie das nicht gesehen haben!«
Mr. Pickering war Programmierer bei einer Softwarefirma in der Nähe des Kreisverkehrs an der Old Street; anders als Ms. Khalil hätte er in King’s Cross umsteigen müssen. Die genaue Fahrtroute war also wohl nicht entscheidend.
»Und, was meinst du?«, fragte Jaget.
Ich sagte ihm, mit dem »Sarazenenweib« hätte er mich definitiv gekriegt. Ich würde die Akte mitnehmen, eine vorläufige Falcon-Einschätzung vornehmen und am nächsten Tag wieder vorbeikommen.
»Vorläufige Falcon-Einschätzung?«, fragte er.
»Ja, auch wir im Folly schöpfen die Potenzialität moderner Polizeiarbeit voll aus.«
Auch wenn unser Ablagesystem zur Gänze von der (vorletzten) Jahrhundertwende stammte. Die Schriften über Geister verteilten sich über zwei separate Bibliotheken, diverse ohne erkennbares System abgeheftete Berichte von Zauberern und Bezirkspraktizierenden ab dem 18. Jahrhundert und eine Karteikartensammlung, die mir verdächtig unvollständig vorkam – als hätte derjenige, der sie angelegt hatte, mittendrin entnervt aufgegeben.
Zum Glück stand mir jedoch eine dieser nützlichen, vielseitig einsetzbaren Bürokomponenten unserer Tage zur Verfügung: die unbezahlte Schulpraktikantin in Gestalt meiner minderjährigen Cousine Abigail Kamara. Die, da jetzt Sommerferien waren, davon abgehalten werden musste, Blödsinn anzustellen.
»Was für ein Gespenst ist es denn?«, fragte sie.
»Wir wissen noch nicht, ob es überhaupt eins ist«, sagte ich. »Keine vorschnellen Annahmen, bitte.«
Sie verdrehte die Augen, um anzudeuten, dass hier nur einer vorschnelle Annahmen machte, und zwar nicht sie. Ihr schmales Gesicht konnte einen Ausdruck derart streitlustiger Skepsis annehmen, dass ihre Lehrer schworen, dies selbst dann noch zu spüren, wenn sie sich im Lehrerzimmer versteckt hatten. Diesem Gesichtsausdruck plus ihrer Sturheit und dem alltäglichen unterschwelligen Rassismus hatte sie es zu verdanken, dass sie in ständiger Gefahr schwebte, von der Schule zu fliegen.
»Sie ist so aufsässig«, sagte mir eine ihrer Lehrerinnen, konnte auf meine Nachfrage hin aber nicht präzisieren, worin genau diese Aufsässigkeit bestand. »Ich weiß es nicht«, jammerte sie. »Sie sitzt da und starrt einen an, und die ganze Stundenvorbereitung löst sich in Luft auf.«
Mein Boss Nightingale, der ihr Lateinunterricht gab, hatte keine solchen Probleme. »Wenn nur all meine Schüler so fleißig wären«, pflegte er zu bemerken – was ich ein bisschen unfair fand angesichts der Tatsache, dass ich sein einziger weiterer Schüler war. Abigail musste schließlich nicht nebenher in Vollzeit bei der Polizei arbeiten oder zaubern lernen. Wobei ich befürchtete, dass es mit dem Zaubern nicht mehr lange dauern würde.
»Es muss Ihnen doch damals klar gewesen sein, dass sie unweigerlich in die Lehren und Künste eingewiesen werden muss«, sagte Nightingale.
»Ich hatte gehofft, das könnte warten, bis sie wenigstens achtzehn ist«, sagte ich. Insgeheim hatte ich eher gehofft, sie würde bis dahin das Interesse verlieren … aber versprochen ist versprochen, oder, wie Nightingale so schön sagt: »Entweder Sie stehen zu Ihrem Wort, oder es ist wertlos.«
Die Zauberei ist mühsam zu erlernen, kompliziert und birgt ernste Risiken. Aber sie sich in Eigenregie beizubringen endet fast unweigerlich tödlich. Und so wie ich Abigail kannte, würde sie im Zweifelsfall genau das versuchen. Also würden wir uns irgendwann mit ihren Eltern hinsetzen und ihnen erklären müssen, dass wir ihrer Tochter das Zaubern beibringen wollten.
»Ist das gefährlich?«, würden sie fragen.
»Oh, lebensgefährlich bis tödlich, aber wenn sie’s nicht von uns lernt, wird sie sich ziemlich sicher beim Herumprobieren umbringen, noch bevor sie sechzehn ist.«
Das war so ein Gespräch, auf das ich mich schon richtig freute.
Eine schöne gründliche und vermutlich sinnlose Suche in den Archiven war genau das Richtige, um diesen Tag des Schreckens noch etwas hinauszuzögern. Während Abigail sich die Karteikarten vornahm, pinnte ich eine Karte von Nordwestlondon an die Wand des Lesezimmers im ersten Stock und markierte die Metropolitan Line sowie die Orte, die in den Meldungen erwähnt wurden.
Die Metropolitan Line startet bei Aldgate im Herzen Londons, strebt von dort aus nach Nordwesten bis weit über die M25 hinaus und verliert sich erst kurz vor den Chiltern Hills. Ursprünglich war sie als Bahnlinie von den Midlands nach Paris geplant, mit kleinem Zwischenstopp in London zum Shoppen. Dass an ihr entlang stattdessen ein substanzieller Teil des modernen London entstehen würde, war eine zufällige Nebenwirkung – aber die Geschichte meiner Stadt besteht seit Anbeginn aus einer Abfolge zufälliger Nebenwirkungen, fragen Sie nur mal Boudicca.
Ans Tageslicht kommt die Linie bei Baker Street, dann macht sie einen Satz über die Jubilee Line, erreicht in nur zwei Stationen Wembley Park, kreuzt die North Circular und eilt so schnell wie möglich auf den Grüngürtel zu, wobei sie bloß eine flüchtige Pause einlegt, um sich zu teilen und ein paar Schlafstädte aus dem Boden schießen zu lassen, damit die Londoner Mittelschichts-Nullbockgeneration was hat, wogegen sie sich auflehnen kann. Dann kommt Rickmansworth und damit das Grauen, die letzten Ausläufer der Stadt bleiben zurück, und die U-Bahn-Linie verschwindet in den grünlich schimmernden Nebeln Buckinghamshires.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich mag ländliche Gebiete. Tatsächlich sind einige meiner besten Freunde landschaftliche Gegebenheiten. Nur ist die Polizeiarbeit dort draußen wirklich scheußlich vertrackt. Zum Glück für mich hatten sich alle sieben Vorfälle aus Jagets Akte zwischen Baker Street und Wembley Park abgespielt. Und ja, übernatürlich waren sie definitiv – dieses Gedächtnisschwund-Phänomen kannte ich bereits.
Dr. Walid hat die These aufgestellt, dass Menschen unter bestimmten magischen Einflüssen möglicherweise eine andere Art von Neurotransmittern als normalerweise produzieren, ähnlich denjenigen, von denen man annimmt, dass wir sie im Schlaf generieren. In beiden Fällen gehen Kurzzeiterinnerungen nicht ins Langzeitgedächtnis über – deshalb vergessen wir auch nach dem Aufwachen unsere Träume.
Ich rief ihn an. Alles, was er beitragen konnte, war der Vorschlag, den nächsten Zeugen möglichst schnell zu erwischen, solange dieser vielleicht noch genauere Erinnerungen hatte.
»Wenn es ähnlich funktioniert wie das Erinnern an Träume«, sagte er, »könnte das Erzählen davon helfen, es im Langzeitgedächtnis zu verankern.«
Sein Herzenswunsch wären wie üblich Blutproben gewesen, aber wir müssen immer wieder feststellen, dass es der Bevölkerung erstaunlich widerstrebt, der Polizei ihre Körpersäfte zur wissenschaftlichen Untersuchung zu überlassen.
Noch einmal ging ich die Meldungen durch in der vergeblichen Hoffnung, dass mir etwas Neues auffallen würde. Dann begab ich mich zum Tee ins Atrium hinunter. Molly hatte etwas gebacken, was einem Bananenkuchen ähnelte, nur waren Rosinen darin. Sie experimentierte wieder – wir vermuteten, unter dem Einfluss der Fernsehsendung The Great British Bake Off.
Beim Tee holte Abigail ihr Notizbuch heraus und begann darin zu blättern. Ihr erstes Notizbuch hatte ich ihr vor vielleicht einem Jahr geschenkt; dieses hier war bestimmt schon Nummer zehn. Genau konnte ich es nicht sagen, weil sie niemandem erlaubte hineinzuschauen, und ihrem Dad zufolge bewahrte sie sie in ihrem Zimmer in einem verschließbaren Kasten auf, den er für sie gemacht hatte. Ihr Dad ist Gleisbauer, das heißt, wenn er was baut, dann ist das zu solide, als dass ich mal kurz reinlinsen könnte. Nightingale bekäme das Ding