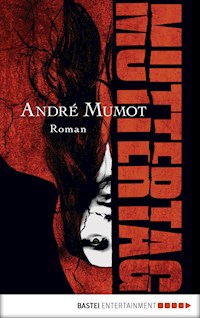15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein doppelbödiger literarischer Spannungsroman, fiebrig, poetisch und verblüffend
Die Berliner Schauspielerin Kathi Bechstein verdient mit spiritistischen Sitzungen gutes Geld - auch wenn sie noch nie einen Geist gesehen hat.
Ihr Leben nimmt eine jähe Wendung, als die zehnjährige Sophie bei ihr auftaucht und ihr einen ganz besonderen Auftrag erteilt: Kathi soll mit Sophies ermordetem Bruder in Kontakt treten. Es eilt.
Was wie ein Spiel beginnt, wird bald schon bitterer Ernst. Unversehens geraten das falsche Medium und das Mädchen mit dem Glasauge in einen Strudel bedrohlicher Ereignisse - und holen Geheimnisse ans Tageslicht, die besser verborgen geblieben wären.
"Dieser Erzähler hat Vergnügen daran, Horror- und Thrillermotive mit dem Familienroman zusammenzuführen"Jens Bisky,SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, überMUTTERTAG
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumZitatI SchweißII Die kleine und die große Hand123456789101112131415161718192021III Der Riese im Fluss1234567891011121314151617181920212223242526272829303132IV MondscheinsonateV Die Engel Wahrheit und Gnade123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839VI Konfetti12345DanksagungÜber dieses Buch
Kathi Bechsteins spiritistische Sitzungen sind ein gutes Geschäft. Die als Schauspielerin leider wenig gefragte Kathi kommt über die Runden - nur einen Geist hat sie bisher noch nicht gesehen. Eines Nachmittags klingelt ein junges Mädchen bei ihr und fleht Kathi an: Sie soll Kontakt herstellen zum ermordeten Bruder des Mädchens. Und das bitte so schnell wie möglich. Es eilt. Ungewollt werden das falsche Medium und das Mädchen mit dem Glasauge zu Ermittlern. Ein literarischer Spannungsroman voller Überraschungen.
Über den Autor
André Mumot ist promovierter Kulturwissenschaftler, Autor, Literaturübersetzer, Journalist und lebt in Berlin. Er übersetzte u.a. Bücher von Jo Nesbø und Neil Gaiman. Sein Debütroman »MUTTERTAG« erschien im Herbst 2016 im Eichborn Verlag.
André Mumot
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Anabelle Assaf, Köln
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
Einband-/Umschlagmotiv: © Tobyphotos / shutterstock
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-6047-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Thousands of ghosts in the darknessLost in a strange neighborhoodThe lights from the warm houses haunt themThey forgot what they lost but they know it was good
Stars: I died so I could haunt you
ISchweiß
Dienstag, 29. August 2017
Der Abend, an dem Jakob Bechstein ins Koma geprügelt wird, ist einer der schönsten des Sommers. Ein Abend, auf den viele gewartet haben. Weil die Luft mild ist und warm und keine Wolken über den Häusern hängen. Kein bisschen schwül ist es, und endlich kann man aufatmen. Die meisten Fenster stehen offen, und die Leute zieht es hinaus in die vollen, freundlichen Farben dieses Abends, in sein sanftes Licht. Jakob Bechstein ist einer von ihnen.
Vorläufig noch ohne Ziel, erst einmal Richtung Strausberger Platz. Da steht der Brunnen, mitten im Kreisverkehr, und vermischt den Feinstaub in der Luft mit winzigen Wassertröpfchen. Um ihn herum Wagen und Fahrräder und Menschen und die zwei hohen Wohntürme aus einer anderen Zeit. Ganz in der Nähe laufen Kinder über den Spielplatz, brüllen, lachen.
Irgendwo am Rand, ein Stück abseits der Rutsche, sitzen zwei und fühlen sich ausgeschlossen. Das ist immer so. Irgendwer gehört eben nicht dazu. Aber auch sie werden heute länger draußen bleiben. Die Gutenachtgeschichten müssen noch warten.
Jakob Bechstein nickt und redet und strahlt wie alles um ihn herum. Er ist nicht allein, hat den Arm lässig um die Schultern von Kenan Akyüz gelegt, und beide lachen. Jemand wie Jakob muss nicht allein sein, wenn er nicht will. Ausgeschlossen fühlt er sich nie. Er sieht gut aus, ist munter und sorglos. Bei diesen milden dreiundzwanzig Grad und dem hohen blauen Abendhimmel gibt es aber auch wirklich keinen Grund, sich zu beschweren. Genießen muss man das, denn spätestens morgen geht es wieder los. Spätestens morgen beschwert sich wieder irgendwer.
Übers Wetter klagen die Leute in jedem Sommer, da gibt es keine Ausnahmen. In Umkleidekabinen, in Mittagspausen, vor Kantinenfenstern und in Schlafzimmern, bei ersten Dates und leise unter den schwarzen Regenschirmen, die bei Beerdigungen aufgespannt werden. Der Himmel weint, sagen sie. Sie reden, wenn sie schon mal dabei sind, auch über die Politiker, die immer bloß Lügen von sich geben, und über die Mieten, die immer bloß steigen. Manche reden übers Theater und über Bücher oder über die Ausländer und die Terroristen, aber irgendwann reden dann doch alle bloß wieder übers Wetter.
Man kann es verstehen. Dieser Sommer hat den meisten Regen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gebracht. An einigen Tagen hat er die Straßen so tief unter Wasser gesetzt, dass die Bewohner der Stadt an den Haltestellen die Füße heben mussten, weil bei jedem Öffnen der Bustüren ein großer Wasserschwall ins Fahrzeuginnere hereingerauscht kam. Und während sie in den vergangenen Jahren oft wochenlang darauf warten mussten, dass ein erlösendes Gewitter die aufgestaute Hitze aus den Hinterhöfen wusch, hat in diesem August jede Unwetterfront sofort die nächste nach sich gezogen und jeden halbwegs sonnigen Tag gnadenlos mit donnerndem Zorn bestraft.
Dazwischen die drückende Wärme, von der niemand etwas hat. Wenn man schon morgens verschwitzt aus der Bahn steigt und den ganzen Tag mit Flecken unterm Arm herumläuft, möchte man wenigstens in einen sonnigen Himmel schauen dabei, möchte an den See am Nachmittag, abends draußen sitzen und sich so lange Bier bestellen oder Wein, bis man angenehm betrunken ist. Aber dann rücken doch wieder die Wolken zusammen, und schon springen alle in die nächste Tram. Denn wenn es erst einmal anfängt zu regnen in diesem Sommer, hört es so schnell nicht wieder auf.
Und da soll man nicht verrückt werden?
Nein, soll man nicht.
Immer schieben sie’s aufs Wetter, die Leute. Ihre Wut und ihre schlechte Laune, ihre Schmerzen im Kopf und in den Gelenken, und am Ende auch die Schläge, die sie anderen verpassen. Normalerweise muss die quälende Schwüle des langen Sommers als Entschuldigung herhalten. Weil es unmöglich ist, sich zusammenzureißen, wenn’s zu heiß ist, vor allem nachts. Die Polizei fährt öfter raus im Juli und im August, steht in Fluren, in Treppenhäusern, vor Kneipen und in Bars, beruhigt, greift ein, führt ab. Aber auch ein Regensommer, der die Leute unter die Markisen treibt, der sie hinter Fenstern stehen und voller Unruhe ihre Wetter-Apps mustern lässt, kann sehr wütend machen.
So ein Sommer entwurzelt Bäume, die auf Autos krachen. Es schert ihn nicht, ob zufällig jemand in solch einem Wagen sitzt, auf sein Handy starrt und feststellt, dass die Niederschlagswahrscheinlichkeit für die nächsten sechs Stunden bei 80 Prozent liegt. Es dauert noch ein Weilchen, bis die wirklich verheerenden Herbststürme aufziehen, aber der durchweichte Boden bringt die Bäume schon jetzt zu Fall, nimmt den Wurzeln ihren sicheren Halt. Verlässliche, freundliche Kastanien geraten ins Wanken, und stramme deutsche Eichen kippen einfach um.
Eine fantastische Sache ist dieser Sommer eigentlich nur für die Mücken. Überall breiten sich auf den unebenen Bürgersteigen und den sandigen Parkwegen der Stadt kleine und größere Pfützen aus. Bald kreisen darüber Flügel, Beine, Stechrüssel, verbinden sich zu dünnen, kaum sichtbaren Körpern und steigen suchend auf. Auch die Mücken würden wohl übers Wetter reden, wenn sie’s könnten, und zwar voller Begeisterung. Das ist ihr Sommer. Aber sie wissen: Viel Zeit bleibt ihnen nicht, um ihren Hunger zu stillen und Eier abzulegen. Der Herbst ist fast schon da. Also lassen sie sich von den Blut- und Schweißgerüchen treiben. Beides ist hier im Überfluss vorhanden, da müssen sie nicht lange suchen.
Überall sprechen offene Fenster ihre Einladung aus. Auf der Danziger Straße, im vierten Stock, hinter einem dieser Fenster, steht Jakob Bechsteins Schwester und schaut hinaus. Zwei Mücken sind bereits fest entschlossen, bei ihr einzuziehen, und huschen an ihr vorbei.
Auch Kathi Bechstein atmet auf. Auch ihr tut es gut, dass der Abend zur Abwechslung mild ist und heiter. Das einzige Problem: Wenn es zu schön ist, sagt ihr womöglich die Kundschaft ab. Das wäre ärgerlich. Für ihr Geschäft bieten dunkle Wolken und ferner Donner bessere Arbeitsbedingungen. Aber nur nicht den Teufel an die Wand malen. Sie werden schon kommen. Man muss ja von irgendwas leben.
Jakobs Schwester schließt das Fenster und zieht die schweren Vorhänge zu. Das Deckenlicht brennt zu hell und bringt die beiden Mücken durcheinander. Aber Kathi Bechstein wird umgehend für indirektere Beleuchtung sorgen. Sie zündet Kerzen an, verteilt sie auf der Kommode und auf den zwei Beistelltischen. Sie weiß genau, wie der richtige Effekt zustande kommt. Eine einzelne Lampe wird später von unten ihr Gesicht anstrahlen und starke Schatten werfen.
Sie stellt eine flache gusseiserne Schale mit Wasser in die Mitte des runden Tisches und frische, aber dezente Duftstäbchen ins Regal. Ihre Klienten wissen den stilistischen Minimalismus zu schätzen, übertriebenen Hokuspokus können sie an jeder Ecke bekommen. Außerdem geht es nicht um das, was schon im Raum ist, sondern um das, was sie in den Raum hineinholen wird.
Ein prüfender Blick. Ihre Hand fährt über die Rückenlehne eines Stuhls, schiebt ihn ein Stück zur Seite. Sie räuspert sich mehrmals. Eine altmodische Pendeluhr macht Geräusche an der Wand. Wie ein Metronom. Das erträgt sie nur, wenn sie Sitzungen veranstaltet. Wenn nicht, hält sie die Uhr an.
20 Uhr 53.
Wie schön: Es sind keine Nachrichten auf ihrem Handy. Bisher hat niemand abgesagt. Also geht sie noch einmal ins Bad, begutachtet sich im Spiegel. Mit spitzen Fingern zupft sie zwei lange blonde Haare von ihrem hochgeschlossenen schwarzen Wollkleid. Sie legt die Kette mit den großen Amethysten um und zieht den braunroten Lippenstift nach. Dazu dunkler Lidschatten. Das Wichtigste sind dramatische Augen.
Kathi Bechstein ist zufrieden. Sie schaltet das Licht im Bad aus und lockert die Schultern. Beim Gang über den Flur macht sie Stimmübungen, sagt zweimal mit angespannter Gesichtsmuskulatur: »Zwischen zweiundzwanzig schwankenden Zwetschgenzweigen.« Gelernt ist gelernt.
Dann klingelt es endlich, und ihre Finger legen sich mit sanftem Druck auf den Türöffner. Sie strafft sich und lächelt. Mit einem freundlichen Guten Abend bittet sie den ersten Gast in die künstliche Nacht ihrer Wohnung, während ihr Bruder mit seinem Begleiter schon beinahe den Alexanderplatz erreicht hat und die letzte Sonnenwärme auf den Wangen spürt.
Jetzt bleibt er stehen, schaut auf sein Telefon. Schüttelt den Kopf. Dann grinst er wieder und erklärt, was los ist.
Fahrräder fahren an ihm und Kenan Akyüz vorbei. In einigem Abstand bleiben drei Männer stehen. Sie sind schon eine ganze Weile hinter den beiden hergegangen und haben auf dem Weg abwechselnd aus einer kleinen Wodkaflasche getrunken. Jetzt zünden sie sich Zigaretten an. Einer fotografiert. Den schönen Abend. Und Jakob Bechstein, der sich verabschiedet, weil er noch wegmuss. Es hat sich sehr spontan etwas ergeben.
Nein. Moment. Echt jetzt?
Es könnte so schön sein, aus dem Abend könnte eine Nacht werden, eine gemeinsame. Aber mit so was muss man bei Jakob immer rechnen. Er hat so viele Freunde. So viele Menschen, die um ihn buhlen, die ihn treffen, mit ihm Zeit verbringen, ihn küssen oder sonst was mit ihm machen wollen. Zugegeben: Vielleicht gibt es auch den ein oder anderen, der ihn zusammenschlagen möchte.
»Wir sehen uns dann morgen wieder, ist doch kein Problem. Mach du auch noch was Schönes.«
»Was Schönes?«
Jetzt, da Jakob wegmuss, scheint auch die Luft nicht mehr ganz so sauber und frisch zu sein. Wenn er nicht strahlt, sondern Ausflüchte macht, strahlt auch die Umgebung nicht mehr. Der Wind hebt einige Blätter auf und pustet Körnchen in die Gesichter der rauchenden Männer, die Jakob beobachten und auf ihre Gelegenheit warten. Wie winzige Spiegelscherben fühlen sie sich an und stechen auf der Haut. Man macht besser kurz die Augen zu. Einer, es ist ein blonder mit mehreren aufgekratzten Pickeln auf der Stirn, löst sich von der Gruppe, geht schon mal vor und ist bald nicht mehr zu sehen.
Die Sonne zieht sich ebenfalls zurück. Zeit für die Straßenlaternen. Sie stehen überall, links und rechts auf den Bürgersteigen, und ihre über die Fahrbahn gebogenen Hälse sind reich behängt mit Politikergesichtern. Überall die Kanzlerin – auch sie eine mütterliche, kreisrunde Sonne, die fest darauf vertraut, dass sie immer wieder aufgehen wird, ganz gleich, wie dunkel es zwischendurch auch werden mag: »Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben.«
Jakob Bechstein schaut noch einmal auf sein Handy, runzelt kurz die Stirn. Neben ihm tritt Kenan Akyüz von einem Fuß auf den anderen. Auf einem der Plakate steht: »Digital first, Bedenken second.« Eine dunkelhaarige Frau zeigt von ihrem Laternenbild mit dem Finger in die Welt. »Ich schütze am liebsten Daten, Grundrechte und Bienen.« Bienen? Dein Ernst?
Die Mücken würden lachen, wenn sie’s könnten. Sie sind nicht derart schutzbedürftig, auch nicht so verweichlicht: Siegessicher und fast unsichtbar treiben sie in ihrer eigenen Wolke. Für Pollen interessieren sie sich nicht, auch nicht für Obstbäume, nur für Blut.
Zwei von ihnen wissen schon, dass ihnen ein guter Abend bevorsteht. Denn in Kathi Bechsteins warmer, stickiger Wohnung mit den dicht zugezogenen Vorhängen haben sich inzwischen mehrere entblößte Hälse und Nacken eingefunden. Außerdem Handgelenke, die zu Händen gehören, die einander umfassen und sich auf den runden Tisch legen. Wie auf dem Silbertablett.
Der Schweiß im Raum ist köstlich, weil er verstärkt wird vom Aroma einer leichten Angst. Die Uhr tickt. Anspannung dünstet sich aus am Tisch, das klamme, aufregende Gefühl, etwas eigentlich Verbotenes zu tun. Aber Kathi Bechstein schaut mit einem vertrauenerweckenden Blick in die Runde. Aufmunternd drückt sie die Hände links und rechts von sich. Es wird euch nichts passieren, sagt dieser Druck.
Einer der Gäste ist ein Neuling, ein frisch verwitweter Heilpraktiker aus Halensee. Er hat diese besondere Erfahrung noch nicht gemacht, und ihn lächelt sie besonders mütterlich an. Dann atmet sie ein und hebt die Augenbrauen.
»Wir fangen an. Keine Sorge. Wir sind hier zusammen, wir gehen unseren Weg gemeinsam.« Ein Nicken. Alles klar? »Wir wollen nun unsere Energien verbinden«, sagt Kathi Bechstein. Ihre Stimme klingt ganz anders, als wenn sie beispielsweise Brötchen kauft oder mit ihrem Bruder telefoniert. Tiefer. Klarer. Nachdrücklicher. »Wir wollen uns nahekommen, wir wollen unsere Gedanken vereinen und leeren. Wir müssen uns jetzt konzentrieren.«
Alle halten den Atem an, und die im Kerzenschein zuckenden Schatten der Mücken an der Wand bäumen sich auf wie zornige Doppelgänger.
»Stellt euch eine Farbe vor. Eine Farbe, die euch beruhigt.« Der Heilpraktiker öffnet kurz die Augen, befeuchtet seine Lippen. Na gut.
»Und nun ein Zimmer. Stellt euch ein Zimmer vor, das ihr gut kennt. Ein Zimmer, das ihr betretet und in dem eine Erinnerung auf euch wartet. In dem ihr demjenigen nahe gewesen seid, um den es euch geht. Dieser jemand ist nicht mehr dort. Das Zimmer ist verlassen. Und es leert sich weiter vor euren Augen. Alle Möbel verschwinden, alle Dinge, die in dieses Zimmer gehören. Stattdessen dringt die Farbe, die ihr euch vorgestellt habt, Stück für Stück in das Zimmer ein. Seht ihr sie? Gut, sehr gut, ich sehe sie auch. Ganz, ganz langsam breitet sie sich aus, und ganz langsam wird es heller in eurem Raum. Mit dem Licht wird auch die Farbe blasser. Immer blasser, bis sie ebenfalls verschwindet.« Sie atmet mehrere Male angestrengt ein und aus. Man hört leise Ärmelstoff rascheln und die Uhr an der Wand. Danach ist Kathi Bechsteins Stimme verändert, gleichgültiger, beinahe schläfrig.
»Da ist jetzt ein helles Nichts, das den Raum ausfüllt und in euch übergeht. Lasst euch davon aufnehmen. Dieses Nichts ist freundlich. Es hebt euch auf, macht euch leicht. Ich kann jetzt in eure Zimmer treten, denn sie sind verbunden, sind eins, sind vom selben Licht erfüllt. Nun werde ich uns die Tür öffnen, die am Ende dieses Zimmers ist. Ich werde hindurchgehen auf die andere Seite.« Sie macht schon wieder eine Pause, atmet schwer. Was sie als Nächstes sagt, ist undeutlich. Es kommt aus ihrer Kehle, klingt aber, als wäre sie weit weg. Dann noch eine Pause. Sie schnauft, bewegt den Kopf. Hält die Augen geschlossen. Der Schein der Lampe strahlt sie an, verändert die Schatten zwischen Stirn und Mund, zieht sie in die Länge. Sie stößt ein Lallen aus. Dann ist sie wieder still. Nur die Uhr tickt.
Das kann lange dauern. Ihre Gäste müssen Geduld haben. Ein köstlicher, ängstlicher Schweißtropfen rinnt über einen entblößten Nacken. Kathi Bechstein ist durch die Tür gegangen und wird dahinter Dinge sehen, die ihre Besucher nicht sehen können. Das hoffen sie zumindest, daran glauben sie. Sie wird für sie vielleicht die Toten sehen. Die Lebenden sieht sie jetzt jedenfalls nicht mehr, nicht die Gäste an ihrem Tisch, und schon gar nicht ihren Bruder.
Dabei wäre es eine gute Gelegenheit, ihn noch einmal gebührend zu würdigen: Mitte dreißig und voller Energie, mit einem breiten Lächeln und schönem, gepflegtem Vollbart, in einem tief ausgeschnittenen T-Shirt, draußen auf der Alexanderstraße, wo es langsam schummrig wird. Genau genommen ist er deutlich hübscher als seine Schwester. Weil er weiß, dass er gut aussieht und auch viel dafür tut, fotografiert er sich gern im Fitnessstudio, halb nackt und ernst, oder entschlossen und kampfbereit auf Demos in Kreuzberg und Neukölln. Er ist Künstler und politisch aktiv. Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen aller Art machen ihn wahnsinnig. Vor der Welt und den Menschen hat er keine Angst. Er weiß, er ist im Recht. Deshalb muss er sich auch jetzt nicht entschuldigen, nichts begründen. Er muss gehen, das ist einfach so.
»Also bis morgen dann?«
»Klar, bis morgen.«
Kenan Akyüz bleibt nichts anderes übrig, als das einzusehen. Ist ja nicht das erste Mal.
Vierundzwanzig ist Kenan und wäre gern glücklich. Er wäre es gern heute, an diesem lauen Abend, der so vielversprechend begonnen hat, aber auch ganz grundsätzlich. Er weiß, es gibt noch Chancen: Er ist noch jung. Als er jetzt in Jakobs strahlendes, aufmunterndes Lächeln blickt, kommen ihm zwar ernsthafte Zweifel, doch wer das Glück sucht, wie Kenan Akyüz, trotzt dem Unglück, solange es geht. Deshalb streckt er die Arme aus.
Die Straßenlaternen verströmen in der warmen Dämmerung ein weiches, ganz besonderes Licht. »Burkas? Wir stehen auf Bikinis« sagt eins der Plakate, die ganz oben hängen. Aber die beiden schauen nicht hoch, sie schauen einander an. »Lügen haben lange Leitern« stand auf einem anderen, handgeschriebenen, das bis gestern an derselben Laterne hing, aber es ist schon entfernt worden. Der deutsche Bundestagswahlkampf ist eine ernste Angelegenheit, und Wahlplakate stehen unter besonderem Schutz.
Einer der beiden Männer, die sie immer noch beobachten, ein kräftiger Typ, der unter seiner Motorrad-Lederjacke nur ein weißes Unterhemd trägt, wirft seine Zigarette weg. Als würde er ausspucken. Mit engen, fokussierten Augen. Schon bereit. Der andere fotografiert den Abschied, macht ein Bild davon, wie Kenan seine Arme ausstreckt, die deutlich schmächtiger sind als die von Jakob. Kenan ist auch etwas kleiner, trägt eine kreisrunde Brille mit fast unsichtbarem Gestell, hat einen hellen Bartschatten, kurze dunkle Haare und einige Probleme, von denen er noch nichts weiß. Jetzt greift er nach Jakobs Gesicht und gibt ihm einen langen, intensiven Kuss. Traurig und trotzig küsst er ihn und mit so viel Nachdruck, dass Jakob unmöglich weggehen kann. Es ist ein Kuss, der sich gut fotografieren lässt.
Aber Jakob geht. Er betrachtet Kenan erst etwas überrascht und hebt dann eine Augenbraue, nur ein klein wenig spöttisch. Es ist nicht ihr erster Kuss und nicht ihr längster, auch nicht ihr leidenschaftlichster, aber ihr wichtigster. Jakob streicht mit den Fingern über Kenans Wange und strahlt. Noch ein Foto. Der Kuss sollte eine Aufforderung sein, aber Jakob nimmt ihn als Kompliment. Wie so vieles. Er verabschiedet sich, winkt noch mal und überquert die Straße.
Auf die beiden Männer, die Jakob folgen, achtet Kenan nicht. Später wird er sich auch nicht an sie erinnern. Er schaut bloß Jakob hinterher und schüttelt den Kopf. Na toll, denkt er. Und jetzt?
Jakob hat den Weg Richtung Jannowitzbrücke eingeschlagen, und Kenan fröstelt in seinem Shirt. Die Sonne ist schon ziemlich weit weg, geht hinterm Fernsehturm, irgendwo am Westberliner Himmel, endgültig unter, um die Stadt so dunkel zu machen, wie es in der kleinen Wohnung in der Danziger Straße schon ist. Die Kerzen flackern, und das Wasser in der flachen Schale zittert zwischen den sich umfassenden Händen. Es bildet Ringe.
Die Uhr an der Wand gibt der Stille ihren Puls. Kathi Bechsteins Augen sind offen. Sie starrt vor sich hin und spricht mit einer hohen, fremd klingenden Stimme. Dann entsteht wieder eine Pause. Der Weg auf die andere Seite ist beschwerlich. Schließlich traut sich einer der Gäste, stellt eine Frage, und sofort kippt der Kopf des Mediums nach vorn, als wäre er von hinten gestoßen worden. Kathi Bechstein murmelt, jammert, ihre Stimme geht rauf und runter. Dann hebt sie den Kopf und sagt: »Jetzt sind wir angekommen, jetzt können wir uns sehen.«
Na also, das Ziel ist in Reichweite, nur noch ein paar Meter. Auch Jakob Bechstein ist gut sichtbar hinter dem großen altrosafarbenen Einkaufszentrum an der Ostseite des Alexanderplatzes, wo es ruhig ist, wo nur wenige Leute unterwegs sind. Er hat sich seine Kopfhörer in die Ohren gesteckt, summt und raucht. Auf der großen Brache, die jeden Winter den vom Riesenrad überragten Weihnachtsmarkt aufnimmt, werden neue Häuser gebaut, die die Stadt dringend braucht. Weil sie nach innen wachsen muss, nicht nur nach außen. Eine S-Bahn rauscht gelb und voller Menschen über die Brücke, unter der Jakob Bechstein abbiegt, Richtung Parochialkirche, wo er erwartet wird. Er hat vor, heute noch etwas Geld zu verdienen. Von irgendwas muss der Mensch ja leben. Jeder muss das. Auch wenn heute Abend nicht alle der Meinung sind, dass Jakob Bechstein von etwas leben muss. Oder überhaupt.
Vor einer weiteren Baulücke und zwischen parkenden Autos steht einer, irgendein Typ, der ihn hat kommen sehen. Die beiden Männer, die ihm gar nicht mehr so unauffällig folgen, haben ebenfalls aufgeschlossen und die Hände in den Taschen zu Fäusten geballt. Der Typ fängt ihn für sie ab. »Kann ich dich mal was fragen?« Freundlich, etwas schwere Zunge.
Jakob Bechstein rennt nicht weg, er bleibt stehen. Es kommt ihm komisch vor, es kribbelt in seinem Hinterkopf, aber Angst hat er keine. Schon aus Prinzip nicht.
»Hast du Feuer?«, fragt der Typ. Ein blonder. Mit drei aufgekratzten Pickeln auf der Stirn. Alkoholatem.
Jakob Bechstein holt sein Feuerzeug aus der Hosentasche und hört die Schritte hinter sich, weil er die Kopfhörer aus den Ohren gezogen hat.
Der Typ hat keine Zigarette in der Hand, die man anzünden könnte. Er lächelt ihn schief an, streckt die Hand nach seiner Wange aus. Auch das versteht Jakob Bechstein falsch, aber nicht mehr lange.
Jetzt ist es so weit.
Die Türen all ihrer Zimmer sind geöffnet. Kathi Bechstein ist hindurchgegangen und holt die Stimmen derjenigen in den dunklen Raum, die dahinter warten, um sich mitzuteilen. Von der anderen Seite. Ihre Stimme leiert, sie überstürzt sich, dann verstummt sie wieder. Das Wasser vibriert jetzt noch heftiger in der Schale, und es scheint einen tiefen blauen Schimmer angenommen zu haben. Sie sind nicht mehr allein im Raum, und alle schwitzen. Am stärksten schwitzt der Heilpraktiker aus Halensee. Deshalb lösen sich die Mücken von ihrem Warteplatz an der Wand und treiben der klebrig flüssigen Angst entgegen, unter der die nächste Mahlzeit wartet. Ein entblößter Handrücken bietet sich an, mit einer dicken blauen Ader unter der Haut. Er hat sich nicht bewegt, dieser Handrücken, höchstens ein bisschen gezittert. Aber die Mücke ist groß und kräftig, ein Prachtexemplar. Ihre Beine streichen spürbar über die empfindliche Haut. Sie spaziert eine Weile hin und her, surrt, sucht den perfekten Platz und sticht zu. Sie saugt. Man soll den Kreis nicht unterbrechen, aber es ist sowieso leichte Unruhe am Tisch entstanden. Kathi Bechstein wirft ihren Kopf hin und her, verdreht die Augen, und jemand räuspert sich angespannt. Die Mücke lenkt ab. Sie ist kein hilfreicher Geist von der anderen Seite. Ein verdammter Plagegeist ist sie, nichts weiter. Es geht ja schnell, kurz die Finger gelockert und zugeschlagen. Damit Ruhe ist. Manchmal muss man einfach zuschlagen.
Und noch mal, und noch mal. Jakob Bechstein ist nach wie vor erstaunt, über jeden einzelnen Schlag, und die Empörung über das, was ihm passiert, ist schlimmer als der Schmerz. Man hat ihn gezogen und getreten. Er wird hin und her geworfen. Seine Kopfhörer liegen noch vorn an der Straße, eine weiße Schnur mit Augen, und sein Shirt ist an der linken Schulter aufgerissen. Wie viele Männer sind das jetzt? Von dem kleinen Parkplatz haben sie ihn auf den Hinterhof gezerrt. Die Fenster der Bürogebäude drum herum sind dunkel, der Abend darüber tiefblau, und eine weitere S-Bahn rattert von Osten nach Westen. Jakob Bechstein macht sich los. Er hebt die Hände. Als wolle er bloß um eine kleine Pause bitten, nur mal kurz verschnaufen. Fast rührend ist das. Dann taumelt er orientierungslos auf eine Hauswand zu und kotzt die Falafeln aus, die er vor einer Stunde im Friedrichshain gegessen hat. Und Galle.
Der Mann im Unterhemd schaut zu, wartet ab. Seine Lippen zucken, und seine Fäuste auch. Von seinen Freunden wird er Lenni genannt, aber eigentlich heißt er Lennart. Lennart Krappe. Ja, er hat Freunde – warum auch nicht? –, sogar eine feste Freundin hat er. Einen festen Job hat er nicht, verdient aber ganz gut. Zum Beispiel an Abenden wie diesem. Er hat seine nicht gerade billige Motorrad-Lederjacke bis oben zugezogen. Vielleicht will er nicht, dass Blut an sein Unterhemd kommt. Zuschlagen will er in jedem Fall, will treten, und das tut er. »Scheiß Schwuchtel«, sagt er mehrmals. »Kanakenficker.« Er sagt: »Schwanzlutscher«, und beißt sich beim Treten versehentlich auf die Zunge. Blutgeschmack und ein leichter Ständer. »Das gefällt dir doch, Schwuchtel, oder?« Nein, sieht nicht so aus. Einer von den anderen lacht. »Das magst du doch, Schwuchtel!« Nein, wirklich nicht. »Dein Arschloch ist doch geil drauf, oder? Du willst doch was drinhaben, oder?« Keine Stahlkappe, nein.
Es ist wirklich einer der schönsten Tage dieses Sommers gewesen, aber jetzt geht er zu Ende. Der Himmel ist dunkel, und zwischen den tiefblauen Hauswänden des Hinterhofs, nahe der Parochialkirche, flattern die Fledermäuse von links nach rechts und wieder zurück. Aufgeschreckt, geradezu panisch wirken sie, aber das täuscht, denn sie fangen sich mit größter Präzision Mücken mitten im Flug.
Es ist nichts Persönliches für den Mann in Unterhemd und Lederjacke. Er kennt Jakob Bechstein nicht, aber während sich seine beiden Kollegen längst ein Stück zurückgezogen haben und zweifelnde Blicke austauschen, legt er sich noch mal richtig ins Zeug. Er schlägt zu und tritt, noch mal und noch mal. Und es funktioniert: Mit jedem Tritt, mit jedem Schlag wird die Welt wieder mehr zu der Welt, wie sie sein sollte, zu einer Welt, in der Lennart Krappe gut und gerne leben kann. Er holt sie sich zurück, diese Welt, seine Welt, mit Schwung, mit Kraft, mit Händen und Beinen und Füßen in Stiefeln, mit seinem ganzen Körper holt er sie sich zurück.
Jakob Bechstein hat bereits mehrere gebrochene Rippen, längst auch innere Verletzungen, ist aber immer noch nicht bewusstlos. Er rutscht noch aus eigener Kraft ein paar Zentimeter vorwärts über den Boden, bevor er, die Schwuchtel, der Kanakenficker, der scheiß linke Abschaum, der alles zu wissen glaubt, der sich immer und überall überlegen fühlt, der für alles steht, was schiefläuft in diesem Land, zurückgerissen wird, bevor der Stiefel endlich seinen Kopf trifft. Jakob Bechstein hat oft Glück im Unglück, auch diesmal, wenn vielleicht auch nicht genug. Es kommen ein paar Leute in der Nähe vorbei. Jemand ist mutig und hebt die Stimme, jemand verständigt per Handy die Polizei, und die ist ohnehin nicht weit weg, wegen der vielen Gewaltdelikte am Alexanderplatz. Der Blonde mit den Pickeln auf der Stirn, der am Hofeingang Schmiere gestanden hat, ruft zum Abflug, und der andere zieht Lenni an der Schulter.
Der Weg auf die andere Seite ist beschwerlich. Jakob Bechstein spürt nicht, dass die Tritte aufgehört haben. Er hört nicht, dass seine Angreifer davonlaufen und noch mal laut und deutlich »Schwuchtel!« in die Nacht brüllen – ihr Lieblingswort –, damit es später keine Zweifel am Motiv der Täter gibt. Er liegt gekrümmt auf dem Boden, ein weiteres Opfer der zunehmenden Gewalt. Er blutet und glaubt zu sehen, dass der Hinterhof sich leert, dass das letzte bisschen Welt, in das er noch gehört, langsam von einer hellen, dann dunkler werdenden Farbe ausgefüllt wird. Den Krankenwagen hört Jakob Bechstein nicht mehr, während die Farbe, ein beinahe schwarzes Braun, ihn in sich aufnimmt, vom Boden löst und seine letzten Gedanken löscht.
Viel bleibt jetzt nicht mehr zu tun. Seine Schwester schüttelt erst benommen den Kopf, dann Hände. Auf einer davon hat sich eine dicke Quaddel gebildet. Kathi Bechstein verabschiedet ihre beeindruckten Gäste, öffnet das Fenster, lässt Frischluft herein. Bevor sie sich setzt, hält sie die Uhr an. Dieses Ticken kann einen in den Wahnsinn treiben.
Jetzt ist es dunkel draußen. Ein Krankenwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht über die Danziger Straße und beschleunigt. Sterne sieht man nicht am Himmel, weil schon wieder die nächsten Regenwolken aufziehen. Wie sollte es anders sein. Der schöne Sommertag ist vorbei und die Nacht finster und böse. Man bleibt besser im Haus, bringt seine Kinder ins Bett und in Sicherheit, setzt sich vor den Fernseher oder geht früh schlafen. Es ist keine gute Nacht, da draußen. Der Himmel weint. Dann wütet er. Gießt seinen Regen aus über Berlin, füllt die Pfützen und schiebt die Wolken weiter ins Umland. Über Felder und Dörfer fällt der Regen, über Plattenbauten und kleine Bäche, und findet auf seinem Weg noch ein weiteres Opfer dieses Abends. Einen Jungen, vielleicht elf, vielleicht zwölf Jahre alt, vielleicht jünger, der nicht mehr friert, obwohl er nur ein dünnes T-Shirt und eine abgewetzte Jeans trägt. Keine Socken, keine Schuhe. Die Füße sind nackt. Seine Augen sind geöffnet, obwohl er nichts sieht. Wie er heißt, wird man nicht so leicht herausbekommen. Einen Ausweis wird man bei ihm jedenfalls nicht finden. Er ist nicht blond. Dunkel ist er. Fremd sieht er aus, wie er da so sitzt, die Arme herabhängend, die Hände im Schoß. Mit aufgerissenen, staunenden Augen in der Gabelung eines Astes. Der Ast gehört zu einem Baum, der Baum zu einer Schrebergartenanlage. Vor wenigen Stunden ging noch der Geruch von Senf und Kohle, von verbrannter Würstchenhaut über die Hecken, und Tupperware-Schüsseln mit selbst gemachtem Kartoffelsalat wurden geöffnet. Hier stehen Lauben, an deren Wänden Rechen lehnen. Einige Plastikstühle sind mit Ketten angebunden, die Lauben abgeschlossen. Die Wege zwischen den Gärten sind sauber geharkt, einige schwarzrotgoldene Fahnen schlackern im regennassen Wind. Der Junge passt nicht hierher, gehört hier nicht hin. Wo er stattdessen hingehört, kann niemand so leicht sagen, er selbst vermutlich konnte es am wenigsten. Eines steht fest: Ihn hat heute niemand liebevoll zu Bett gebracht, ihm hat niemand eine Gutenachtgeschichte erzählt und schon gar kein deutsches Märchen. Er sieht nicht aus, als wisse er viel über Großmütter, die in Betten liegen und eigentlich hungrige Wölfe sind. Er weiß nichts über die Schönsten im ganzen Land, über Prinzen und Rosenhecken, hinter denen man hundert Jahre schläft, bis man endlich wachgeküsst wird. Was er gehört und gesehen hat, hier in der Fremde, scheint ihn erschreckt zu haben. Verstanden hat er es vermutlich nicht. Er ist abgemagert, und es sind mehrere Verletzungen an seinem Körper zu finden, Hämatome, die bereits verblassen, eher gelb und grünlich sind als blau und rot. Nur eine Wunde ist frisch. In seine Stirn ist etwas eingeritzt worden. Jemand hat sich mit einer scharfen Klinge über ihn gebeugt. Da hat er es schon nicht mehr gespürt, da war es schon vorbei. Was ist das? Ein X? Könnte sein. Ein Kreuz? Ebenfalls möglich.
In der Nähe werden Schritte leiser. Sie stammen von demjenigen, der ihn hochgehoben und beinahe zärtlich abgesetzt hat, der ihn auf diesem Ast platziert hat wie eine Puppe. Es sind die Schritte von demjenigen, der sich nun entfernt. Der seine Taschenlampe immer nur ganz kurz einschaltet, um den Weg zu finden durch den Wald, der hinter der Gartenkolonie beginnt. Dieser Jemand bewegt sich mühsam, angestrengt, weil er Schuhe trägt, die ihm nicht passen und die er in Kürze irgendwo entsorgen wird. Für den Fall, dass er Spuren hinterlässt, was man ja immer tut. Der Junge schaut derweil in den Regen, in die böse Nacht, und erst morgen früh wird man ihn finden. Demnächst ist es dann in den Zeitungen zu lesen, erst online und dann im Print: dass ein Junge, vermutlich einer der unbegleiteten Geflüchteten, tot aufgefunden wurde. Man wird auch von dem homophoben Überfall auf einen jungen Theaterkünstler lesen, der in letzter Zeit in Berlins freier Szene durch Arbeiten zu wichtigen gesellschaftlichen Fragen auf sich aufmerksam gemacht hat. Es sind vielsagende Beispiele für die fortschreitende Verrohung unserer Zeit. Darüber wird man sprechen, während der Regen weiter und weiter fällt. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt in den nächsten Tagen bei 70 bis 80 Prozent, und bald, es dauert gar nicht lang, reden alle wieder übers Wetter.
IIDie kleine und die große Hand
Das Kindlein winkt, der Schatten geschwind
winkt aus der Tiefe ihm wider,
»Herauf, herauf«, so meint’s das Kind,
der Schatten: »Hernieder, hernieder!«
Friedrich Hebbel: Das Kind am Brunnen
Donnerstag, 5. Oktober 2017
1
Erst einmal sucht sie die Markierung. »Hier?« – »Ja, genau.« »Gut.« Dann stellt sie sich auf. »Du weißt Bescheid, Kathi. Nicht zu viele Zähne.« Sie nickt, lächelt, ohne den Mund wirklich zu öffnen. Sie zieht ihn bloß leicht hoch und lässt die Schultern hängen. Ganz entspannt. Damit hätten wir schon mal das Foto. Alles wie immer. Jetzt hält sie einen Bogen Papier hoch, auf dem ihre Nummer steht: 24. Sie senkt ihn wieder, lässt ihn los. Er segelt sanft zu ihren Füßen. »Hallo. Mein Name ist Katharina Bechstein. Ich bin Schauspielerin.« Sie spricht über ihr letztes Projekt. Kurz. Ein Satz. »Hauptsächlich spiele ich Theater.« Sie zeigt ihre Hände und ihre Profile, links und rechts. Als sie sich wieder nach vorne dreht, zur Kamera, lächelt sie und hebt die Augenbrauen. Nicht zu viele Zähne. Sie geht zur Wand und zurück. Man sieht, wie sie sich bewegt. Wo ist die Markierung? Ach ja. Hier. »Danke.« Alles klar. Und jetzt, erst jetzt geht’s zur Suppe.
2
Sophie Kramer zögert noch. Mit hochgezogenen Knien sitzt sie oben im siebten Stock auf dem Balkon, ein Buch, sein Buch, unter die verschränkten Arme geklemmt, kaut auf ihrer Unterlippe herum und ist sich nicht ganz sicher. Aber dann entdeckt sie die Elster, und das gibt den Ausschlag: Sie wird es durchziehen. Sie wird Geld aus dem Portemonnaie ihrer Mutter nehmen, um zu tun, was getan werden muss. Stehlen nennt man das.
Sie weiß nicht, ob es sich bei der Elster immer um dieselbe handelt. Sie weiß auch nicht, ob es ein Elster-Männchen ist oder ein Weibchen. Vermutlich spielt das keine Rolle. Etwas unheimlich ist ihr der Vogel so oder so. In einer Kastanie sitzt er, ganz in der Nähe, und dann stößt er sich plötzlich ab. Er wirkt viel größer im Flug, lässt sich, weiter unten, auf einem der Balkone nieder und inspiziert die vertrockneten Pflanzen in den Balkonkästen. Wem die Wohnung da unten gehört, weiß Sophie nicht, es ist ihr aber auch egal. Sophie ist zehn Jahre alt. Sie interessiert sich nicht für Nachbarn, auch wenn sie die meisten vom Sehen kennt und einige wenige mit Namen. Sie kennt die Kinder aus ihrem Haus und aus den Nebenhäusern und einige der Eltern. Sie mag sie alle nicht, kann sie alle nicht leiden. Er hat sie auch nicht gemocht.
So viele Balkone, links und rechts von ihr, dazwischen Wege, Bäume, der Spielplatz, auf dem sie nicht mehr spielen wird (weil sie eigentlich schon zu alt dafür ist, aber auch aus anderen, wichtigeren Gründen), dann die große Straße. Krähen sind viele zu sehen im Augenblick, vor allem unten. Gierige, gefährliche, aggressive Vögel, die ihr in letzter Zeit immer wieder unangenehm aufgefallen sind. Sie halten gar keinen Abstand mehr, kommen dicht heran. Sie fliegen nicht davon, wenn sie auf Zäunen und Hecken sitzen und Sophie an ihnen vorbeigeht. Sie haben kleine, durchdringende Augen und spitze Schnäbel. Sie kreischen, als wollten sie sich gegenseitig warnen: Da kommt sie, da kommt Sophie. Habt ihr sie gesehen? Da ist sie schon wieder! Dann die Spatzen in den Büschen, die sich zu großen, dummen Gruppen zusammenschließen und immer durcheinanderreden, ohne einander zuzuhören. Ihr Lärm dringt bis nach hier oben, wenn der Verkehr nicht zu laut ist. Manchmal verstummen sie alle gleichzeitig, halten in ein und derselben Sekunde die Luft an, und das ist dann auch nicht ganz geheuer.
Bei der Elster liegt der Fall anders. Sie ist ein Einzelgänger – vielleicht eine Einzelgängerin – mit langem, gestuftem Schwanz, mit weißer Brust und weißen Flügelspitzen. Das Schwarz der Federn schimmert blau und grün. Eine Schönheit ist sie. Wenn sie nicht fliegt, bewegt sie sich hüpfend vorwärts, und trotzdem sieht sie nicht lächerlich aus, sondern stolz. Wenn sie raufkommt, denkt Sophie, muss ich es tun.
Wenn sie zu mir kommt, wenn sie noch näher kommt, denkt Sophie.
Dann mach ich’s!
Auf jeden Fall, denkt sie.
Hinter ihr, in der Küche, geht ihre Mutter auf und ab, murmelt irgendwas Unverständliches ins Telefon.
Sophie wartet und beobachtet, atmet dabei so flach wie möglich. Unter ihren verschränkten Armen pocht ihr Herz, sie spürt es unter seinem Buch. Die Elster verschwindet aus ihrem Blickfeld, muss irgendwo direkt unter ihr sein, sodass sie sie nicht sehen kann. Sophie reckt den Kopf vor, dreht ihn in die richtige Richtung, muss sich anstrengen. Wenn sie nicht wiederkommt, kann ich’s nicht machen, denkt Sophie, und damit wird das Herzklopfen noch schlimmer. Aber … nein!
Da ist die Elster wieder. Allerdings, zugegeben, ziemlich weit weg, drüben im … Moment, fünften Stock des Nebenhauses. Da hockt sie, grün und blau, hockt schwarz und weiß auf einem Balkonkasten. Stolz schaut sie auf die Straße hinunter, nicht zu ihr hinauf.
Sophies Mutter hat den Wasserhahn aufgedreht in der Küche, vermutlich, weil sie ihre Medikamente nehmen will, die großen, staubigen Pillen, ohne die sie keine zwei Stunden mehr durchhält. Sophie dreht sich nicht nach ihr um, bleibt vollkommen reglos sitzen. Sie weiß schon, dass es passieren wird, bevor es so weit ist.
Die Schönheit breitet ihre Flügel aus. Sie entscheidet sich so unvermittelt, wie sich nur Vögel entscheiden können, und ist dann plötzlich da. Sophie Kramer reißt die Augen auf, mehr traut sie sich nicht. Am liebsten würde sie ihre Mutter rufen – komm schnell! –, damit sie das sieht. Die Elster sitzt, keinen Meter von ihr entfernt, auf dem Balkongeländer. Viel scheuer müsste sie sein, müsste Menschen meiden. Aber vielleicht hat sie Sophie nicht bemerkt, vielleicht ist Sophie so reglos, dass sie unsichtbar bleibt für den Vogel. Vielleicht sieht der Vogel schlecht, hat was mit den Augen. Aber auch das stimmt nicht.
Die Elster dreht den Kopf erst schräg nach unten und blickt dann auf, schaut die verkrampft auf dem Plastikstuhl sitzende Sophie direkt an. In diesem Augenblick ist alles klar.
Hallo.
Sophie formt das Wort lautlos mit dem Mund. Vor lauter Aufregung und Anspannung sammelt sich eine Träne in ihrem linken Auge, aber auch das vertreibt die Elster nicht. Du bist gekommen.
Tu’s, sagt die Elster zu ihr.
Ja, gut.
Ich tu’s, sagt Sophie.
Und dann – wieder so ein Moment, von jetzt auf gleich – fliegt der Vogel weg, irgendwohin. Da sind die ausgebreiteten Flügel, schwarz und weiß und blau und grün, und zurück bleibt bloß die Gänsehaut auf Sophies Armen. Bleib, würde sie gern sagen, aber das geht nicht. So auffällig sind Wunder nie. Das versteht Sophie Kramer und atmet tief und lange ein. Ein bisschen schwindlig ist ihr, und sie hofft, dass ihr Herz bald wieder langsamer schlägt. Wenn sie es hinter sich gebracht hat.
Eins nach dem anderen. Sie hält sein Buch jetzt nur noch in einer Hand, mit der anderen macht sie die Balkontür hinter sich zu, tritt in die Küche. Sie hört ihre Mutter, die jetzt im Wohnzimmer ist. Sie telefoniert noch immer. Spricht in ihrer eigenen Sprache, die Sophie zum Teil versteht, aber nicht ganz.
»No i ja nie wiem co mam teraz zrobić«, sagt sie, das versteht Sophie. Sie redet mit ihrer Schwester, mit Sophies Tante. Sie redet über Sophies Vater. Und darüber, wie es im Augenblick aussieht bei ihnen, hier oben im siebten Stock. Ziemlich schlimm. »To jest po prostu katastrofa.«
Sophie räumt zwei Teller, eine Gabel und ein benutztes Glas in die Spüle, und in den kurzen Augenblicken, in denen das Geschirr nicht klappert, lauscht sie. Daran, dass die Stimme ihrer Mutter mal leiser, mal lauter wird, mal mehr von links kommt und mal von rechts, erkennt sie, dass sie auf und ab tigert beim Telefonieren. Sophie hat ein sehr gutes Gehör entwickelt mit der Zeit.
Sie geht in ihr Zimmer und legt sein Buch neben ihre Schulhefte auf den Tisch. Es ist unaufgeräumt in ihrer kleinen, engen Höhle, was im Augenblick aber niemanden interessiert, nicht mal ihre Mutter. Am Fenster hängt noch die Lichterkette von Weihnachten. Über zehn Monate ist es her, dass sie aufgehängt wurde, und immer noch hängt sie da, obwohl die Batterien längst so schwach geworden sind, dass die kleinen Glühbirnen kaum noch brennen. Überall liegen Decken herum und Kissen und Klamotten und Bücher, Stifte und Kekspackungen und Schätze, die niemand hier vermuten würde. Einen davon zieht sie unter dem Bett hervor. Eine prall gefüllte, dick ausgebeulte Kaufhof-Plastiktüte. Die nimmt Sophie in die Hand und horcht. Nichts. Dann, zum Glück, wieder die Stimme, dumpf und bedrückt. »Ja wiem. Masz racje.«
Sophie geht auf den Flur. Mit jedem zweiten Herzschlag macht sie einen schnellen, leisen Schritt. Sophie zieht sich ihre Jacke an, aber keinen Schal. Noch ist es nicht kalt draußen. Sie bindet sich die Schuhe zu, rückt ihre Brille zurecht, überprüft, dass ihr Handy in der Hosentasche steckt. Sie will vorher anrufen, sich anmelden. Es soll alles seine Richtigkeit haben.
Sophies Hand steckt in der Handtasche ihrer Mutter, die wie immer, wenn sie in der Wohnung ist, auf der Kommode neben der Garderobe steht. Ihre Finger tasten darin herum, bis sie findet, was sie sucht. Sie weiß genau, wie viel Geld im Portemonnaie ist, schließlich war sie vorhin mit ihrer Mutter in der Bank, hat neben ihr am Automaten gestanden, jeden einzelnen Schein gesehen. Sophie nimmt zwei davon heraus, schiebt sie in ihre Hosentasche zu dem Geld, das sie gespart hat.
Die Stimme ihrer Mutter kommt ein Stück näher, ist dann wieder weiter weg. Sie spricht mit einem anderen Land.
Es gibt zwei Möglichkeiten, das ist Sophie klar: Entweder – und das ist am wahrscheinlichsten – wird sich ihre Mutter nicht erinnern, dass die beiden Scheine vorher da waren, und nicht merken, dass sie es jetzt nicht mehr sind. Oder, wenn sie es doch bemerkt, glauben, ihr Vater hätte das Geld genommen. Ihm ist momentan alles zuzutrauen. Sophie nicht. Sophie nimmt kein Geld aus dem Portemonnaie ihrer Mutter.
Sie dreht sich um, nickt, weil das so beruhigende Gedanken sind, kommt aber nicht weit und zuckt zusammen. Vor ihr, direkt vor ihr, steht ihre Mutter. Ein großer, erwachsener Mensch steht da mit einem Handy am Ohr und zwei weit offenen Augen. Mit diesen Augen, die beide vorschriftsmäßig funktionieren, die nicht einmal eine Brille benötigen, steht sie in der Tür zum Wohnzimmer, und Sophie öffnet unsicher den Mund, ohne etwas zu sagen. Der Kloß, der ihr im Hals sitzt, macht es schwer, zu atmen, und unmöglich, zu sprechen.
»Poczekaj chwile«, sagt ihre Mutter ins Telefon. Und dann zu ihr: »Willst du raus?«
Sophie nickt. Sie braucht einen Augenblick, um zu verstehen, dass es ganz egal ist, ob ihre Mutter gesehen hat, wie sie ihr Portemonnaie zurück in die Handtasche gesteckt hat, oder nicht. Ihre Augen sind weit offen und rot und ungeschminkt und schauen durch das meiste, was sie sehen, hindurch. Das ist so im Augenblick. Zurzeit gibt es niemanden auf dieser Welt, den man so leicht bestehlen kann wie Sophies Mutter.
»Wann kommst du wieder?«, fragt sie.
»Zum Abendessen bin ich wieder da.«
Ihre Mutter macht zwei Schritte. Sie berührt Sophie an der Jacke, küsst sie auf die Haare, dann dreht sie sich um, redet weiter ins Telefon und verschwindet im Wohnzimmer. Sophie hört ihre Schritte nur leise auf dem Teppichboden, fasst die Henkel der Kaufhof-Tüte fester. Es soll so sein.
3
Eine warme Suppe ist nie verkehrt, und Kathi Bechstein serviert sie mit großer Überzeugung. Frühlingseintopf mit Markklößchen. Danach sieht die Welt gleich ganz anders aus. Die Schöpfkelle, mit der sie eine große, dampfende Portion auf den Teller befördert, ist eigentlich ein ganz normaler Löffel. Aber warum sollte ein Suppenlöffel keine Kelle sein? Zumal es den Teller vor ihr ebenso wenig gibt wie die Suppe oder den Jungen und das Mädchen, die hungrig am Tisch sitzen. Das ist jetzt alles egal. Entscheidend ist nur Kathi Bechsteins Schwung und wie sie die Augen schließt, wie sie die Schultern hebt und den wunderbaren Duft jedes einzelnen Markklößchens einatmet. Dann schaut sie auf. Vor ihr könnte eine Küchentür sein, eigentlich ist da aber bloß eine Kamera, die sich ein kleines Stück zur Seite bewegt und den Bildausschnitt ändert, in dem Kathi Bechsteins kurze Überraschung aufflackert. Denn jetzt öffnet sich die nicht vorhandene Tür und Kathis unsichtbarer Ehemann taucht auf. Natürlich ist er klitschnass, trieft geradezu. Kathi stellt sich vor, wie ihm die Tropfen an der Nasenspitze hängen, auch an den Wimpern. Darunter treue Augen. Natürlich, er hat wieder mal den Schirm vergessen. Er ist im Stress, der Arme, aber er sieht sie entschuldigend an, zuckt mit den Schultern, und sie reagiert wie gewünscht.
Das Skript, das ihr die Agentur gestern noch am späten Abend zugemailt hat (nachdem sie zweimal nachhaken musste), ist zum Glück nicht besonders lang oder kompliziert gewesen. Es hat auch keinen Text zum Auswendiglernen enthalten. (Ein Segen, immerhin!) Dafür Fotos, die eine Vorstellung davon vermitteln, wie der Auftraggeber sich die Frau vorstellt, die ihrer Familie eine Dose Frühlingseintopf mit Markklößchen heiß macht. Wie sie angezogen sein, was für ein Typ sie sein sollte. Deshalb trägt Kathi Bechstein Pferdeschwanz, enge hellblaue Jeans, eine weiße Bluse. Sie sieht frisch aus – so gut es eben geht im Moment. Sie ist kantiger als die Frau auf den Fotos, hat eine breitere Stirn, kräftigere Wangenknochen. Sie ist etwas müder, etwas echter. Sie kommt aus dem Leben. Das kann von Vorteil sein, ist es aber nicht immer. Normalerweise ist ihr Leben weit weg, wenn sie arbeitet, aber heute kann sie es nicht abschütteln, während sie vor diesem Tisch ohne Kinder steht.
Aber gut, sie macht so was ja nicht zum ersten Mal. Kathi Bechstein weiß genau, worum es geht und was das kleine schwarze Auge der Kamera in ihrem Gesicht sucht. Diesen einen, besonderen Blick. Den hat sie längst perfektioniert, ebenso wie das kaum merkliche Kopfschütteln. Sie ist ein Profi. Ihre Augen lachen, und ihre Mundwinkel schmunzeln Richtung Kamera. Denn das ist ein Gesetz: In der Werbung schmunzeln Frauen über ihre Männer, zeigen liebevolle, lebenskluge Überlegenheit, zur Not eben auch am Suppentopf, wenn sie so tun, als wären die 80er-Jahre niemals zu Ende gegangen. Kathis Augen sprechen stumm mit dem Mann, den es noch nicht gibt, weil er erst morgen Vormittag gecastet wird. Ich mache das hier sehr gern für uns, sagen ihre Augen. Jeder Teller Suppe, den du dir nicht selbst kochen musst, ist eine Investition in unsere goldene Zukunft.
»Toll, Kathi, ganz toll. Wie immer.« Frank sitzt neben dem Kameramann am PC, überprüft die Aufnahmen. »Ich finde das super, Kathi, eins a, aber wir müssen noch was anderes anbieten.« Er nimmt seine Brille ab, fährt sich mit der Hand übers Gesicht. Sie ist Nummer 24. Theoretisch hat Frank heute schon 23 andere Frauen Suppe servieren sehen. »Wir brauchen noch eine alternative Version für den Kunden.«
»Ja, okay.«
»Mach das mal – ich weiß auch nicht – mit ein bisschen mehr Energie.«
»Mehr Energie?«
»Ja, mit mehr Nachdruck.«
»Beim Einschenken, oder wie?« Sie hebt fragend den Suppenlöffel.
»Nee, eher so die grundsätzliche Haltung. Eben warst du total sympathisch, ganz super. Aber vielleicht kannst du das noch ein bisschen frecher machen, ein bisschen, ich weiß auch nicht, mit mehr Aggressivität, eher edgy. Du weißt schon, was ich meine …«
»Verstehe, klar.« Kathi nickt.
Viele Castings muss sie inzwischen allein aufnehmen, muss sich zu Hause vor ihren Rechner oder ihr Handy setzen, ihre Szene spielen und anschließend an die Agentur schicken. Was immerhin den Vorteil hat, dass niemand auf die Idee kommt, sie solle Suppe eher edgy servieren, obwohl vom Auftraggeber sowieso nur das verständnisvolle Schmunzeln gewünscht wird, das sie gleich beim ersten Take abgeliefert hat. Aber, sagen Kathi Bechsteins Augen zu Franks Kamera, ich kann sein, was ihr wollt, das ist mein Job. Und dann wendet sie ihren Blick dem unsichtbaren Ehemann zu, der selbstverständlich von ihr erwartet, dass sie sich abhetzt, dass sie auf ihn wartet, dass sie für ihn und die Kinder kocht, irgendwas aufwärmt, eine billige Dose, dass sie Verständnis hat und schmunzelt, obwohl die Zeit des Schmunzelns abgelaufen ist, ein für alle Mal. Kathi Bechsteins Augen sind jetzt anders. Sie schwingt den Löffel. Und den Teller stellt sie nicht, sie knallt ihn auf den Tisch.
4
Kenan entschuldigt sich. Das ist ein Reflex. Ein leise gemurmeltes »Sorry«, ohne aufzusehen. Was man eben sagt bei so einem kleinen Zusammenstoß. Und dann schnell weiter. Raus hier. An die frische Luft. Aber es geht nicht. Der andere lässt ihn nicht vorbei.
Wieder zu viel los. Zu viele Menschen in der U1. Weil die Bahn davor ausgefallen ist. Kenan hat auf dem gesamten Weg von Schöneberg bis hierher stehen müssen, eingeklemmt, direkt an der Tür. Deshalb jetzt auch das Gedränge auf der Treppe, die vom Bahnsteig hinunterführt. Da bleibt es nicht aus, dass man angerempelt wird oder jemanden anrempelt. Aus Versehen. Man sagt »Sorry«, geistesabwesend, defensiv, weil jemand unerwartet stehen geblieben ist, am äußeren Rand der Treppe, und man unbeabsichtigt in ihn hineingelaufen ist. Den Blick hat Kenan nach unten gerichtet, auf die Stufen, auf die Beine und Schuhe, die eigenen und die der anderen, will ja bloß schnell hinaus auf die Straße. Er hasst diese Drängelei. Ein bisschen Minimalabstand, findet er, sollte man sich gegenseitig schon geben. Aber er kommt nicht vorbei an dem Typen vor ihm, und als er merkt, dass das Absicht ist, steigt ihm schlagartig die Hitze ins Gesicht.
»Hey«, sagt er, aber es klingt genauso wie sein »Sorry«. Da ist nicht bloß ein breites Kreuz in einer Lederjacke, sondern auch ein starker Arm, der ihn plötzlich gegen die Wand drückt, mit einem kurzen Stoß, während immer mehr Leute von oben nach unten eilen. Kenan sieht vor sich den kurz rasierten Hinterkopf, ganz, ganz nah, und innerhalb von Sekunden vibriert sein ganzer Körper vor Empörung. Er schnappt nach Luft, will irgendwas sagen. Aber es kommt nur trockene Fassungslosigkeit aus seinem Mund. Was soll denn das? Ist der auf Drogen, der Typ? Gut möglich. Da will mal wieder einer seine Aggressionen rauslassen, ganz nebenbei, und hat sich dafür Kenan ausgesucht, dem nur Sekunden bleiben, um sich für eine Reaktion zu entscheiden. Er spürt den Druck des fremden Ellbogens, der ihn fester gegen die Wand presst. Was kommt als Nächstes? Ein Schlag in die Magengrube? Nein. Der Typ tritt einen Schritt zurück und – das ist die nächste Überraschung – geht, als wäre nichts gewesen, weiter die Stufen hinunter. Lässig, federnd, breitbeinig. Immer noch kommen Leute von oben, aber weniger, und der Mann bleibt kurz stehen. Auf halber Treppenhöhe, vor dem Geldautomaten, schaut er zu Kenan hinauf. Grinst. Und hält für einen kurzen Moment Blickkontakt.
Kenan merkt, dass er schneller atmet. Er ist allein auf der Treppe, und auch der Typ ist nicht mehr da. Von draußen sind Musik zu hören und Stimmen und Verkehr. Er könnte sich jetzt beruhigen. So was kommt vor. Hier laufen viele Irre rum. Es ist ja auch gar nichts passiert. Nichts. Da hat sich einer Platz verschafft, sich aufgespielt. Das ist alles. Kenan presst die Lippen aufeinander, nimmt die letzten Stufen sehr, sehr langsam. Es könnte ein Zufall gewesen sein. Klar. Es gibt nur ein Problem: dass es keiner war. Kenan weiß es. Er hat den Mann gestern schon gesehen. Und vielleicht auch vorher schon mal. Nein, nicht vielleicht. Ganz sicher. Das heißt nichts. Doch, das heißt was.
Eben wollte Kenan nur raus hier, an die frische Luft, jetzt bleibt er schon wieder stehen, unten in der kleinen Halle, die Augenbrauen zusammengezogen, und kommt nicht weiter. Seine Gedanken machen Sprünge. Zu viele. Statt hinaus, geht er erst einmal in den kleinen U-Bahnhofs-Laden, holt sich eine Halbliterflasche Wasser aus einem Kühlschrank. Sein Mund ist trocken.
Vor ihm kauft eine Frau Zigaretten – die kann er auch mitnehmen, stimmt – und ein Magazin. Es liegt zwischen ihr und dem Mann an der Kasse, dem sie einen Zwanziger reicht, und Kenans Blick fällt aufs Cover. Ein älterer Mann zwischen großen Buchstaben. Kenan schaut wieder in die Halle hinaus, dann zurück. Es gib etwas, worüber er schon eine ganze Weile nachdenkt, seit Wochen schon, und jetzt hämmert es wie wild von innen gegen seine Schläfen. Jakob. Nein. Blödsinn. Ein Zufall. Er hört Jakobs Stimme, irgendwo weit weg. »Dem wird sein Grinsen noch vergehen.« Das ist ein Zufall. Weiter nichts. Alles Quatsch. Als die Frau bezahlt hat, kauft Kenan sich das Wasser. Und die Zigaretten. Und das Magazin.
Es ist warm draußen, aber nicht besonders hell. Stumpfe graue Wolken drücken die Luft nach unten, machen sie dick. Kenan sitzt auf einer niedrigen Mauer, gegenüber vom U-Bahnhof, auf der Skalitzer Straße und zieht die Jacke aus, legt sie neben sich ab. Dann trinkt er fast die gesamte Wasserflasche aus, schraubt sie zu, beißt auf seiner Unterlippe herum und beginnt zu blättern. Sucht, findet. Da ist er, der Hauptartikel. Neues vom Rattenfänger: Ein Streifzug durchs Deutsche Historische Museum mit Arvid Schönfeld. Der Text ist eingequetscht zwischen große Fotos, auf denen ein älterer Mann, kräftig und mit dünnem grauem Haar, mal ernst, mal selbstzufrieden lächelnd vor Bilderrahmen und Ausstellungsstücken steht. Kenan überfliegt Absätze. Er liest: »Arvid Schönfeld ist in bester Stimmung, trotz oder vielleicht gerade wegen der Aufregung, die er in letzter Zeit verursacht hat. Nach seinen äußerst erfolgreichen Büchern über die deutsche Geschichte und die deutsche Seele hat er nun den dritten Bestseller in Folge veröffentlicht: Deutsche Märchen sind diesmal sein Thema. Unpolitischer oder leiser ist er deshalb aber nicht geworden, im Gegenteil. Seine Kolumne gegen linke Selbstgewissheiten ist der Talkshowdauergast und einstige Lieblings-Provokateur der Feuilletons inzwischen los, und die Aufregung über mehrere seiner als rassistisch verstandenen Aussagen steigert sich weiter. Doch Arvid Schönfeld zuckt bloß mit den Schultern, lässt die Vorwürfe an sich abprallen. Von den neuen Rechten distanziert er sich weiterhin, wenn auch immer weniger eindeutig, möchte sich lieber als Vorreiter einer rechtskonservativen intellektuellen Wende verstanden wissen.«
Kenan schlägt das Magazin zu, denkt nach, versucht, sich zu erinnern. Daran, was Jakob gesagt hat. Aber es ist zu lange her. Monate. Sein Blick wandert zu den Leuten an der Ampel, vor dem Bahnhof, auf der anderen Straßenseite. Nein, der Typ ist nicht da, er ist weg. Aber er war da. Und er wird wieder da sein. Kenan zieht die Folie von der Zigarettenpackung, holt das Feuerzeug aus seiner Tasche. »Scheiße«, murmelt er vor sich hin. »Scheiße, Jakob, was hast du gemacht?«
5
Vor dem Studioraum warten schon die nächsten Zettel: 25 und 26. Neue blonde Pferdeschwänze – deutlich jünger, frischer, engagierter. Kathi nickt ihnen zu, bevor sie ihr Handy aus der Tasche holt. Vorsichtshalber hebt sie die Stummschaltung wieder auf. Zu viele Nachrichten, Anrufe in Abwesenheit. Aber keiner vom Krankenhaus, das ist erst mal die Hauptsache. Abgesehen davon, dass sich ihr Leben so bald wie möglich ändern sollte, damit wieder Ordnung einkehrt und sie sich aufs Wesentliche konzentrieren kann. Aufs Geldverdienen zum Beispiel.
Sie schaut durch die Glastür neben dem Empfang ins Großraumbüro. Hinter einem der Schreibtische, zwischen zu vielen Topfpflanzen, sitzt Ulla, legt einen Telefonhörer auf und lächelt ihr zu. Also greift Kathi zur Türklinke. Ulla ist schon seit fünfzehn Jahren ihre Agentin. Eigentlich auch eine Art Freundin. Und eine Seele von Mensch.
»Wie ist es gelaufen?«, fragt Ulla. Eingeschüchtert sieht sie aus dabei. Wie immer.
»Es geht«, sagt Kathi. Dann schüttelt sie den Kopf. »Nein. Nicht gut.«
»Ach, Quatsch, war bestimmt wieder großartig. Alle Caster schwärmen von dir.«
Kathi saugt die Lippen ein, lässt ihren Blick über zwei Palmen und mehrere Efeugewächse wandern, deren Blätter über Schreibtischkanten und Regalbretter klettern. Ulla hat einen grünen Daumen. Im Grunde ist sie menschenscheu, eigentlich wie gemacht für einen Job irgendwo draußen, in der Natur.
»Wir müssen uns echt was einfallen lassen«, sagt Kathi.
Ulla schaut durch große, dick umrandete Brillengläser wie ein ertapptes Kind. Neben ihrer Tastatur steht eine hellrote Plastikgießkanne.
»Ich bin jetzt einundvierzig, und ich kann nicht immer so weitermachen, hier muss sich jetzt endlich mal was tun.«
Ulla steht auf. Sie trägt ein kurzes schwarzes Kleid, graue Wollstrumpfhosen und schwarze Stiefel und ist einen guten Kopf kleiner als Kathi. »Man steckt eben nicht drin, weißt du doch.«
»Okay, klar, aber darauf können wir uns ja nun auch nicht ausruhen. Ich meine, wie viele Fernsehfilme und wie viele gottverdammte Krimiserien werden in Deutschland gedreht?«
»Kathi …«
»Tausende, Ulla!«
»Na ja, nicht wirklich …«
»Es sind sehr, sehr viele! Ich könnte doch wirklich mal eine Kommissarin spielen oder wenigstens ’ne Gerichtsmedizinerin. Dafür bin ich genau der Typ. Für so kaputte, traumatisierte Frauen, die … was weiß ich … Alkoholprobleme haben oder sich grade scheiden lassen oder so. Das kann ich auf jeden Fall.«
Kathi sieht kaputt und traumatisiert aus, und Ulla berührt sie am Arm. Aber eben wie eine Freundin sie am Arm berühren würde, die sie irgendwo getroffen hat und der sie zufällig das Herz ausschüttet. Nicht wie eine Agentin.
»Was Regelmäßiges wäre gut. Irgendwas, worauf man sich verlassen kann. Zehn, zwölf Drehtage, das wäre doch schon was.«
Ulla nickt nachdenklich. Als wäre sie selbst noch nie auf die Idee gekommen. »Ich hör mich mal um. Vielleicht hab ich nächste Woche was für dich.« Sie schaut auf, lächelt. »Und dann gehen wir demnächst mal wieder was essen.« Ulla umarmt sie. »Wir kriegen das hin.«
Als das Handy brummt, nur wenige Minuten später, sitzt Kathi Bechstein schon auf dem Rad und hört es nicht. Ihre Handtasche ist auf den Gepäckträger geklemmt, und sie bahnt sich mit Entschlossenheit den Weg über die Torstraße. Ihr Pferdeschwanz flattert im Wind, und neben, hinter und vor ihr schiebt sich schwerfällig der Verkehr in den frühen, abgasdicken Abend. Sie muss an einer Kreuzung halten, pustet sich eine ungebändigte Strähne aus der Stirn und stellt sich ihr kaputtes Kommissarinnengesicht vor. Als die Ampel auf Grün schaltet, biegt sie ab.
Kathi Bechstein kämpft sich bergauf und denkt an die Zukunft. Es ist nicht wahrscheinlich, aber auch nicht ausgeschlossen, dass so etwas wie der große Durchbruch auf sie wartet, dass sie lediglich noch eine Weile in die Pedale treten, den Blick nach vorn richten und entschlossen bleiben muss.
Und warum sollte sie auch aufgeben? Wenn sie nicht so müde und so ausgelaugt ist wie heute, spürt sie immer noch den Rückenwind, der sie nach der Schauspielschule in den Beruf getrieben hat. Zwei Jahre in Dresden am Theater, dann noch zwei Jahre im Ensemble in Hannover. Konflikte mit Regisseuren, oft auch mit Kolleginnen und Kollegen. Zu viel Selbstbewusstsein. Ein paar kleine Komödienrollen bei Tourneebühnen an der Seite von Fernsehstars, die dreimal so viel Gage für jeden Abend bekommen haben wie sie, ein paar kleine Auftritte in Vorabendserien. Umzug nach Berlin und in die Selbstständigkeit. (Was würde besser zu mir passen? Nichts!) Dazu eine vielversprechende junge Agentur, eine kleine, gemütliche, mit Seele und Topfpflanzen. Ulla. Werbung, gutes Geld für wenig Arbeit. Manchmal auch nur Fotos.
Kathi Bechstein legt sich ins Zeug, streckt den Arm aus, fährt über eine Kreuzung. Keine Rollen, keine Figuren, keine Monologe mehr in letzter Zeit, nicht mal Dialoge. Dabei ist sie Schauspielerin. Nimmt an Workshops teil. Spielen vor der Kamera. Als müsste man ihr das beibringen! Aber wer nichts tut, bekommt Schwierigkeiten mit dem Amt. Immer wieder hat sie ihrem Sachbearbeiter mit ausladenden Handbewegungen erklärt, wie ihr Job funktioniert, dass man Geduld haben muss. Abgesehen davon, dass sie wirklich keine Lust hat, noch mehr vom Staat abhängig zu sein als sowieso schon.