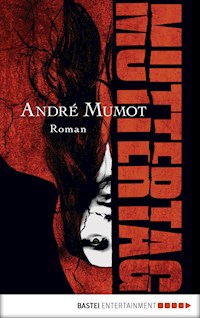
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine verfallene Villa, ein traumatisiertes Dorf und vertuschte Experimente. Menschen, die sich vor dem Tag verstecken, und eine einsame Kapelle, in der Gläubige ein Mädchen ohne Gedächtnis anbeten. Lange hat sie sich verborgen, doch nun kehrt eine skrupellose Sekte zurück, um ihre blutigen Pläne in die Tat umzusetzen. Ausgerechnet der vermeintlich harmlose Pensionär Richard Korff gerät dabei ins Fadenkreuz, und bald verfängt sich auch der Rest seiner Familie im tödlichen Spiel einer Mutter, die keine Gnade kennt.
André Mumots raffiniertes Romandebüt über Abgründe in der deutschen Provinz. Ein so unerschrockenes wie elegantes Spiel mit den Genres.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 715
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Über das BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungInhaltZitatPrologErster Teil – Wenn man vom Teufel spricht1234567891011121314151617181920212223Zweiter Teil – Verlassene Zimmer123456789101112131415Dritter Teil – Pu1234567891011121314Vierter Teil – Ein letzter Wille1234567891011121314Fünfter Teil – Das perfekte Muttertagsgeschenk1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041Sechster Teil – Eine unendlich traurige Motte1234567891011121314EpilogPersonenverzeichnisZitatquellenÜber das Buch
Eine Kleinstadt in der Mitte Deutschlands: Der 16jährige Philipp ist nach der Scheidung seiner Mutter bei seinem Großonkel Richard Korff gelandet, einem hinkenden, schweigsamen alten Mann. Doch erst, als ein entstellter Unbekannter in die Wohnung eindringt, und Philipp und den Alten entführen will, wird klar, dass Korff nicht der ist, für den Philipp ihn hält. Immer mehr geraten sie in die Fänge eines geheimnisvollen Mädchens und dessen Mutter, die keine Gnade kennt, und die geduldig darauf wartet, dass sich etwas erfüllt, was vor zwanzig Jahren begonnen wurde.
Über den Autor
André Mumot, geboren 1979, hat nach seinem Studium und der Promotion in Kulturwissenschaften und Ästhetischer Praxis in Hildesheim für verschiedene Medien, Tageszeitungen und Magazine geschrieben und 2008 das Buch »Irrwege zum Ich. Eine kleine Literaturgeschichte des Gehens« veröffentlicht. Für verschiedene Verlage (unter anderem Hanser und ars edition) übersetzt er aus dem Englischen und Zum von Publikum und Kritik gefeierten Bestseller wurde seine Übersetzung des Romans »Wunder« von Raquel Palacio – eines der erfolgreichsten Jugendbücher des Jahres 2013.
André Mumot
MUTTERTAG
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Massimo Peters
Einband-/Umschlagmotiv: © shutterstock/Alexander Trinitatov/Kaponia Aliaksei/Komkrit Preechachanwate/Miloje
E-Book-Produktion: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-7325-2978-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für J. R.
Inhalt
Prolog
Erster Teil
WENN MAN VOM TEUFEL SPRICHT
Zweiter Teil
VERLASSENE ZIMMER
Dritter Teil
PU
Vierter Teil
EIN LETZTER WILLE
Fünfter Teil
DAS PERFEKTE MUTTERTAGSGESCHENK
Sechster Teil
EINE UNENDLICH TRAURIGE MOTTE
Epilog
Denn vor allem eins liegt uns immer am Herzen:
Wir wollen uns nicht fürchten.
Friedrich Bergmann: Über die Verdrängung
Prolog
Und wenn sie sich wehrt? Sie bleiben stehen, werfen einander unschlüssige Blicke zu, flüstern kurz miteinander. Sie schauen sich um im Raum und dann zögerlich zu ihr hinüber. Wird sie diesmal tun, was man ihr sagt? Sie muss. Einer stellt sicher, dass die Tür verschlossen ist, nickt einem anderen zu, der das Futteral öffnet und die Schärfe einer Klinge prüft. Dann geht er auf sie zu. Erst mal rauf mit ihr. Die Treppe hoch, auf die leere, dunkle Bühne. Notfalls werden sie sie zerren, notfalls wird sie eben geschleift. An den Haaren gezogen, wenn es nicht anders geht. Aber, nein, das Mädchen wehrt sich nicht – diesmal nicht. Fast könnte man meinen, es hätte sich schon an all das gewöhnt. Noch ist es stumm, noch sagt es kein Wort. Es krümmt sich kurz, es schaut mit großen starren Augen zur Decke hinauf. Es konzentriert sich, lauscht, nickt.
* * *
Wenn ich es einmal gekonnt habe, denkt das Mädchen, kann ich es wieder tun. Schneiden und trinken. »Da.« Jetzt hält er mir einen dieser Gegenstände vors Gesicht. Noch einmal sagt er: »Da!« Ich nicke. »Du musst das Messer nehmen.« Es ist kalt. Ich schließe die Augen und spüre, dass mein Herz schneller und schneller schlägt. Aber das heißt doch, dass ich am Leben bin, oder nicht? Dass ich immer noch am Leben bin. Ich versuche, mich auf die Stimme zu konzentrieren, aber es gelingt mir einfach nicht. Zu viel Bewegung. Etwas flattert dicht an mir vorbei, und ich zucke zusammen, schreie auf. Es ist ein Vogel, einer von diesen Vögeln, die nicht wissen, wohin, die mit den Flügeln schlagen und zur Decke aufsteigen. Weil dort Rettung sein müsste. Eine Hand umfasst meine Schulter. »Hör zu«, sagt er leise, und ich spüre kalt die Klinge. Ich weiß nicht, ob ich es richtig mache, aber jetzt tue ich, was sie wollen. Jetzt spreche ich. Mein Herz klopft, und kurz öffne ich die Augen. Stewart sitzt in einer Ecke. Ich kann ihn kaum erkennen, aber er hat beide Hände vor dem Mund gefaltet und die Ellenbogen auf die Knie gestützt. Ich kann seine Spannung spüren, weiß, dass er jetzt sehr viel von mir erwartet. Es ist kalt, seit sie das Feuer gelöscht haben. Die abgezogene Haut ist verbrannt, nur noch bittere, stinkende Asche. Aber ich bin am Leben, vielleicht bin ich immer noch ich, und als der Schrei ertönt, schreie ich mit, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Der Raum ist hoch, das Echo fällt auf uns herab. Das Blut ist so dünn. Dünn ist es, und es sieht nicht rot aus, nicht so rot, wie ich es mir vorgestellt habe. »Es genügt noch nicht«, sagt er. Stewart nickt in seiner Ecke. Also weiter.
* * *
Jetzt wartet er schon eine ganze Weile. Noch immer keine Bewegung auf der Straße. Ein bisschen Regen, Tropfen wie hauchfeiner Staub im Laternenlicht. Schon wieder schaut er auf die Uhr. Pünktlich sind sie nicht.
Der unordentliche Haufen auf dem Beifahrersitz zieht seinen Blick immer wieder an – die Notizblöcke, die Karten, die Kopie eines medizinischen Gutachtens, die Kamera. Bilder von Luisenburg: das Gelände, aufsteigende Rasenflächen, Bänke, die Umgebung. Die Zufahrtsstraßen. Das frisch eingesetzte Fenster.
Jetzt steigt er aus, hält sich an der Fahrertür fest. In so einem Moment, denkt er, würde es sich lohnen, Raucher zu sein. 23 Uhr 19. Es ist kalt, niemand hier. Die fensterlosen Gebäuderückseiten der leerstehenden Farbenfabrik versperren ihm die Sicht auf die Straße. Aber sie ist da, schlängelt sich durch das vereinsamte Gewerbegebiet mit den weit auseinanderstehenden, kalten Lichtquellen und den ausgeschalteten Ampeln. Ein viel zu breiter Fluss aus aufgesprungenem Asphalt, der sie zu ihm bringen wird. Er dreht sich um. Irgendwo dort ist die Raststätte, dahinter die Autobahnauffahrt, dahinter mitteldeutscher Wald.
Die Müdigkeit macht ihm zu schaffen. Gewiss wird er angespannt und überfordert wirken, wenn sie hier eintreffen. Dabei kann er so jung, so frisch, so hoffnungsvoll aussehen. Auf seiner Website zum Beispiel gibt es mehrere Fotos von ihm, die ein Freund aufgenommen hat. Auf einem davon hält er den Kopf leicht abgewandt und schaut wissend und halbwegs amüsiert in eine erfolgversprechende Zukunft. Den Text hat er selbst verfasst, sich aber dazu entschieden, sich in der dritten Person vorzustellen: Morten Rheinberger hat Medienwissenschaften, Philosophie und Politologie studiert, schreibt für verschiedene Musikzeitschriften, Tageszeitungen und Magazine.
Er muss daran denken, dass bei ihm zu Hause noch Konzertkarten an der Pinnwand im Flur hängen. Seine Gedanken suchen Halt in der kommenden Woche, haken Verabredungen ab. Im Kalender stehen Termine, die er ganz lässig abwickeln kann – wenig Geld, aber leicht verdient. Das hier ist was anderes. Sogar Veltheim sitzt ihm mit der Geschichte im Nacken, spornt ihn an. Und das, obwohl er zu den Redakteuren gehört, die grundsätzlich nicht zur Begeisterung neigen. Weil er eigentlich nichts anderes ist als ein undankbarer Besserwisser, der einem die Artikel zerpflückt und am Telefon schon aus Prinzip so kurz angebunden ist, dass man besser gar nicht erst anruft.
Aber auch einer wie Veltheim, denkt Morten Rheinberger, hat seine hellen Momente. Neulich jedenfalls hat er ihm beim Vier-Augen-Gespräch in einem schlecht gelüfteten Konferenzraum die Hand auf die Schulter gelegt und »Gerne mehr« gesagt. Aber gleichzeitig hat er ihm klargemacht, dass er die Artikel erst veröffentlichen und entsprechend bezahlen wird, wenn die Recherche abgeschlossen ist und er gesicherte Fakten auf dem Tisch hat.
Jetzt! Das Geräusch eines näher kommenden Wagens? Nein, immer noch nicht, bloß ein fernes Rauschen, das sich in den verwaschenen Lauten der Nacht verliert. Wieder sieht er sich um. Gut gewählt ist dieser Treffpunkt in jedem Fall. Abgeschieden und auf fast schon lächerliche Weise bedrückend. Respekt! Er hört sich auflachen, versucht es mit Sarkasmus. Zugleich bemüht er sich, nicht daran zu denken, was er heute Nacht womöglich zu Gesicht bekommen wird. Er muss Beobachter bleiben, einen kühlen, wertfreien Blick bewahren. Er glaubt noch immer, dass er eine Geschichte schreiben und nicht Teil einer Geschichte sein wird. Gute Artikel sollen das werden, Artikel, die ihm Respekt verschaffen, die den hoffnungsvollen Zukunftsblick auf seiner Website rechtfertigen und es ihm ermöglichen, bessere Aufträge zu bekommen, bessere Honorare und die Option einer Festanstellung.
Er könnte jetzt im Backstagebereich eines Konzertes stehen, mit einer Bierflasche in der Hand, aber stattdessen steht er hier, bärtig und besorgt, trommelt mit den Fingern auf dem Autodach herum und hebt den Blick. Na also. Diesmal gibt es keinen Zweifel. Das Motorengeräusch, gleichmäßiges, lauter werdendes Rauschen. Die Sache kommt jetzt in Gang und ein Zurück nicht mehr in Frage. Deep Throat, denkt der Freelancer. Er denkt immer noch nicht: Das hier ist nicht meine Liga. Das hier sollten andere tun.
Ein alter Corolla. Auf dem Beifahrersitz eine Frau. Am Steuer ein Mann. Als dieser aussteigt, kann er erkennen, dass hinten noch jemand sitzt. Zu dritt?
Nun also professionell sein. Nicht nervös, sondern genervt aussehen. Gutes journalistisches Handwerk. Seine Stimme lässt ihn nicht im Stich, als er den Mann anspricht, der bei laufendem Motor auf ihn zukommt, ihm fahrig die Hand drückt und den Blick nicht von ihm abwendet. »Da sind Sie ja. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist, aber ich habe nicht die ganze Nacht Zeit.«
»Verständlich«, sagt der Mann und nickt etwas zu nachdrücklich. Auch er scheint nervös. Glatte dunkle Haare, durchtrainiert, Mitte dreißig? – nicht das, was Morten Rheinberger erwartet hat. »Es wird nicht lange dauern. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen, wir setzen Sie nachher wieder hier ab.«
Er greift nach dem Notizblock und hält mit fragendem Gesicht die Kamera hoch.
Der Mann schüttelt den Kopf. Die Frau auf dem Beifahrersitz hat sich umgedreht, scheint sich mit der Person hinter ihr zu besprechen.
»Es wird sich für uns lohnen und auch für Sie«, sagt der Mann. »Aber wir müssen uns beeilen.«
Morten Rheinberger steigt ein, und schon hat sich der Corolla in Bewegung gesetzt, gleitet geschmeidig unter den kalten Laternen dahin. Mit vier Insassen verlässt er den Parkplatz und das menschenleere, in Nieselregen gehüllte Gewerbegebiet mit seinem verwaisten Baumarkt, dem vierstöckigen Möbelhaus und der schlauchartigen Waschanlage. Auf seinem unbeirrten Weg rauscht der Wagen an der Raststätte vorbei, wo weitgereiste LKW schwer nebeneinander ruhen. Die Auffahrt aber lässt er aus, biegt stattdessen ab und verschwindet auf einem Schotterweg, der direkt in den mitteldeutschen Wald hineinführt.
Scheinwerfer zwischen dünnen Ästen, hier und da zuckt etwas. Motorengeräusche in angespannter Stille, aufgescheuchte Bewegungen im Unterholz, erstarrtes Verharren. Von alledem bekommt der gerade Zugestiegene aber sowieso schon nichts mehr mit.
* * *
Sie geben keine Ruhe. Eins folgt aufs andere. Ich hab es einmal gekonnt, ich kann es wieder, auch wenn ich würgen muss. »Es genügt noch nicht«, sagt er. Stewart nickt mir zu. »Weiter«, sagt er. »Weiter.« Es ist so kalt. Ich höre über mir das Flügelschlagen, immer im Kreis, manchmal tiefer, aber eigentlich nach oben, weiter in die Höhe, dorthin, wo der Himmel sein müsste und wo kein Himmel ist. Und noch etwas. Die Tür. Jemand ist hereingekommen. Sie schauen einander an, nicht mich. Mich schauen sie nicht an. Das Mädchen wird nicht angeschaut. Da draußen ist jemand. Ich verstehe sie nicht, aber ich weiß es, so wie ich weiß, dass es begonnen hat zu regnen. Ganz nah. Vor der Tür, die sie verriegelt haben, steht jemand. Nicht nur einer, es sind mehrere. Ich wende den Kopf. Sie geben mir ein Zeichen. Nein, jetzt können wir nicht aufhören. Ich habe das Blut an den Händen und am Kinn und die Stimme in mir. Jetzt nicht. Stewart ist aufgestanden, er berührt mich, ich schüttele ihn ab. Nicht jetzt. Da ist die Tür. Sollen sie kommen, sage ich. Sollen sie kommen, sie werden es bereuen.
Erster Teil
WENN MAN VOM TEUFEL SPRICHT
Der Greis aber sitzt, schaut auf nichts,
und die leere Luft und der vergebliche Sonnenschein
spielen um ihn.
Adalbert Stifter: Der Hagestolz
1
Manchmal blieb er mitten auf dem Bürgersteig stehen. Dann drehte er sich nicht um, ließ den Blick nicht schweifen. Der alte Mann machte nicht den Eindruck, als hätte er etwas bemerkt. Vielleicht war er einfach erschöpft. Oder ganz in Gedanken. Nicht auszuschließen, dass es mit seiner Gesundheit nicht zum Besten stand. Er sah älter aus, als er es laut der Unterlagen war. Man konnte sehen, dass sein Mund Worte formte, dass sich seine Stirn zerstreut zusammenzog. Dann ging er weiter. Langsam, mit erhobenem Kopf. Er wartete an der Ampel, überquerte die Straße. Manchmal humpelte er stark, manchmal kaum.
Es waren einsame Wege, aber wie es aussah, legte er sie mit großer Selbstverständlichkeit zurück. Die Spaziergänge waren eine Angewohnheit, die ihm in Fleisch und Blut übergegangen zu sein schien, und er nahm sie zeitig auf. Morgens sahen ihn seine Beobachter im ersten Stock des Hauses, das er im Starenweg bewohnte, erst das eine, dann das andere Fenster öffnen, und dann lehnte er sich eine Weile auf das Fensterbrett und schaute stumm hinaus. Hinter ihm war leise Musik zu hören, vermutlich waren da auch die Stimmen seiner Gäste. Da er immer wieder für Momente die Augen schloss, sah es aus, als versuche er sie zu ignorieren. Vielleicht wünschte er sie fort.
Später trat der alte Mann auf die Straße. Er kaufte sich an einem Kiosk in der Pestalozzistraße zwei Tageszeitungen (eine regionale und die Frankfurter Allgemeine) und tauschte kurze, aber freundliche Floskeln mit dem türkischen Besitzer aus. Sein Lächeln hatte etwas sehr Gewinnendes, aber man sah es nicht oft. Er betrachtete beide Titelseiten noch im Stehen, vor dem Kiosk, seufzte, faltete die Zeitungen zusammen und steckte sie sich unter den rechten Arm.
Sie sind lang, die Tage in Kronstedt, und er durchwanderte sie in konzentrischen Kreisen, kehrte zur Mittagszeit in den Starenweg zurück, wo er hinter seinen nun geschlossenen Fenstern verschwand, nur um zwei Stunden später wieder in der Schlegelstraße aufzutauchen. Er überquerte sie erneut, ging Richtung Pestalozzistraße. Gestern hatte er am Nachmittag eine Dreiviertelstunde im Café Teichgräber gesessen, an einem Fensterplatz mit Blick auf die Fußgängerzone. Er hatte Tee getrunken, aber nichts verzehrt. Er hatte nicht gelesen, sich mit niemandem getroffen, bloß mit strengen Augen vor sich hin gebrütet.
»Und, wie möchtest du im Alter leben?«, fragte die Frau, als sie abends im Hotel das Protokoll des ersten Tages abschloss und die Fotos hochlud.
Ihr Kollege schnaufte durch die Nase, lächelte sie an und fügte nach einer Weile leise hinzu: »So jedenfalls nicht.«
Sie nickte und lächelte auch.
Später, das erfuhren sie von der Ablösung, gab es eine kleine Überraschung. Sie hatten ihn in den eigenen vier Wänden vermutet, als er gegen 21 Uhr 30 noch einmal im Starenweg aufgetaucht war. Schlank und hoch aufgerichtet, kaum humpelnd und in seinem dunklen Mantel große Schritte machend, als habe er es eilig. Es war nicht bemerkt worden, dass er zuvor das Haus verlassen hatte. Für einen weiteren abendlichen Spaziergang? Oder gab es doch jemanden, den er besuchte? Es war nicht wirklich von Bedeutung. Noch war es lediglich vonnöten, sich einen Überblick über seine Gewohnheiten zu verschaffen.
Heute war es erheblich wärmer als gestern, auch heller. Aber er trug denselben Mantel, der ihm schwer von den Schultern hing. Eine Angewohnheit vieler alter Leute: sich zu warm anzuziehen, lieber zu schwitzen, als zu frieren.
Als er sich auf eine Bank setzte, direkt am Eingang des Pestalozziparks, zu dem es ihn bereits gestern am späten Vormittag gezogen hatte (und in dem er bei mildem Wetter wahrscheinlich oft saß), kamen sie ihm versehentlich sehr nah, und kurz blickte er von seiner Lektüre auf. Zwei Krähen mit grauem Halsgefieder hüpften über die Wiese. Auf einer Bank gegenüber saß eine ältere Dame, die in einer abgegriffenen Taschenbuchausgabe von Bleak House las, und der Blick des Alten streifte teilnahmslos den Mann und die Frau, die zu dicht aufgeschlossen hatten.
Ihr Lapsus war erklärlich: Gestern war er weiter in den Park hineingegangen, hatte sich erst in der Nähe des kleinen Spielplatzes niedergelassen, bei der Kletterburg aus dunkel angelaufenen Holzbrettern und den zwei Schaukeln, deren schwere Gummireifen heute wie gestern gleichgültig über dem Boden baumelten und Schatten auf den plattgetretenen Sandboden warfen. Da sie ihn nicht noch einmal aus den Augen verlieren wollten, beeilten sie sich zu sehr, ihm zu folgen, und bogen zügig ab. Als sie an seinem Platz auf der Bank vorbeikamen, lachten sie und bemühten sich, nicht in eine andere Richtung zu schauen.
Ein Pärchen in mittlerem Alter. Vielleicht registrierte er, dass der Mann etwas älter war als die Frau, über vierzig wohl. Einige blonde Locken fielen ihr in die Stirn, sie trug ein blaues Halstuch, und kurz drückte sie den Kopf an die Schulter ihres Begleiters, der seinen Arm um ihren Rücken gelegt hatte. Sie sahen verliebt aus und sprachen weiter über Unwichtiges. (»Wann sollen wir denn da sein?« – »Weiß ich noch nicht, klären wir nachher, ich rufe an.«)
Der alte Mann auf der Bank schaute eher durch sie hindurch als sie an, hielt den Kopf schräg. Seine scharf geschnittene Nase bildete eine nachdenkliche Diagonale, dann senkte er den Blick, straffte die aufgeschlagene Seite, las weiter.
2
Natürlich ist es schlimm, wenn man plötzlich bemerkt, dass man verfolgt wird. Weitaus schlimmer aber ist es, wenn man es nicht bemerkt. Das sollte Philip Steinert später lernen. Noch aber war es für solche Lektionen zu früh. An diesem hellen Freitagvormittag hatte der Sechzehnjährige, dessen Blick verbissen nach vorn gerichtet war, eine eigene Mission. Natürlich hatte er nicht mitbekommen, dass sein Stiefbruder vor vier Tagen, mitten in der Nacht, von einem leeren Parkplatz aus verschleppt worden war – wie denn auch?
Er setzte einen Schritt vor den anderen, schwitzte ein wenig und hatte keine Ahnung, dass bereits vor geraumer Zeit eine Schlinge ausgelegt worden war, die sich nun langsam zusammenzog. Immer enger legte sie sich um ihn und um das, was man mit viel gutem Willen seine Familie nennen konnte. Philip wusste nicht, dass ein Mann, der von seinen Auftraggebern nur Dezember genannt wurde, erst vor wenigen Stunden das alles entscheidende Signal gegeben hatte und dass nun in seiner unmittelbaren Umgebung (Pestalozzipark, Schlegelstraße, Starenweg) die entscheidenden Schritte eingeleitet wurden, damit im richtigen Moment alles sehr schnell gehen konnte.
Philip Steinert konzentrierte sich auf den Weg und auf seine Verabredung. Dass Harry zugesagt hatte, dass er tatsächlich bereit war zu kommen, war ein gutes Zeichen, ganz bestimmt.
Die Musik in den Ohren trieb ihn vorwärts: Dritte Sinfonie, erster Satz. Philip befand sich seit etwa zwei Wochen in einer Bruckner-Phase. Fatalistisch donnerndes Orchester bei stechendem Sonnenschein. Wahrscheinlich war alles zu spät, wahrscheinlich war nichts mehr zu retten, aber er musste wenigstens versuchen, die dummen Entscheidungen der anderen rückgängig zu machen. Überließ er es seiner Mutter und ihrem Eigensinn, würde sich alles nur immer weiter auflösen. Aber er kannte ihre wunden Punkte, und den wundesten von allen würde er jetzt einfach an die Hand nehmen und bei ihr abliefern. Die überfällige Konfrontation herbeiführen.
»Wann kommst du nach Hause?«, hatte seine Mutter gefragt. »Wir sehen uns doch noch, bevor ich fahre?«
Er hatte nicht aufgeschaut, bloß tiefer in seinem Rucksack gegraben und kurz genickt. Nach Hause! Für diese Formulierung brauchte man viel Humor. Nein: Notunterkunft war das Wort. Auf mehr ließ Philip sich nicht ein, auch wenn er mit ihr nun schon seit einem halben Jahr als Hausgast eines tattrigen Rentners im Starenweg Zeit vertrödelte und auf eine Rückkehr wartete, die seine Mutter gerade endgültig zu versauen schien.
Jetzt packte sie schon wieder ihren Koffer, so wie damals, als sie plötzlich in seiner Tür gestanden und zu ihm gesagt hatte: »Wir gehen. Es ist vorbei.« Ihm drehte sich bei der Erinnerung der Magen um.
Es funktionierte eben nicht: an nichts zu denken. Philip verzog das Gesicht, konzentrierte sich auf das an- und abschwellende Misterioso in seinen Ohren. Auch die Berliner Philharmoniker unter Daniel Barenboim gaben nicht auf, sondern ihr Bestes (er hatte sich eine Einspielung von 1996 heruntergeladen), also marschierte er weiter und bemühte sich, die deprimierende Umgebung noch deprimierender zu finden: Die schlecht gepflegten Fachwerkhäuser auf dem Marktplatz, den er gerade überquerte. Die halb leerstehende City-Passage, in der nur noch der Ein-Euro-Shop, der Zeitschriftenladen und Ögeleks Döner-Pizza-Currywurst-Imbiss Kunden anzogen. Das rot-grüne Schild des »Wurst-Basars«, vor dem eine Frau an einem weißen Plastikstehtisch mit abwesendem Blick Pommes aufspießte und sich in den Mund schob. Dann der Obstladen, »Weißgerbers Frischeparadies«, dessen Auslage ein intensives Aroma ausströmte und wenigstens den Kronstedter Fruchtfliegen einen Freudentag bescherte.
Hier musste er einen Bogen machen, denn das marode Kopfsteinpflaster der Fußgängerzone wurde gerade gegen schlichte Sandsteinplatten ersetzt. Für einige hundert Meter ging Bruckners Pizzicato im Dröhnen einer Pressluftmaschine unter. Die vier Punks, die vor der Apotheke ihre großen schwarzen Hunde kraulten, schauten nicht auf, als Philip an ihnen vorbeizog. Einer zerquetschte eine leere Bierdose und ließ sie scheppernd fallen.
Die Sonne schien warm an diesem Tag, und Philip fiel auf, dass er das elende Kronstedt bisher hauptsächlich bei Wind, bei Schneeregen und dann bei Regen, bei grauer, öder Lichtlosigkeit erlebt hatte. In den letzten Tagen waren die Temperaturen gestiegen, aber auf eine dumpfe Weise, als wären Frühling und Sommer von einem schwül behangenen Herbst überholt worden. Heute jedoch stocherte die Sonne gut gelaunt in den Gassen der Altstadt herum, und auch die kastenförmigen Nachkriegsbauten an der Hauptstraße, die man irgendwann orange und rosa und hellblau gestrichen hatte, machten einen aufgeräumten, selbstbewussten Eindruck. Man hätte es fast hübsch finden können hier. Aber das kam überhaupt nicht in Frage. Das Ziel musste lauten: Abgang.Bloß nicht eingewöhnen.
Philip war während des Umzugs nach Kronstedt schrecklich frustriert gewesen, konsequent schlecht gelaunt und manchmal beklommen. Er hatte Magenschmerzen gehabt, und ihm war noch öfter übel gewesen als sonst. Psychosomatik, klar. Auch Ohrgeräusche. Kein hochfrequentes Piepen, aber ein dumpfes Klopfen, gegen das er sich nachts wütend in die Kissen drückte. Im Grunde hatte sich seitdem nichts geändert. Immerhin hatte er Caro gefunden, mit der sich reden ließ, mit der er gemeinsam düstere Schwarz-Weiß-Fotos schoss für ihr Tumblr-Blog und mit der er lachte. Aber meistens fühlte er sich elend. Vor allem, wenn er seine Mutter mit größter Begeisterung vom neuen Lebensabschnitt sprechen hörte. Oder wenn sie sagte: »Das Klopfen in den Ohren liegt nur an den kleinen Kopfhörern, die du dir ewig in den Gehörgang schiebst!« Der Sonnenschein half auch nicht, denn der ließ ihn schwitzen, und das hasste er wie die Pest.
Er entdeckte den dunkelgrünen Jaguar an der Ecke Moltkestraße und atmete angespannt ein. Es hat nicht mehr den geringsten Sinn, dachte er kurz, schüttelte aber den Kopf. Nein, so wird das nichts. Positiv denken! Du willst dein Leben zurück, also streng dich an. Die beiden brauchen einen Anstoß. Vielleicht haben sie nur gehofft, dass der andere den ersten Schritt macht. Und wenn sie dann sehen, dass er möglich ist, der erste Versöhnungsschritt, fallen sie sich in die Arme oder lachen wenigstens und stellen fest, wie dämlich sie gewesen sind in letzter Zeit. Er klopfte gegen die Scheibe der Beifahrertür.
Ein Arm wurde ausgestreckt, die Tür ging auf. Jetzt sah Philip genau das zuversichtliche Lächeln, das er erwartet hatte.
»Wie geht’s dir?«, fragte der Mann. »Steig ein.«
Philip pulte sich die weißen Stöpsel aus den Ohren und ließ sie über den Pulloverrand baumeln, wo sich noch einige hohe Töne bemerkbar machten. Er schloss die Tür von innen und erschauderte wegen des stechenden Geruchs des hellbraunen Leders und der hochgedrehten Klimaanlage. Es war, als würden kalte Hände den schweißnassen Pullistoff unter seine Achseln drücken.
»Hi«, sagte er. »Cool, dass du hergekommen bist.«
»Ist Barbara noch da?«
Philip nickte.
»Und, wie ist sie drauf?«
»Total euphorisch.«
»Gut. Dann ist sie vielleicht etwas zugänglicher. Was ist das denn nun für ein Job?«
»Der Alte hat ihn ihr besorgt. Vertretung für zwei Wochen. Bis nach Ostern. Aber sie geht natürlich davon aus, dass ’ne feste Sache draus wird.«
»Ist ja vielleicht nicht das Schlechteste.«
»Von wegen. Das ist da irgendwo in so einem beschissenen Kaff im Harz. Fünf Häuser und ein Hotel.«
»Und? Fährst du mit?«
»Ich? Auf keinen Fall.«
»Willst du lieber bei deinem Großonkel bleiben?«
Philip schüttelte den Kopf. Ach, Scheiße. Warum war das denn so schwierig?
»Es wird sich schon eine Lösung finden«, sagte Harald Rheinberger, den seine Mutter vor knapp drei Jahren kennengelernt und vor fünfzehn Monaten geheiratet hatte. »Wann fährt sie denn?«
»Gegen drei, glaub ich.«
»Gut. Ich habe gestern Abend extra noch mal versucht anzurufen. Sie hat aufgelegt.«
»Ich weiß.«
»Und ist ihr Onkel auch da?«
»Keine Ahnung. Der kommt und geht.«
»Na ja. Vielleicht hab ich Glück.«
Er startete den Motor, und Philip schaute nervös aus dem Fenster. Er sah die Moltkestraße, die Back-Factory, das türkische Sportwettenlokal, das Matratzenoutletcenter. Und als er sich unter dem Gurt zurechtrückte, fiel ihm ein Tulpenstrauß auf dem Rücksitz auf. Ein weiterer Hoffnungsblitz durchzuckte ihn. Keine Rosen. Aber was ist denn gegen Tulpen einzuwenden? Blumen, immerhin.
»Vielleicht kriegt sie sich ja wieder ein, vielleicht könnt ihr euch einigen«, sagte er.
Harald Rheinberger nickte. Und nach einer sehr langen Pause fügte er hinzu: »Hab ich dir von Susanne erzählt?«
Philip schloss die Augen.
»Sie ist jetzt bei mir eingezogen.« Harald Rheinberger schaute angestrengt durch die Windschutzscheibe. »Du musst mich navigieren. Links, oder?«
»Ja, links.«
»Weißt du, mit der Zeit finden wir alle unseren Weg.« Harry lächelte, schaute aber nur ganz kurz zu ihm herüber.
Mir ist schlecht, dachte Philip, dessen Mission gescheitert war, bevor sie überhaupt angefangen hatte. Ja, jetzt ist mir schlecht.
»Wir beide können uns wenigstens wie vernünftige Menschen unterhalten«, sagte Harry, während er den Blinker setzte. Es stimmte. Aber das, stellte Philip düster fest, machte die Sache auch nicht leichter.
3
Es war ein schweres ratterndes Dröhnen, das in den Ohren wehtat. Ein Krachen, ein Aufbrechen, ein harsches Splittern, das seine Schallwellen zwischen den Häusern hindurchschickte und die Passanten dazu brachte, die Zähne zusammenzubeißen, während sie ihre Schritte beschleunigten. Nach ein paar Metern wurde es besser. Aber das röhrende Bersten der alten Steine wummerte ihnen hinterher, huschte ihren Füßen unterirdisch voran, ließ den Boden vibrieren. Hoffentlich ist das bald geschafft, dachte Reinhard Weißgerber, fuhr mit seiner Rechten in den Fruchtfliegenfeiertag und zupfte einige nicht mehr einwandfrei aussehende Trauben aus der Auslage seines Frischeparadieses. Ist ja nicht mehr auszuhalten, dieser Lärm.
Für ein verirrtes Erdbeben hätte man es halten können, dieses unnachgiebige Grollen unter den Füßen, das immer wieder kurz pausierte, nur um weitaus hämischer von vorn zu beginnen. An der Ecke zum Rathaus, das den Übergang zum Marktplatz markierte, blieb jetzt ein Mann stehen. Er ließ kurz den Blick schweifen und fuhr sich mit einer nachdenklichen Geste über den kahlen Schädel. Als er sich orientiert hatte, setzte auch das erbitterte, feindselige Dröhnen wieder ein, und neuer Staub stieg über dem Beben auf. Vielleicht bäumte sich ja der Untergrund auf, vielleicht empörte sich etwas da unten, vielleicht waren es doch zu viele Fremde, die der kleinen Stadt an diesem Tag ihren Besuch abstatteten, sodass sich ihre Atmosphäre änderte und sie sie abwerfen, von ihrem Fußgängerzonenrücken abschütteln wollte.
Im Grunde waren es ja immer dieselben Gesichter, dieselben geschobenen Fahrräder, dieselben Kinder, dieselben Angestellten, dieselben Rentner. Immer jemand, dem man zunicken, dem man Guten Tag sagen kann. Immer jemand, der immer kommt, der von links nach rechts oder von rechts nach links geht, um seine Einkäufe zu erledigen. Da vorn, Frau Trümer, schaut gar nicht rüber heute.Hat’s eilig.
Reinhard Weißgerbers Blick fuhr unzufrieden über die Baustelle, die in den letzten Tagen immer näher gekommen, von Tag zu Tag lauter geworden war, über den vibrierenden Helm des Bauarbeiters, seine Ohrschützer, die Zigarette im Mund, den Steinstaub, den der Presslufthammer aufwirbelte, und blieb an dem Mann hängen, der zielstrebig an ihm vorbeimarschierte. Nie gesehen. Man konnte nicht alle Kronstedter kennen, aber dieser Typ mit seiner Glatze war eindeutig nicht von hier.
Sie war nicht völlig abgeschnitten von der Welt, die kleine Stadt. Viele durchfuhren sie, hielten, um zu tanken, vielleicht um kurz etwas zu essen. Manche hatten geschäftliche Termine, andere besuchten ihre Verwandtschaft, selten aber gingen irgendwelche Fremden zur Mittagszeit durch die Fußgängerzone, vorbei an Weißgerbers Frischeparadies, vorbei am Wurst-Basar, und betraten Hans Jerkes Rathausapotheke, in der das Pressluftdröhnen nur noch gedämpft zu hören war.
Hier ließ der neue Kunde seinen Blick wandern, begleitet von einem abschätzigen Zucken um die Mundwinkel, über die Auslagen und Werbeaufsteller (Nachts weniger müssen müssen).
»Guten Tag«, sagte Hans Jerke. Seine beste, seine servilste Stimme, mit einem kleinen Lachen auf dem zweiten Wort. Als Antwort erntete er nur ein flüchtiges Nicken ohne Blick. Also beeilte er sich, die alte Frau Trümer abzufertigen, die ebenfalls kurz gestutzt, inzwischen aber wieder ihren Faden aufgenommen hatte. Mit leidender Stimme und in unnötiger Ausführlichkeit berichtete sie davon, dass sie schon seit Tagen vergeblich versuchte, ihren Mann zu Dr. Aschenbrenner zu schicken. »Dieses Augentränen ist nicht normal, das kann mir keiner erzählen.«
Er reichte ihr das Wechselgeld und die Packungen Marcomar und Lefax, die sie umständlich in ihrer Handtasche verstaute, bevor sie sich enttäuscht Richtung Tür aufmachte. Sie hatte sich wohl Rat von ihm erhofft. Ein andermal. Sie hatte die Apotheken-Umschau mitgenommen. Vielleicht gab die aktuelle Ausgabe ja Aufschluss darüber, wie man Ehemänner vom Weinen abhielt.
»Bittschön«, sagte er in die Stille. Feste Freundlichkeit. »Kann ich helfen?«
Der glatzköpfige Mann, der gerade interesselos das Mandel-Johanniskraut-Pflegeöl von Dr. Hauschka betrachtet hatte, schaute auf und kam ihm entgegen. Der Gang gemessen, wiegend, fast zu selbstbewusst. Ein Sportler.
Hans Jerke war von Natur aus kontaktfreudig und aufgeschlossen – zumindest hielt er sich dafür. Und er wusste, dass es dort draußen einen anderen Menschenschlag gab, mit dem er sich verbunden fühlte. An den Wochenenden fuhr er regelmäßig in die größeren Städte, zwei, drei Mal pro Jahr auch nach Berlin. Für Ostern hatte er bereits in seinem Stammhotel in der Motzstraße ein Zimmer gebucht.
Der trainiert unentwegt, dachte er. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Bildest dir ordentlich was drauf ein, was? Aber wenn ich nicht diesen unvorteilhaften Kittel anhätte, könntest du erkennen, dass ich auch nicht so schlecht in Form bin. Er ging drei Mal pro Woche im Kronstedter Hallenbad schwimmen, außerdem joggte er regelmäßig über den Wall und an den Ruinen der alten Stadtmauer entlang. Aber dieser Typ hatte etwas an sich … eine unbeeindruckte und zugleich beeindruckende Souveränität. Als wäre er beim Film: Stuntman, das wäre vorstellbar. Die polierte Glatze, die auf kraftvollen Testosteron-Überschuss schließen ließ, der Bartschatten, die dezent vorspringenden Brustmuskeln, die Oberarme, die sehr breit aussahen unter dem schwarzen Pulloverstoff. Aber sehr beweglich, nicht zu massig. Konnte auch Kampfsportler sein. Kein Boxer, eher in den asiatischen Disziplinen zu Hause. Nicht allzu grobschlächtig, schlanke Gesichtszüge. Aber … doch, da war ein etwas primitiver, ein gemeiner Zug um den Mund. Eigenartig, dachte Hans Jerke, dass so etwas manchen Männern gut steht, dass es nicht so abschreckend wirkt, wie es eigentlich müsste.
Der Kunde hatte immer noch nichts gesagt und legte nun zwei Rezepte auf den Tresen. Aber vielleicht huschte dabei ja der Anflug eines Lächelns über seine Lippen.
Verstehen wir uns? Hans Jerke grinste vor sich hin, nahm die beiden Papiere und musterte zuerst die Adresse des Arztes, der sie ausgestellt hatte. »Hab ich mir doch gedacht. Sie sind nur auf der Durchreise, was?«, sagte er. »Travemünde. Hab ich mal für einen Tagesausflug besucht. Schön da. Aber auch nicht die ganz große Welt, oder?«
Der Typ zog seine Lippen ein. Nein, das war kein Lächeln, nicht einmal der Anflug eines Lächelns. Genau genommen schaute er ihn sehr ungemütlich an, also drehte sich Hans Jerke rasch um. Was war denn so schwer daran, nett und verbindlich zu sein? Schicksalsergeben trat er in den hinteren Bereich, wo die zahllosen Holzschubladen bis zur Decke reichten. Er musste sich bücken, um das erste Präparat herauszuziehen. Das zweite musste er einen Moment lang suchen und schließlich sogar die Trittleiter benutzen. Als er wieder nach vorne kam, zogen sich für einen Augenblick seine Brauen zusammen, während er die beiden Medikamente betrachtete. Mit dem linken Handrücken schob er seine Brille die Nase hinauf und versuchte, eine Verbindung herzustellen.
Der Mann vor dem Tresen hatte weder seine Position verändert noch seinen Blick. Komm mir nicht dumm, sagte dieser Blick. Trotzdem sprach Hans Jerke ihn noch einmal an. »Die sind sehr stark. Beide. Ich nehme mal an, sie sind nicht für ein und denselben Patienten?«
Der Mann zuckte mit den Schultern. Kalt.
»Das würde sich nämlich gar nicht miteinander vertragen.« Er legte die beiden Packungen auf die Wechselgeldschale aus Kunststoff, und schon im nächsten Moment hatte der mutmaßliche Kampfsportler aus Travemünde die Medikamente in einer fließenden Bewegung eingesackt.
»Na ja, Ihr Arzt muss es ja wissen«, sagte Jerke noch und fühlte sich kein bisschen kontaktfreudig und aufgeschlossen mehr.
Der glatzköpfige Mann verließ die Rathausapotheke mit seinen selbstbewussten, wiegenden Schritten, und von der Position hinter dem Tresen aus konnte Hans Jerke nicht mehr sehen, wie er vor der Tür verächtlich ausspuckte und einen großen Bogen um die Punks an der Ecke machte. Er konnte nicht sehen, wie sein Kunde am Frischeparadies vorbei über den Marktplatz ging und schließlich um eine Ecke bog, wo ein dunkler Audi parkte. Auch die Rückscheiben waren dunkel, das Kennzeichen allerdings widersprach der Ostseeherkunft seiner Rezepte. Der Wagen war in Düren zugelassen. Aber was sollte das schon heißen?
Als der Mann die Tür öffnete, schlugen die Glocken der Michaeliskirche. Die Tauben, die gleichzeitig vom Boden abhoben, klangen, als schüttelten sie im Abflug ihr Gefieder aus, und nachdem er sich umgeschaut und tief eingeatmet hatte, war sein Gesicht deutlich härter geworden. So hart, dass ein Menschenkenner wie Hans Jerke vielleicht die Spur einer Verunsicherung darin erkannt hätte.
Im Wagen roch es schlecht, aber der Mann, der in Sachen Kampfsport tatsächlich nicht ganz unbewandert war, auch wenn es sich bei ihm keineswegs um einen Stuntman handelte, durfte die Fenster nicht herunterkurbeln. Dumpfe Laute drangen an sein Ohr. Ein Atmen. Ein Nach-Luft-Schnappen. Ein hohes Fiepen, das sich durch zu enge Nasenscheidewände kämpfte.
Er reichte die beiden Medikamente auf den Rücksitz durch. Sie wurden ihm aus der Hand gerissen. »Haben Sie noch Wasser?«, fragte er. Er konnte die schiefstehende, halbvolle Flasche sehen. Aber er wollte freundlich klingen.
»Sind das die stärkeren?«, fragte die Stimme.
»Scheint so«, sagte der Mann und schaute durch die Frontscheibe nach draußen.
4
Das Sonnenlicht fiel durch die großen Fenster auf der Südseite des Starenwegs, als die Glocken der Michaeliskirche schlugen, und nur wenig Staub flirrte sichtbar in den Strahlen. Frühling, jetzt ist der Frühling da, dachte Barbara Rheinberger und roch zufrieden an der frisch gewaschenen Unterwäsche.
Ins Innere des Hauses waren bisher keine neugierigen Blicke von außen gedrungen. Es gab keine Fotos von diesen Zimmern in den Akten, aber es gab auch nicht viel zu sehen. Bücherschränke aus schwerem, dunklem Holz, Zeitschriftenstapel, Stehlampen mit altmodischen, gelblichen Schirmen, Tapeten, deren schemenhafte Blumenmuster sich nur noch erahnen ließen. Es hingen einige Stiche an den Wänden, es gab ein paar ausgestopfte Tiere, einen Eichelhäher zum Beispiel, aber keine persönlichen Fotos. Auf einem Schränkchen mit schwerer Steinplatte im Flur, neben dem Schirmständer, stand ein Telefon mit geringelter schwarzer Schnur, von dem aus in den vergangenen Tagen nur wenige Anrufe getätigt worden waren. Philip Steinert hatte zwei Mal kurz mit seiner Freundin Carolin Hille telefoniert und Barbara Rheinberger mit ihrem zukünftigen Chef, dem Hotelier Wolfgang Seitzer. Als sie jetzt aus dem Badezimmer kam, mit den Slips, denen sie heute Morgen eine energische Handwäsche verpasst hatte, warf sie einen kurzen, dankbaren Blick darauf.
Es war Frühling, und die Sonne schien zum Fenster hinein. Der Eichelhäher stand tot auf seinem kleinen Stückchen Ast, streckte aber die Brust vor und sah zufrieden aus. Ja, die Dinge wandten sich zum Besseren. Wenn die Bezahlung stimmte (und davon war auszugehen), würde sie auch an Philip einiges gutmachen können – wenn sie es schaffte, seine Trotzphase zu durchbrechen. Trennungen sind für die Kinder am schlimmsten, aber er war sechzehn, Herrgott. Er sollte sich nicht so anstellen. Harald war nicht einmal sein Vater.
Entscheidend war: nicht mehr abhängig sein. Wenn sie wieder was verdiente, konnte sie ihm das bieten, was er sich wünschte, mit ihm wegfahren, es sich gutgehen lassen. Vielleicht würde sie sich sogar überwinden und mit ihm in eines dieser stinklangweiligen Klassikkonzerte gehen, die er wohl nur deshalb so toll fand, weil er ihr in pubertärem Protest zeigen wollte, dass er sich nicht für gewöhnliches Fußvolk hielt. Aber egal: Such dir was aus, würde sie sagen: Mozart meinetwegen oder Beethoven oder was auch immer. Egal! Nur keine Opern. Sie wusste: Die dauerten Stunden.
Barbara Rheinberger, geborene Steinert, atmete tief ein und legte die Slips neben den Koffer. Sie hatte sie ausgewrungen und vor Stunden zum Trocknen über den Heizkörper gelegt, aber sie waren noch klamm. Unzufrieden musterte sie den Kleiderhaufen auf dem Korbstuhl, den sie noch sortieren musste. Sie zog ihren blasslilafarbenen BH heraus, den mit den weißen Punkten, untersuchte ihn kritisch und steckte ihn in den Koffer. Sie ließ den Blick durch den Raum gleiten, bis er auf ihren Laptop fiel, den sie aufgeklappt auf eine Kommode gestellt hatte, um immer mal wieder, auf dem Weg von einem Zimmer ins andere, einen Blick hineinzuwerfen. Sie hatte an diesem Vormittag, auch das ging aus den Protokollen hervor, nach verschiedenen Begriffen gegoogelt, die mit dem Harz und dem Hotel zu tun hatten, sie hatte Google Maps geöffnet und zwei persönliche Nachrichten auf einer kostenpflichtigen Dating-Plattform geschrieben. Es gab noch einen weiteren Rechner in der Wohnung, ein weiteres MacBook, das ihrem Sohn gehörte und auf dem sich in letzter Zeit, neben dem üblichen E-Mail-Verkehr mit einem Schulfreund in Kassel und seiner Freundin Carolin Hille, wenig Berichtenswertes getan hatte: Vor allem war Musik gestreamt worden. Außerdem hatte er einige Mediatheken von Fernsehsendern sowie pornografische Inhalte aufgerufen – nichts, was bei einem 16-Jährigen auffällig gewesen wäre.
Barbara Rheinberger prüfte, ob man ihr geantwortet hatte – nein, noch nicht –, hörte unten die Tür und klappte ihren Laptop zu.
Sie war sich nicht immer sicher gewesen, aber heute schien es ihr eindeutig: Es war die richtige Entscheidung gewesen, mit Philip zu ihrem alten Onkel zu ziehen, der jetzt von einem seiner Spaziergänge nach Hause kam. Sie erkannte ihn an den langsamen Schritten, daran, wie er sich die Treppe hinaufbemühte.
Als er es nach oben geschafft hatte, begann Richard Korff umständlich damit, sich aus dem schweren Mantel zu winden. Sie kam ihm entgegen und half ihm. Dann hängte sie den Mantel an die Garderobe und strich liebevoll einen der Ärmel glatt.
»Kommst du voran?«, fragte er. Er hatte etwas aus seiner Tasche genommen, ein Buch, wie es aussah, und steuerte nun das Wohnzimmer an, wo immer noch eines ihrer Tops an einem Bügel an der Türklinke hing. Seufzend ließ sich der alte Mann in einen Sessel fallen.
»Ja, ich hab eigentlich so gut wie alles zusammen«, sagte sie und folgte ihm. »Und das Wetter ist ja herrlich. Das ist doch ein gutes Zeichen. Ist es warm draußen?«
Er blickte einen Moment auf das Taschenbuch in seiner Hand und schaute dann zu ihr auf, als habe er sie nicht verstanden. »Ja … ja, es ist recht warm geworden. Das stimmt.«
»Bist du eigentlich selber schon mal dort gewesen?«
Keine Antwort.
»Im Hotel, meine ich.«
»Wie? Nein.« Eine mit traurigem Lächeln unterlegte Pause. »Aber, weißt du, Wolfgang, also der Herr Seitzer, hat mir oft davon erzählt. Es muss wirklich sehr schön sein.« Er zögerte, blickte zu ihr auf. »Was ist mit Philip? Hast du noch mal mit ihm gesprochen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Er stellt einfach auf stur, er will nicht mitkommen.« Ihre Stimme klang jetzt angespannter. »Aber ich werd ihn mir noch mal vorknöpfen, wenn er wieder da ist.«
Onkel Richard lächelte wieder. Sie liebte es, wenn er diese entschuldigende, stille Sanftmut ausstrahlte. Und es rührte sie.
»Er ist ein bisschen überfordert im Moment«, sagte sie. »Aber wir müssen uns ja alle irgendwann anpassen und lernen, uns einzufügen.« Gut klang das und sehr vernünftig, allerdings spürte sie ein Ziehen im Magen, wenn sie sich vorstellte, wie Philip sie zum Abschied anschauen würde. Mit diesen braunen Vorwurfsaugen, die gegen jede physische Wahrscheinlichkeit immer noch größer und größer wurden. Man konnte doch erwarten, dass er sich seinem Alter entsprechend verhielt. Inzwischen wischte sie regelmäßig seine Rasierschaumreste aus dem Waschbecken, und wenn sie sich nicht täuschte, hatte sie ihn erst kürzlich beim Onanieren erwischt. So ein hektisches Zusammenzucken und Wegdrehen war ja wohl eindeutig. Ein muffiger, schweißiger Geruch. Natürlich hatte sie die Tür sehr schnell wieder zugemacht, und sie war sich auch nicht hundertprozentig sicher. Er hätte ja längst eine Freundin haben müssen – sechzehn Jahre, mein Gott! – da kamen noch ganz andere Sachen auf sie zu – natürlich – aber das war nur gut und richtig.
Sie legte ihrem Onkel eine Hand auf die Schulter. »Auf jeden Fall möchte ich, dass du weißt, wie dankbar wir dir sind. Wir beide, weißt du.«
»Es ist schon in Ordnung, wirklich.« Er legte seine Hand auf ihre, aber sein Blick wanderte durch den Raum.
Ach, das alles war wirklich nicht leicht. Umso nötiger schien es ihr, festzuhalten, was übriggeblieben war. Familie war ein großes Wort, und es hatte ihr hauptsächlich Probleme eingebracht. Sie selbst hatte ihren Vater nie kennengelernt, und ihre Mutter hatte mit schmallippigem Eifer jedes einzelne Foto von ihm aus sämtlichen Alben entfernt. Kostbare Leerstellen waren das, heimlich betrachtet unter knittrigem, trübem Schutzpapier. Klebeecken wie Wunden, wahrscheinlich aber Illusionen, wie sich Barbara später, bei gesteigerter Lebenserfahrung, eingestanden hatte.
Ihr nicht vorhandener Vater war dann irgendwann bei einem Verkehrsunfall aus einer Landstraßenkurve geschleudert worden. Aber das hatte Barbaras Leben kaum betroffen. Keine Beerdigung, an der sie hätte teilnehmen können, außerdem das von ihrer Mutter verhängte Trauerverbot. Übriggeblieben war der wütende Kinderzimmerwunsch, es selbst besser zu machen. Und sehr bald, ja, in Philips Alter, zwischen picklig-tumben Jungs mit großen, schnellen Händen (zwischen Jungs, wie Philip heute einer war?), bei herumgereichten Joints und kichernd aufgerissenen Kondomverpackungen, hatte sie feststellen müssen, dass es nicht leicht werden würde.
Leicht aber war gewesen: Nach Jahren ohne Richtung ein Kind zu bekommen von einem Mann, den schon das bloße Wort Verantwortung die Beine in die Hand nehmen ließ. Anschließend hatte sie das Gefühl gehabt, immer angeschaut, immer beobachtet zu werden: Die Blicke des Winzlings, die Hunger- und die Liebesblicke, die Erwartungsblicke rund um die Uhr und dazu noch der wissende Blick ihrer Mutter im Nacken. Dieses Es musste ja so kommen.
Leicht war es auch gewesen, die Flucht zu ergreifen. Eine unbeschwerte, mutige Abenteurerin hatte sie sein wollen, die in Bewegung blieb und sich von den Augen, die so voller Erwartung auf sie gerichtet waren, nicht irritieren ließ. Ja, vielleicht war das Ergebnis ein Abenteuer gewesen, aber meistens hatte es sich bloß wie ein unübersichtliches Chaos angefühlt. Immerhin hatte sie dabei gelernt, die eigene Mutter zu verstehen. Zu spät allerdings. Ein plötzlicher Krebs hatte die schmalen Lippen der alten Frau Steinert zu Strichen werden lassen, und die letzten Versöhnungsgelegenheiten waren bei viel zu kurzen Krankenhausbesuchen ungenutzt verstrichen.
Die Panik dieses Verlustes steckte immer noch tief in Barbara und war, das wusste sie selbst, zu ihrem Motor geworden. Eine Niederlage nach der anderen hatte sie in der Folge einstecken müssen, Niederlagen, über die sie selber staunte und die fast immer Männernamen trugen.
Es musste ja so kommen, hatte ihre Mutter gesagt, leise, aber so unüberhörbar, dass es ihr immer noch in den Ohren klang. Und jetzt? Jetzt konnte Barbara Rheinberger die Worte nachsprechen, denn auf ärgerliche Weise schien sich alles zu wiederholen. Ihre eigene kaputte Jugend brachte eine weitere kaputte Jugend zustande, und tatsächlich kam ihr der vaterlose Philip oft wie ihr Spiegelbild vor.
Das war eine Erkenntnis, über die man mal einen Ratgeber schreiben sollte, einen ehrlichen: Familien sind Teufelskreise. Aber jetzt ließ sich ihrer vielleicht unterbrechen! Alles sah besser aus, seit sie ihn wiedergefunden hatte: Onkel Richard, der ihr nach dem Tod der Mutter als Verwandtschaftsrest geblieben war und für den sie jetzt die Thermoskanne aus der Küche holte. Dem sie Tee eingoss und der die Tasse, die sie ihm reichte, dankbar entgegennahm. Nur ein Fremder im Grunde, der immer abwesend geblieben war, und mit dem sie jetzt stellvertretend Versöhnung feierte. Die Stimme ihrer Mutter zwischen verkniffenen Lippen: Mein Bruder. Ach, der. Der sitzt in Schottland und will auch nichts mehr von uns wissen. Na schön: Verwandtschaft auf dem Papier, aber immerhin Verwandtschaft. Ein paar Briefe aus dem Ausland, auch später kein echter Kontakt. Doch damit musste man sich ja nicht abfinden, dabei musste es ja nicht bleiben. Das hatte sie bewiesen. Wir gehören ja trotzdem zusammen.
Jetzt gewährte er ihr Unterschlupf, half ihr auf die Beine. Ein schlanker, feiner, ja, im Grunde sehr eleganter und empfindlicher älterer Herr. Sie atmete tief ein, während er in seinem Wohnzimmersessel saß und am Tee nippte. Man sah ihm seine Lebenserfahrung an, seine Bildung, man sah immer, wie er nachdachte, wenn man mit ihm sprach.
Er legte das Taschenbuch vor sich auf den Tisch, das er offenbar auf seinem Spaziergang mitgenommen hatte. Es war ein Roman von Charles Dickens, wie ihr auffiel: Bleak House. Er hob jetzt den Kopf, lächelte sie an, und sie erwiderte sein Lächeln.
Die Erinnerung war nur schwammig, als warmes Gefühl aber sehr stark: der Bruder der alten Frau Steinert, den Barbara als Kind staunend gemustert hatte, der sie auf den Schoß genommen und ihr Witze erzählt hatte. Sie wusste das im Grunde nur aus den Erzählungen ihrer Mutter. Das war vor seinen Jahren in Schottland gewesen, vor seinen beruflichen Abwegen, die ihn zu so einem scheuen Einzelgänger gemacht hatten. Aber er war nicht stehen geblieben und voller Selbstmitleid versauert. Er war ausgezogen, in die Welt hinaus, er hatte Dinge gesehen, etwas herausgeholt aus dem Leben, trotz aller Hindernisse. Schon damals, als sie noch klein gewesen war, das immerhin fiel ihr wieder ein, hatte er das schlimme Bein gehabt, das ihn noch heute quälte. Sie hätte es ihm gern massiert. Das Angebot stand, aber er wollte nicht. Sein Schamgefühl ließ das wohl nicht zu. Oh, der gute alte Mann, der Rest Familie, den sie aus der Vergessenheit geborgen hatte und der festgehalten werden musste. Sie küsste ihn sacht auf die Schläfe, und er zuckte zusammen, lächelte aber weiter und schaute nickend zu ihr auf.
»Möchtest du noch eine Tasse?«, fragte sie.
Er wandte sich ab, blickte Richtung Fenster und rappelte sich mit zusammengezogenen Augenbrauen auf. Auch Barbara hörte das Geräusch. Unten war ein Auto vorgefahren, und nacheinander knallten zwei Autotüren zu.
Richard Korff öffnete das Fenster, lehnte sich hinaus und drehte sich zu Barbara um. »Philip kommt.«
»Mit dem Auto?«
»Mit deinem Mann.«
5
Da hängt er schon wieder und glotzt, dachte Philip, nachdem er tief die frische Luft eingeatmet hatte. Zu Harry sagte er nur: »Wenn man vom Teufel spricht.« Sein Großonkel schaute vom ersten Stock auf den dunkelgrünen Jaguar hinunter. Jetzt hob Richard Korff eine seiner furchtbar dünnen Hände und winkte den beiden kurz zu. Lächelte angestrengt. Aber es war ja sein Haus. Warum sollte er nicht die Nachbarschaft beobachten, wenn es sonst nichts für ihn zu tun gab? Zumal seine aufdringliche Nichte einen Großteil seiner Wohnung blockierte – samt Sohn und jeder Menge ungelöster Lebensfragen.
Philip musste einen Schritt zur Seite tun. Er stand einer alten Frau im Weg, die sich umständlich an ihm vorbeischob. Aus ihrer Handtasche, die sie eng an den Oberkörper presste, ragte die eingeknickte Ecke einer Tageszeitung. Undeutlich murmelte sie eine Entschuldigung. Sowieso: super Nachbarschaft. Florierendes Absterben links und rechts, dachte Philip und warf Harry einen bitteren Blick zu: Willkommen in meinem Leben.Totale Vergreisung. Krückenstedt. Letztes Paradies der Rollatorenschieber. Direkt um die Ecke erhob sich der Altenheimkomplex mit seiner unendlichen Zahl übereinandergestapelter Mini-Balkone: die so genannte Speicherresidenz. In besseren Zeiten – lange war es wohl her – musste hier ein Speicher gestanden haben, randvoll mit Getreide oder irgendetwas Nützlichem, von dem es nun keine Spuren mehr gab. Heute wurden hier die Greise gespeichert, und eingefallene Gesichter schauten über die extra hohen Brüstungen. Hinter anderen standen rauchende Pfleger, blinzelten in ihrer Pause dem Sonnenlicht entgegen und sahen aus, als wünschten sie sich weit weg. Hin und wieder hörte man lauter werdende Stimmen, manchmal ein unbeherrschtes Stöhnen. Alle zwei Wochen spielte eine Zwei-Mann-Combo im Innenhof Volksmusik, und wer konnte, sang mit.
In dem schlanken, spitz aufragenden Reihenhaus, dem sich Philip Steinert und sein Stiefvater jetzt näherten, war irgendwann einmal ein Geschäft geführt worden. Der verblichen grüne Schriftzug ließ sich in geschwungenen Buchstaben noch immer gut entziffern: »Antiquitätenkontor«. Das Schaufenster neben der Eingangstür war jetzt von innen mit einer fleckig grauen Pappe verdeckt. Dahinter, im ehemaligen Laden, befand sich nur noch ein dunkles Lager aus Gerümpel, ein Wirrwarr aus hölzernen Möbelbeinen, aus alten Büchern und eingerissenen Kartons, die einen unguten Geruch verbreiteten. Nicht zu vergessen: Seit einem guten halben Jahr standen dort auch die Koffer, die seine Mutter und er mitgebracht hatten, und warteten, wie Philip, auf den Auszug. Immerhin: Einer von ihnen, der Mutterkoffer, würde bald die Berge sehen.
»Na, das wird wohl nichts mehr mit der Überraschung«, sagte Harry. Er griff sich gequält an die linke Schulter.
Philip ging die vier Stufen zur Haustür hinauf und steckte kopfschüttelnd den Schlüssel ins Schloss. Als sie, am ehemaligen Antiquariat vorbei, die mit dunkelgrünem Teppich ausgelegte Holztreppe zum ersten Stock hinaufgestiegen waren (jeder Schritt ein Knarren), stand der Alte bereits an der Tür zur Wohnung, als wolle er sie in Empfang nehmen. Philip aber sah ihm an, dass er einfach nur der nächsten Ruhestörung tapfer ins Auge blickte.
»Herr Rheinberger, das ist ja eine Überraschung«, sagte Richard Korff und stützte sich unsicher mit der einen Hand auf das Geländer, während er mit der anderen fahrige Bewegungen machte. Vermutlich sollten sie einladend wirken. »Sie haben sogar Blumen mitgebracht. So ein bisschen Natur im Haus macht alles viel freundlicher, finde ich.« Dazu nickte er mehrere Male mit dem Kopf und wirkte, wie meist, ziemlich geistesabwesend. Humpelnd ging er ihnen voran in die Wohnung. »Kommen Sie doch rein«, sagte er.
Aus dem provisorischen Zimmer von Philips Mutter, dem ehemaligen »Lesezimmer«, drang dumpf Musik. Sie hatte das Radio angestellt. Cause what you don’t understand is I’d catch a granade for ya, yeah, yeah, yeah …
»Vielen Dank, Herr Korff«, sagte Harald Rheinberger gedämpft und suchte mit unruhigen Augen den Flur ab. Philip schaute ihn skeptisch an. Er sah aus, als fühle er sich gar nicht wohl in seiner Haut. Für gewöhnlich hielt er sich natürlich in anderen Sphären auf, in weitläufigen Büros und in Fabrikhallen, wo er in kollegialem Ton mit Produktionsleitern sprach oder die Verbesserungsvorschläge der Ingenieure diskutierte. Harry hatte vor zweiundzwanzig Jahren eine mittelständische Schraubenfabrik übernommen und stellte inzwischen hauptsächlich Kleiderbügel her – aus biegsamem Draht –, die er in gigantischen Mengen vor allem an osteuropäische Wäschereien verkaufte.
»Ich würde gern mit meiner … mit Barbara sprechen«, sagte er jetzt.
… throw my hand on a blade for ya …
Man musste das ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Also öffnete Philip die Tür und sagte: »Hi. Besuch ist da.«
Seine Mutter drehte sich nicht um. Konzentriert schminkte sie sich vor einem kleinen Spiegel, den sie auf einen wackligen Bücherstapel gestellt hatte.
»Hallo, Spätzchen.« Sie meinte Philip, nicht Harry.
Dieser klopfte mit dem Zeigefinger gegen den Türrahmen und räusperte sich.
Ein kurzer Blick über die Schulter. »Harald. Warum hast du nicht angerufen? Du hast Glück, dass du mich erwischst.« Und nachdem sie die Kappe auf den Eyeliner gestülpt hatte, fügte sie ohne Betonung hinzu: »Blumen. Wie nett.«
Philip schob sich an Harry vorbei und sah sich um: Auf dem Sofa der große Koffer, geöffnet, aber noch nicht gepackt. Darum herum zwei benutzte Wassergläser, eine innen wie außen braun gesprenkelte Kaffeetasse mitten auf dem Fußboden. Ein Joghurtbecher, in dem der Löffel steckte. Auf dem Korbsessel in der Ecke eine undurchschaubare Unordnung aus benutzten und unbenutzten Kleidungsstücken und einigen Handtüchern. Waren das Kekskrümel auf dem Teppich? Philip musste sich sehr zusammenreißen, um nicht sofort aufzuräumen.
»Hallo, Barbara.« Harry blieb in Türnähe stehen. Er steckte eine Hand in die Hosentasche, hielt mit der anderen die Blumen fest und begann mit ziemlich angespannter Stimme zu sprechen. »Ich dachte, ich komme einfach mal persönlich vorbei und schaue, wie ihr euch hier eingerichtet habt.« Unangenehme, zu lange Pause. Er seufzte. »Ich habe gestern angerufen.«
»Ja?« Sie stand auf, schaute sich um, suchte irgendwas.
»Aber das hat ja offensichtlich keinen Zweck, wenn du dich immer verleugnen lässt oder auflegst.«
Sie nickte zufrieden. Weil sie ihren Schmuck gefunden hatte.
»So können wir nicht regeln, was geregelt werden muss«, sagte Harry.
»Es muss nichts geregelt werden.« Mit größter Ruhe legte sie ihre Ohrringe an. »Setz dich irgendwohin, Philip, du machst mich nervös.«
Sonst noch Wünsche? Philip blieb stehen und verschränkte die Arme. Harry sah ihn an. Das hätten wir uns schenken können, sagte sein Blick. Ob er ihr wohl erzählen würde, wer inzwischen bei ihm eingezogen war?
»Also«, setzte Harald Rheinberger mit geschäftsmäßiger Stimme an. »Du hast letzte Woche den Betrag zurücküberwiesen. Das habe ich nicht verstanden. Ich würde das gerne klären.«
»Aha.«
»Ich habe mir freigenommen und bin den ganzen Weg hierher- gefahren, um die Sache mit dem Unterhalt noch mal abzusprechen. Ich habe gehört, dass du einen Job gefunden hast.«
Philip betrachtete eingehend den ungesaugten Fußboden. Er musste nicht aufschauen, um zu merken, wie ihn der Blick seiner Mutter traf.
»Harald …«, sagte sie. Nur ein kläglicher Versuch, ihn zu unterbrechen.
»Es ist toll, dass du wieder Arbeit hast. Meinen Glückwunsch. Aber ich möchte das aus der Welt schaffen. Es gibt Dinge, die stehen dir einfach zu. Punkt. Wenn wir das nicht besprechen können wie erwachsene Menschen, dann muss es eben schriftlich geregelt werden. Aber bisher ist nichts von deinem Anwalt bei uns eingegangen. Vielleicht hast du ja noch nicht den richtigen gefunden. Ich kann dir wen empfehlen, überhaupt kein Problem.« (Natürlich hatte sich Philips Mutter keinen Anwalt genommen, natürlich hatte sie auch die Briefe von Harrys Anwälten nicht aufgemacht. Geregelt wurde also gar nichts.)
»Wie soll das aussehen, wenn das mit dem festen Job im Harz nichts wird?«, fragte Harald Rheinberger mit einer Stimme, die kurz davor war, laut zu werden, und Philips letzte Hoffnungen zunichte machte. »Willst du dann hierher zurück? Das ist ja nun wirklich keine Lösung. Ich meine, mal realistisch betrachtet. Ihr müsst doch in eine vernünftige Wohnung ziehen, Barbara, und ich finde – ganz im Ernst: Du solltest dich nicht derart bockig anstellen, nur um hier irgendwas zu beweisen …«
Sie blickte ihn an, atmete hörbar ein und verschränkte angespannt ihre Arme. Äußerlich schien sie in guter Verfassung zu sein. Die rotblonden Haare fest am Hinterkopf zusammengebunden, die helle Bluse eng anliegend. Schlank, beherrscht, mit unübersehbaren Tränensäcken unter den Augen. Philip, der dieses Gesicht besser kannte als jedes andere, konnte spüren, wie es in ihr brodelte, meinte sogar, ein Zucken ihrer Unterlippe zu erkennen. Aber sie sprach langsam und mit ernster Freundlichkeit. »Diese Diskussion hat keinen Zweck. Im Augenblick reicht mir, was ich in der Vertretung verdiene und was ich zurückgelegt habe.«
»Na, ich bin sehr beeindruckt. Aber es geht ja nun mal nicht nur um jetzt und heute, sondern um die Zukunft.«
»Ach, die Zukunft. Ich lebe in der Gegenwart. Solltest du auch mal ausprobieren.« Sie schaffte es zu lächeln. »Ich weiß, du hast ein schlechtes Gewissen, und du wünschst dir natürlich, dass dir das abgenommen wird.«
Er machte ein grunzendes Geräusch, verdrehte die Augen, riss sich aber zusammen. »Ich möchte lediglich, dass wir miteinander sprechen.«
»Du willst es hinter dir haben. Aber hier geht’s nicht um Geld. Ich will kein Geld von dir, keine Wohnungen, keine Anwälte, und ich glaube auch nicht, dass du ernsthaft was anderes erwartet hast.« Ihre Augen waren sehr groß und ihre Wangen sehr rot. »Das ist alles völlig unnötig, Harry«, fügte sie hinzu. »Uns geht es sehr gut. Mach du ruhig mit deinem Leben weiter, und wir leben unser Leben. Im Hier und Jetzt. Es ging früher auch ohne dich.« Noch ein Lächeln zum Abschluss, etwas verkrampfter diesmal.
Philip erhob sich, machte weit ausholende Schritte und bückte sich hier und da. Er spürte einen ganzen Pfeilregen aus Blicken im Rücken, sammelte aber unbeirrt das Geschirr und den Joghurtbecher mit den eingetrockneten Resten auf und marschierte in die Küche. Warumsprach sie immer von ihnen beiden?Warum lehnte sie für sie beide ab? Was bildete sie sich eigentlich ein? Er war, wie eh und je, das Anhängsel, weiter nichts.
Wenn er die Augen schloss, so wie jetzt, glaubte er manchmal, sich selbst sehen zu können: als kleinen Jungen, dessen Finger sich in die Hand seiner Mutter hakten und dessen Arm immer länger wurde. Er stand an der Spüle in der Korffküche und sah sich zugleich mit ihr durch irgendwelche fremden, unübersichtlichen Fußgängerzonen irren, verwirrt Treppenhäuser zu Einwohnermeldeämtern hinaufstürzen, immer wieder mit erhitztem Gesicht und Schweiß auf der Stirn vor neuen Schulhöfen ankommen und in neuen Wohnungen. Die furchtbaren Momente, wenn neue Männer sich herabbeugten und sagten: »Das ist also der kleine Philip?« (Klaus, Martin, Gerd – oh Gott, der dämliche Gerd!) Hände auf seinem Kopf, scheue und deshalb grobe Männerberührungen. Lebensabschnittsgefährten für ziemlich kurze Lebensabschnitte, die ihre Unsicherheit überspielten und mit tiefen, lauten Stimmen Sachen sagten wie: »Warum ist er denn so schüchtern, der Kleine?« Vier Umzüge in den letzten zehn Jahren. Immer in Bewegung bleiben. Vier neue Versuche, neue Anfänge in wechselnden Städten, und jetzt das. Endstation Elefantenfriedhof.
Unschlüssig schaute er sich in der Küche um, sammelte auch hier zwei Teller und ein nutellaverkrustetes Messer ein und schüttelte Brötchenkrümel in den Mülleimer. Dann schüttete er Allzweckreiniger auf einen kleinen Schwamm und begann, Korffs Küchentisch damit zu wischen. Der zitrussüße Hygieneduft beruhigte ihn jedes Mal.
In Harrys Haus, nicht weit entfernt von der Kasseler Wilhelmshöhe, hatte es mehrere Flure und Treppen gegeben und hohe, rauschende Bäume vor den Fenstern. Dort hatten nicht nur zwei leise brummende Miele-Spülmaschinen zur Verfügung gestanden, sondern – Höchststufe der Dekadenz – freundliche, festangestellte Damen und Herren, die tagsüber vorbeikamen und einem die Hausarbeit abnahmen. Goldene Zeiten!
Philip schnaufte, wusch den Schwamm aus. Gut, man sollte sein Herz nicht an materielle Dinge hängen und auf keinen Fall und um Gottes willen sowieso überhaupt nicht an Miele-Spülmaschinen, aber er hatte dort ein großes Zimmer mit weißen Wänden und Parkettboden bewohnt und über ein eigenes Bad verfügt. Mit Handtuchwärmern und Fußbodenheizung. Er war mit erträglichen Leuten zur Schule gegangen, hatte seine Ruhe gehabt. Auch Harry war auszuhalten gewesen. Vor allem hatte er sich ihm auch nicht in verlogener Kumpanei aufgedrängt. Nein, sie waren bloß höflich zueinander gewesen, hatten Abstand gewahrt.
Einmal waren sie miteinander einkaufen gegangen (für die Hochzeit): Schuhe, weißes Hemd, einen Anzug, die dünne, dunkle Krawatte, die er nicht selbst binden konnte und die Harry ihm gebunden hatte. In diesem grauen Anzug, der ihm Schultern und eine schmale Taille gegeben hatte, war er später über die langen Flure und die breiten Treppen hinuntergegangen, war auf die Terrasse getreten, hatte sich gezeigt und dabei erwachsen und sicher ausgesehen. Das Staunen in den Augen seiner Mutter war ihm nicht entgangen. Die Frage in ihrem Gesicht: Nanu, was haben wir denn da? Kommt da so ein richtiger, eigenständiger Mensch daher!





























