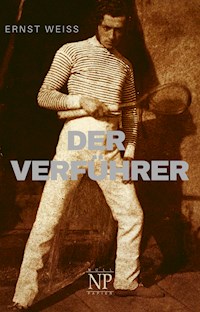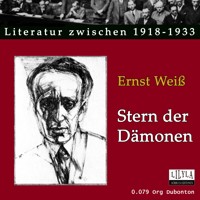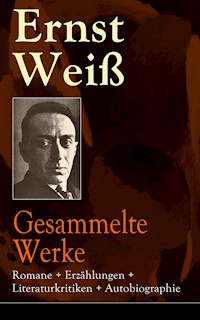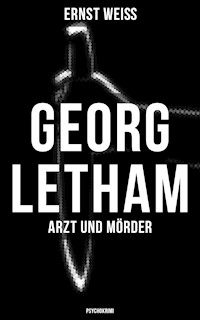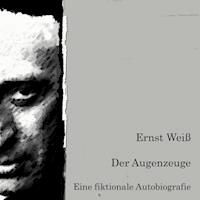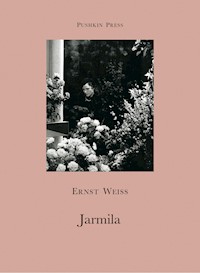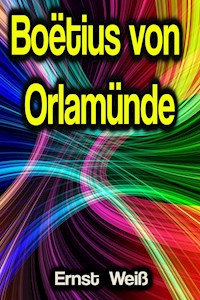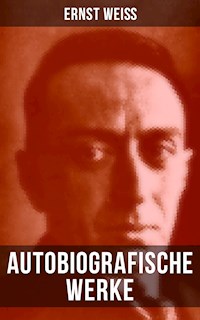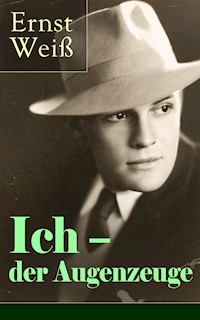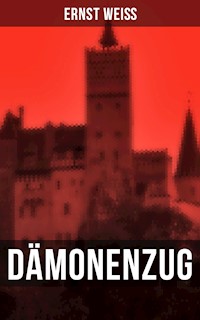1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
In "Gesammelte Essays" präsentiert Ernst Weiß eine facettenreiche Sammlung seiner tiefgründigen und analytischen Essays, die sich eingehend mit den menschlichen Konflikten, der Kultur und der eigenen Identität auseinandersetzen. Diese Texte, geprägt von einem literarischen Stil, der sowohl lyrisch als auch präzise ist, reflektieren den tumultuösen Kontext des frühen 20. Jahrhunderts in Europa. Weiß gelingt es, persönliche Erfahrungen mit universellen Themen zu verweben, wodurch seine Essays nicht nur zeitgenössisch, sondern auch zeitlos werden. Die Kombination von philosophischen Betrachtungen und autobiografischen Elementen schafft eine dichte, nachdenkliche Atmosphäre, die den Leser zum Verweilen und Reflektieren einlädt. Ernst Weiß, geboren 1880 in Prag, zählt zu den bedeutenden Autoren der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. Als Mitglied des literarischen Kreises um Franz Kafka und andere Wegbereiter des modernen Denkens, beeinflussten seine Erlebnisse als Jude in einer sich wandelnden Welt seine Schreibweise maßgeblich. Die essaysistischen Werke von Weiß sind oft als Brücke zwischen der persönlichen und der kollektiven Erfahrung zu verstehen, was ihm erlaubt, die leidvollen und aufsuchenden Fragen seiner Zeit zu thematisieren. Dieses Buch ist besonders empfehlenswert für Leser, die sich für die Schnittstellen von Kultur, Identität und Geschichte interessieren. Die Essays bieten nicht nur Einblicke in die Gedankenwelt eines tiefgründigen Denkens, sondern auch die Möglichkeit, sich mit den existenziellen Fragestellungen der menschlichen Erfahrung auseinanderzusetzen. Ein unverzichtbares Werk für alle, die die literarische und philosophische Landschaft des 20. Jahrhunderts näher erkunden möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Gesammelte Essays
Inhaltsverzeichnis
Gerhart Hauptmann, die Insel der großen Mutter
Der Beginn des neuen Romanes von Gerhart Hauptmann ist prachtvoll: »Dem Ufer einer herrlich und verlassen prangenden, von Gebirgen überhöhten Insel im südlichen Weltmeer näherten sich eines Tages mehrere Boote, als die Sonne gerade im Mittag brütete.« Solch eines Einleitungssatzes brauchte sich Kleist nicht zu schämen, und die folgende Exposition scheint den hochgespannten Erwartungen recht zu geben. Es sind schiffbrüchige Frauen, die sich, lachend und wehklagend zugleich, in den Booten auf die verlassene Insel flüchten, die ihnen von jetzt an Heimat, Bodenkrume, Arbeitsfeld, Totenacker, Schauplatz aller Leiden, Freuden, Pläne, Hoffnungen und Leidenschaften werden soll. Sie werden, so glaubt man, jetzt wie Robinson Crusoe die Zivilisation, die Gesittung, die menschliche Gesellschaft aus dem Urkern wieder aufbauen; die reinsten menschlichen Beziehungen werden sich in der balsamischen, regenfreien, klaren Luft der einsamen Insel wie in Goethes »Wahlverwandtschaften« in völliger Reinheit, Unbefangenheit und daher mit letzter Tragik entwickeln. Nun müßte das Menschengeschlecht mit ihnen aussterben, falls nicht eine unter ihnen wäre, die guter Hoffnung ist. Doch dies trifft nicht zu. Aber es ist ein zwölfjähriger schöner Knabe, namens Phaon, mit gerettet worden, von dem nun die Erhaltung dieses von dem übrigen Menschengeschlecht abgeschnittenen Zweiges abhängt. Zweihundert Frauen und nur ein Mann. Zweihundert vollblütige Menschen im sinnlichen Überfluß, denn diese schiffbrüchigen Weiber haben alles Nötige und Überflüssige gerettet: Sie haben in ihren Kähnen nicht, nur Feuerzeug, Waffen, Kochgeschirr, sondern Pelze, Füllfedern, Papier, Taschentücher, Zigarren, Bordstühle und ein Büchelchen von Wilhelm Bölsche gerettet, worin der Schädel eines auf Java ausgegrabenen Menschenaffen abgebildet ist, damit man seine Ähnlichkeit mit dem ersten Menschen feststellen könne, der auf der Insel geboren wird. Alles haben diese guten Weiber gerettet, nur ihr Empfinden, ihre angeborenen, selbstverständlichen Instinkte haben sie bei dem Untergang ihres Schiffes verloren, oder der Dichter hat sie ihnen grausam genommen. So viel Frauen und kein Mann. Eine Komödie. So viel Frauen und kein Kind. Eine Tragödie. Keines von beiden erfüllt sich.
Alles Glück der Erde ist über dem Eiland ausgeschüttet. Was könnte fehlen, wenn Früchte im Überfluß, Bast, Matten, Kaffee, Nahrung aller Art, Geflügel und Wild, Zebukühe zum Reiten und alles andere ohne die geringste Arbeitsmühe vorhanden sind. Der unbeschreibliche Reiz, der von Robinson ausgeht, der alles improvisiert, alles entdeckt, alles mühsam pflanzt, erntet und sich erst im Papagei, dann im Eingeborenen »Freitag« eine Gesellschaft und Gemeinschaft aufbaut, scheint Hauptmann nicht verlockt zu haben. Die Frauen finden alles vor oder haben es mitgebracht, wie den Papagei, es beginnt ein Leben der Wohlzufriedenheit, um so mehr, als keine Frau, die Mutter Phaons ausgenommen, einem ihrer mit dem Schiff gesunkenen Angehörigen ernsthaft nachtrauert, indem sie von einem dieser Menschen erzählt. Selbst der wüste Abenteurer Robinson gedenkt der Seinen. Aber Hauptmann hat seltsamerweise auf alle Regungen der Menschlichkeit verzichtet. Es ist ein unorganischer Weiberhaufen, geschwätzig, seelisch dürr, gut gemästet, schön aufblühend und gut in Form, aber völlig leer.
Nun bleibt die Möglichkeit: um den schönen, halbreifen Knaben beginnen die Kämpfe der üppigen Witwen. Aber hier beginnt dem Dichter der Faden völlig zu entgleiten. Er weiß selbst nicht, wer Phaon ist: »Phaon stand nun im ersten Drittel des 15. Lebensjahres. Als Jüngling genommen, glich er noch vollkommen einem Knaben. Als Knabe genommen, erschien er bereits jünglingshaft. Phaon war schön, wie Rodberte richtig bemerkte.« Hier ist der ganze Roman. Jaja, nein nein. Phaons Mutter ist tot, die andern Weibsgesellen nennen sich Mutter und heilig! Sind das eine so wenig wie das andere. Sind überhaupt keine Frauen. Denn, wenn nun Phaon eine nach der anderen heimlich erobert und jede umschlingt, wenn er, um mit Ariadne zu reden, »wie ein Gott gegangen kommt«, wird es dann ein menschliches Herz verstehen, daß die durch diese Liebe beglückten Frauen dies Geheimnis des zeugenden Knaben streng im Busen verschließen, so daß nicht ein einziges Geständnis ihrer Amazonenbrust entfährt? Daß ferner diese Frauen einander den Knaben ohne die geringste Eifersucht gönnen? Daß sie, zum dritten, auf die männlichen Sprossen dieser Umarmungen verzichten und diese Knaben im Alter von fünf Jahren »satzungsgemäß« auf einen abgelegenen Teil der Insel verbannen und den jungen Vater dazu? Hier hört alle Vernunft auf, und das Einhorn tritt in seine Rechte. Das Einhorn wäre an sich keine üble Erscheinung. Denn wir wollen gerne glauben, wollen uns nur zu gerne bezaubern lassen gegen jede Vernunft. Aber glaubt der Dichter an dieses Einhorn, wenn er das arme Fabelwesen wörtlich mit einem Zitat aus dem »Nüchternen Herbert Spencer« motiviert. Ratlos und hilflos schwankt der Schöpfer dieser Gestalten zwischen Glauben und Schönheitsschilderung und einem ganz kraftlosen, altersmüden Spott, der um so betrübender dort wirkt, wo man die schärfste Lauge des Aristophanes herbeiwünscht. Was soll es, wenn bei der ersten Geburt eines neuen Bürgers auf der Insel sich eine Frau folgendermaßen ausläßt: »Und für sich könne sie es mit dem Einsatz ihres Lebens verbürgen, daß nämlich Babette (die junge Mutter) das reinste, makelloseste Geschöpf der Erde sei, über jeden Verdacht einer platten oder auch nur bewußten Buhlschaft hoch erhoben.« Dazu über jeder Seite des umfangreichen Buches ein, halb ernst, halb humoristisch gewähltes Schlagwort, wie es der gute Hartleben in seinen Novellen liebte, so über dieser Seite: »Das jungfräulichste Geschöpf«, über einer anderen: »Ein genialer Schimpanse?« oder »No, i kann a nix weiter sogn«, oder: »Halten Sie fest, ich bin nicht toll!«, oder »Sardanapal«, »Unter vier Augen«, »Kochtopf der Anachoreten« usw.
Hauptmann spitzt das nun außerordentlich verkünstelte Werk so zu, daß die verbannten Knaben mit Phaon sich gegen die Weiber auf dem andern Teil der Insel empören, gegen sie zu Felde ziehen und sie besiegen, wobei unter Brüdern und Schwestern neue Ehen geschlossen werden. Dem großen Problem, was der Mann Phaon erotisch für seine schönen Töchter empfindet, ist Hauptmann aus dem Weg gegangen, aber auch das hat er nicht folgerecht durchgeführt, er. berührt es immer wieder, löst es nie. Ungelöste Probleme sind vom Mythos weltenweit entfernt. Aus dem ungelösten, ja kaum von Hauptmann geistig erfaßten Problem der männerlosen Mutterschaft entwickelt sich in dem Buch alles eher als ein »Wunder«. Hier ist keine Spur von dem grandiosen Mythos der unbefleckten Empfängnis, des: den mystischen Marienkult und die Gotik geschaffen hat. Es bleibt bei Hauptmann nur ein schwacher, menschenfreundlich gutmütiger, geheimnisloser Witz. Am Ende des Romans sieht man Phaon mit seiner Tochter ratlos im Segelboot der Insel enteilen, nicht anders als im »Graf von Monte Christo« den Grafen mit seiner schönen Heydee.
Daß dem Dichter, dem unsere Verehrung treu bleibt, das Werk, an dem er seit vielen Jahren gearbeitet hat, bis zu einem solchen Maße von abseitiger, leerer, ja kindischer Darstellung mißlingen konnte, ist unbegreiflich, denn es stehen Schönheiten von besonderem Zauber in dem Buche, die ganze, nicht eigentlich tropische, sondern mehr südgriechische Atmosphäre, die unübertreffliche Beschreibung eines Wasserfalles oder der Terrassen am Meere mit den kochenden, kristallklaren Bädern. Schön sind auch einige eingestreute Gedichte. Das Gedankliche, das oft ganz unvermittelt ausgesponnen wird, ist, mitten in dem Wust von unmöglichen Tatsachen und seelenlosen Schemen, an vielen Stellen ganz herrlich klar und zwingend. Eine kosmische Vision zum Schluß kann nur ein Dichter geschrieben haben, und der Abschied Phaons von seinen Geschöpfen könnte eine unvergeßliche, ja unsterbliche Szene der Weltliteratur sein, wenn der Dichter sie wirklich gestaltet hätte.
Thomas Mann, der Zauberberg
Die deutsche Nation ist um ein episches Meisterwerk reicher. Thomas Mann legt uns in seinem Buche »Der Zauberberg« eine Arbeit vor, das Ergebnis langjähriger Mühe offenbar, das man, ohne der Majestät Goethes nahezutreten, mit dem »Wilhelm Meister« in einem Atem nennen kann. Es ist, wenngleich das Thema das gleiche ist wie in Goethes Roman, kein zweiter »Wilhelm Meister«, aber, gemessen an der herrlichsten, sichersten Darstellungskunst, an dem reichsten geistigen Gehalte, wird das Buch Thomas Manns seinen Wert nicht allzuweit hinter Goethe stets behalten; nicht nur durch das, was es ist, sondern auch dadurch, was es uns bedeutet. In seinem kleinen Vorwort spricht der Dichter von seinem Helden, den er einen einfachen, wenn auch ansprechenden jungen Menschen nennt, er charakterisiert die Linie der Darstellung so: »Die Geschichte ist sehr lange her, sie ist sozusagen schon ganz mit historischem Edelrost überzogen und unbedingt in der Zeitform der tiefsten Vergangenheit vorzutragen«. Hier unterschätzt sich der Dichter. Sein »Zauberberg« ist und wirkt lebendiger als sonst ein literarisches Erzeugnis der letzten zehn Jahre, der »Zauberberg« ist aktuell im stärksten Maße, und damit wird ein Teil des Interesses, ja der Lesewut erklärt, die den Leser durch die zwei außerordentlich umfangreichen Bände dieses Buches treibt. Auch wenn, in Diskussionen .freilich mehr als in Erlebnissen, sich fast alle Probleme von 1914 bis 1923 in dem Werke aufrollen, Christentum, Heidentum, Judentum, Fleisch oder Geist, Rom oder Voltaire, Schauen oder Leben, Spiritismus und Nihilismus, Sozialismus oder Jesuitentum (in der feinsten Abstraktion), und vor allem Relativitätsproblem und Zeitbegriff, Schmerz, Leiden und Sterben, auch wenn diese in klarster Form vorgetragenen, ganz erleuchtet erfaßten Geisteskämpfe fehlten, auch dann würde das Buch zum Spiegel seiner Zeit und seines Volkes, fast wie Goethes »Wilhelm Meister«. Denn es ist der chaotische Bürger, um den es geht. Im wahrsten Sinne des Wortes geht es um ihn. Alles bewegt ihn, aber nichts bringt ihn aus der Ruhe. Er erlebt alles, und nichts ist ihm bestimmt: Und wenn der Mensch dieses Buches, Hans Castorp, zum Schlusse gewandelt ist, wissen wir nicht, ist er gesünder geworden oder nur schmerzgewohnter, ist er weiser geworden oder bloß älter. Ein junger Mann kommt auf den Zauberberg, die große Heilungs- und Sterbestätte der Lungenkranken, er hält sich für gesund, sein Besuch gilt einem lieben Vetter und Freund, der das militärische Element, das aristokratische vertritt, wie er, Hans Castorp das zivile, demokratische, edelbürgerliche.
Aber der Held erweist sich dem Zauberberg nicht gewachsen oder vielmehr nur zu sehr gewachsen, er ist krank wie alle anderen Gäste des Bergsanatoriums, er findet den Weg nicht zurück. Oder er findet den Weg nur in den Untergang, in den Weltkrieg, der flüchtig visionär den Abschluß des Buches, aber nicht den Abschluß der Lebensexistenz bildet. Hans Castorp kehrt, wenn er nach mühseliger, sieben Jahre langer Kurbehandlung sich in den Schützengraben widerstandslos stürzt, nur in sein eigentliches Element, in das chaotische zurück. Denn diese Seele, von außen gesehen, simpel, banal, alltäglich, hat es in sich. Sie bietet sich allem dar, was ist, und da die Summa summae unserer Zeit Chaos ist, da die Epoche eben zu groß für unsere Persönlichkeit ist, da die naturwissenschaftlichen Ergebnisse in ihrer stumpfen Prägnanz kein ebenso starkes, scharfes, klares philosophisches Gegengewicht gefunden haben, schwankt unser Held in allen erdenklichen Abenteuern des Geistes, des Fleisches, des Krankseins, des Gesundheitsrausches, des Bewußtseins und der Verdunkelung, bis ihn der allgemeine Abgrund des Namenlosen (darf man sagen, die Pflicht gegen das eigene Volk?) aufnimmt und ihm ein ehrenvolles Begräbnis sichert. Dieser chaotische Grundcharakter scheint hier schärfer erfaßt als in Goethes Werk, wo er sich, fast gegen den Willen des Schöpfers, erst in den späteren Partien durcharbeitet. Mit großer Sicherheit hat Mann die Gegenpole erfaßt. Das Fleisch, die Anatomie, das rein Tatsächliche aller dieser sterbenden, leidenden Menschen, und er ist dabei, trotz seiner Urbanität, vor nichts zurückgeschreckt. Man findet Bilder des Lebens in diesem Buch, so strotzend, voller Kraft und Lust am Glanz, leicht beflügelt, zart blumenhaft wie die Russin Clawdia Chauchat, ein vollendetes Kunstwerk im Kunstwerk. Man findet die starke Persönlichkeit, halb Maske, halb zitterndes Fleisch, den Weltfürsten Peeperkorn, mit unerhört sicherm Strich angesetzt, leider nicht ebenso vollendet, Ebenbild des herrlichen, nie wieder erreichten Luckner in Wedekinds »Schloß Wetterstein«; den Mann, der an seiner Kraft erstickt und an seiner Gesundheit sich verblutet. Man findet so erschütternde, kleine Bilder des animalen Sterbens, wie das einer kleinen Dame, die sich vor dem Priester mit dem tröstenden Viatikum unter die Decken verkriecht und markerschütternd, unvergeßbar nach Leben schreit. Man findet Landschaften, zauberhaft erfühlt, nur mit Stifters Landschaften, mit seinen Hochgebirgen, Schneewehen, Bergwiesen vergleichbar. Hier ist alles persönlich, einmalig, namenhaft und nie wiederkehrend. Wie sich der Frack mit dem Totenhemd, wie sich das Elegante mit dem Schicksalmäßigen vermählt, wie die gut gekleidete, gut genährte, wenn auch von Tuberkelbazillen infizierte Existenz kosmisch wird, sich den Sternen angesellt, das ist so herrlich, so unnachahmbar gestaltet, daß es unvergeßbar wird; ich weiß es.
Zwei große, unmenschliche, übermenschliche Szenen, der Dialog des Helden mit der Russin (diese Szene hat Mann aus Zart- und Schamgefühl französisch geschrieben) und die Unterredung des Helden mit dem Indienfahrer Peeperkorn, diese Zusammenkunft müder Jugend mit einer allzu frischen, behenden, überlebendigen Greisenhaftigkeit, das sind Bewegungen zwischen Menschen, wie sie nur ein Genie der Erzählung zu gestalten vermag.
Es wäre nicht gerecht, zu sagen, daß sich das ganze, riesige Werk auf dieser Höhe hält. Von allen Problemen und Geistesabenteuern, die in dem Rahmen des Buches sich finden (mehr, als daß sie sich finden, kann man nicht sagen), ist bloß das Problem der Zeit organisch, notwendig, überzeugend, ja zwingend aus der Seele des Werkes hervorgewachsen. Zeit ist für einen Genesenden, für einen Sterbenden das wichtigste Problem; und da wir alle andern, mögen wir auch nicht auf dem Zauberberg weilen, in diese zwei Kategorien der Sterbenden und Genesenden eingereiht zu werden uns gefallen lassen müssen, ist das »Zeitliche« in dem Zauberberg gerade das Ewige. Alle anderen Probleme, die der Dichter mit Hilfe zweier Nebenfiguren, des romanischen Heiden Settembrini und des jüdischen Christen Naphta entwickeln läßt, sind; wohl für die Zeit charakteristisch, für den Helden indirekt auch, denn er schlittert in diese Probleme hinein und aus ihnen heraus, man weiß nicht wie, und er kann von Glück reden, daß er heil aus ihnen sich rettet. Aber nun macht es Mühe. Es beweist sehr viel für die absolute Erzählungskraft Manns, für das Tolstoische, um nicht zu sagen, Homerische an ihm, daß er sich diese Schwergewichte aufladen kann, ohne zusammenzubrechen. In der Hand eines geringeren Meisters wäre der »Zauberberg« Torso geblieben. Diese Abweichungen sind nicht zufällig, sondern gewollt, Thomas Mann sagt selbst darüber: »Schon Jahre, soviel ist sicher, sind wir hier oben, uns schwindelt, das ist ein Lastertraum ohne Opium und Haschisch – und doch stellen wir der schlimmen Umnebelung absichtlich viel Verstandeshelligkeit und logische Schärfe gegenüber. Nicht zufällig, das möge anerkannt werden, haben wir uns Köpfe wie die Herren Naphta und Settembrini zum Umgang erwählt ...« Nein, nicht Umgang! Nicht um den Menschen herum möge sich das gedankliche Gewirre und die Entwirrung der Seele begeben, sondern in ihm selbst. Aber wie kann es Handlung, Verhandlung, Entscheidung geben, bei chaotischen, fessellosen, grenzenlosen Naturen, schon darum fessellos, weil sie dem tätigen Leben des großen Goethe längst entsagt haben und, halb mit Willen, halb durch das sterbliche Teil bezwungen, mit einem Fuße (ihrer Seele?) im Grabe stehen. Bei Tuberkelbazillen im Sputum gibt es keine geistigen Entscheidungen, diese Menschen sind nicht mehr mögliche Subjekte der Welterfassung, sondern nur bestenfalls Objekte.
Hier liegt also nicht das Schwergewicht. Es muß auch gar nicht hier liegen. Hat ein hoher Meister eine Figur geschildert, wie sie ist, dann hat er, unausgesprochen auch gesagt, was sie bedeutet. Bei einer Figur ist dies Thomas Mann auch ohne trüben Rest gelungen, bei dem preußischen Vetter, Joachim Ziemssen, der in seinem keuschen und doch weit überspannten Leben und Streben, in seinem kühnen Wollen und Versagen, nicht sich allein als singulare Erscheinung darstellt, sondern seine ganze Klasse, ja sogar sein Volk. Seine letzten Tage, Stunden und Augenblicke sind so meisterhaft, so herrlich unvergeßbar, so männlich rührend und im tiefsten erschütternd geschildert, daß man es als Sakrileg empfindet – ich wenigstens –, wenn bei einer spiritistischen Seance ebendieser große, keusche Held, zu einem trügerischen, abenteuerlichen, aufregenden Schein und Schauerdasein wiedererweckt wird.
Giacomo Casanova, Erinnerungen
Casanova, dessen Geburtstag sich jetzt zum zweihundertsten Male jährt, gehört nicht zu den säkularen Menschen. Sein Leben enthält zwar unzählige Züge von säkularem Charakter, es gibt Beispiele für jede menschliche Verirrung, für manche menschliche Klarheit, für menschliche Trübe und menschliche Lebensfreude, für übermenschlichen Lebensglanz – aber beispielhaft ist es nicht. Er ist ein ewiger Verführer. Macht ihn das mit Don Juan verwandt? Nein, – denn Don Juan und Casanova sind entgegengesetzt gerichtete Seelenfiguren, und was Don Juan, zum unaussprechbaren Problem wird, wird Casanova zur fabelhaft erzählten Selbstverständlichkeit. Er ist gebildet, hat interessante Züge, ist dem guten Leben in keiner Weise abhold. Vor allem nährt er sich gewohnheitsmäßig von der Unschuld junger Mädchen, wird alt dabei, genießt sein Leben bis zum nie schal werdenden Rest und weiß zum Schluß nur, was er erlebt hat, hat aber im Grunde nicht erlebt, was er weiß. Denn wie wäre das möglich?
Schon der erste Band seiner Lebenserinnerungen, die jetzt der Verlag Ernst Rowohlt in einer herrlichen Ausgabe neu herausgibt, enthält des Gelebten unendlich viel, aber es ist so, wie wenn ein Schneider eine Naht herunternäht, es geht alles seinen Gang, aber nichts hat ein Ende. Alles ist Tatsache, nichts ist Wahrheit. Das ist sein Glück, sein Stern. Alle Welt findet ihn bezaubernd, geheimnisvoll. Wohlwollend sieht man ihn als Spieler, Hasardeur, Abenteurer, man freut sich am Gewinner und Genießer großen Stils.
Aber das Endresultat ist nur ein gewöhnlicher, wenn auch mit seinen Schwächen ungemein reizvoller Mensch. Man könnte bitter werden, wenn man bedenkt, daß ein Mozart für seinen »Don Giovanni« nicht soviel Dukaten bekommt als ein Casanova in einer halben Stunde am Pharaotisch verspielt, gewinnt und wieder verspielt, um endlich doch mit goldgefüllten, schwer am seidenen, blaugestickten Galakleide herabhängenden, metallklirrenden Taschen fortzugehen – aber eine solche Betrachtungsweise lenkt von dem eigentlichen Problem Casanova ab. Und ein Problem ist es. Gerade deshalb, weil der Kern der Persönlichkeit so zweideutig ist. Gerade, weil die Auflösung des Rätsels Casanova so leicht scheint.
Erinnert man sich dessen, daß dieser Mann nach unzählbaren Abenteuern, die er in seiner zehnbändigen Lebensgeschichte auf 5000 Seiten erzählt, nach mannigfachen Fehlschlägen, nach galanten Krankheiten, nach vielen Kümmernissen, gelehrten Bestrebungen, Hochstapeleien, Spielerleidenschaften, Kreditoperationen, Reisen und tausenderlei Begegnungen mit Menschen (selten mit sich) im zweiundsiebenzigsten Lebensjahre noch die Kraft hatte, in seiner Verbannung in dem Schlosse zu Dux seine Memoiren zu schreiben und alles Frühere so lebenstrotzend heraufzubeschwören, daß diese zehn Bände zu den nie verschwindenden Dokumenten ihrer Zeit und ihres Schöpfers gehören, daß sie jetzt immer noch spannen, belustigen und Anteil erwecken – dann kann man nur das Wunder einer Vitalität bewundern, die über das gewöhnliche Menschenmaß weit hinausgeht, und dagegen gehalten, bedeuten die tausend »gepflückten Mädchenblüten« in ihrer etwas schwammig gewordenen Sinnlichkeit fast nichts.
Lebensfreude ist eine heute selten gewordene Sache, mag sie sich auch manchmal so sehr irdisch, fleischhaft, bis zum Gemeinen genießerfreudig zeigen wie hier, eine Freude ist es doch, und Freude strahlt auch jetzt aus den Büchern des Casanova aus. Fragen der Moral oder gar der Ethik kommen für uns weniger in Betracht als für Casanova selbst, der, wie alle Wüstlinge, nie frei war von moralischen Bedenken. An einer Stelle der Einleitung sagt er: »Lachend wirst du (Leser!) sehen, wie oft ich mir, wenn es nötig war, kein Gewissen gemacht habe, Wirrköpfe, Schurken, Narren zu überlisten. Wenn man es mit Frauen zu tun hat, so steht List gegen List, und das zählt nicht. Denn wenn Liebe mitspielt, sind beide Teile betrogen.« Was an dieser Äußerung eigenartig ist, ist die allgemeine Entwertung von Grundsätzen, die ein mittelmäßiger Geist gern vornimmt, solange sie zu seinem Vorteil stattfinden kann. Dieser Hang zur Skepsis ist auch für unsere klägliche Zeit sehr charakteristisch. So läppisch sich heute dieser Skeptizismus gebärdet, des Erfolges kann er immer sicher sein, er ist der Trost aller Mittelmäßigen. Glaube erfordert Kraft. Unglaube verlangt Mut. Die »Heilige Johanna« verlangt nichts. Sieht man also diesen vernünftelnden, »billigen« Geist als den von 1925 an, kann es kein zeitgemäßeres Buch geben als Casanova. Das zitierte Wort ist nicht zufällig. An einer anderen Stelle wiederholt und begründet er es tiefer: »Der Mensch ist frei, doch nur, solange er an seine Freiheit glaubt. Je mehr Macht er dem Schicksal einräumt, um so mehr beraubt er sich selbst der Macht, die Gott ihm mit der Vernunft verliehen hat. Die Vernunft ist ein Stück von der Göttlichkeit des Schöpfers. Bedienen wir uns ihrer, um demütig und gerecht zu sein, so machen wir uns ihm, der sie uns geschenkt hat, wohlgefällig. Gott hört nur für die auf Gott zu sein, die sein Nichtssein für möglich halten. Und diese Vorstellung muß für sie die größte Strafe sein.«
Äußerungen dieser Art gehören notwendig zu den »gepflückten Mädchenblüten«, zu den goldgefüllten Taschen und zu den okkultistischen Studien, den Verwandlungsversuchen von Quecksilber zu Gold, zu den magischen Pyramiden und kabbalistischen Zahlenmanövern. Aber sie geben nur die Ausstrahlungen dieser unpersönlichen Persönlichkeit. Sie führen nur indirekt in Casanovas Inneres. Der Gegensatz, der in den Worten »unpersönliche Persönlichkeit« liegt, ist nicht ein bloßes Wortspiel. Die innere Ausgeglichenheit, der gleichmäßig feststehende Barometerstand der Seele ist etwas, das Casanova besitzt, was ihn erfolgreich macht; er ist etwas, was Don Juan fehlt und was ihn scheitern läßt. Don Juan lebt intensiv, und wenn er zugrunde geht, ist es deshalb, weil keine irdische Erscheinung eine wirklich intensive Liebe erträgt. Der wirklich intensiv Liebende muß lächerlich werden wie Don Quichotte oder sich entmannen wie Abaelard oder Tote zu Gaste laden wie Don Juan. Dies alles sind verschiedene Wege, zum gleichen Endziel führend, aber alle aus dem Glauben, aus einer wahrhaften Quelle entspringend. Nie wird es einem Casanova einfallen, einen toten Komtur, den Vater einer seiner »Mädchenblüten«, zu Gaste zu laden. Er wirft nicht einmal einen Schatten auf die Lebenden, geschweige denn auf die Toten. Er betört sie nur, die Mädchen, Frauen, Spieler, Betrogenen und Betrüger, aber er verführt sie nicht. Sie verfolgen ihn nicht, tragikomisch wie den Don Juan, der nie die Ruhe zu neuen Abenteuern hat, weil das nicht zu Ende gelebte immer wieder auftaucht und seine Rechte verlangt. Die »gepflückten Mädchenblüten« lassen Casanova ohne viel Kummer gehen, und da wird Casanovas sinnlose Vernunft eins mit der sinnlosen Vernunft des gewöhnlichen Weltgeschehens. Das schnoddrige Wort »Ab dafür« wäre der eigentliche Sinnspruch dieses Mannes.
Seine außerordentlich reichen Erinnerungen bieten Stoff für unzählige Romane und Dramen, sind aber an sich weder romanhaft (mit Ausnahme der herrlich erzählten Episode der Nonne M.M. in den Kasinos von Murano und Venedig), und ebensowenig sind sie dramatisch, mit Ausnahme der unbeschreiblich prächtigen Flucht aus den Bleikammern. In beiden Fällen kommt das Entscheidende, das nicht Wiederkehrende, von außen. Wenn es bloß nach Casanova ginge, würden Nanette und Marton, seine zwei ersten »Opfer auf dem süßen Altare der Venus«, sich wie Kaninchen vermehren. Unschuldiger Menschen gibt es zwar wenige, aber unberührter viel. Die Nonne M.M. aber ist eine wahrhaft erlebte Frauengestalt mit männlichen, mit weiblichen Zügen, ein sonderbarer, gebrochener und doch herrlich lebender und blühender Charakter – und weil sie blüht, welkt sie auch und vergeht. Sie ergreift als Mensch, als Charakter, als Schicksal, als einmaliges, nicht wiederkehrendes – aber auch nicht als entscheidendes. Denn diesen Allerweltsbruder Casanova entscheidet nichts – weder der Untergang eines Menschen noch der Untergang einer Welt. (Er sah das achtzehnte Jahrhundert zugrunde gehen – unbekümmert, ungerührt, gesund und lustig, klug und verbohrt, und eine Schüssel gut gekochter Makkaroni war sein »Lebensziel« im Schlosse von Dux.)
Was die Ausgabe anbetrifft, von der der größere Teil schon vorliegt und bei der eine neue französische Fassung als Unterlage gedient zu haben scheint, ist sie durchaus zu loben. Das Buch ist von Hessel und Ježower mustergültig übersetzt; klar, beschwingt, immer kraftvoll, nie grob. Der unzerstörbare Hauch der Jugend, den dies im höchsten Greisenalter verfaßte Werk im Original besitzt, bricht in jeder Zeile durch. Wenn an der prachtvoll schlicht gedruckten Ausgabe überhaupt etwas auszusetzen ist, so schien mir ein Bild des Casanova sehr zu fehlen, gerade, weil die Persönlichkeit als solche nicht selbständig zeugen kann (im Gegensatz zu Rousseaus »Bekenntnissen«, bei denen jede Bildbeigabe nur stören kann). Daher wäre es sehr zu begrüßen, wenn späteren Auflagen Bilder dieses merkwürdigen, wenn auch nicht beispielhaften Mannes und der vielen Stätten seines Währens und Wirkens beigefügt würden.
Franz Kafka, Der Prozeß
Der erste der nachgelassenen Romane des Franz Kafka, »Der Prozeß«, ist eben im Verlage »Die Schmiede« erschienen. Schon bei Lebzeiten des Dichters wob sich um dieses Werk ein geheimnisvoller Schleier, und man muß zugeben, es ist kein alltäglicher Fall, wenn ein bedeutender, anerkannter, ja als großer Meister gerühmter Dichter eines seiner bedeutendsten Werke – als das kann man den »Prozeß« jedenfalls betrachten – durch Jahre verborgen hält und wenn er von der Absicht, sein Werk selbst zu zerstören, nur durch milde Gewalt abgebracht werden kann. Wir kennen zwar Ähnliches. Gogol hat den zweiten Teil seiner »Toten Seelen« vernichtet, Werke von Kleist fanden dasselbe Schicksal. Hier begegnet das gleiche uns wieder. Max Brod, einer der wenigen Menschen, die Kafka in seinem Leben wahrhaft nahegestanden haben, hat das Buch dem Dichter im Jahre 1920 fortgenommen und es so, in einer zwar unvollständigen, aber doch das Bild des Ganzen in großen Zügen entwerfenden Fassung gerettet.