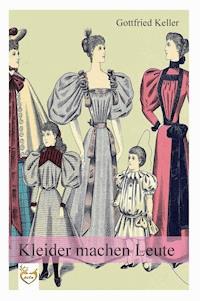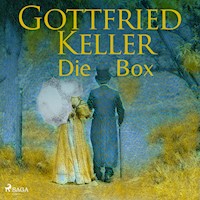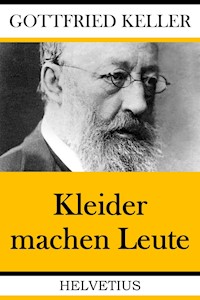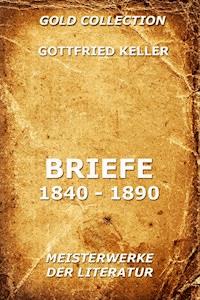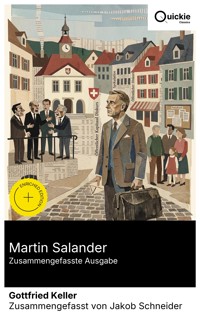Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Gottfried Kellers 'Gesammelte Gedichte' ist eine bemerkenswerte Sammlung von über 350 Gedichten, die die Vielfalt und Tiefe seines schriftstellerischen Talents demonstriert. In diesem Werk unterstreicht Keller sein Können in verschiedenen literarischen Stilen von lyrischer Poesie bis hin zu epischen Versen. Die Gedichte behandeln Themen wie Natur, Liebe, Gesellschaft und persönliche Reflexionen, die Leser aller Art ansprechen. Kellers sprachliche Eleganz und künstlerische Sensibilität verleihen seinen Gedichten eine zeitlose Qualität, die auch heute noch fasziniert. Als einer der bedeutendsten Schweizer Schriftsteller des 19. Jahrhunderts bleibt Kellers Werk bis heute ein wichtiger Bestandteil der deutschsprachigen Literaturgeschichte. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine umfassende Einführung skizziert die verbindenden Merkmale, Themen oder stilistischen Entwicklungen dieser ausgewählten Werke. - Ein Abschnitt zum historischen Kontext verortet die Werke in ihrer Epoche – soziale Strömungen, kulturelle Trends und Schlüsselerlebnisse, die ihrer Entstehung zugrunde liegen. - Eine knappe Synopsis (Auswahl) gibt einen zugänglichen Überblick über die enthaltenen Texte und hilft dabei, Handlungsverläufe und Hauptideen zu erfassen, ohne wichtige Wendepunkte zu verraten. - Eine vereinheitlichende Analyse untersucht wiederkehrende Motive und charakteristische Stilmittel in der Sammlung, verbindet die Erzählungen miteinander und beleuchtet zugleich die individuellen Stärken der einzelnen Werke. - Reflexionsfragen regen zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der übergreifenden Botschaft des Autors an und laden dazu ein, Bezüge zwischen den verschiedenen Texten herzustellen sowie sie in einen modernen Kontext zu setzen. - Abschließend fassen unsere handverlesenen unvergesslichen Zitate zentrale Aussagen und Wendepunkte zusammen und verdeutlichen so die Kernthemen der gesamten Sammlung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gesammelte Gedichte (Über 350 Titel in einem Buch)
Books
Inhaltsverzeichnis
Sonette
An einen Schulgenossen
Wohin hat dich dein guter Stern gezogen, O Schulgenoß aus ersten Knabenjahren? Wie weit sind auseinander wir gefahren In unsren Schifflein auf des Lebens Wogen!
Wenn wir die Untersten der Klasse waren, Wie haben wir treuherzig uns betrogen Und schwärmerisch, erfindrisch uns belogen Von Aventüren, Liebschaft und Gefahren!«
Da seh ich just, beim Schimmer der Laterne, Wie mir gebückt, zerlumpt, ein Vagabund Mit einem Häscher scheu vorübergeht. –
So also wendeten sich unsre Sterne? Und so hat es gewuchert, unser Pfund? Du bist ein Spitzbub worden – ich Poet!
An einen Freund
Du, der so lang im Herzen mich geborgen Mit allen meinen grämlichen Gebrechen, Mit meinen hastig immer neuen Schwächen, Mit allen meinen wunderlichen Sorgen;
Die Hand verzeihend botest jeden Morgen, Wenn ich die Nacht vorher mit blindem Stechen, Mit ungerechtem, vorwurfsvollem Sprechen Dir schnitt ins Herz, so treu und unverborgen:
Nicht um zu spähn nach Tadel oder Lobe, Will ich dir diese Lieder übersenden, Die zagend unter meiner Hand verblassen!
Nein, nur zur letzten, schweren Freundesprobe: Ich muß mich gegen deinen Glauben wenden – Wirst du mich darum endlich doch verlassen?
An einen zweiten (Künstler)
Ich sehe dich mit lässig sichrer Hand Den feinen Nacken einer Göttin schreiben, Dazu den Hohn um deine Lippen treiben: »’s ist nichts dahinter!« oder: »eitler Tand!«
Seh dich zuhinterst an der Schenke Wand Bis Mitternacht bei den Gesellen bleiben; Dein Schwarzaug sucht dem Witz die breiten Scheiben, Jedoch dein schöner Mund des Bechers Rand.
Du schlenderst heim, ein leichtes Liedlein pfeifend, Drückst in die Kissen deine dunkeln Locken, Indes der Traum dir einen Schwank erzählt.
Zeigt er dir mich, in wachen Träumen schweifend, Enthusiastisch bei den Büchern hocken? – Hast du am End den bessern Teil erwählt?
Winterabend
Schneebleich lag eine Leiche, und es trank Daneben ein Geselle unverdrossen, Bis endlich ihm der Himmel aufgeschlossen Und er berauscht zu ihr aufs Lager sank.
Von rotem Wein den Becher voll und blank Bot er dem Toten; bald war übergossen Das Grabgesicht und purpurn überflossen Das Leichenhemd; so trieb er tollen Schwank.
Die trunkne rote Sonne übergießt Im Sinken dieses schneeverhüllte Land, Daß Rosenschein von allen Hügeln fließt.
Von Purpur trieft der Erde Grabgewand: Doch die verblaßte Leichenlippe schließt Sich kalt und starr des Sonnenbechers Rand.
Was ist es an der Zeit?
1
Im Mittagsglast, auf des Gebirges Grat, Schlief unter alten Fichten müd ich ein; Ich schlief und träumte bis zum Abendschein Von leerem Hoffen und verlorner Tat.
Schlaftrunken und verwirrt erwacht ich spat. Gerötet war des Urbergs hart Gebein, Gerötet seiner Lenden Busch und Stein, Der Himmel war wie eine blut’ge Saat!
Mir aber schien der Tag nun aufzugehn; Ich hielt die Glut für lichtes Morgenrot Und harrte auf der Sonne Auferstehn.
Doch Berg um Berg versank in Schlaf und Tod, Die Nacht stieg auf mit graulich stillem Wehn, Und mir im Herzen war es kalt und tot!
2
So werd ich manchmal irre an der Stunde, An Tag und Jahr, ach, an der ganzen Zeit! Sie gärt, sie tost, doch mitten auf dem Grunde Ist es so still, so kalt und zugeschneit!
Habt ihr euch auf ein neues Jahr gefreut, Die Zukunft preisend mit beredtem Munde? Es rollt heran und schleudert weit, o weit! Zurück euch, ihr versinkt im alten Schlunde!
O hätt den Hammer ich des starken Thor, Auf das Jahrhundert einen Schlag zu führen, Ich schlüg sein morsches Zeigerblatt zu Trümmern!
Tritt denn kein Uhrenmacher kühn hervor, Die irre Zeit mit Macht zu regulieren? Soll sie denn ganz in Staub und Rost verkümmern?
In der Stadt
1
Wo sich drei Gassen kreuzen, krumm und enge, Drei Züge wallen plötzlich sich entgegen Und schlingen sich, gehemmt auf ihren Wegen, Zu einem Knäul und lärmenden Gedränge:
Die Wachtparad’ mit gellen Trommelschlägen, Ein Hochzeitzug mit Geigen und Gepränge, Ein Leichenzug klagt seine Grabgesänge – Das alles stockt, kein Glied kann sich mehr regen.
Verstummt sind Geiger, Pfaff und Trommelschläger, Der dicke Hauptmann flucht, daß niemand weiche, Gelächter schallet aus dem Hochzeitzug.
Doch oben auf den Schultern schwarzer Träger Starrt in der Mitte kalt und still die Leiche Mit blinden Augen in den Wolkenflug.
2
Was ist das für ein Schrein und Peitschenknallen? Die Fenster zittern von der Hufen Klang; Zwölf Rosse keuchen an dem straffen Strang, Und Fuhrmannsflüche durch die Gasse schallen.
Der auf den freien Bergen ist gefallen, Dem toten Waldeskönig gilt der Drang; Da schleppen sie, wohl dreißig Ellen lang, Die Rieseneiche durch die dumpfen Hallen.
Der Zug hält unter meinem Fenster an, Denn es gebricht zum Wenden ihm an Raum; Verwundert drängt der Pöbel sich heran
Und weidet sich an der gebrochnen Kraft; Da liegt entkrönt der stille, tote Baum, Aus seinen Wunden fließt der frische Saft.
Die schweizerische Nationalität
Die Sprache ist das teure Jugendland, Darin die Völker wachsen und gedeihen, Das Mutterhaus, wonach sie sehnend schreien, Wenn sie verschüttet sind auf fremdem Sand!
Sie ist ein glänzend, stahlgeschmiedet Band, Wovon Tyrannenheere nicht befreien, Dem sich die tiefsten, reinsten Kräfte weihen, Die eine Nation je in sich fand!
Nur eines, eines ist noch mächtiger: Das ist die Freiheit, der polit’sche Glaube, Hier springt zum Teil die harte Völkerkette!
Hier trennen sich die Ströme kreuz und quer: Versiegend schwindet der im alten Staube, Und jener bricht sich kühn ein neues Bette!
Wie ist denn wohl der Diamant entstanden Zu seiner unvergänglich festgeschloßnen Einheit, Zu seiner ungetrübten, strahlenhellen Reinheit, Verknüpft von so viel unsichtbaren Banden?
Wenn aus der Völker Schwellen und Versanden Ein Neues sich zu einem Ganzen einreiht, Lieb und Bedürfnis es zum Volke einweiht, Wo Gleichgesinnte eine Heimat fanden:
Wer will denn da noch rütteln gar und feilen? Zu spät! zu spät! schon ist’s ein Diamant, Der nicht mehr ist zu trüben und zu teilen!
Und wenn, wie man im Edelstein erkannt, Darin noch kleine, fremde Körper weilen, So sind sie fest umgossen und gebannt.
Warnung
Ja, du bist frei, mein Volk, von Eisenketten Und von des Vorrechts unerhörter Schande, Kein Adel schmiedet dich in schnöde Bande, Und fröhlich magst du dir im Wohlstand betten.
Doch dies kann nicht dich vor der Knechtschaft retten, Der schwarzen, die im weißen Schafsgewande An allen Türen horcht im weiten Lande, Wie Unkraut sich an jedes Herz will kletten.
Wenn du nicht kühnlich magst den Geist entbinden Von allem Wust und tötender Umhüllung, Nicht sorglich deiner eignen Einsicht pflegen:
Wird stets dein Feind die Tore offen finden, All deiner Hoffnung raubend die Erfüllung, Dein schön begonnen Werk in Asche legen.
Den Konservativen
»Ist wohl ein Volk, so frei von allen Plagen – Die andrer Nationen Erbteil sind – Ein blühender, glückselig Heldenkind Als unser Schweizervölklein zu erfragen?
Und doch so fiebrisch seine Pulse schlagen! Für seiner Freiheit reichen Segen blind, Hascht übermütig es nach eitlem Wind; Wann enden seine undankbaren Klagen?«
So sprechen, die mit tückischem Verlangen Im Trümmerschutt der alten Babel schleichen, Gehüllt in der Vernichtung Leichentuch!
Wir aber sprechen: »Ja, ihr falschen Schlangen, Nur euch, nur euch gilt es noch zu erreichen, Und aufgehoben ist der letzte Fluch!«
Epilog
»Das ist ein Schreier und ein dummer Prahler, Ein müder Drescher auf gedroschnen Halmen, Ein Räuchlein mehr in der Empörung Qualmen, Ein Vielversprecher, jedoch schlechter Zahler!«
Gemach, gemach, Philistertroß, du kahler! Nicht bei dir such noch find ich meine Palmen; Säng ich gleich David auch die hehrsten Psalmen, Sie würden durch dein Lob um soviel schaler!
Ich geb es zu, ich habe arg geschrieen, Als trübes Echo von geweihtern Tönen, Und nur die gute Sache mag mich tragen!
Doch ist’s mein Herzblut, das ich ausgespieen, Der Schlachtschrei, der beim Angriff muß erdröhnen, Und auf ihn folgt ein scharfes stilles Schlagen!
Ihr nennt uns Träumer, Schwindler, junge Toren, Wenn ehrlich wir nach Licht und Wahrheit streben: Ja, euren Namen habt ihr uns gegeben; So merket auf mit hochgehobnen Ohren!
Wir haben uns bescheidentlich erkoren, Dem Volk zu lichten nur dies ird’sche Leben:Ihr laßt verhungernd es gen Himmel schweben! Wer sind die Schwindler nun? – Ihr, alte Toren!
Und wenn die Sterne uns geheim erzählen Von ew’gem Frühling, von Unsterblichkeit: Was geht das euch denn an in unsrer Zeit?
Wir lassen uns das Sonnenlicht nicht stehlen Noch unsre Lampe, die die Nacht erhellt: Denn uns gehört die ganze, schöne Welt!
Die Tellenschüsse
Ob sie geschehn? das ist hier nicht zu fragen; Die Zierde jeder Fabel ist der Sinn. Das Mark der Wahrheit ruht hier frisch darin, Der reife Kern von allen Völkersagen.
Es war der erste Schuß ein Alleswagen, Kind, Leib und Gut, an köstlichen Gewinn: Blick her, Tyrann! Was ich nur hab und bin, Will ich zum Kampf mit dir entgegentragen.
Und du kommst leer und heillos, wie du bist, Und lässest fühllos dir am Herzen rütteln, Und spiegelst höhnisch dich in meinem Blut?
Und immer: Nein!? – Verlaufen ist die Frist. Verflucht sei seines Hauptes ewig Schütteln! O zweiter, heil’ger Schuß, nun triff mir gut!
Goethe
»Nur Anmut! Ordnung!« tönt es immerdar! Wer spricht von Ordnung, wo die Berge wanken? Wer spricht von Anmut, während die Gedanken Noch schutzlos irren mit zerrauftem Haar?
Noch kämpfen wir, durchringend Jahr um Jahr! Noch tut uns not ein scharf und unschön Zanken, Und durch des Zeitenwaldes wirre Ranken Glänzt noch der Zukunft Au nicht gar zu klar!
Und Goethe ist ein Kleinod, das im Kriege Man scheu begräbt im untersten Gewölbe, Es bergend vor der rohen Feindeshand.
Doch wenn der Feind verjagt, nach heißem Siege Holt man mit Jubelsang herauf dasselbe Und läßt es strahlen von des Altars Rand.
Brentano, Kerner
»Was sind das für possierliche Gesellen In blut’gen Laken und mit Räucherpfannen? Ob sie nach Schätzen graben? Geister bannen? Sie lassen sonderbare Töne gellen!
Und sahst du diesem rotes Blut entquellen, Indes dem andren stille Tränen rannen? Sie huschen leis, gespensterhaft von dannen Auf dieser Zeiten grundempörten Wellen.
Auch scheinen sie ein hölzern Schwert zu tragen Und um die Stirn ein üppiges Geflecht, Wo zwischen Stroh die feinsten Rosen ragen?«
Sie ziehen gen die Sonne ins Gefecht – ’s sind Dichter, Freund! So laß sie ungeschlagen, Denn Dichter, weißt du, haben immer recht!
Herwegh
Schäum brausend auf! – Wir haben lang gedürstet, Du Goldpokal, nach einem jungen Wein! Da traf mit dir ein guter Jahrgang ein! Wir haben baß getrunken und gebürstet!
Noch ist das Land vom Schergenzaun umhürstet, Noch ist es nur ein schmucker Totenschrein, Der schweigend harrt auf seinen Osterschein. Zum Wecker bist vor allen du gefürstet!
Doch wenn nach Wettergraun die Sonne lacht Und der Dämonen dunkle Schar bezwungen, Zurückgescheucht in ihres Ursprungs Nacht:
Dann wird dein Lied, das jetzt so stark geklungen, Erst recht erblühn in holder Frühlingspracht. Nur durch den Winter wird der Lenz errungen!
Subjektives Dichten
Erst wollte ich mit vieler Mühe flechten ’ne lange Schnur von schläfrigen Terzinen, Mit breitem Klatsch die Kläffer zu bedienen, Die mit dem Ich in diesen Liedern rechten.
Der Teufel aber möge das verfechten, Was solchen Langgeöhrten krumm erschienen! Und feige wär’s, nach jedes Narren Mienen Zu drehen sich und gar das Lied zu knechten.
Ein wunderlicher Kauz ist der Poet, Der das, was alle andern bloß empfinden, Mit wunderlichen Worten sagen kann.
Wenn’s unter seinem Namen besser geht, Wie möget ihr ein Ärgernis da finden, Ihr nüchternes Geschlecht: er, sie, es, man?
Der deutsche Freiheitskrieg
Das deutsche Volk mit seinem Löwenzorn, Wie es Vernichtung schwur dem schlimmen Franken, Hochschwanger ging mit kühnlichen Gedanken, Begeistert aus der Freiheit Feuerborn,
Und wie es drauf mit scharfem Schrot und Korn Den Feind zurückjug über seine Schranken, In großer Heldeneintracht, ohne Wanken Im Herzen stecken ließ den alten Dorn
Und dann im Jubel tät den Bund beeidigen: Es mahnet mich an jenen närr’schen Tropf – Das Gleichnis soll mitnichten euch beleidigen –,
Der, als die Laus ihn biß in seinem Schopf, Sich gegen solche Plage zu verteidigen, Mit Ingrimm kratzte an des Nachbars Kopf.
Auch an die »Ichel«
1
»Ich mach die Seelen selig, ich allein!« Spricht Rom; lang hielt ich diesen Jammerspruch Für das Erbärmlichste, was je ins Buch Der Sünde schrieb das Erdenelend ein.
Da kommet ihr, euch würdig anzureihn, Und sagt: »Ein Ende macht das Leichentuch! Der Jenseitsglaube ist ein dürrer Fluch, Hier laßt uns Hütten baun, hier ist gut sein!«
Auch ich glaub wandellos: Hier ist gut wohnen! Auf! laßt uns sehn, wie wir zurecht uns finden: Die Menschenseele ist zum Glück bestimmt!
Was aber ward aus all den Millionen, Die bleich und siech von hinnen mußten schwinden? – Wie unvernünftig euer Lichtlein glimmt!
2
Wer ohne Schmerz, der ist auch ohne Liebe, Wer ohne Leid, der ist auch ohne Treu, Und dem nur wird die Sonne wolkenfrei, Der aus dem Dunkel ringt mit heißem Triebe.
Bei euch ist nichts als lärmendes Geschiebe, In wildem Tummel trollt ihr euch herbei Und meßt das Erdreich ohne heil’ge Scheu, Als ob zu hoffen kein Kolumb mehr bliebe!
Euch ist der eigne Leichnam noch nicht klar, Ihr kennet kaum den Wurm zu euren Füßen, Die Blume nicht, die sproßt aus eurem Grab.
Doch hüpfet ihr und krönt mit Stroh das Haar, Gedankenlos als Götter euch zu grüßen; Der Zweifel fehlt – und das bricht euch den Stab!
3
Es ist nicht Selbstsucht und nicht Eitelkeit, Was sehnend mir das Herz grabüber trägt; Ich glaub, was mir die schöne Brücke schlägt, Ist wohl der Stolz, der mich vom Staub befreit.
Sie ist so kurz, die grüne Erdenzeit, Unendlich aber, was den Geist bewegt! ’s muß wenig sein, was ihr im Busen hegt, Da ihr hier gar so satt vergnüglich seid.
Und wenn auch einst die Freiheit ist errungen, Die Menschheit hoch wie eine Rose blüht, Auch nicht vom kleinsten Dorne mehr umschlungen:
So ist’s ein Funke nur, der ärmlich sprüht, Vom Feuer der Unsterblichkeit bezwungen, Das in des Kindes kleinem Herzen glüht.
4
Wenn ein Poet ein Stück vom ew’gen Leben Im Herzen trägt schon hier als Morgengabe, Wenn in Verklärung alle Dinge schweben, Die er berührt mit seinem Zauberstabe,
Und er den Blick nach dem, was überm Grabe, Unsterblichkeitgetränkt, nicht mag erheben: Oh, was er auch im Rausch gesungen habe –Euch soll es drum kein gültig Zeugnis geben.
Wenn, sonnend sich auf seinem Maienthron, Buntschillernd eine Schlange sich erhebt, So ist sie mit den Blumen Poesie:
Jedoch der Atheist von Profession, Der nur vom Atheismus-Knochen lebt, Ist eine eingefleischte Blasphemie.
Reformation
Im Bauch der Pyramide tief begraben, In einer Mumie schwarzer Totenhand War’s, daß man alte Weizenkörner fand, Die dort Jahrtausende geschlummert haben.
Und prüfend nahm man diese seltnen Gaben Und sät’ sie in lebendig Ackerland; Und sieh da, eine goldne Saat erstand, An der sich Herz und Auge konnten laben!
So blüht die Frucht dem späten Enkelkinde, Die mit den Ahnen schlief in Grabesschoß – Das Sterben ist ein endlos Auferstehn!
Wer hindert nun, daß wieder man entwinde Der Kirche Mumienhand, was sie verschloß: Das Wort des Lebens! wieder es zu sän?
Von Kindern
Ich sah jüngst einen Schwarm von schönen Knaben, Gekoppelt und gespannt, wie ein Zug Pferde; Sie wieherten und scharrten an der Erde Und taten sonst, was Pferde an sich haben.
Und mehr noch; was sonst diesen ist Beschwerde, Das schien die Buben köstlich zu erlaben; Denn lustig sah ich durch die Gasse traben Auf einen Peitschenknall die ganze Herde!
Das Leitseil war in eines Knirpses Händen, Der, klein und schwach, nicht sparte seine Hiebe Und launenhaft den Zug ließ gehn und wenden.
Mich kränkten minder diese Herrschertriebe Als solchen Knechtsinns zeitiges Vollenden; Es tat mir weh an meiner Kinderliebe.
Die Abendsonne lag am Bergeshang, Ich stieg hinan, und auf den goldnen Wegen Kam weinend mir ein zartes Kind entgegen, Das, mein nicht achtend, schreiend abwärts sprang.
Ums Haupt war duftig ihm ein Schein gelegen Von Abendgold, das durch die Löcklein drang. Ich sah ihm nach, bis ich den Gramgesang Des Kleinen nur noch hörte aus den Hägen.
Zuletzt verstummte er; denn freundlich Kosen Hört ich den Schreihals liebevoll empfangen; Dann tönt’ empor der Jubelruf des Losen.
Ich aber bin vollends hinaufgegangen, Wo oben bleichten just die letzten Rosen, Fern, wild und weh der Adler Rüfe klangen.
Man merkte, daß der Wein geraten war: Der alte Bettler wankte aus dem Tor, Die Wangen glühend wie ein Rosenflor, Mutwillig flatterte sein Silberhaar.
Und vor und hinter ihm die Kinderschar Umdrängte ihn, ein lauter Jubelchor; Draus ragte schwank der Selige empor, Sich vielfach spiegelnd in den Äuglein klar.
Am Morgen, als die Kinderlein noch schliefen, Von jungen Träumen drollig angelacht, Sah man den roten Wald von Silber triefen.
Es war ein Reif gefallen über Nacht; Der Alte lag erfroren in dem tiefen Gebüsch, vom Rausch im Himmel aufgewacht.
An Follen
Mit einem Bändchen Gedichte
Nimm diese Lieder, Lobgesang und Klagen, Wie sie die bunte Jahreszeit gebracht! Wie mir ihr Himmel wechselnd weint’ und lacht’, Hab ich die Lyra regellos geschlagen.
Im Sande knarrt der Freiheit goldner Wagen, Es ist ein müßig Schreien Tag und Nacht; Betäubt, verworren von der Zungenschlacht, Zeigt sich der Beste schwach in diesen Tagen.
Uns mangelt des Gefühles edle Feinheit, So Schwung und Schärfe gibt dem Schwert im Fechten, Das hohe Wollen und des Herzens Reinheit.
Klar sind sich nur die Schlimmen und die Schlechten; Sie suchen sich und scharen sich in Einheit, Entsagend dumpf der Ehre und dem Rechten!
Der Schein trügt
Ich weiß ein Haus, das ragt mit stolzen Zinnen, Frei spielt das Licht in allen seinen Sälen, Sein Giebel schimmert frei von allen Fehlen, Kein Neider schilt’s, nicht außen und nicht innen.
Nur wer es weiß mit Klugheit zu beginnen, In seinen tiefsten Keller sich zu stehlen, Sieht üppig feuchtes Unkraut dort verhehlen Von dicken Schlangen wahre Königinnen.
Doch würde der sich arg betrogen haben, Der rasch empor die Treppen wollte steigen, Die Neider mit der Kunde zu erlaben:
Denn tiefer noch, im allertiefsten Schweigen, Da liegt ein ungemeßner Schatz begraben, Der niemals wird dem Lichte wohl sich zeigen!
Das Leben ist doch schön!
Wie schön, wie schön ist dieses kurze Leben, Wenn es eröffnet alle seine Quellen! Die Tage gleichen klaren Silberwellen, Die sich mit Macht zu überholen streben.
Was gestern freudig mocht mein Herz erheben, Das muß ich lächelnd heute rückwärts stellen; Wenn die Erfahrungen, sich drängend, schwellen, Erlebnisse wie Blumen sie umgeben!
So muß ich breiter stets den Strom erschauen, Auch tiefer mählich seh den Grund ich winken, Und täglich lern ich mehr der Flut vertrauen.
Nun goldene Geschirre, sie zu trinken, Gebt, Götter! mir und Marmor, um zu bauen Den festen Damm zur Rechten wie zur Linken!
Erkenntnis
Willst du, o Herz! ein gutes Ziel erreichen, Mußt du in eigner Angel schwebend ruhn; Ein Tor versucht zu gehn in fremden Schuhn, Nur mit sich selbst kann sich der Mann vergleichen!
Ein Tor, der aus des Nachbars Kinderstreichen Sich Trost nimmt für das eigne schwache Tun, Der immer um sich späht und lauscht und nun Sich seinen Wert bestimmt nach falschen Zeichen!
Tu frei und offen, was du nicht willst lassen, Doch wandle streng auf selbstbeschränkten Wegen Und lerne früh nur deine Fehler hassen!
Und ruhig geh den anderen entgegen; Kannst du dein Ich nur fest zusammenfassen, Wird deine Kraft die fremde Kraft erregen.
Ein Wanderer
Geh auf, o Sonn! und öffne mir die weiten Kristallnen Tore dieser weiten Welt! Mein Sinn ist auf den goldnen Ruhm gestellt, Zu ihm sollst du mich unaufhaltsam leiten!
Nicht kann uns Hebe edlern Trank bereiten, Der lieblicher uns in die Seele quellt Und froher als der Ruhm die Adern schwellt Und sichrer hilft den Abgrund überschreiten!
Der Frauen Gunst vermag er zuzuwenden Und macht uns leicht dereinst das letzte Scheiden, Da wir zur Hälfte nur das Dasein enden.
Er läutert reiner als die Glut der Leiden: Wer wird, bekränzt, mit ungewaschnen Händen, Mit Lorbeer und mit Staub zugleich sich kleiden?
Seid mir gesegnet, meiner Heimat Gründe, Die in des Niederganges Röte strahlen! Glimmt mir die Liebe noch in diesen Talen, An der sich neu mein kaltes Herz entzünde?
Nun schließ ich mit dir ewig feste Bünde! Kann ich mit einem größern Ruhme prahlen, Der Nachwelt schöner alle Schulden zahlen, Als wenn ich deine Treue laut verkünde?
Du wandelst still auf sonnenhellen Wegen Mit eines Schirms nicht dürft’gem Schritt, du Reine! Nimm mit und führ mich Lässigen und Trägen!
Und meinen Kranz sollst im geheimsten Schreine Zu abgelegtem Schmuck und Bändern legen, Daß nimmer er vor Augen mir erscheine!
Seht da den Vogel mit gerupften Schwingen, Halb flattert er, halb hüpft er hin zum Neste, Sich einzubaun in eine Liebesfeste, Wohin kein rauhes Lüftchen mehr soll dringen!
Doch war er groß und mochte Ruhm erringen, Ihm grünt’ und blüht’ der Lorbeer auf das beste, In seinen Schatten lud er stolz die Gäste Und war so recht ein Thema zum Besingen.
Nur als den Zweig dem freien Feld er raubte, Aus Luft und Sonne, drin er aufgeschossen, Und sachte sich mit zu salvieren glaubte:
Da war der Traum bald wie ein Schaum zerflossen, Das Reis stand ab, das schon so grün belaubte – Da geht er heim nun schläfrig und verdrossen.
Nach dem Sonderbundskriege
Zu einem entworfenen, aber nicht ausgeführten Zyklus
In tiefer Scham erglühen meine Wangen, Da ich mit dieser Reime leerem Beten Vor mein lebendig-kräft’ges Volk will treten, Das eben kommt von Tat und Sieg gegangen!
Des Tambours Schlegel, die im Wirbel sprangen, Der rauhste Tagruf gellender Trompeten: Sie gelten jetzo mehr, o ihr Propheten! Als alles, was wir stolz und eitel sangen.
Der letzte schlichte Wächter vor dem Heere, Der, Glut und Kraft im Herzen, hat getragen In kalter Sternennacht die blanke Wehre,
Und jeder, der nur einen Streich geschlagen, Ist nun ein König von lebend’ger Ehre! – Was soll da unser Singen noch und Sagen?
[Aus dem Leben]
Ich habe so manchen Narren gekannt, Der wollte ewig leben; Es war ein gewaltig feuriges Und liederliches Bestreben.
Ich selber verlor darüber den Kopf Und wäre bald verdorben Und so mit meiner Unsterblichkeit Recht als ein Lump gestorben!
Vier Jugendfreunde
Du, der so lang im Herzen mich geborgen, Mit allen meinen grämlichen Gebrechen, Mit meinen hastig immer neuen Schwächen, Mit allen meinen wunderlichen Sorgen;
Die Hand vergessend botest jeden Morgen, Wenn ich die Nacht vorher mit blindem Stechen, Mit ungerechtem oder bittrem Sprechen Dir schnitt ins Herz, so treu und unverborgen;
Nicht um zu spähn nach Tadel oder Lobe, Will ich dir diese Lieder übersenden, Eh unsre Jugendtage ganz erblassen:
Nein, nur zur letzten schwersten Freundesprobe! Ich muß mich gegen deinen Glauben wenden – Wirst du mich darum endlich doch verlassen?
Ich sehe dich mit lässig sichrer Hand Die Schulterlinien einer Göttin schreiben, Dazu den Hohn um deine Lippen treiben: »’s ist nichts dahinter!« oder: »eitler Tand!«
Seh dich zuhinterst an der Schenke Wand Bis Mitternacht bei den Gesellen bleiben; Dein Schwarzaug sucht des Witzes breite Scheiben, Jedoch dein schöner Mund des Bechers Rand.
Du schlenderst heim, ein leichtes Liedchen pfeifend, Drückst in die Kissen deine dunklen Locken, Bald steigt im Traum dir neuer Schwank empor.
Zeigt er dir mich, in wachen Träumen schweifend, Begeistert über hundert Büchern hocken? Schon schwirrt dein Traumgelächter mir im Ohr!
Da liegt vor mir dein unglücksel’ger Brief, Und weder Rat noch Hilfe seh ich winken; Schwer ist das Aufstehn wohl nach solchem Sinken, Du aber, Freund, du sankest fast zu tief!
Der Lenz, der dich von Blum’ zu Blume rief, Erloschen ist jetzt seiner Sonne Blinken; Den du so sinnlos hastig mußtest trinken, Siehst du, was auf des Bechers Grunde schlief?
Ich aber steh in Ohnmacht, in der Ferne, Und fluch der Kraft, die dich von mir getrieben, Die nur zu wirren weiß und nie zu lösen.
Am Ende preis ich meine dürft’gen Sterne: Im Guten träge und zu blöd im Bösen, Bin ich ein stilles Kind im Land geblieben!
Ans Fenster schlägt ein unerschöpfter Regen, Her rauscht die Mitternacht auf feuchten Schwingen, Und mit dem Dunkel muß das Lämplein ringen – Wie bin ich müd, ich will zu Bett mich legen!
Was sinn ich noch zu meinem Abendsegen? – In meinem Ohre summt ein leises Klingen Und widerhallet ein verschollnes Singen: Mein denket einer auf entfernten Wegen.
Bist du’s, o Freund? Auch ich gedenke dein! Sei mir gegrüßt im unsichtbaren Raume Nach Jahren voll Vergessenheit und Leiden!
Bei unsrer Jugend bleichem Sternenschein Sehn wir uns flüchtig fragend an im Traume, Um wieder lang, auf immer wohl zu scheiden.
Ein früh Geschiedener
Er war geschaffen, durch das All zu schweifen Mit hellem Mute und gestählten Sinnen, Zu lauschen, wo des Lebens Quellen rinnen, Und forschend jeden Abgrund zu durchstreifen.
Hinaus, hinüber, wo die Palmen reifen, Zog es ihn mächtig jeden Lenz von hinnen; Von des Planeten höchsten Gletscherzinnen Gelüstet’s ihn, den Äther zu ergreifen.
Er blieb gefesselt an das tiefe Moor: Theologie, die Notdurft zu erwerben, Im Nacken hart der Armut scharfe Klauen.
Da öffnet ihm der Tod das Sonnentor, Der Jüngling säumte nicht, das Licht zu schauen Und jungfräulichen Geistes hier zu sterben.
Schein und Wirklichkeit
Im Mittagsglast, auf des Gebirges Grat Schlief unter alten Fichten müd ich ein; Ich schlief und träumte bis zum Abendschein Von leerem Hoffen und verlorner Tat.
Schlaftrunken und verwirrt erwacht ich spat: Gerötet war ringsum Gebüsch und Stein, Des Hochgebirges Eishaupt und Gebein, Der Horizont ein sprühend Feuerrad.
Und rascher fühlt ich meine Pulse gehen, Ich hielt die Glut für lichtes Morgenrot, Erharrend nun der Sonne Auferstehen.
Doch Berg um Berg versank in Schlaf und Tod, Die Nacht stieg auf mit frostig rauhem Wehen Und mit dem Mond des Herzens alte Not.
So manchmal werd ich irre an der Stunde, An Tag und Jahr, ach, an der ganzen Zeit; Es gärt und tost, doch mitten auf dem Grunde Ist es so still, so kalt, so zugeschneit!
Habt ihr euch auf ein neues Jahr gefreut, Die Zukunft preisend mit beredtem Munde? Es rollt heran und schleudert, o wie weit! Euch rückwärts. – Ihr versinkt im alten Schlunde.
Doch kann ich nie die Hoffnung ganz verlieren, Sind auch noch viele Nächte zu durchträumen, Zu schlafen, zu durchwachen, zu durchfrieren!
So wahr erzürnte Wasser müssen schäumen, Muß, ob der tiefsten Nacht, Tag triumphieren, Und sieh: schon bricht es rot aus Wolkensäumen!
In der Stadt
Wo sich drei Gassen kreuzen, krumm und enge, Drei Züge wallen plötzlich sich entgegen Und schlingen sich, gehemmt auf ihren Wegen, Zu einem Knäul und lärmendem Gedränge.
Die Wachtparad’ mit gellen Trommelschlägen, Ein Brautzug kommt mit Geigen und Gepränge, Ein Leichenzug klagt seine Grabgesänge: Das alles stockt, es kann kein Glied sich regen.
Verstummt sind Geiger, Pfaff und Trommelschläger; Der dicke Hauptmann flucht, daß niemand weiche, Gelächter schallet aus dem Freudenzug.
Doch oben, auf den Schultern schwarzer Träger Starrt in der Mitte kalt und still die Leiche Mit blinden Augen in den Wolkenflug.
Was ist das für ein Schrein und Peitschenknallen? Die Fenster zittern von der Hufe Klang, Zwölf Rosse keuchen an dem straffen Strang, Und Fuhrmannsflüche durch die Gasse schallen.
Der auf den freien Bergen ist gefallen, Dem toten Waldeskönig gilt der Drang; Da schleifen sie, wohl dreißig Ellen lang, Die Rieseneiche durch die dumpfen Hallen.
Der Zug hält unter meinem Fenster an, Denn es gebricht zum Wenden ihm an Raum; Verwundert drängt sich alles Volk heran.
Sie weiden sich an der gebrochnen Kraft; Da liegt entkrönt der tausendjähr’ge Baum, Aus allen Wunden quillt der edle Saft.
Reformation
Im Bauch der Pyramide tief begraben, In einer Mumie schwarzer Totenhand War’s, daß man alte Weizenkörner fand, Die dort Jahrtausende geschlummert haben.
Und prüfend nahm man diese seltnen Gaben Und warf sie in lebendig Ackerland, Und siehe da! die goldne Saat erstand, Des Volkes Herz und Auge zu erlaben!
So blüht die Frucht dem späten Nachweltskinde, Die mit den Ahnen schlief in Grabes Schoß; Das Sterben ist ein endlos Auferstehn.
Wer hindert nun, daß wieder man entwinde Der Kirche Mumienhand, was sie verschloß, Das Korn des Wortes, neu es auszusän?
Von Kindern
Man merkte, daß der Wein geraten war: Der alte Bettler wankte aus dem Tor, Die Wangen glühend wie ein Rosenflor, Mutwillig flatterte sein Silberhaar.
Und vor und hinter ihm die Kinderschar Umdrängt’ ihn, wie ein Klein-Bacchantenchor, Draus ragte schwank der Selige empor, Sich spiegelnd in den hundert Äuglein klar.
Am Morgen, als die Kinderlein noch schliefen, Von jungen Träumen drollig angelacht, Sah man den braunen Wald von Silber triefen.
Es war ein Reif gefallen über Nacht; Der Alte lag erfroren in dem tiefen Gebüsch, vom Rausch im Himmel aufgewacht.
Die Abendsonne lag am Bergeshang, Ich stieg hinan, und auf den goldnen Wegen Kam weinend mir ein zartes Kind entgegen, Das, mein nicht achtend, schreiend abwärts sprang.
Ums Haupt war duftig ihm ein Schein gelegen Von Abendgold, das durch die Löcklein drang. Ich sah ihm nach, bis ich den Gramgesang Des Kleinen nur noch hörte aus den Hägen.
Zuletzt verstummte er; denn freundlich Kosen Hört ich den Schreihals liebevoll empfangen; Dann tönt’ empor der Jubelruf des Losen.
Ich aber bin vollends hinaufgegangen, Wo oben bleichten just die letzten Rosen, Fern, wild und weh der Falken Stimmen klangen.
Ich sah jüngst einen Schwarm von frischen Knaben, Gekoppelt und gezäumt wie ein Zug Pferde; Sie wieherten und scharrten an der Erde Und taten sonst, was Pferde an sich haben.
Und mehr noch; was sonst diesen ist Beschwerde, Das schien die Buben köstlich zu erlaben; Denn lustig sah ich durch die Gasse traben Auf einen Peitschenknall die ganze Herde.
Das Leitseil war in eines Knirpses Händen, Der, klein und schwach, nicht sparte seine Hiebe Und launisch das Gespann ließ gehn und wenden.
Wenn nur dies frühe Sinnbild niedrer Triebe, Anstatt mit schlimmer Wirklichkeit zu enden, Einst mit den Kinderschuhn verloren bliebe!
Jeder Schein trügt
Ich weiß ein Haus, das ragt mit stolzen Zinnen, Frei spielt das Licht in allen seinen Sälen, Sein Giebel schimmert frei von allen Fehlen, Kein Neider schilt’s, nicht außen und nicht innen.
Nur wer es weiß mit Klugheit zu beginnen, In seine Grundgewölbe sich zu stehlen, Sieht üppig feuchten Moder dort verhehlen Von dicken Schlangen wahre Königinnen.
Doch würde der sich auch betrogen haben, Der rasch empor die Treppen wollte steigen, Die Feinde mit der Kunde zu erlaben:
Denn tiefer noch, im allertiefsten Schweigen, Da liegt ein ungehobner Schatz begraben, Der niemals wird dem Tage wohl sich zeigen.
Winterabend
Schneebleich lag eine Leiche, und es trank Bei ihr der Totenwächter unverdrossen, Bis endlich ihm der Himmel aufgeschlossen Und er berauscht zu ihr aufs Lager sank.
Von rotem Wein den Becher voll und blank Bot er dem Toten; bald war übergossen Das Grabgesicht und purpurn überflossen Das Leichenhemd; so trieb er tollen Schwank.
Die trunkne rote Sonne übergießt Im Sinken dieses schneeverhüllte Land, Daß Rosenschein von allen Hügeln fließt;
Von Purpur trieft der Erde Grabgewand, Doch die verblaßte Leichenlippe tut Erstarrt sich nimmer auf der roten Flut.
Nationalität
Volkstum und Sprache sind das Jugendland, Darin die Völker wachsen und gedeihen, Das Mutterhaus, nach dem sie sehnend schreien, Wenn sie verschlagen sind auf fremden Strand.
Doch manchmal werden sie zum Gängelband, Sogar zur Kette um den Hals der Freien; Dann treiben Längsterwachsne Spielereien, Genarrt von der Tyrannen schlauer Hand.
Hier trenne sich der lang vereinte Strom! Versiegend schwinde der im alten Staube, Der andre breche sich ein neues Bette!
Denn einen Pontifex nur faßt der Dom: Das ist die Freiheit, der polit’sche Glaube, Der löst und bindet jede Seelenkette!
Eidgenossenschaft
Wie ist denn einst der Diamant entstanden Zu unzerstörlich alldurchdrungner Einheit, Zu ungetrübter, strahlenheller Reinheit, Gefestiget von unsichtbaren Banden?
Wenn aus der Völker Schwellen und Versanden Ein Neues sich zu einem Ganzen einreiht, Wenn Freiheitslieb zum Volke dann es einweiht, Wo Gleichgesinnte ihre Heimat fanden:
Wer will da wohl noch rütteln dran und feilen? Zu spät, ihr Herrn! schon ist’s ein Diamant, Der nicht mehr ist zu trüben und zu teilen!
Und wenn, wie man im Edelstein erkannt, Darin noch kleine dunkle Körper weilen, So sind sie fest umschlossen und gebannt.
Alles oder nichts
Ja, du bist frei, mein Volk, von Eisenketten, Frei von der Hörigkeiten alter Schande; Kein Hochgeborner schmiedet dir die Bande, Und wie du liegen willst, darfst du dir betten!
Doch nicht kann dies dich vor der Herrschaft retten, Die ohne Grenzen schleicht von Land zu Lande; Ein grimmer Wolf im weichen Lammsgewande, Schafft sie zum Lehn sich all’ bewohnte Stätten.
Wenn du nicht völlig magst den Geist entbinden Von ihres Dunstes tödlicher Umhüllung, Nicht tapfer um der Seele Freiheit ringen:
So wird der Feind stets offne Tore finden, All deinem Werke rauben die Erfüllung Und jede Knechtschaft endlich wiederbringen!
Die Tellenschüsse
Ob sie geschehn? Das ist hier nicht zu fragen; Die Perle jeder Fabel ist der Sinn, Das Mark der Wahrheit ruht hier frisch darin, Der reife Kern von allen Völkersagen.
Es war der erste Schuß ein Alleswagen, Kind, Leib und Gut, an köstlichen Gewinn: »Blick her, Tyrann! was ich nur hab und bin, Will ich beim ersten in die Schanze schlagen!
Und du stehst leer und heillos, wie du bist, Und lässest fühllos dir am Herzen rütteln Und spiegelst lächelnd dich in meinem Blut?
Und immer: Nein? – Verlaufen ist die Frist! Verflucht sei deines Hauptes ewig Schütteln! O zweiter, heil’ger Schuß, nun triff mir gut!«
Auf die Motten
»Wo ist ein Volk, so frei von allen Plagen, Die andrer Völker traurig Erbteil sind, Ein glücklicher nutznießrisch Heldenkind Als unser Schweizervölklein zu erfragen?
Und doch, wie fiebernd seine Pulse schlagen! Für seiner Freiheit Überfülle blind, Hascht übermütig es nach leerem Wind! Wann enden seine undankbaren Klagen?«
So sprechen jene flink gelenken Motten, Die so gemütlich in dem Rauchwerk nisten, Dem warmen, köstlichen, und es zernagen.
»Nur eben euch gilt es noch auszurotten (So sprechen wir, die radikalen Christen), Mit lindem Klopfen aus dem Pelz zu jagen!«
Die Hehler
Ihr nennt uns Träumer, Schächer, blinde Toren, Wenn redlich wir die Möglichkeit erstreben! Ja, eure Namen habt ihr uns gegeben, So merket auf mit hochgehobnen Ohren!
Wir haben uns bescheidentlich erkoren, Zu lichten dieses dornenvolle Leben;Ihr laßt verschmachtend uns gen Himmel schweben, Wo ihr schon lang das Bürgerrecht verloren!
Und wenn die Sterne uns geheim erzählen Von neuem Leben und Unsterblichkeit, Was geht das euch denn an zu dieser Zeit?
Braucht ihr darum gestohlnes Öl zu hehlen, Das unsrer Tage Dämmerung erhellt, Indes den Fuß ihr setzt auf diese Welt?
Die Goethe-Pedanten
»Nur Ordnung, Anmut!« tönt es immerdar. Wer spricht von Ordnung, wo die Berge wanken? Wer spricht von Anmut, während die Gedanken Noch schutzlos irren mit zerrauftem Haar?
Noch kämpfen wir, durchringend Jahr um Jahr, Noch tut uns not ein scharf, ob unschön Zanken; Durch dieses Zeitenwaldes wirre Ranken Lacht eine Zukunftsau noch nicht uns klar.
Und Goethe ist ein Kleinod, das im Kriege Man still vergräbt im sichersten Gewölbe, Es bergend vor des rauhen Feindes Hand;
Doch ist der Feind verjagt, nach heißem Siege Holt man erinnrungsfroh hervor dasselbe Und läßt es friedlich leuchten durch das Land.
An A.A.L. Follen
Nimm diese Lieder, Lobgesang und Klagen, Wie sie die bunte Jahreszeit gebracht! Wie mir der Himmel wechselnd weint’ und lacht’, Hab ich die Lyra regellos geschlagen.
Im Sande knarrt der Freiheit goldner Wagen, Es ist ein müßig Schreien Tag und Nacht; Betäubt, verworren von der Zungenschlacht, Zeigt sich der Beste schwach in diesen Tagen.
Uns mangelt des Gefühles edle Feinheit, So Schwung und Schärfe leiht dem Schwert im Fechten, Das hohe Wollen und des Herzens Reinheit.
Klar sind sich nur die Schlimmen und die Schlechten, Sie suchen sich und scharen sich in Einheit, Entsagend dumpf der Ehre und dem Rechten!
Clemens Brentano, Kerner und Genossen
»Was sind das für possierliche Gesellen In weißen Laken und mit Räucherpfannen? Ob sie nach Schätzen graben? Geister bannen? Sie lassen sonderbare Töne gellen!
Sahst du dem einen rotes Blut entquellen, Indes dem andern große Tränen rannen? Sie huschen sacht, gespensterhaft von dannen Auf dieser Zeiten grundempörten Wellen.
Auch scheinen Schild’ und Schwerter sie zu tragen Von Holz und um die Stirn ein dürr Geflecht Von Reisig, draus die feinsten Rosen ragen?«
Sie ziehen gen die Sonne ins Gefecht; Poeten sind’s, so laß sie ungeschlagen! Denn solche, weißt du, haben immer recht.
Herwegh
Schäum brausend auf! – Wir haben lang gedürstet, Du Goldpokal, nach einem jungen Wein, Da traf in dir ein guter Jahrgang ein, Wir haben was getrunken, was gebürstet!
Noch immer ragt Zwing-Uri hoch gefirstet, Noch ist die Zeit ein stummer Totenschrein, Der Schläfer harrt auf seinen Osterschein – Zum Wecker bist vor vielen du gefürstet!
Doch wenn nach Sturm der Friedensbogen lacht, Wenn der Dämonen finstre Schar bezwungen, Zurückgescheucht in ihres Ursprungs Nacht:
Dann soll dein Lied, das uns nur Sturm gesungen, Erst voll erblühn in reicher Frühlingspracht: Nur durch den Winter wird der Lenz errungen!
Zur Verständigung
»Du bist ein Schreier, bist ein frecher Prahler, Ein Drescher mehr auf abgedroschnen Halmen, Ein Räuchlein mehr in der Empörung Qualmen, Ein Vielversprecher und ein Wenigzahler!«
Gemach, o du Philisterschwarm, du kahler! Bei dir nicht such und find ich meine Palmen; Säng ich, ein David, dir die hehrsten Psalmen, Sie deuchten durch dein Lob mir soviel schaler.
Ich geb es zu, ich habe laut geschrieen, Ein rauhes Echo von geweihtern Tönen, Und nur die gute Sache mag mich tragen!
Doch ist’s mein Herzblut, das ich ausgespieen, Der Schlachtschrei, der beim Angriff muß erdröhnen; Auf diesen folgt ein regelrechtes Schlagen!
Den Zweifellosen
Wer ohne Leid, der ist auch ohne Liebe, Wer ohne Reu, der ist auch ohne Treu, Und dem nur wird die Sonne wolkenfrei, Der aus dem Dunkel ringt mit heißem Triebe.
Bei euch ist nichts als lärmendes Geschiebe, In wildem Tummel trollt ihr euch herbei, Meßt aus und schließt den Zirkel sonder Scheu, Als ob zu hoffen kein Kolumb mehr bliebe!
Euch ist der eigne Leichnam noch nicht klar, Ihr kennet nicht den Wurm zu euren Füßen, Des Halmes Leben nicht auf eurem Grab;
Und dennoch kränzt ihr schon mit Stroh das Haar, Als Eintagsgötter stolz euch zu begrüßen – Der Zweifel fehlt, der alte Wanderstab.
Es ist nicht Selbstsucht und nicht Eitelkeit, Was sehnend mir das Herz grabüber trägt; Was mir die kühngeschwungne Brücke schlägt, Ist wohl der Stolz, der mich vom Staub befreit.
Sie ist so eng, die grüne Erdenzeit, Unendlich aber, was den Geist bewegt! Wie wenig ist’s, was ihr im Busen hegt, Da ihr so satt hier, so vergnüglich seid!
Und wenn auch einst die Freiheit ist errungen, Die Menschheit hoch wie eine Rose glüht, Ihr tiefster Kelch vom Sonnenlicht durchdrungen:
Das Sehnen bleibt, das uns hinüberzieht, Das Nachtigallenlied ist nicht verklungen, Bei dessen Ton die Knospen sind erblüht!
Dankbares Leben
Wie schön, wie schön ist dieses kurze Leben, Wenn es eröffnet alle seine Quellen! Die Tage gleichen klaren Silberwellen, Die sich mit Macht zu überholen streben.
Was gestern freudig mocht das Herz erheben, Wir müssen’s lächelnd heute rückwärts stellen; Wenn die Erfahrungen des Geistes schwellen, Erlebnisse gleich Blumen sie durchweben.
So mag man breiter stets den Strom erschauen, Auch tiefer mählich sehn den Grund wir winken Und lernen täglich mehr der Flut vertrauen.
Nun zierliche Geschirre, sie zu trinken, Leiht, Götter! uns, und Marmor, um zu bauen Den festen Damm zur Rechten und zur Linken!
Eitles Leben
Geh auf, o Sonn! und öffne mir die weiten Kristallnen Tore dieser weiten Welt! Mein Sinn ist auf den goldnen Ruhm gestellt, Zu ihm sollst du mich unaufhaltsam leiten!
Nicht kann uns Hebe reinern Trank bereiten, Der lieblicher uns in die Seele quellt Und froher als der Ruhm die Adern schwellt Und sichrer hilft den Abgrund überschreiten!
Der Frauen Gunst vermag er zuzuwenden Und macht uns leicht dereinst das letzte Scheiden, Da wir zur Hälfte nur das Dasein enden.
Mißtraue allem Außerordentlichen
Mißtraue allem Außerordentlichen Mißtraue allem Außerordentlichen, Denn ungesegnet lebt das Ungemeine, Sich selbst zur Qual und andern zur Verwirrung. Das Ungemeine ist das Ungelungne, Das nicht vermochte, groß genug zu denken, So einfach still zu sein wie die Natur, Und, sich für größer achtend, schlechter ward!
In eines Armen Gärtchen
In eines Armen Gärtchen, tief verborgen, Blüht einsam eine wunderschöne Rose, Sie schmückt mit Tau der klare Sommermorgen, Und schmeichelnd um sie her die Abendlüfte kosen.
Doch nichts bewegt ihr schuldlos heitres Leben; Sich unbewußt, in kindlich süßem Träumen, Schaut unverwandt mit ahnungsvollem Beben Die Zarte nach des Äthers fernen blauen Räumen.
Da naht es sich mit goldnen Liebesschwingen, Der Schmetterling wiegt sich im Glanz der Sonne; Er wird der Rose teure Grüße bringen, Sie wecken zu der Liebe Weh und Wonne.
Schon glühet sie von seinen heißen Küssen, Nicht weiß die Arme, wie ihr will geschehen, Sie siehet tausend Blütensterne sprießen Und rings um sich ein Zauberland entstehen.
Das zarte Herz, das lang verschlossen träumte, Erschließt sich jetzt in unbegrenztem Sehnen; Was unsichtbar im reichen Innern keimte, Eröffnet üppig sich mit Liebestränen.
Noch zittert sie, und schon ist er entschwunden, Der schöne Fremdling, dem sie sich ergeben. Er hat sie leider nimmermehr gefunden – Lang ist die Liebe, doch nur kurz das Leben.
Und stille wird die Rose nun verblühen, Die Blätter fallen schon, eins nach dem andern. So wird auch unser Jugendstern verglühen – Wir träumen nur, wir lieben und wir wandern.
In der alten braunen Stube
In der alten braunen Stube Sitzt ein Bursch in guter Rast Hinterm wohlgefüllten Kruge Als der Wirtschaft ältster Gast.
Voll gekritzelt und geschrieben Ist am Krug des Deckels Zinn, Daraufschaut mit starren Blicken, Träumend, der Geselle hin.
Dann und wann kommt auch ein Füchslein Mit der Mappe unterm Arm, Plaudert ihm von dem und jenem, Geht dann wieder sonder Harm.
Dann und wann kommt ein Philister, Mahnend an die alte Schuld, Doch der Bursche trinkt und lächelt Und der Mann geht mit Geduld.
So vom Morgen bis zum Abend Sitzt er da mit seinem Krug, Und schon sind es zwölf Semester, Die er so zu Grabe trug.
Unbekümmert, selbstvergessen Und verwahrlost starrt er hin, Bleiche Bilder hohler Freuden Fahren wirr ihm durch den Sinn.
Nur wenn er an Heimat denket Und ans gute Vaterhaus, Wird es ihm ein wenig bänglich, Trinkt dann rasch sein Krüglein aus.
Kommt ein Brieflein aus der Heimat; Doch er rühret es nicht an. »Lieschen, lies mir doch das Brieflein!« Und die Kellnerin fängt an:
»›Eure Braut ist Wartens müde, Hat sich einen Mann erwählt. Dies sei Euch mit Fleiß berichtet, Daß Ihr nicht mehr auf sie zählt!‹«
Kommt ein Brieflein von der Mutter; Doch er rühret es nicht an »Lieschen, lies mir doch das Brieflein!« Und die Kellnerin hebt an:
»›Euer Vater ist gestorben Und die Pension ist aus, Eure Mutter ist geborgen Und versorgt im Armenhaus!‹«
Kommt ein Brieflein vom Senate; Doch er rühret es nicht an. »Lieschen, lies mir doch das Brieflein!« Und sie kündiget ihm an:
»›Binnen vierundzwanzig Stunden Sollt verlassen Ihr die Stadt, Weil Ihr seid ein Taugenichtse, Der nichts mehr zu zahlen hat!‹«
Eine Nacht
Aus wilder Liebesträume wirrem Treiben War ich erschöpft, beklommen aufgewacht; Ausruhend mußt ich auf dem Lager bleiben,
Mich zu erholen von so banger Nacht. Und wie mir leichter ward, sandt ich mein Denken Zurücke in des Schlafes dunklen Schacht
Und suchte sinnend an das Licht zu lenken, Was die entbundne Seele so erschreckt, In Todesangst vermochte zu versenken.
Doch formlos, schattenhaft, was ich entdeckt, Und nur verworren ist es mir geblieben: Entschlafne Kinderjahre, aufgeweckt
Und weinend in des Traumes Sturm getrieben, Sah ich in scheuer Flucht vorüberfliehn. Ich sah sie alle, jene guten, lieben,
Verschollnen Tage, sah dahin sie ziehn Mit ihren kleinen Freuden, kleinen Sünden – Ach, warum mußtet ihr so schnell verglühn,
Ihr bleichen Sternlein, nimmer zu entzünden? – Mir schienen jene Jahre bang und leis Und kaum vernehmbar also zu verkünden:
»O weh dir, wehe! Deines Lebens Kreis, Er hat sein Mittel und sein Maß verloren! Du bist ein wurzellos, zerknicktes Reis,
Dem Wintersturm zum leichten Spiel erkoren! Der seines Lebens Grundstein nicht gelegt, Dir wäre besser, wenn du nie geboren!
Der seine Jugendzeit nicht zart gepflegt, Wirst nimmermehr die Zeit der Tat genießen! Wie kann dem Baum, der keine Blüten trägt,
Dereinst die segensvolle Frucht entsprießen? Und, dessen Quell verschüttet ist im Sand, Kann frisch der Strom durch die Gefilde fließen;
Die einst dein rauher Lenz zum Opfer fand, Wir sind die Blüten, deine Kinderjahre! Der klare Quell, versiegt am öden Strand,
Es ist die Jugend dein, die unfruchtbare! Was schaust uns nach betränten Angesichts? Stürzt schon von deines Herzens Hochaltare
Der Hoffnung Bild? In Staub und Kot zerbrichts! Drum reiß den welken Kranz aus deinen Locken Und folg uns nach ins leere graue Nichts!«
Das Blut in meinen Adern wollte stocken, Als ich die Lieben mir entfliehen sah; Und meine Augen, sonst so starr und trocken,
Sie füllten sich mit heißen Tränen da, Wie ich so hoffnungslos zum zweiten Male Verlieren sollt, die mir so deutlich nah!
Sie schienen in des Traumes Zauberstrahle Wie eine führerlose, wilde Kinderschar, Die, kaum entronnen aus des Lehrers Saale,
Ins Feld sich warf, der Zucht und Ordnung bar. Auf weiter Heide nun sie sich zerstreuten Und ich sah ihnen nach und ward gewahr,
Wie diese unfruchtbaren, heißbereuten, Die Kinderjahre mein, im wilden Sumpf – Der mochte meinen Lebenslauf bedeuten –
Versanken. Ein Gewimmer, fern und dumpf, Klang hilferufend noch zu mir herüber. Ich horchte schmerzzerrissen, starr und stumpf,
Gepackt von der Verzweiflung eisgem Fieber. Erbleichend fiel die Sonne nun hinab, Das Dämmergrau umfloß mich trüb und trüber;
Ein matter Stern vom Himmel schoß herab, Ein leis Gelächter überstrich die Heide, Ein Irrlicht tanzt’ auf meiner Jugend Grab –
Bewußtlos sank ich hin mit meinem Leide.
Und wieder deuchte mir, daß alt und krank, Gefurchter Stirn, gebeugt, mit grauem Haar, Der letzte auf der allerletzten Bank
Ich in der längst vergessnen Schule war. So saß ich da, ein abgelebter Greis Inmitten einer frischen Knabenschar;
Ein scheuer Fremdling in dem fremden Kreis, Den um mich her ein neu Geschlecht nun zog. Der alte Lehrer aber streng und weis,
Doch milden Sinns, der ernsten Lehre pflog. Ich horchte auf, gar sorglich, still und bang, Worum verfehltes Leben mich betrog,
Wornach ich später oft vergeblich rang, Zu lernen jetzt. O es war wohl zu spät! In meinem Ohr des Lehrers Wort verklang,
Wie wirkungslos ein Hauch vorüberweht! Und, was der Frühling rings ergriff mit Lust, War mir, dem Winter, auf das Eis gesät!
Wie sollten auch in meiner kalten Brust Die zarten Pflanzen wieder duftend blühn, Die mir erfroren längst schon unbewußt;
Vergeblich war und blieb mein angstvoll Mühn. Des Lehrers Nachsicht ging nun endlich aus, Auf mich begann sein Aug voll Zorn zu sprühn:
Was willst du Alter in der Jugend Haus, Verpestend meinen schönen Maienflor; Du grauer Junge, mache dich hinaus!
Hinaus mit dir, du unbrauchbarer Tor! Und, wie man einen bösen Geist verbannt, So stimmt’ er an der Jugend zarten Chor;
Ein altes Kirchenlied, mir wohlbekannt, Schlug seine frommen Töne an mein Herz! Da hab ich zitternd mich hinausgewandt
Und schlich gebückt mit meinem heißen Schmerz Davon; und zu entrinnen dem Gesang Strebt ich mit schwanken Schritten feldauswärts.
Doch wie ich auch ihm zu entfliehen rang, Die schwachen Füße widersetzten sich, In meinen Ohren stets das Lied noch klang,
Und jeder Ton traf wie ein blutger Stich Mein Innerstes. Denn einem Urteilsspruch Das friedenvolle, heilge Lied ja glich
Und einem lächelnden Verbannungsfluch Aus dieser Erde zu der Toten Ruh! Es deckten, wie ein blumig Leichentuch,
Die holden Kinderstimmen fest mich zu.