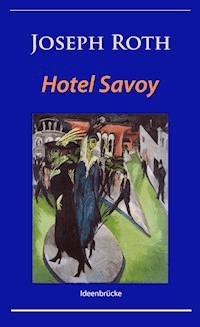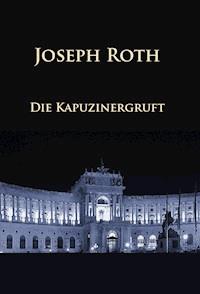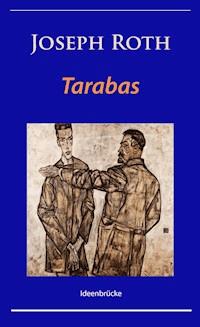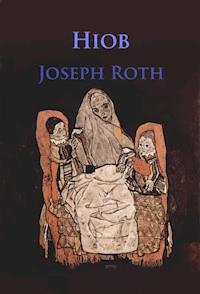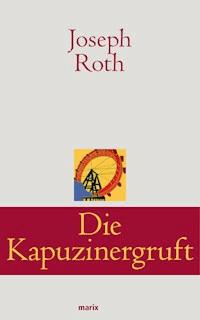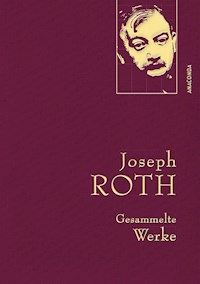Gesammelte Romane: Radetzkymarsch + Hiob + Die Kapuzinergruft + Hotel Savoy + Das Spinnennetz + Die Flucht ohne Ende + Beichte eines Mörders + Das falsche Gewicht + Die hundert Tage und viel mehr E-Book
Joseph Roth
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Joseph Roths "Gesammelte Romane" vereint einige seiner bedeutendsten Werke, darunter den berühmten "Radetzkymarsch" und "Hiob". In einer eindringlichen Prosa beschreibt Roth mit scharfsinniger Beobachtungsgabe die Dekadenz und den Niedergang der österreichisch-ungarischen Monarchie sowie die existenziellen Fragen des Lebens. Seine Werke sind geprägt von einem melancholischen, oft nostalgischen Ton, der die Komplexität menschlichen Schicksals und gesellschaftlicher Umwälzungen eindrucksvoll einfängt. Der literarische Kontext dieser Sammlung spiegelt Roths Engagement für die Themen Identität, Verlust und Hoffnung wider und verbindet die historischen Umbrüche seiner Zeit mit individuellen Schicksalen auf berührende Weise. Joseph Roth, geboren 1894 in der damaligen Habsburgermonarchie, war ein scharfer Gesellschaftsanalytiker und Chronist seiner Zeit. Er erlebte den Ersten Weltkrieg und die politischen Umwälzungen der Weimarer Republik, die seinen Blick auf das ungewisse Schicksal des Individuums prägten. Seine jüdische Herkunft und die Erfahrung des Exils verankern sich tief in seinem Schreiben, was sich in der emotionalen Tiefe und der kulturellen Analyse seiner Werke zeigt. Roths Schreibstil ist gleichzeitig poetisch und ergreifend, was ihm einen dauerhaften Platz in der Weltliteratur sichert. Diese Sammlung ist ein unverzichtbares Lebenswerk für jeden Leser, der sich für die Schnittstelle von Geschichte, Identität und Literatur interessiert. Roths Fähigkeit, das Menschliche im Politischen zu erfassen, macht seine Romane zeitlos und relevant. Empfehlenswert für Literaturbegeisterte, Geschichtsliebhaber und alle, die ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen der menschlichen Existenz suchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Gesammelte Romane: Radetzkymarsch + Hiob + Die Kapuzinergruft + Hotel Savoy + Das Spinnennetz + Die Flucht ohne Ende + Beichte eines Mörders + Das falsche Gewicht + Die hundert Tage und viel mehr
Inhaltsverzeichnis
Das Spinnennetz
I
Theodor wuchs im Hause seines Vaters heran, des Bahnzollrevisors und gewesenen Wachtmeisters Wilhelm Lohse. Der kleine Theodor war ein blonder, strebsamer und gesitteter Knabe. Er hatte die Bedeutung, die er später erhielt, sehnsüchtig erhofft, aber niemals an sie zu glauben gewagt. Man kann sagen: er übertraf die Erwartungen, die er niemals auf sich gesetzt hatte.
Der alte Lohse erlebte die Größe seines Sohnes nicht mehr. Dem Bahnzollrevisor war nur vergönnt gewesen, Theodor in der Uniform eines Reserveleutnants zu schauen. Mehr hatte sich der Alte niemals gewünscht. Er starb im vierten Jahre des großen Krieges, und den letzten Augenblick seines Lebens verherrlichte der Gedanke, daß hinter dem Sarge der Leutnant Theodor Lohse schreiten würde.
Ein Jahr später war Theodor nicht mehr Leutnant, sondern Hörer der Rechte und Hauslehrer beim Juwelier Efrussi. Im Hause des Juweliers bekam er jeden Tag weißen Kaffee mit Haut und eine Schinkensemmel und jeden Monat ein Honorar. Es waren die Grundlagen seiner materiellen Existenz. Denn bei der Technischen Nothilfe, zu deren Mitgliedern er zählte, gab es selten Arbeit, und die seltene war hart und mäßig bezahlt. Vom wirtschaftlichen Verband der Reserveoffiziere bezog Theodor einmal wöchentlich Hülsenfrüchte. Diese teilte er mit Mutter und Schwestern, in deren Hause er lebte, geduldet, nicht wohlgelitten, wenig beachtet und, wenn es dennoch geschah, mit Geringschätzung bedacht. Die Mutter kränkelte, die Schwestern gilbten, sie wurden alt und konnten es Theodor nicht verzeihen, daß er nicht seine Pflicht, als Leutnant und zweimal im Heeresbericht genannter Held zu fallen, erfüllt hatte. Ein toter Sohn wäre immer der Stolz der Familie geblieben. Ein abgerüsteter Leutnant und ein Opfer der Revolution war den Frauen lästig. Es lebte Theodor mit den Seinigen wie ein alter Großvater, den man geehrt hätte, wenn er tot gewesen wäre, den man geringschätzt, weil er am Leben bleibt.
Manches Ungemach hätte ihm erspart bleiben können, wenn zwischen ihm und seinem Hause nicht die wortlose Feindschaft wie eine Wand gestanden wäre. Er hätte den Schwestern sagen können, daß er sein Unglück nicht selbst verschuldete; daß er die Revolution verfluchte; daß er einen Haß gegen Sozialisten und Juden nährte; daß er jeden seiner Tage wie ein schmerzendes Joch über gebeugtem Nacken trug und in seiner Zeit sich eingeschlossen wähnte wie in einem sonnenlosen Kerker. Von außen her winkte keine Erlösung, und Flucht war unmöglich.
Aber er sagte nichts, immer war er schweigsam gewesen, immer hatte er die unsichtbare Hand vor seinen Lippen gefühlt, immer, als Knabe schon. Nur das auswendig Gelernte, dessen Klang schon fertig und ein dutzendmal lautlos geformt in seinen Ohren, seiner Kehle lag, konnte er sprechen. Er mußte lange lernen, ehe die spröden Worte nachgiebig wurden und sich seinem Gehirn einfügten. Erzählungen lernte er auswendig wie Gedichte, das Bild der gedruckten Sätze stand vor seinem Auge, als sähe er sie im Buch, darüber die Seitenzahl und am Rande die Nase, gekritzelt in müßigen Viertelstunden.
Jede Stunde hatte ein fremdes Gesicht. Alles überraschte ihn. Jedes Ereignis war schrecklich, nur weil es neu war, und verschwunden, ehe er es sich eingeprägt hatte. Aus Furchtsamkeit lernte er Sorgfalt, wurde fleißig, bereitete sich mit hartnäckiger Ruhelosigkeit vor, und wieder und wieder entdeckte er, daß die Vorbereitung noch zu mangelhaft gewesen. Aber er verzehnfachte seinen Eifer, brachte es bis zum zweiten Platz in der Schule. Primus war der Jude Glaser, der leicht und lächelnd, von Büchern und Sorgen unbeschwert, durch die Pausen strich, der in zwanzig Minuten den fehlerlosen lateinischen Aufsatz ablieferte und in dessen Kopfe Vokabeln, Formeln, Ausnahmen und unregelmäßige Verba zu wachsen schienen, ohne mühevoll gezüchtet zu werden.
Der kleine Efrussi war Glaser so ähnlich, daß Theodor Mühe hatte, vor dem Sohn des Juweliers Autorität zu bewahren. Theodor mußte eine leise, hartnäckig aufsteigende Zaghaftigkeit unterdrücken, ehe er seinen Schüler zurechtwies. Denn so sicher schrieb der junge Efrussi einen Fehler hin, so selbstbewußt sprach er ihn aus, daß Theodor am Lehrbuch zu zweifeln und seines Schülers Irrtum gelten zu lassen geneigt war. Und immer war es so schon gewesen. Immer hatte Theodor der fremden Macht geglaubt, jeder fremden, die ihm gegenüberstand. In der Armee nur war er glücklich. Was man ihm sagte, mußte er glauben, und die andern mußten es, wenn er selbst sprach. Theodor wäre gern sein Leben lang bei der Armee geblieben.
Anders war das Leben in Zivil, grausam, voller Tücke in unbekannten Winkeln. Gab man sich Mühe, sie hatte keine Richtung, Kräfte verschwendete man an Ungewisses, es war ein unaufhörliches Aufbauen von Kartenhäusern, die ein geheimnisvoller Windzug umblies. Kein Streben nutzte, kein Fleiß erlebte seine Belohnung. Kein Vorgesetzter war, dessen Launen man erkunden, dessen Wünsche man erraten konnte. Alle waren Vorgesetzte, alle Menschen in den Straßen, die Kollegen im Hörsaal, die Mütter sogar und die Schwestern auch.
Alle hatten es leicht, am leichtesten die Glasers und Efrussis: der wurde Primus, und der Juwelier, und jener Sohn des reichen Juweliers. Nur in der Armee waren sie nichts geworden, selten Sergeanten. Dort siegte Gerechtigkeit über Schwindel. Denn alles war Schwindel, Glasers Wissen unredlich erworben wie das Geld des Juweliers. Es ging nicht mit rechten Dingen zu, wenn der Soldat Grünbaum einen Urlaub erhielt und wenn Efrussi ein Geschäft machte. Erschwindelt war die Revolution, der Kaiser betrogen, der General genarrt, die Republik ein jüdisches Geschäft. Theodor sah das alles selbst, und die Meinung der anderen verstärkte seine Eindrücke. Kluge Köpfe, wie Wilhelm Tiedemann, Professor Koethe, der Dozent Bastelmann, der Physiker Lorranz, der Rassenforscher Mannheim, behaupteten und bewiesen die Schädlichkeit der jüdischen Rasse an den Vortragsabenden des Vereines deutscher Rechtshörer und in ihren Büchern, die in der Lesehalle der »Germania« ausgestellt waren.
Oft hatte der Vater Lohse seine Töchter vor dem Verkehr mit jungen Juden in der Tanzstunde gewarnt. Beispiele gibt es, Beispiele! Ihm selbst, dem Bahnzollrevisor Lohse, passierte es mindestens zweimal im Monat, daß ihn Juden aus Posen, welche die schlimmsten sind, zu bestechen versuchten. Im Kriege wurden sie enthoben, für den Kriegsdienst ungeeignet erklärt, saßen sie als Schreiber in den Lazaretten und in den Etappenkommandos.
Im juridischen Seminar meldeten sie sich immer wieder zu Wort und schufen neue Situationen, in denen Theodor sich heimatlos fühlte und zu neuerlichen, unangenehmen, eifervollen, hartnäckigen Arbeiten gedrängt.
Nun hatten sie die Armee vernichtet, nun beherrschten sie den Staat, sie erfanden den Sozialismus, die Vaterlandslosigkeit, die Liebe für den Feind. Es stand in den »Weisen von Zion« – das Buch bekamen alle Mitglieder des Reserveoffiziersverbandes zu den Hülsenfrüchten am Freitag –, daß sie die Weltherrschaft erstrebten. Sie hatten die Polizei in Händen und verfolgten die nationalen Organisationen. Und man mußte ihre Söhne unterrichten, von ihnen leben, schlecht leben – wie lebten sie selbst?
Oh, wie herrlich lebten sie! Durch ein graues, silbern schimmerndes Gitter von der gemeinen Straße getrennt war das Haus Efrussis und von grünem, weitem Rasen umgeben. Weiß schimmerte der Kies, noch heller die Treppe, die zur Tür führte, Bilder in Goldrahmen hingen im Vestibül, und ein Diener in grün-goldener Livree empfing und verneigte sich. Der Juwelier war hager und groß, immer schwarz gekleidet, in einer hohen, schwarzen Weste, deren Ausschnitt nur ein Stückchen schwarzer, mit einer haselnußgroßen Perle geschmückter Kragenbinde frei ließ.
Theodors Familie bewohnte drei Zimmer in Moabit, und das schönste enthielt zwei wackelige Schränke, als Prunkstück die Kredenz und als einzigen Schmuck jenen silbernen Aufsatz, den Theodor aus dem Schlosse von Amiens gerettet und auf dem Grunde des Koffers geborgen hatte, noch knapp vor der Ankunft des gestrengen Majors Krause, der solche Dinge nicht geschehen ließ.
Nein! Theodor lebte nicht in einer Villa hinter silbrig glänzendem Drahtgitter. Und kein Rang tröstete ihn über die Not seines Lebens. Er war ein Hauslehrer mit gescheiterten Hoffnungen, begrabenem Mut, aber ewig lebendigem quälendem Ehrgeiz. Frauen, mit einer süßen, lockenden Musik in den wiegenden Hüften, gingen an ihm vorbei, unerreichbar, und er war doch geschaffen, sie zu besitzen. Als Leutnant hätte er sie besessen, alle, auch die junge Frau Efrussi, die zweite Gattin des Juweliers.
Wie ferne war sie, aus jener großen Welt kam sie, in die Theodor beinahe schon gelangt wäre. Sie war eine Dame, jüdisch, aber eine Dame. In der Uniform eines Leutnants hätte er ihr entgegentreten müssen, nicht im Zivil des Hauslehrers. Er hatte einmal, in seiner Leutnantszeit, auf Urlaub in Berlin, ein Abenteuer mit einer Dame. Man konnte schon sagen: Dame; Gattin eines Zigarrenhändlers, der in Flandern stand; seine Photographie hing im Speisezimmer; violette Unterhöschen trug sie. Es waren die ersten violetten Unterhöschen in Theodors männlichem Dasein.
Was ahnte er jetzt von Damen! Sein waren die kleinen Mädchen für billiges Geld, die hastige Minute kalter Liebe im nächtlichen Dunkel des Hausflurs, in der Nische, umflattert von der Furcht vor dem zufällig heimkehrenden Nachbarn, die Lust, die in der Angst vor dem überraschenden Schritt erlosch, wie die Glut erkaltet, die roh in Flüssigkeit geschleuderte; sein war das barfüßige einfache Mädel aus dem Norden, das Weib mit den eckigen, harthäutigen Händen, deren Liebkosung rauh war, deren Berührung abkühlte, deren Wäsche schmutzig, deren Strümpfe durchschwitzt waren.
Nicht von seiner Welt war sie, die Frau Efrussi. Während er ihre Stimme hörte, fiel ihm ein, daß sie gut sein müsse. Niemand hatte ihm so viel Schönes so einfach und herzlich gesagt. Sie verstehn es vortrefflich, Herr Lohse! Gefällt es Ihnen hier? Fühlen Sie sich wohl bei uns? Oh, wie war sie gut, schön, jung. Theodor hätte sich so eine Schwester gewünscht.
Einmal erschrak er, als sie aus einem Laden trat. Als wäre es plötzlich in ihm hell geworden, erinnerte er sich in diesem Augenblick, daß er auf dem ganzen Wege ihrer gedacht hatte.
Es erschreckte ihn die Entdeckung, daß sie in ihm lebte, daß er wider Willen und ohne es zu wissen stehengeblieben war, daß er ihre Einladung annahm, mit ihr ins Auto zu steigen, und fast hätte er es vor ihr getan. Manchmal wurde er gegen sie geworfen, ihren Arm berührte er und bat schnell um Verzeihung. Ihre Frage überhörte er. Er mußte angestrengt achtgeben, um nicht wieder an sie zu stoßen. Dennoch ereignete es sich. Eifrig bereitete er sich auf den Moment des Aussteigens vor. Aber früher, als er gedacht hatte, hielt der Wagen, und nun war keine Zeit mehr auszusteigen, ihr hilfreich die Hand zu bieten. Er blieb sitzen und ließ sie warten, bis er unten stand, die Schachtel, die er gerade ergreifen wollte, hielt schon der Chauffeur. Aus einer sehr weiten Ferne traf ihr Abschiedswort sein Ohr, aber in unentrinnbarer Nähe lebte ihr Lächeln vor seinen Augen; als lächelte das Spiegelbild einer fern sprechenden Frau.
Niemals erreichte er sie, wie wollte er es? Glühend war sein Wunsch. Aber erloschen der Glaube an seine Kraft, zu erobern, da er nicht mehr Leutnant war. Er hätte es erst wieder werden müssen. Er wollte es werden, Leutnant werden oder sonst etwas. Nicht bleiben in der Verborgenheit und nicht mehr geborgen sein, nicht ein bescheidener Ziegelstein im Gefüge einer Mauer, nicht der Letzte der Kameraden, nicht ihr Lauscher und Lacher, wenn sie Anekdoten erzählten und Zoten rissen, nicht mehr einsam unter den vielen, allein mit seiner vergeblichen Sehnsucht, gehört zu werden, und mit der ewigen Enttäuschung des Überhörten, Geduldeten und wegen seiner dankbaren Aufmerksamkeit Beliebten. Oh, glaubten sie, er wäre harmlos und ungefährlich? Sie sollten sehen. Alle sollten es sehen! Bald wird er aus seinem ruhmlosen Winkel treten, ein Sieger, nicht mehr gefangen in der Zeit, nicht mehr unter das Joch seiner Tage gedrückt. Es schmetterten helle Fanfaren irgendwo am Horizont.
II
Manchmal überfiel ihn sein eigener Stolz wie eine fremde Gewalt, und er fürchtete seine Wünsche, die ihn gefangenhielten. Aber sooft er durch die Straßen ging, hörte er Millionen fremder Stimmen, flimmerten Millionen Buntheiten vor seinen Augen, die Schätze der Welt klangen und leuchteten. Musik wehte aus offenen Fenstern, süßer Duft von schreitenden Frauen, Stolz und Gewalt von sicheren Männern. Sooft er durch das Brandenburger Tor ging, träumte er den alten, verlorenen Traum vom siegreichen Einzug auf schneeweißem Roß, als berittener Hauptmann an der Spitze seiner Kompanie, von Tausenden Frauen beachtet, vielleicht von manchen geküßt, von Fahnen umflattert und Jubel umbraust. Diesen Traum hatte er in sich getragen und liebevoll genährt vom ersten Augenblick seines freiwilligen Eintritts in die Kaserne, durch die Entbehrungen und Lebensnöte des Krieges. Die schmerzende Beschimpfung des Wachtmeisters auf der Exerzierwiese hatte dieser Traum gelindert, den Hunger auf tagelangem Marsch, das brennende Weh in den Knien, den Arrest in dunkler Zelle, das betäubende, qualvolle Weiß der verschneiten Wachtpostennacht, den stechenden Frost in den Zehen.
Der Traum drängte zum Ausbruch wie eine Krankheit, die lange unsichtbar in Gelenken, Nerven, Muskeln lebt und alle Blutgefäße des Körpers erfüllt, der man nicht entrinnen kann, es sei denn, man entrinne sich selbst. Und zufolge jener unbekannten Gewalt, welche Theodor schon oft geholfen hatte und die ihn lehrte, daß der Erfüllung jeder qualvollen Sehnsucht im letzten Moment eine günstige äußere Bedingung auf halbem Wege entgegenkommt, ereignete es sich, daß er den Doktor Trebitsch im Hause Efrussis kennenlernte.
In der ersten Viertelstunde ihrer Bekanntschaft sprach der Doktor Trebitsch unermüdlich, und sein blonder, langer, in sanften, dunkelnden, an den Rändern gelichteten Strähnen herabfließender Bart bewegte sich vor den Augen Theodors in regelmäßigem Auf und Ab und störte die Aufmerksamkeit des Zuhörers. Leise plätscherten die Worte des Blondbärtigen, eines und das andere blieb eine Weile in Theodor haften und verwehte wieder. Noch nie war er einem Vollbart so nahe gewesen. Plötzlich stöberte ihn der Klang eines Namens aus seiner betäubten Zerstreutheit auf. Es war der Name des Prinzen Heinrich. Und mit dem Instinkt eines Mannes, der zufällig einem Prunkstück aus seiner verschütteten Vergangenheit begegnet und es mit rettend hastiger Gebärde an die Brust reißt, rief Theodor: »Ich war Leutnant im Regiment Seiner Hoheit, des Prinzen Heinrich!«
»Der Prinz wird sich sehr freuen«, sagte Doktor Trebitsch, und seine Stimme war nicht mehr fern, sondern ganz, ganz nahe.
Der Stolz füllte, wie etwas Körperliches, Theodors Brustkorb, und sein gestärktes Hemd wölbte sich.
Sie fuhren im Auto ins Kasino. Und Theodor saß im Wagen, nicht wie vor einer Woche, als er mit Frau Efrussi fuhr. Nicht mehr fühlte er, gedrückt und dünn, die Ecke zwischen Seitenwand und Rückenpolster. Er breitete sich aus. Sein Körper fühlte durch Paletot, Rock, Weste die sanfte, kühle Nachgiebigkeit des Leders. Die Füße lehnte er gegen den vorderen Sitz. Die Zigarre erfüllte das Coupé mit dem satten Duft einer überflüssigen Behaglichkeit. Theodor öffnete das Fenster und fühlte die schnelle, schießende kalte Märzluft mit der Wollust eines innerlich Durchwärmten.
Man trank Schnaps und Bier, und der Abend im Kasino erinnerte an eine Kaiser-Geburtstagsfeier. Graf Straubwitz von den Kürassieren hielt eine Rede. Man brach in ein dreifaches Hurra aus. Jemand erzählte Anekdoten aus dem Kriege. Theodor war Gast an der Seite des Prinzen. Nicht einen Moment verlor er Seine Hoheit aus den Augen. Er ignorierte seinen Nachbarn zur anderen Seite. Es galt, allezeit auf eine Frage des Prinzen vorbereitet und zur Stelle zu sein. Nicht für die Dauer eines Augenblicks vergaß Theodor, daß er jetzt endlich die Gelegenheit ergreifen konnte, Teile seines Traums zu verwirklichen. War er noch der kleine, unbekannte Hauslehrer eines jüdischen Knaben? Kannte ihn der Prinz nicht? Kannten ihn nicht alle Herren, die hier um den Tisch saßen? Und obwohl der ungewohnte Alkohol allmählich Theodors Sinn für die augenblicklichen kleinen Wirklichkeiten einschläferte, blieb doch eine große helle Heiterkeit zurück, und die Sicherheit kehrte ihm so oft wieder, als er sie brauchte, um dem Prinzen eine Serviette, ein Glas, Feuer für die Zigarette zu reichen.
Als ihn der Prinz aufforderte, von jener Schlacht bei Stojanowics zu erzählen, die das Regiment so löblich mitgemacht hatte, begann Theodor aufs Geratewohl, etwas lauter, als er gewöhnlich zu sprechen pflegte. Es ging eine Weile ganz gut, bis er bemerkte, daß er die Erzählung angefangen hatte, ohne sich den Schluß zurechtgelegt zu haben. Er hielt ein, und es erschütterte ihn die große, lauschende Stille. Er wußte noch, daß seine letzten Worte »Hauptmann von der Heidt« gewesen waren. »Dieser Hauptmann also«, fuhr Theodor fort, aber das Ende des Satzes fand er nicht mehr. »Er lebe hoch! Hurra!« fiel der Doktor Trebitsch ein, und man feierte den Hauptmann von der Heidt.
Dann stellte es sich heraus, daß Theodor und der Prinz denselben Weg nach Hause hatten, und sie saßen zusammen im Auto. Theodor redete unterwegs. Frau Efrussi fiel ihm ein, und er erzählte von ihr dem Prinzen. Ihre großen grünen Augen sah er. Ihre Schultern. Er streifte ihr die Kleider ab, sie stand vor ihm in der Unterwäsche. Sie trug violette Unterhöschen. Er erzählte alles dem Prinzen, was er sah, tat, erlebte. »Ich streife ihr das Hemd ab«, sagte Theodor, »Hoheit müssen wissen, sie hat braune Brustwarzen … ich beiße in ihre harte Brust!«
»Sie sind ein famoser Junge«, sagte der Prinz.
Er wiederholte diesen Satz auch später noch, als sie im Zimmer saßen und einen schwarzen Kaffee tranken und noch einen Likör. So nahe saßen sie beieinander, ihre Schenkel berührten sich, und der Prinz hielt Theodors Hand und drückte sie. Und auf einmal war Theodor nackt und der Prinz Heinrich ebenfalls. Der Prinz hat eine dichtbehaarte Brust und sehr dünne Beine. Seine Zehen sind ein bißchen verkrümmt. Theodor hat den Kopf gesenkt, und obwohl es ihm peinlich ist, muß er die Zehen betrachten. Er denkt, es wäre schon bei weitem besser, dem Prinzen ins Angesicht zu sehen. Das Angesicht, denkt er, ist der einzige bekleidete Körperteil des Prinzen. Der Prinz drückt aus einem Gummiballon einen kühlen, feinen Staubregen in die Luft.
Theodor sieht zum erstenmal seine ganze Nacktheit in einem großen Wandspiegel. Er kann feststellen, daß er eine weiße, rosa angehauchte Haut besitzt, rundlich geformte Beine, ein wenig gewölbte Brüste und leuchtende Brustwarzen wie zwei dunkelrote, winzige Kuppeln.
Theodor liegt auf dem warmen, weichen Eisbärfell, und neben ihm atmet schwer und laut der Prinz Heinrich. Der Prinz beißt in Theodors Fleisch. Die Bartreste des Prinzen kratzen, seine gekräuselten Brust-und Beinhaare kitzeln Theodor.
Er erwachte in einem halbdunklen Zimmer, und sein erster Blick traf ein großes Ölporträt des Prinzen an der Wand. In einer erschreckenden Wachheit sah er alle Ereignisse der vergangenen Nacht. Er kämpfte gegen sie vergeblich. Er versuchte, sie auszulöschen. Sie waren überhaupt nie gewesen. Er begann, an allerlei entfernte Dinge zu denken. Er konjugierte ein griechisches Verbum. Aber seine letzten Erlebnisse überfielen ihn, eine Schar zudringlicher Fliegen. Er stieg langsam die Stiege hinunter und nahm den Gruß eines alten ehrfürchtigen Dieners entgegen. Schon meldete das helle Geklingel der Straßenbahn die Nähe der Welt.
Oh, die Nähe dieser reichen Welt, deren Millionen Schätze klangen und flimmerten. Die Straße erlebte er, den Gang der Frauen, Musik in den wiegenden Hüften, die stolze Gewißheit sicher schreitender Männer und seine eigene kleine Dürftigkeit in der Mitte.
Geringer, als er je gewesen, verließ er das Haus. Immer schon war es so gewesen, daß er zurückweichen mußte, getroffen, wenn er sich erhaben gewähnt, verlassen und auf Wegen, die hinunterführten, sooft er Höhen entgegengestrebt war. Er wollte nicht zurück, er wollte hier bleiben. Und er blieb vor dem alten ehrfürchtigen Diener stehen und fragte nach dem Prinzen.
Prinz Heinrich hielt die Füße in der gefüllten Schüssel unter dem Tisch, während er Frühstück aß. »Gu’n Morjen, Theo!« sagte der Prinz und ließ Theodor stehen.
Ganz nahe an den Tisch trat Theodor und sah den Prinzen an.
Der Prinz brach ein Ei nach dem anderen auf und schüttete die Dotter in ein Glas.
»Setz dich!« sagte er endlich. Und als hätte er sich jetzt erst erinnert: »Schon gegessen?«, und er schob Theodor Eier, Butter und Brot zu.
Die Nahrung kräftigte Theodor. Er aß schweigsam, eine gute, wohltätige, klare Ruhe kehrte in ihm ein.
Und plötzlich, als hätte sich die Zunge von jeder Abhängigkeit befreit, huschte seine hurtige Frage über den Tisch: ob der Prinz einen Sekretär brauche.
Prinz Heinrich nickte, längst hat er die Frage erwartet. Er schreibt etwas auf seine Visitenkarte: »Trebitsch«, sagt der Prinz, nichts mehr. Und als Theodor aufsteht: »Gu’n Morjen!«
Und Theodor verläßt das Haus und geht durch den märzfrischen Tiergarten und saugt die Bläue des Himmels ein und das erste Zwitschern der Vögel und weiß, daß er bergaufwärts geht, obwohl die Straße eben ist. Und er weiß, daß man durch Abgründe muß und daß man vergessen soll. Ablegen will er hindernde Erinnerungen an die Ereignisse der vergangenen Nacht. Sie ist verschlungen von der strahlenden Bläue des Morgens.
III
Trebitsch nahm ihn auf, bei feierlichem Kerzenglanz schwor Theodor einen langen Eid, setzte er seinen Namen auf ein Blatt Papier, dessen Inhalt er kaum gelesen hatte, seine Hand lag zwei Minuten lang in der behaarten Tatze eines Mannes, den man Detektiv Klitsche nannte, der über einem zerschossenen oder verkümmerten Ohrläppchen eine mangelhaft verhüllende glatte Haarsträhne trug und der von nun an Theodors Vorgesetzter sein sollte. Nun war Theodor Mitglied einer Organisation, einer Gemeinschaft, deren Namen er nicht kannte, einen Buchstaben wußte er nur und eine römische Zahl, den Buchstaben S und die Zahl II, und den Sitz dieser unbekannten Macht, der in München war. Befehle hatte er von Klitsche zu erwarten, briefliche, mündliche, Gehorsam unter allen Umständen war Bedingung und ebenso Verschwiegenheit. Tod stand auf Verrat und Vernichtung auf unbedacht gesprochenes Wort.
Es ging Theodor wider seinen Willen zu schnell und gegen die Bedächtigkeit seines Gemüts. Er erschrak wiederum vor so viel Neuem, er kam sich überrumpelt vor. Er fürchtete sich vor dem Kerzenglanz und den tönenden Worten des Schwurs, der Pranke seines Vorgesetzten, und den Tod fühlte er nahe wie ein bereits zum Verräter Gewordener und Verurteilter. Er hatte niemals schlecht geschlafen, in der Nacht träumte er selten und, wenn es geschah, immer nur Tröstliches. Vor dem Einschlafen pflegte er an die schönen Bilder der Zukunft zu denken, mochte der vergangene Tag auch keinen Anlaß dazu gegeben haben. Seit jenem Vormittag im Büro des Dr. Trebitsch träumte er von brennenden Kerzen, gelben, im Licht eines vollen Tages. Am gräßlichsten war die Vorstellung, daß kein Entrinnen möglich war und daß er nicht mehr zurück konnte, zurück in die geborgene Stille einer Hauslehrerexistenz, die Freiheit war. Welche Befehle harrten seiner? Mord und Diebstahl und gefährliches Spionieren? Wieviel Feinde lauerten im Dunkel der abendlichen Straßen? Schon jetzt war er nicht mehr seines Lebens sicher.
Aber welch ein Lohn konnte ihm werden! Ich sprenge die Zeit, in der ich gefangen bin, den sonnenlosen Kerker dieses Daseins, werfe das drückende Joch dieser Tage ab, steige auf, zerschmettere geschlossene Pforten, ich, Theodor Lohse, ein Gefährdeter, aber ein Gefährlicher, mehr als ein Leutnant, mehr als ein Sieger auf trabendem Roß, zwischen grüßenden Spalieren, Retter des Vaterlandes vielleicht. In diesen Zeiten gewinnt der Wagende.
Ein paar Tage später bekam er den ersten Befehl: bei Efrussi zu kündigen, zugleich mit dem ersten, von Heinrich Meyer unterzeichneten Scheck über einen phantastisch hohen Betrag, bei der Dresdener Bank zu beheben. Niemals war so viel Geld bei Theodor gewesen, im Nu veränderte der Besitz seine Miene, seinen Gang, seine Haltung, seine Umwelt. Es war ein heller Aprilabend, die Mädchen trugen leichte Kleider und lebendige Brüste. Die Fenster einer ganzen Häuserfront standen offen. Zwitschernde Spatzen hüpften zwischen gelbem Pferdekot. Es lächelte die Straße. Schon trug der Laternenanzünder den sommerlich weißen Kittel. Die Welt verjüngte sich ohne Zweifel. Die letzten Sonnenstrahlen zitterten in kleinen Kotlachen. Die Mädchen lächelten und schienen sehr zugänglich. Es gab blonde und braune und schwarze. Aber das war eine oberflächliche Einteilung, Mädchen mit breiten Hüften sind Theodors besondere Lieblinge. Er liebt es, Zuflucht und Heimat zu finden im Weibe. Er will nach vollendeter Liebe Mütterlichkeit, weite, breite, gütige. Er will seinen Kopf zwischen großen, guten Brüsten betten.
Das war ein Tag, an dem ihm die Kündigung bei Efrussi leichtfallen mußte. Zwei Jahre war er ins Haus gekommen, Tag für Tag, und jetzt wird er die junge Frau Efrussi nicht mehr sehen. Er dachte ihrer wie einer Landschaft, die man einmal aus der Ferne erblickt hat und in der ein Verweilen unmöglich war.
Er könnte vielleicht schriftlich kündigen – unter irgendeinem Vorwand. Prüfungen nähmen ihn jetzt so in Anspruch. Allein das wäre nicht nur Lüge, wäre Feigheit sogar und die Gelegenheit, dem verhaßten Efrussi die lange krampfhaft zurückgehaltene Wahrheit zu sagen, versäumt. »Herr Efrussi, ich bin ein armer Deutscher, Sie ein reicher Jude. Es bedeutet Verrat, eines Juden Brot zu essen.«
Aber Theodor sprach nicht so zu dem schwarzen, hageren Efrussi, dessen Angesicht an das Porträt einer alten Frau mit strengen Zügen erinnerte. Theodor sagte nur:
»Ich will Ihnen etwas mitteilen, Herr Efrussi.«
»Bitte!« sagte Efrussi.
»Ich unterrichte in Ihrem Hause schon zwei Jahre …«
»Ihren Gehalt will ich erhöhen«, unterbricht Efrussi.
»Nein, im Gegenteil, ich will kündigen«, sagt Theodor.
»Weshalb?«
»Weil Herr Trebitsch nämlich …«
Efrussi lächelt: »Sehen Sie, Herr Lohse, ich kenne den Trebitsch schon sehr lange. Sein Vater war ein Geschäftsfreund meines Vaters. Er war groß und bedeutend in der Manufaktur. Sein Sohn hätte besser daran getan, im Geschäft zu bleiben. Ich kenne die Kindereien des Doktor Trebitsch. Sie sind der dritte Hauslehrer, den er mir wegnimmt. Er ist ein stiller Narr.«
»Er ist ein Freund Seiner Hoheit des Prinzen Heinrich.«
»Ja«, sagt Efrussi, »der Prinz hat bekanntlich viele Freunde.«
»Was wollen Sie damit sagen? Ich war Leutnant im Regiment des Prinzen.«
»Des Prinzen Regiment war bestimmt ein tapferes. Übrigens halte ich sehr viel vom Prinzentum im allgemeinen, aber sehr wenig vom Prinzen. Aber das gehört nicht hierher…«
»Doch«, sagte Theodor und, ohne Efrussis letzten Satz begriffen zu haben: »Sie sind Jude!«
»Das ist mir nicht neu.« Efrussi lächelte. »Auch Trebitsch ist Jude, ohne daß ich den Wunsch hätte, mich mit ihm zu vergleichen. Aber ich verstehe Sie, ich lese ja die nationalen Blätter. Ich inseriere sogar in der ›Deutschen Zeitung‹. Sie wollen also nicht mehr meinen Sohn unterrichten. Hier ist Ihr letzter Monatsgehalt. Lassen Sie sich durch nichts abhalten, ihn zu nehmen. Er gebührt Ihnen!«
Theodor nahm ihn. Seine Weigerung hätte die Diskussion fortgesetzt. Und gebührte er ihm nicht wirklich? Hatte er nicht schon beinahe drei Wochen vom laufenden Monat weg? Er nahm, verneigte sich und ging. Und wußte nicht, daß Efrussi den Major Pauli von der Stadtkommandantur anrief und sich über den Verlust des Hauslehrers beklagte: »Ihre Agitation geht zu weit!« sagte Efrussi. Und der Major entschuldigte sich.
Theodor hat die erste Aufgabe erfüllt. Er hat ein blutendes Herz mitgenommen. Er wird niemals mehr Frau Efrussi sehen.
Und es ist ihm, als hätte er jetzt erst seinen langen klingenden Eid geleistet. Diese Kündigung war wie ein donnernd zugeschlagenes Tor, Abschluß eines Weges, Ende eines Lebens.
IV
Drei Tage, drei Nächte genoß Theodor sein Geld. Es nahm ihm die Besinnung, zu wählen und sich mit Bedacht zu freuen. Er beschlief Mädchen von der Straße und kostspieligere, die in den Lokalen warteten. Er trank Wein, der ihm nicht schmeckte, und süße Liköre, die ihm Qual verursachten und deren widerlichen Geschmack er durch Kognak loszuwerden versuchte. Er schlief in schmutzigen Gasthöfen und entdeckte spät, daß er für die gleiche Summe alle paradiesischen Genüsse eines großen Hotels hätte kaufen können. Er ging einmal in die Gesellschaft seiner Kameraden, zahlte ihnen ein paar Runden und wurde ausgelacht. Jedes neue Mißlingen einer verschwenderisch unternommenen Freude stachelte seinen Ehrgeiz auf, und nur aus Angst vor dem angedrohten Tode hielt er in der Berauschtheit mit seinem Geheimnis zurück und dämmte krampfhaft das Wort hinter widerstrebenden Lippen: ich, Theodor Lohse, bin Mitglied einer geheimen Organisation.
Wie würden sie ihn bewundern, wenn sie es wüßten! Aber fast so köstlich, wie das Bewundertsein gewesen wäre, war das Geheimnis, in dem er lebte, und das Inkognito. Er war im Begriff, an den unsichtbaren Fäden zu ziehen, an denen, wie er aus den Zeitungen wußte, Minister, Behörden, Staatsmänner, Abgeordnete hingen. Und er trug immer noch das unscheinbare Gewand eines Rechtshörers und Hauslehrers. Er ging an einem Polizisten vorbei und wurde nicht erkannt. Niemand sah ihm seine Gefährlichkeit an. Manchmal gefiel es ihm, seine Verborgenheit zu verstärken, und er trat für einige Minuten in einen dunklen Hausflur und bildete sich ein, jemanden zu beobachten, ohne selbst bemerkt zu werden. Er bereitete sich auf seinen Beruf vor, indem er eine eingebildete Aufgabe ausführte. Er trat in irgendein Ministerium und fragte den Portier nach einem beliebigen Namen, er las die Liste der Beamten über die Schulter des suchenden Portiers und ging zufrieden davon. Er begann sich um Dinge zu kümmern, die ihn niemals interessiert hatten. Er kaufte revolutionäre Blätter, er ging, um ein gleichgültiges Inserat aufzugeben, in die Redaktion der »Roten Fahne« und stellte fest, daß sie leicht zu erobern war. Man sollte mit ihm zufrieden sein. Er würde – fiel ihm eine Aufgabe zu – über wichtige Dinge schon orientiert sein.
Mit jenem hitzigen Fleiß, mit dem er einmal freiwillig seinen Einzug in die Kaserne gehalten hatte, machte er sich an noch nicht erhaltene Aufträge, nicht verlangte Arbeiten. Freilich war es beim Regiment leichter, weil übersichtlicher. Man kannte den Zimmerkommandanten genau, den Schulleiter, den Sergeanten und den Wachtmeister. Hier tappte man im dunkeln. Sollte man seine Beflissenheit in Trebitschs Dienste stellen oder dem Detektiv Klitsche widmen? Wer kannte sich hier aus?
Theodor ging planlos durch die Straßen, mit rastlos leerlaufendem Eifer angefüllt. Er empfand die Notwendigkeit, seiner Beflissenheit ein sichtbares Gebiet zu erobern, deutliche Erfolge zu konstatieren. Vor einem Schaukasten eines Photographenateliers Unter den Linden blieb er stehen. Hier hing das farbige Bild des Generals Ludendorff, ein Paradestück des Photographen.
Immer war es Theodors Bestreben gewesen, mit den Großen und Größten in irgendeinen Kontakt zu gelangen. Schon in der Schule hatte er es durch allerlei Dienst-und Ehrenerweisungen erreicht, daß ihn der Leiter in den Pausen mit irgendeinem persönlichen Auftrag begnadete. Im Kriege war er nach kurzen Monaten Adjutant des Obersten geworden. Und beim Anblick des Ludendorffschen Bildes verfiel Theodor auf den Gedanken, seine alte Methode anzuwenden und eine Verbindung mit dem General herzustellen. Sein Herz schlug, sein Blut klopfte gegen die Schläfen, als stünde er vor dem lebendigen General, nicht vor einer Photographie. Und Theodor begab sich in ein Café und schrieb einen ehrerbietigen Brief an Ludendorff nach München, ohne nähere Adresse, im Vertrauen auf die Popularität des Generals und die Zuverlässigkeit der Post.
Und es geschah, daß Theodor wirklich eine Antwort erhielt. Er las und wuchs bei jedem der kurzen, metallenen Worte. »Lieber Freund!« schrieb der General, »Sie gefallen mir. Arbeiten Sie fleißig mit Gott für Freiheit und Vaterland. Ihr Ludendorff.«
Theodor las den Brief: in der Bahn, an der Haltestelle, im Kolleg und während er aß. Ja, mitten im Gewühl der Straßen erfaßte ihn Verlangen nach dem Brief. Es zog ihn zu einer der kleinen Bänke am Rande eines Rasens hin, auf die er sich niemals gesetzt hätte, aus Widerwillen gegen die plebejischen und von Menschen niederen Schlages bevölkerten Sitzgelegenheiten. Heute war er meilenweit von den Menschen entfernt, mit denen er dieselbe Bank teilte. Er las den Brief und wanderte weiter, um sich nach zehn Minuten wieder zu setzen.
Wie ein frommer Bibeldeuter im Text der Heiligen Schrift, so fand Theodor in den Zeilen des Generals immer wieder einen neuen Sinn. Bald kam er zu der Überzeugung, daß Ludendorff von Theodor Lohses Eintritt in die Geheimorganisation wisse. Trebitsch mußte es ihm mitgeteilt haben. War Theodor nicht ein persönlicher Freund des Prinzen? Zwischen der Absendung des Briefes und dem Eintreffen der Antwort lagen acht Tage. Also hat sich Ludendorff in Berlin erkundigt. »Mein lieber Freund!« schrieb der General. So schreibt man einem, der mehr verspricht, als er schon geleistet hat.
Theodor begab sich in die »Germania«, in deren Lesesaal der Germanist Spitz einen Vortrag über Rassenprobleme hielt. Wilhelm Tiedemann und andere vom Bunde deutscher Rechtshörer waren anwesend. Zuerst las Tiedemann den Brief. Auf seine Einsicht konnte sich Theodor verlassen. Und Tiedemann war ebenso wie Theodor überzeugt, daß Ludendorff seines neuen Freundes Persönlichkeit schon längere Zeit kennen mußte.
Alle sagten es Theodor, alle waren seine Freunde. Aus aller Augen strömte ihm Liebe entgegen. Jedes einzelnen Herzschlag hörte er, und das Pochen ihrer Herzen war die Sprache der Freundschaft. Er lud sie ein. Er legte seinen Arm um Tiedemanns Schultern. Man trank auf Kosten Theodors. Man ließ ihn hochleben. Er sprach viel, und noch mehr fiel ihm ein. Als er fortging, trug er ein gewaltiges Geräusch seiner eigenen Worte davon.
Der nächste Morgen brachte ihm eine Einladung zum Detektiv Klitsche. Er hätte keine Briefe zu schreiben. An Ludendorff am allerwenigsten. Noch weniger hätte er darüber reden sollen. Er wäre nicht der einzige im Bunde der Rechtshörer, der zur Organisation gehörte, und jedes Wort, das er gestern gesagt, war Klitsche hinterbracht worden.
»Geben Sie den Brief her!« sagte Klitsche.
Theodor wurde rot. Flammende Räder kreisten vor seinen Augen. Er war plötzlich der kleine Einjährige und stand im Kasernenhof. Er nahm vorschriftsmäßig stramme Stellung an. Er war ein kleiner Einjähriger mit der Aussicht auf einen Gefreitenknopf.
Er gab den Brief her. Klitsche steckte ihn ein. Er befahl:
»Ziehen Sie sich aus!«
Und Theodor zog sich aus. Als wäre es ganz selbstverständlich, zog er sich aus. Er dachte daran, daß er Klitsche gehorchen müsse.
Und langsam und gleichgültig zog er sich wieder an, so langsam und gleichgültig wie in seinem Zimmer des Morgens, wie alle Tage.
Es war Frühling in den Straßen, es zwitscherten übermütige Vögel, die Straßenbahnen klingelten, die Luft war blau, die Frauen trugen leichte Kleider.
Theodor möchte krank sein und ein kleiner Junge und in seinem Bett liegen. Er trank in Schnapsbuden zweiten Ranges und schlief mit Mädchen vom Potsdamer Platz, weil sein Geld zur Neige ging. Und als er nichts mehr hatte, empfand er die rauschende Buntheit der Straße tausendmal stärker und seine eigene Kleinheit. Und er vergaß den Besuch bei Klitsche, wie er den beim Prinzen Heinrich vergraben hatte. Über Abhänge und durch Niederungen führte der Weg.
V
Sein Weg führte vorläufig zu der Wohnung des Malers Klaften.
Theodor hieß Friedrich Trattner und war Genosse aus Hamburg. Moderne Bilder sah er bei Klaften, farbenrauschende Fanfaronaden, gelbe, violette, rote. Die Augen schmerzten, wenn man sich von den Bildern abwendete, wie wenn man in die Sonne gesehen hätte. Theodor sagte: »Sehr schön!«
Seine Bewunderung genügte allen und ersetzte die Legitimation. Man sagte Genosse Trattner zu ihm. Er trug seinen neuen Namen mit Inbrunst. Er, den jede neue Situation überraschte, erschüttern konnte, jetzt erfand er selbst Situationen, abenteuerliche Ausbrüche aus Gefängnissen, plötzliche Flucht vor auftauchenden Spitzeln, Prügeleien mit Polizei und Studenten.
Theodor wuchs in Friedrich Trattner hinein. Durch den Körper dieser Figur, die er spielte, ging es zu Ansehen und Geltung. Es war wie eine Gefreitencharge beim Militär, die man ganz durchkosten mußte, ehe man weiterkam. Man hatte sie bald überstanden. Man gab sich Mühe, ihrer würdig zu sein, aber nur, um aus ihr schlüpfen zu können.
Neue Menschen lernte Theodor kennen. Den Juden Goldscheider, der die Güte predigte und bei jeder Gelegenheit das Neue Testament zitierte. War er ein Bolschewik oder nur ein Jude? Goldscheider selbst erzählte von seinem Aufenthalt in Irrenhäusern. Er war gewiß närrisch. Er sagte manchmal Unverständliches. Die anderen täuschten Verständnis vor.
Es war eine harmlose Gesellschaft junger armer Menschen ohne Obdach. Sie bekamen Logis und einen Kaffee vom Maler Klaften. Der Maler lebte von unmodernen Bildern, die allgemein in der Gesellschaft Kitsch genannt wurden. Theodor hielt sie für die besten Werke Klaftens.
Theodor hörte die jungen Leute fluchen. Sie sahen den Tag der großen Revolution greifbar nahe. Sie fluchten auf sozialistische Abgeordnete und Minister, die Theodor immer für Kommunisten gehalten hatte. Er verstand so feine Unterschiede nicht.
Der Maler Klaften porträtierte Theodor. Er erschrak vor seinem eigenen Bildnis. Es war, als hätte er in einen furchtbaren Spiegel gesehen. Sein Angesicht war rund, rötlich, die Nase platt, mit leise angedeuteter Spaltlinie auf dem breiten, flachen Rücken. Der Mund war breit, mit aufgeworfenen Schaufellippen. Der kleine Schnurrbart verhüllte die wirkliche Lippe zwar, aber die gemalte nicht. Es war, als hätte der Maler den Bart wegrasiert – und er hatte ihn doch mitgemalt.
Es ist mißlungen, dachte Theodor. Das Bild hing im Zimmer und verriet ihn. Alle, die das Porträt sahen, wurden schweigsam und betrachteten Theodor verstohlen. Er fühlte sich fast entlarvt und wäre vor diesem Bild geflohen, wenn nicht der junge Kommunist Thimme eingetroffen wäre.
Thimme hatte Ekrasit im Keller eines sicheren Gastwirtes eingelagert. Er wollte es im Dienst der Revolution explodieren lassen. Er sprach von der Notwendigkeit einer neuen revolutionären Tat und fand Zustimmung bei allen, bei Theodor Begeisterung.
Theodor hörte mit tausend Ohren. Tausend Arme hätte er bereithalten mögen. Er entsann sich jener Spinne in den Sommerferien seiner Knabenzeit, die er jeden Tag mit gefangenen Fliegen gefüttert hatte; des atemlosen Wartens auf das hastige Heranklettern des Tieres, sein sekundenlanges Lauern, den letzten todbringenden Anlauf, der Sturz und Sprung und Fall in einer Bewegung war.
So saß er jetzt selbst, sturzbereit, zum Sprunge entschlossen. Er haßte diese Menschen, wußte nicht, weshalb, und führte für sich selbst Gründe seines Hasses an. Sie waren Sozialisten, Vaterlandslose, Verräter. In seiner Gewalt waren sie. Oh, er hatte Gewalt über fünf, sechs, zehn Menschen. Er hatte wieder Macht über Menschen, Theodor Lohse, der Hauslehrer, Jurist, vom Detektiv Klitsche Erniedrigte, vom Prinzen Mißbrauchte, von seinen Kameraden Verratene. Alle sahen das Feuer in seinem Auge, seine geröteten Wangen. Er betrachtete Thimme, den jungen verhungerten Thimme, einen Glasbläser mit sichtbarer Tuberkulose, den dunklen Tod trug er in den tiefschattenden Augenhöhlen. Er betrachtete Thimme als sein Wild, seinen Menschen, sein Eigentum.
Er kostete seine Verborgenheit wie eine labende Nahrung. Er rückte ins Dunkel. Er spreizte die Finger in den Hosentaschen. Er beugte den Oberkörper vor. Er nahm, ohne es zu wissen, die lauernde Haltung seiner Spinne an.
Sie stritten über das Objekt ihres Angriffs. Einige wollten den Reichstag, andere die Polizei. Andere rieten zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Goldscheider stand mit ausgebreiteten Armen und bat und beschwor, von dem Ekrasit abzulassen. Er hatte die Brille abgelegt, und sein bärtiges Gesicht sah hilflos und verloren und Rettung heischend aus.
Wer die Tat ausführen sollte? Sie einigten sich auf das Los. Es traf Goldscheider.
Theodor ging. Spät in der Nacht verließ er das Haus, schritt durch den finsteren rauschenden Tiergarten zu Trebitsch. Die letzte Allee durchlief er, als würde er verfolgt, gedrückt in das Dunkel der schattenden Bäume. Er wollte niemanden wecken. Er warf einen kleinen Stein gegen Trebitschs erleuchtetes Fenster. Er trat ein und sah nach der Tür. Er schilderte eine unermeßliche Gefahr, in der er schwebte. Spitzel hätten ihn hierher verfolgt, kommunistische Spitzel, unterwegs sei er auf einen Omnibus gesprungen. Sie witterten in ihm den, der er war. Sie ahnten schon, daß er nicht Trattner heiße. Und während er erzählte, steigerte sich seine Furcht. Er log nicht mehr mit Vorbedacht, sondern schilderte seine ängstlichen Vorstellungen. »Ekrasit!« sagte er leise und sah zur Tür.
Man solle sie nicht stören, sagte Trebitsch, sanft und lächelnd wie immer. Er strählte seinen Bart mit gespreizten Fingern wie mit einem Kamm. Nach dem Attentat – und hoffentlich gelingt es – müsse man zur Polizei gehen.
Gegen vier Uhr morgens kehrte Theodor zum Maler Klaften zurück. Man hatte sich auf die Siegessäule geeinigt. Zwei Leute holten das Ekrasit in einer Droschke. Thimme bohrte ein Loch in das Kästchen. Thimme, Theodor und Goldscheider fuhren zur Siegessäule. Thimme und Theodor warteten in einer geraumen Entfernung. Dann kam Goldscheider. Sie gingen, alle drei, schweigsam und bitter.
Eine Viertelstunde nachdem Goldscheider die Lunten angesteckt hatte, rief Theodor die Polizei an; in einigen Minuten würde ein Unglück geschehen. Rechts hinter dem Gitter um die Siegessäule liege Ekrasit.
Dann ging Goldscheider zurück in Klaftens Wohnung – Polizei hielt ihn an, fesselte ihn rasch und lautlos. Aus dem Zimmer kamen die Verhafteten, zu zweit aneinandergefesselte Freunde. An der Seite des Kommissärs stand Trattner, der Genosse Trattner.
Sie spuckten alle gleichzeitig, wie auf Kommando und ehe man sie hindern konnte, in sein Angesicht.
Theodor wischte den Speichel mit dem Tuch fort. Er lachte. Er lachte kurz, laut und tief. Es klang wie ein halber Schrei.
In der Flur erloschen die grellen Lampen der Polizisten. Man hörte den gleichmäßigen Trott der zehn Verhafteten von der Straße und das leise Metallgeräusch aneinanderschlagender Handspangen.
VI
In den Zeitungen flackerten die Sensationen auf: Kommunistischer Anschlag von einem Mitglied der Technischen Nothilfe vereitelt. Theodor Lohse wurde einigemal genannt. Man gratulierte. Im Bunde deutscher Rechtshörer war Theodor ein seltener Gast geworden. Er ging nicht mehr ins Kolleg. Das hatte Zeit.
Seitdem er im Heeresbericht erwähnt worden war, hatte er seinen Namen niemals mehr gedruckt gesehen. Jetzt begegnete er seiner Tat in allen Zeitungen. Es kam ein Mann vom »Nationalen Beobachter«, ein dünnes Männchen, das sich beständig mit irgendwelchen Gegenständen auf dem Schreibtisch beschäftigte, während es sprach. Es lud Theodor zur Mitarbeit ein, machte aber aufmerksam, daß das Budget des Blattes leider für Honorare nicht ausreiche.
Was tat es? Theodor bekam ein Honorar von Trebitsch, ein weniger hohes als das erstemal. Und es verringerte sich noch um die Hälfte, als Klitsche seinen Anteil forderte. Von ihm hatte Theodor den Maler Klaften! Er, Klitsche, hat in selbstloser Freundschaft Theodor die Sache abgetreten. Klitsche sitzt in seinem Büro, ohne Rock und Weste, mit geöffnetem Kragen, und sieht noch mächtiger aus. Man sieht den gewaltigen Umfang seines Halses mit geblähten Muskelsträngen und die gebändigte Wucht seiner ruhenden Fäuste auf dem Tisch. Seine lange Haarsträhne verschob sich und ließ die verkrüppelten Reste seiner Ohrmuschel frei, ein rötliches Stückchen Knorpel mit verkümmerten winzigen Windungen.
Theodor feilschte erbittert, ein Drittel wollte er hergeben, aber Klitsche rückte den Stuhl mit einem plötzlichen Entschluß hinter sich, so, als wollte er sich erheben. Er stand nicht auf, sondern blieb, auf dem weit zurückgeschobenen Stuhl, den Oberkörper vorgeneigt, die starken Fäuste an der Tischkante, sitzen, ein geducktes Tier; und Theodor gab ihm die Hälfte.
Dann ging er durch die Straßen, machte vor den Schaufenstern halt und kaufte ein Paar Stiefel. Er kam sich gewachsen vor, als hätte er neuen erhabenen Boden unter den Füßen.
Am späten Nachmittag, die Vögel zwitscherten ergreifend und abendlich, sprach er ein weißgekleidetes Mädchen an. Im Laufe des Abends besuchte er einen Tanzpalast, wurde eifersüchtig, weil das Mädchen mit einem Herrn vom Nachbartisch dreimal hintereinander tanzte, trank sauren Sekt. Das Mädchen – sie war nicht so eine – verlangte nach einem besseren Hotel, zwei Zimmer mußte Theodor mieten. Eine Viertelstunde mußte er sie allein lassen, dann klopfte er an ihre Tür, horchte, klopfte wieder und öffnete. Das Mädchen war verschwunden.
Er hatte mehr Glück bei jungen Frauen, die, ohne Hut, in den einfachen Blusen und fadenscheinigen Jäckchen, sich mit einem Kinobesuch begnügten. Er achtete darauf, daß aus den kleinen Zerstreuungen keine bindende Freundschaft wurde, er hielt grundsätzlich kein vereinbartes Rendezvous.
Er war mit sich zufrieden und überzeugt, daß Willenskraft und Begabung ihm diese kurzen Fortschritte in kurzer Zeit ermöglicht hatten.
Er glaubte, die einzige ihm angemessene Beschäftigung gefunden zu haben. Er wurde stolz auf seine Spionierfähigkeit und nannte sie eine diplomatische. Sein Interesse für Kriminalistik steigerte sich. Er saß stundenlang im Kino. Er las Kriminalromane.
Noch lebte das Porträt in ihm, das der Maler Klaften gemalt hatte. Er versuchte, es Lügen zu strafen. Er wendete Mittel an, um seinen Schnurrbart buschiger zu machen. Er kleidete sich neu, jetzt trug er einen hellbraunen Anzug, einen sanft grünlich karierten und ein kleines, goldenes Hakenkreuz in einer quergestreiften, seidenen Krawatte.
Er kaufte Waffen aller Art, Jagdmesser und Dolche, einen ledernen Totschläger, eine Pistole, einen Gummiknüppel. Er ging, wie Detektiv Klitsche, niemals ohne Revolver, er sah in jedem Passanten einen kommunistischen Spitzel. Daß er nicht verfolgt wurde, wußte er. Aber er vergaß es, besonders wenn er ein Kriminaldrama gesehen hatte. Es schmeichelte ihm, verfolgt zu werden, und also glaubte er daran.
Er, dem jede Stunde schrecklich erschien, nur weil sie neu gewesen war, der das Kommende gefürchtet, das Bleibende geliebt hatte, er täuschte sich kühne Unmöglichkeiten vor und erwartete Abenteuer auf jedem Schritt. Er war gerüstet.
Er wurde ungläubig. Hinter jeder klaren Tatsache sah er Schleier, die Geheimnis und wahren Sachverhalt bargen. Er las politisch-philosophische Schriften, die Trebitsch verfaßt hatte. Flugschriften, in denen Zusammenhänge zwischen Sozialismus, Juden, Franzosen und Russen aufgedeckt wurden. Diese Lektüren befruchteten Theodors Phantasie. Er glaubte nicht nur, was er gelesen hatte, er kombinierte aus dem gelesenen Material neue Tatsachen und entwickelte sie im »Nationalen Beobachter«. Seitdem er gedruckt wurde, steigerte sich seine Sicherheit, und wenn er die Feder in die Hand nahm, zweifelte er nicht mehr an der Richtigkeit dessen, was er vorsichtig anzudeuten sich vorgenommen hatte. Las er noch einmal das Manuskript, war er sicher und strich schwächende Worte, jedes »vielleicht« und jedes »wahrscheinlich«. Er schrieb die Aufsätze eines Mannes, der hinter die Kulissen geblickt hat.
Er wußte, daß der »Nationale Beobachter« in den Lesesälen der »Germania« auflag und daß Tiedemann und die anderen ihn lasen. Dieser »Nationale Beobachter« hing in den Kiosken der Untergrundbahn, er hing an jeder Straßenecke und an jedem Kiosk, und an jeder Ecke schrie der weiß-rote Umschlag der Zeitschrift den Namen Theodor Lohse in die Welt.
Er neidete nicht mehr den Efrussis die weißschimmernden Häuser hinter grünen Rasen, die silbernen Gitter und marmornen Treppen. Er dachte an die verlorene Frau Efrussi, wie ein ganz großer Mann einer kleinen Frau aus anderen Kreisen gedenkt, die ein kleines Abenteuer abgegeben hätte. Er beneidete den Juden Efrussi nicht, aber er haßte ihn und seine Sippe, seinen Stolz und die Art, wie er ihn, den Hauslehrer, zuletzt behandelt hatte. Jetzt erinnerte sich Theodor, daß er im Efrussischen Hause eine schüchterne Haltung eingenommen hatte, eine dumme Angst hatte ihn damals noch beherrscht, und die Schuld daran schob er den Juden zu. Wie überhaupt die Juden seine langjährige Erfolglosigkeit verursacht hatten und ihn an der schnellen Eroberung der Welt hinderten. In der Schule war es der Vorzugsschüler Glaser, andere Juden – er wußte sie nicht zu nennen – kamen später. Sie waren, wie alle Welt wußte, furchtbar, weil sie Macht besaßen. Aber auch häßlich und abscheulich, überall, wo sie auftauchten, in der Bahn, auf der Straße, im Theater. Und Theodor zupfte, wenn er einen Juden sah, auffällig an seiner Krawatte, um den anderen auf das drohende Zeichen des Hakenkreuzes aufmerksam zu machen. Die Juden erbebten nicht, ihre Frechheit erweisend. Sie sahen gleichgültig auf Theodor, manchmal höhnten sie ihn sogar, und er wurde beschimpft, wenn er Rechenschaft forderte.
Er war gereizt, und es geschah, daß er des Nachts in stillen Straßen Passanten schmähte und, wenn ihm Gefahr drohte, in einer Nebenstraße verschwand. Von solchen Abenteuern erzählte er gelegentlich dem Detektiv Klitsche, dem Doktor Trebitsch und wurde von ihnen, nicht wie er erwartet hatte, belobt, sondern ermahnt, Disziplin zu üben. Denn Leute, die einer Organisation angehörten, müßten Aufsehen vermeiden.
Von nun an schwieg er, aber der Haß fraß in ihm und machte sich frei in Artikeln für den »Nationalen Beobachter«. Die Aufsätze wurden immer gewalttätiger, bis das Blatt für einen Monat verboten wurde, und ausdrücklich wegen der Artikel Theodor Lohses. Zu diesem Erfolg gratulierten ihm einige junge Leser schriftlich. Auch Frauen schrieben ihm. Theodor antwortete. Man besuchte ihn. Gymnasiasten, Mitglieder des Bismarck-Bundes luden ihn ein, sahen zu ihm auf, Mittelpunkt war er und stillschweigend gewähltes Haupt, Vorträge hielt er und stand, umbrandet vom Beifall seiner Verehrer, auf dem Podium. Er gründete einen nationalen Jugendbund, zog an Sonntagen mit seinen Jungen hinaus in die Wälder und lehrte sie exerzieren.
Indessen fehlte es ihm an Geld. Weit und breit war keine Aussicht mehr, neues zu verdienen, es waren ruhige Zeiten. Im Büro des Detektivs Klitsche ließen sich keine Spitzel mehr blicken. Klitsche war allerdings nicht auf sie angewiesen, er bekam Gehalt, er stand in steter Verbindung mit München. Theodor hätte gern eine ähnliche Stelle bekleidet, er liebte Klitsche nicht. Klitsche war ein Hindernis. Dieser Klitsche war Wachtmeister gewesen, Theodor war immerhin Leutnant und akademischer Bürger. Er ließ manchmal bei Trebitsch seine Unzufriedenheit merken. Einmal sagte Trebitsch im Spaß: »Vielleicht stirbt Klitsche.«
Seit jenem Tag dachte Theodor an Klitsches Tod. Aber Klitsche war gesund, jede Zusammenkunft bewies es, jeder Händedruck, jedes mächtige Gelächter. Es war keine Hoffnung, daß Klitsche jemals nach München abberufen wurde. Und daß man ihm eine Verfehlung nachweisen könnte.
Manchmal träumte Theodor von einem Verrat Klitsches. Wie? War es ganz unmöglich? Verkehrte Klitsche nicht mit kommunistischen Spitzeln? Wer beaufsichtigte ihn? Wer kannte ihn eigentlich genau? Mußte es nicht einem aufmerksamen Beobachter gelingen, den Detektiv zu fangen?
Vorläufig war es unmöglich, und Theodor brauchte Geld. Ein Versuch, bei Trebitsch eine Anleihe zu machen, schlug fehl. Trebitsch erklärte nicht nur, daß er selbst Schulden habe, sondern er verwies auch auf reichere Menschen aus der Bekanntschaft Theodors, wie zum Beispiel der Prinz es war.
»Sie sind ja mit dem Prinzen befreundet!« sagte Trebitsch.
Ja, er war mit dem Prinzen befreundet. War ihm der Prinz nichts mehr schuldig?
Er ging zu Prinz Heinrich. Er mußte lange warten, es war nachmittags, und der Prinz schlief. Dann kam er, im geblümten seidenen Pyjama, mit schlafgeröteten Wangen und Grübchen wie ein gewecktes Kind.
»Ach, Theo!« sagte der Prinz.
Er setzte sich, legte einen Fuß auf den Tisch, ließ die Pantoffeln fallen und betrachtete seine spielenden Zehen. Dazu summte er ein Lied. Er gähnte dazwischen. Er hörte nicht alles, was Theodor sagte. Schließlich unterbrach er ihn:
»Du kannst mit mir nach Königsberg fahren, zur Bootstaufe!«
Also fuhr Theodor, mit einer blühweißen Seemannskappe bekleidet, in einem Coupé erster Klasse nach Königsberg. Seine Hoheit der Prinz schlief unterwegs, ein Buch von Heinz Tovote in der herabhängenden Rechten. Der Ruderklub »Deutsche Treue« holte sie ab, fütterte sie, legte sie schlafen. Sie standen am nächsten Tag, es war ein Sonntag, am Seeufer, und es regnete, wie gewöhnlich bei Bootstaufen. Eine weißgekleidete Jungfrau hielt ein Weinglas in der Rechten, einen Regenschirm in der Linken, der Prinz trat an das Boot, gab ihm seinen Namen und zerschmetterte das Weinglas am Bordrand. Alle riefen dreimal hipp, hipp, hurra! Und der Regen rauschte.
Nachmittags besichtigten sie eine Ehrenkompanie der Reichswehr, lernten die Burschenschaft »Rhenania« kennen, und Theodor erkannte in dem Studenten Günther einen Kameraden aus dem Felde. Sie tranken zusammen, sie gingen durch die Stadt, sie erzählten Erlebnisse, sie hielten einander für prachtvolle Menschen und umarmten sich. Nun gab es kein Geheimnis zwischen ihnen, Theodor verschwieg nur seine Verbindung mit dem Prinzen und mit Klitsche. Dennoch nannte er auch diesen Namen einmal, und nun gestand Günther, daß auch er der Stelle S II in München angehöre und von Klitsche Aufträge erhalte. Aber er sei jetzt der Politik müde und wolle heiraten. Seine Braut lebe in Berlin. Ja, er wollte mit Theodor nach Berlin fahren. Er sehne sich.
Seine Braut war die Tochter eines Arbeiters. Der Vater Betriebsrat bei den Schuckert-Werken. Ein einfacher Arbeiter sogar und ein Roter.
Ob Günther nun auch ein halber Roter wäre, fragte Theodor. Er hielt die Hände in den Taschen und spreizte die Finger. Er horchte mit tausend Ohren.
»Nein!« Aber Günther sprach mit seinem Schwiegervater und ließ eines jeden Meinung gelten.
Sie fuhren zusammen; der Prinz schlief in einem Abteil nebenan, und Theodor schwieg. Er sah in die Landschaft. Er betrachtete Günther, den strohblonden, blauäugigen Buben mit dem dummredlichen Gesicht.
Was war ihm Günther? Name und Gesicht gleichgültig und durch Zufall bekannt. Wie der junge Thimme zum Beispiel.
Liebte er Günther? Liebte er jemanden? Ja, er liebte sein Volk. Im Dienste seines Volkes stand er. Wenn Günther nicht die Wahrheit sprach? Wenn er nur die Hälfte sagte? Wenn er ein Verräter war? mit den Kommunisten verhandelte? die Organisation verriet?
Hier war Theodor auf eine Sache gestoßen. Und mußte vorsichtig sein. Die Sache wies einen Weg.
Detektiv Klitsche hörte Theodor zu. War Näheres nicht zu erfahren?
Es gab nichts, weder konnte die Braut Günthers etwas verraten noch Günther selbst. Einmal fragte Theodor vorsichtig, ob der Schwiegervater nicht Kommunist wäre.
»Ja!« Günther lachte.
Sie gingen durch den Abend, Arm in Arm. Theodor und Günther. Schon betäubte ihn die Macht, Theodor, den Mächtigen, schon knotete er Schlingen mit gehässigen Fingern, Theodor, der Kluge; sah er seine Verdienste, sich selbst erhaben über Klitsche, über Trebitsch, über alle. Er fuhr nach München, mächtig wurde er, übernahm die Leitung. Theodor, ein Führer. Hastig lief er zu Trebitsch, erzählte von Günthers Verrat, Gefahren sah er und schilderte sie und hetzte sich in Begeisterung, angespornt durch des Bärtigen zustimmendes Lächeln. Am Abend sendete Klitsche Boten aus, sechzehn Angehörige der Stelle S II kamen zusammen, zwei Kerzen entzündete Trebitsch und verlas das Protokoll mit Theodor.
Hat Günther gestanden, daß sein Schwiegervater Kommunist und Haupt einer geheimen Organisation ist?
Ja!
Die Arbeiter mit Waffen versorgt?
Ja!
Und Günther beteiligt sich an den Arbeiten?
Ja!
Die Paragraphen acht und neun aus den Statuten lauten:
»Dem Femetod verfallen ist, wer gegen die vaterländischen Organisationen durch List oder offene Gewalt vorgeht; wer mit Parteien der Linken ohne Wissen der Leitung und nicht zu Spionagezwecken Verkehr pflegt.«
Der Student Günther ist schuldig.
Entscheidet das Los?
»Ich übernehme die Aufgabe!« sagte Klitsche.
Man schweigt. Der Atem staunender Verehrung schlägt Klitsche entgegen. Man singt ein Trutzlied:
Der Verräter zahlt mit Blut, Schlagt sie tot, die Judenbrut, Deutschland über alles.
VII
Es war eine Freiturnübung in Weißensee angesagt, unter dem Kommando des Leutnants Wachtl. Hundert Schritte von den anderen entfernt gingen Klitsche, Theodor und Günther. Gast war Günther, herzlich begrüßt und mit Witzen unterhalten. Man hörte das starke Lachen Klitsches.
Sie blieben stehen, beschlossen zu rasten, es hackte ein Specht unermüdlich, schüchtern pfiff ein Vogel, Hunderte Mücken tänzelten in der ungewöhnlich warmen Aprilsonne, frisch und betäubend roch der Waldboden.
Theodor möchte gern das Ende des Waldes sehen. Ach! Der Wald hat kein Ende, Theodor fiebert, er spürt einen Druck auf der Schädeldecke, als lasteten viele, viele Baumstämme auf seinem Kopfe. Tränen überquellen sein Auge, er kann nicht mehr sehen, er läßt sich neben Günther nieder.
Jetzt wartet er, wartet wie auf seinen eigenen Tod. Es kam zu schnell. Zu schnell. Theodor sah vor sich unzählige Baumstämme, die das Sonnenlicht brachen und dämpften. Aber die Bäume waren körperlos, Schattenbäume, sie standen nicht fest, sie befanden sich in einer fortwährenden, unmerklichen Bewegung, als wäre der ganze Wald eine Kulisse aus dünnem Schleierstoff, von einem ganz sanften Wind bewegt. Deutlicher als die Baumstämme, die sich vor ihm befanden, sah Theodor den Detektiv Klitsche hinter sich; sah, wie er eine Beilpicke erhob, mit beiden Händen, und sich reckte, fühlte, wie Klitsche den Atem anhielt, und dann schloß Theodor die Augen. Als er sie wieder aufschlug, sah er Günther neben sich niederbrechen, sah er den halboffenen Mund des Liegenden, den halben Schrei, den steckengebliebenen, und fühlte eine lastende Stille. So ruhig war es im Walde, als wartete alles auf den Todesschrei, der nicht kam.
Zwischen den Brauen Günthers, an der Nasenwurzel, steckte die Spitze der Beilpicke. Sein Angesicht war weiß, violett schimmernd unter den Augen. Noch atmete er. Der Daumen seiner linken, auf der Brust liegenden Hand bewegte sich wie ein kleiner, fleischiger, sterbender Pendel. Mit einem letzten Röcheln verzog er die Oberlippe, man sah seine Zähne und ein Stück weißlichgrauen Zahnfleisches.
Klitsche warf einen Sack über Günther, die Beilpicke ließ er stecken. Er schleppte ihn weiter über Tannennadeln, über Sandboden, über Zapfen, die leicht knisterten. Da war eine Grube, dahinein fiel Günther, Klitsche zog den Sack fort, um die Beilpicke zu entfernen.
Rot und steil, mit unendlich feinem Prasseln, schoß das lang gehemmte Blut aus Günthers Stirn hinauf in die Baumkronen, eine rote Schnur, und tropfte von den Tannen.
Es waren klebrige, zähe Tropfen, sie erstarrten sofort, im Niederfallen noch. Verkrusteten sich wie roter Siegellack. Unendliches, rauschendes Rot umgab Theodor. Im Felde hatte er dieses Rot gesehen und gehört, es schrie, es brüllte wie aus tausend Kehlen, es flackerte, flammte wie tausend Feuersbrünste, rot waren die Bäume, rot war der gelbe Sand, rot die braunen Nadeln auf dem Boden, rot der scharfgezackte Himmel zwischen den Tannen, in grellgelbem Rot spielte der Sonnenschein zwischen den Stämmen. Purpurne, große Räder kreisten in der Luft, purpurne Kugeln rollten auf und nieder, glühende Funken tänzelten zwischendurch, verbanden sich zu sanft gewellten Funkenschlangen, trennten sich. Aus Theodors Innerm kam das rauschende Rot, es erfüllte ihn, schlug aus ihm, aber es machte ihn leicht, und sein Kopf schien zu schweben, als wäre er mit Luft gefüllt. Es war wie ein leichter, roter Jubel, ein Triumph, der ihn hob, ein beschwingendes Rauschen, Tod der schweren Gedanken, Befreiung der verborgen, begraben gewesenen Seele.
Klitsche glitt aus, fiel nieder, stöhnte einmal. Die Beilpicke stand noch eine Weile in der Luft mit aufwärtsragendem Stiel, als wäre sie lebendig, und wankte seitwärts. Theodor griff sie auf. Er ahmte Klitsche nach, erhob die Beilpicke und ließ sie niedersausen. Klitsches Schädel krachte ein wenig. Weißgrauer und blutiger Brei quoll aus seiner Stirn.
Irgendwo hackte wieder der unermüdliche Specht, zwitscherte der schüchterne Vogel, stieg der schwere Dunst aus dem Waldboden.
Mit leichten Schritten ging Theodor durch den Wald, mürbe Zweige krachten unter seinen Füßen, leicht war er wie eine der hundert tänzelnden Mücken.
VIII
Nach München meldete der Bericht, daß Günther Klitsche im Kampfe erschlagen habe und von Theodor Lohse nachher umgebracht worden war. Es wurde von den sechzehn Angehörigen der Stelle S II bezeugt. Die Toten waren gründlich begraben. Ein geschossenes und auseinandergeschnittenes Eichhörnchen lag auf ihrem Grabe und erklärte die Herkunft der Blutspuren.
Frei war die Bahn Theodor Lohses. Klitsches Erbschaft verwaltete er und baute sie aus. Heiß ging sein Atem, kurz war sein Schlaf und weit das Feld, das er beackerte. Aus vierzig Mittelschulen bildete er eine Garde. Unverläßliche Spione schaffte er ab. Dreimal in der Woche hielt er Vorträge. Eine halbe Stunde bereitete er sich vor, aus Trebitschs Flugschriften und aus dem »Nationalen Beobachter«. Er verwaltete Geld, das er von Major Pauli erhielt. Er schrieb Rechnungen und erteilte keine Vorschüsse, es sei denn an sich selbst.
Allmählich begriff er die Zusammenhänge, die er früher nur in Artikeln aufgedeckt hatte. Er fuhr nach München, er lernte seine Vorgesetzten kennen, einen General, der nie nach Preußen reiste und in Bayern unter dem Namen Major Seyfarth wohnte. Er hatte das Bedürfnis, Ludendorff zu besuchen, aber er durfte es nicht, direkter Verkehr mit Ludendorff war verboten. Er verlor die Verehrung für diesen und jenen, den er groß genannt und gewähnt hatte. Er sprach mit Nationalsozialisten und achtete sie gering, weil er erfuhr, daß sie nicht in alles eingeweiht waren und daß Geheimnisse auch ihnen nicht offenbar wurden. Theodor lernte horchen und mißtrauen. Man belog ihn.
Es kränkte ihn. Seinen Fragen gebot man Halt. Es richtete seinen Ehrgeiz auf, es blies ihm neuen Mut ein, Einfluß wollte er, nicht kleine Selbständigkeit, Anfang einer Kette sein, nicht ihr unscheinbares Glied. Aber sein Eifer überwältigte ihn selbst, drang aus ihm, verriet ihn, seinem Fleiß mißtraute man, seine Hitze machte ihn verdächtig. Jeder der Generale, Majore, Hauptleute, Studenten, Journalisten, Politiker klebte an seiner Stelle, es beherrschte sie Angst um ihr tägliches Brot, nichts mehr, nichts weniger. Dazwischen trieben sich kleine Menschen herum, Gäste der Organisationen, der rote Wanderredner Schley, der Pfarrer Block, der Schulmädchen verführte, der Student Biertimpfl, der eine Unterstützungskasse geplündert hatte, der Artist Conti aus Triest, Matrose und Deserteur, der jüdische Spitzel Baum, dessen Spezialität Aufmarschpläne waren, der Elsässer Blum, ein französischer Spion, Klatko aus Oberschlesien, Invalider aus den Abstimmungskämpfen; Marineleutnants und Überseedeutsche, Flüchtlinge aus den besetzten Provinzen, ausgewiesene Regierungsräte, Prostituierte aus Koblenz, Straßenbettler aus den Rheinstädten, ungarische Offiziere, die unkontrollierbare Wünsche geflüchteter Mitglieder aus Budapest brachten, von der Polizei Verfolgte, die falsche Pässe forderten, Redakteure, namenlose, die Geld zur Gründung kleiner Blätter wollten. Jeder wußte etwas, konnte gefährlich, mußte befriedigt werden.