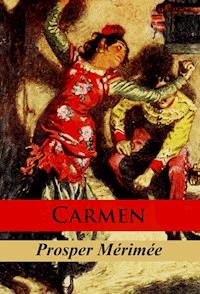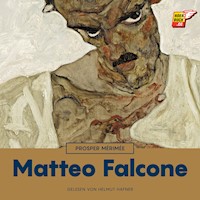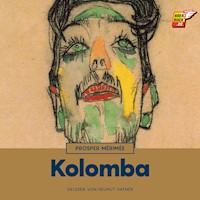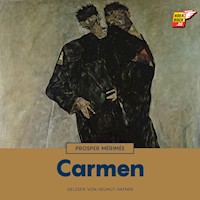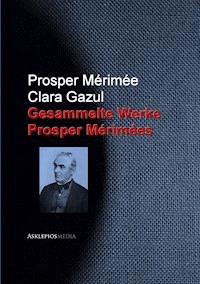
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: aristoteles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese Sammlung der Werke des französischen Schriftstellers Prosper Mérimée enthält: Die Bartholomäusnacht Chronique du règne de Charles Die deutschen Reiter Am Tag nach dem Feste Die jungen Höflinge Der Abtrünnige Die Predigt Ein Parteiführer Gespräch zwischen dem Leser und dem Verfasser Der Handschuh Die Jagd Der Raffiné und das Pré-aux-Clercs Weiße Magie Die Verleumdung Das Rendezvous Die Dunkelheit Das Geständnis Die Privataudienz Der Katechumene Der Franziskaner Die Chevau-légers Der letzte Versuch Der 24. August Die beiden Mönche Die Belagerung von La Rochelle La Noue Der Ausfall Das Hospital Zwiefacher Irrtum Carmen Novelle Aus dem Französischen von Arthur Schurig Die etruskische Vase Die Venus von Ille Erzählungen Die Venus von Ille Das Gäßchen der Madama Lucrezia Djuman Die Seelen des Fegefeuers Lokis
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 867
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Prosper Mérimée,Clara Gazul
Gesammelte Werke Prosper Mérimées
Die Bartholomäusnacht
Originaltitel: Chronique du règne de Charles IX
Vorwort
Ich hatte eine ziemliche Anzahl von Memoiren und Flugschriften gelesen, die sich auf das Ende des 16. Jahrhunderts bezogen, und wollte mir einen Auszug aus meiner Lektüre machen. Dieser Auszug liegt nun hier vor.
Aus der Geschichte liebe ich nur die Anekdoten, und unter den Anekdoten habe ich eine besondere Neigung für diejenigen, in denen ich ein wahrheitsgetreues Sitten- und Charaktergemälde der betreffenden Epoche zu finden glaube. Dieser Geschmack ist nicht sehr edel, aber zu meiner Schande sei es gesagt, daß ich gern den Thukydides für authentische Memoiren einer Aspasia oder eines Sklaven des Perikles darangeben würde; denn allein Memoiren, die ja nichts anderes als vertrauliche Plaudereien des Verfassers mit seinem Leser sind, bieten jenes Charakterbild des Menschen, so wie es mich unterhält und interessiert. Nicht Mézeray, sondern Montluc, Brantôme, d'Aubigné, Tavannes, La Noue und andere geben eine Vorstellung von den Franzosen des sechzehnten Jahrhunderts. Diese zeitgenössischen Schriftsteller sind durch ihren Stil ebenso lehrreich wie durch ihre Erzählungen. Ich lese zum Beispiel in L'Estoile folgende kurze Bemerkung:
›Mademoiselle de Châteauneuf, eine der Geliebten des Königs, bevor dieser nach Polen ging, hatte den Florentiner Antinotti, den Rudermeister der Galeeren von Marseille, in der Verliebtheit geheiratet. Als sie ihn im Liebesgenuß mit einer andern betraf, tötete sie ihn mannhaft mit eigener Hand.‹
Durch diese und so viele andere Anekdoten, deren Brantôme voll ist, lasse ich vor meinem Geiste einen Charakter neu erstehen und erwecke eine Dame vom Hof Heinrichs III. wieder zum Leben.
Mir scheint es interessant, jene Sitten mit den unsern zu vergleichen und in den letzteren den Verfall kraftvoller Leidenschaften zugunsten der Ruhe und vielleicht des Glückes zu beobachten. Ob wir besser sind als unsere Vorfahren, bleibt fraglich, und es ist nicht so leicht, darüber zu entscheiden; denn die Begriffe über die gleiche Handlung haben sich je nach den Zeiten sehr verändert.
So flößten ein Mord oder eine Vergiftung um 1500 nicht den gleichen Abscheu ein, den sie heute erregen. Ein Edelmann tötete seinen Feind durch Verrat; er bat um Begnadigung, erhielt sie und erschien wieder in der Gesellschaft, ohne daß jemand daran dachte, ihn darob schief anzusehen. Manchmal sogar, wenn der Mord aus einer gerechten Rache geschah, sprach man von dem Mörder, so wie man heutzutage von einem Ehrenmann sprechen würde, der, von einem Schurken schwer beleidigt, diesen im Duell tötete.
Es scheint mir also auf der Hand zu liegen, daß menschliche Handlungen aus dem 16. Jahrhundert nicht nach unsern Begriffen des 19. beurteilt werden dürfen. Was auf einer vervollkommneten Kulturstufe als ein Verbrechen erscheint, ist nur ein verwegener Streich auf einer weniger entwickelten und vielleicht eine lobenswerte Handlung in einer barbarischen Zeit. Man wird zugeben müssen, daß das Urteil, welches man über die gleiche Handlung fällen will, auch je nach dem Lande verschieden sein muß; denn zwischen dem einen Volk und einem anderen ist ein ebenso großer Unterschied wie zwischen dem einen Jahrhundert und dem anderen.
Mehemed Ali, dem die Mamelucken-Beys die Herrschaft in Ägypten streitig machten, lädt eines Tages die obersten Führer dieser Herrschaft zu einem Fest ein, das innerhalb seines Schlosses stattfindet. Kaum sind sie eingetreten, so schließen sich die Tore. Albaner in Deckung auf den Terrassen beginnen zu schießen, und von nun an ist Mehemed Ali Alleinherrscher in Ägypten.
Gleichwohl unterhandeln wir mit Mehemed Ali; er wird von den Europäern sogar geschätzt und in allen Zeitungen als großer Mann gefeiert: man nennt ihn den Wohltäter Ägyptens. Und doch, was könnte man sich Schrecklicheres denken als die Ermordung wehrloser Menschen? Tatsächlich wird aber diese Art von Hinterhältigkeit durch die Landessitten und durch die Unmöglichkeit, sich auf andere Weise aus der Sache zu ziehen, gerechtfertigt. Hier ist Gelegenheit, Figaros Spruch anzuwenden: ›Ma, per Dio, l`utilità!‹
Wenn ein Minister, den ich nicht nennen will, Albaner gefunden hätte, bereit, auf seinen Befehl zu schießen, und er hätte bei einem Festessen die hervorragendsten Vertreter der Linken ins bessere Jenseits befördern lassen, so wäre seine Handlung als Tat die gleiche gewesen wie die des ägyptischen Paschas, vom Sittlichkeitsstandpunkt aus aber hundertmal strafbarer. Der Mord liegt nicht mehr in unsern Gepflogenheiten. Jener Minister entließ viele kleine Staatsbeamte, die liberale Wähler waren; er versetzte dadurch die andern in Schrecken und erzielte auf diese Weise Wahlen nach seinem Geschmack. Wäre Mehemed Ali französischer Minister gewesen, so hätte er nicht anders gehandelt; und zweifellos wäre der französische Minister in Ägypten gezwungen gewesen, zum Schießen seine Zuflucht zu nehmen, da Entlassung keine genügende Wirkung auf die Gesinnung der Mamelucken ausgeübt hätte.
Die Bartholomäusnacht war auch für ihre Zeit ein großes Verbrechen; ich wiederhole aber, daß ein Blutbad im sechzehnten Jahrhundert nicht das gleiche Verbrechen ist wie im neunzehnten. Wir müssen noch hinzufügen, daß der größte Teil des Volkes handelnd oder doch wenigstens zustimmend daran teilgenommen hat: es bewaffnete sich, um über die Hugenotten herzufallen, die es als Fremde und Feinde betrachtete. Die Bartholomäusnacht war eine Art nationalen Aufstandes, ähnlich dem spanischen von 1809; und die Bürger von Paris, welche die Häretiker ermordeten, waren überzeugt, der Stimme des Himmels zu gehorchen.
Einem Geschichtenerzähler wie mir steht es nicht zu, in diesem Band eine genaue Schilderung der historischen Ereignisse von 1572 zu geben; da ich aber nun von der Bartholomäusnacht gesprochen habe, kann ich nicht umhin, einige der Gedanken darzulegen, die mir beim Lesen dieser blutigen Seite unserer Geschichte in den Sinn gekommen sind.
Hat man die Ursachen, die jenes Blutbad herbeigeführt haben, richtig erfaßt? War es lange vorher erwogen oder nicht vielmehr das Ergebnis eines plötzlichen, vielleicht sogar zufälligen Entschlusses?
Auf alle diese Fragen gibt mir kein Geschichtsschreiber eine befriedigende Antwort.
Sie führen als Beweise Stadtgerüchte und angebliche Unterredungen an, die nur wenig Gewicht haben, wenn es sich darum handelt, eine geschichtliche Frage zu entscheiden.
Die einen machen aus Karl IX. ein Ungeheuer von Verstellung; die andern schildern ihn als einen launenhaften, ungeduldigen und mürrischen Menschen. Bricht er lange vor dem 24. August in Drohungen gegen die Protestanten aus, so erblickt man darin den Beweis, daß er ihren Untergang von langer Hand erwog. Schmeichelt er ihnen, so beweist es seine Verstellung.
Ich will nur eine gewisse Geschichte anführen, die überall erzählt wird und aus der sich ergibt, mit welcher Leichtfertigkeit man auch die unwahrscheinlichsten Gerüchte gelten läßt.
Ein Jahr ungefähr vor der Bartholomäusnacht hatte man, wie behauptet wird, schon einen Plan für das Blutbad entworfen. Der Plan war folgender: Im Pré-aux-Clercs sollte ein Holzturm gebaut werden; der Herzog von Guise sollte ihn mit Edelleuten und katholischen Soldaten besetzen und der Admiral mit den Protestanten einen Angriff markieren, um dem König das Schauspiel einer Belagerung zu bieten. Wäre diese Art von Turnier einmal im Gange gewesen, so sollten die Katholiken auf ein verabredetes Zeichen ihre Waffen laden und ihre Feinde töten, die in der Überraschung nicht Zeit gefunden hätten, sich zur Wehr zu setzen. Zur Ausschmückung dieser Geschichte fügt man noch hinzu, daß ein Günstling Karls IX., namens Lignerolles, indiskreterweise die ganze Machenschaft aufgedeckt habe, indem er zum König, als dieser vornehme protestantische Herren mit Worten mißhandelte, sagte: »Ach, Sire, warten Sie noch. Wir haben ein Fort, das uns an allen Irrgläubigen rächen wird.« Man beachte, daß noch nicht ein Brett von dem Fort stand. Der König ließ es sich daraufhin angelegen sein, den Schwätzer ermorden zu lassen. Der Plan soll die Erfindung des Kanzlers Birague gewesen sein, dem man andernteils die Bemerkung zuschreibt, die ganz andere Absichten verraten würde: daß ernur einiger Köchebedürfe, um den König von seinen Feinden zu befreien. Dieses letztere Mittel war viel leichter durchführbar als das andere, das in seiner Überspanntheit fast unmöglich war. Und es wäre in der Tat undenkbar, daß der Verdacht der Protestanten durch die Vorbereitungen zu diesem Kleinkrieg nicht erweckt worden wäre, in welchem die beiden vor kurzem noch feindlichen Parteien so aufeinandergehetzt werden sollten. Ferner wäre es ein schlechtes Mittel gewesen, um mit den Hugenotten fertig zu werden, sie sich zusammenscharen und bewaffnen lassen. Es liegt auf der Hand, daß es besser gewesen wäre, falls man sich schon damals zu ihrem Untergang verschworen hatte, sie einzeln und unbewaffnet zu überfallen.
Ich persönlich bin vollkommen davon überzeugt, daß das Blutbad keine vorgefaßte Absicht war, und es ist mir unbegreiflich, wie Schriftsteller eine gegenteilige Meinung vertreten können, die zugleich darin einig sind, Katharina zwar als ein böses Weib, aber auch als einen der politischsten Köpfe ihres Jahrhunderts hinzustellen.
Wir wollen die Moral einen Augenblick beiseite lassen und den angeblichen Plan vom Gesichtspunkt der Nützlichkeit aus betrachten. Da behaupte ich denn, daß er dem Hofe keinen Nutzen brachte und daß er außerdem mit soviel Ungeschicklichkeit ausgeführt worden ist, daß man annehmen müßte, seine Urheber seien die überspanntesten Menschen gewesen.
Man überlege, ob die Autorität des Königs durch diese Vollstreckung gewinnen oder verlieren konnte und ob es in seinem Interesse lag, sie zuzulassen.
Frankreich war damals in drei große Parteien geteilt: die der Protestanten, deren Oberhaupt seit dem Tode des Prinzen von Condé der Admiral war; diejenige des Königs, die schwächste; und die der Guisen und Ultraroyalisten der Zeit.
Es ist klar, daß der König, der gleichermaßen die Guisen und die Protestanten zu fürchten hatte, seine Autorität dadurch zu wahren versuchen mußte, daß er die beiden Parteien aufeinanderhetzte. Die eine davon vernichten wollen, hieß sich der andern auf Gnade oder Ungnade ausliefern.
Das Schaukelsystem war damals schon genügend bekannt und angewandt. Ludwig XI. war es, der gesagt hat: ›Zerteilen, um zu herrschen.‹
Wir wollen nun untersuchen, ob Karl IX. fromm war; denn eine übertriebene Frömmigkeit hätte ihm möglicherweise eine seinen Interessen zuwiderlaufende Maßregel eingeben können. Alles deutet aber im Gegenteil darauf hin, daß er, wenn auch kein Freigeist, so doch jedenfalls kein Fanatiker war. Übrigens hätte seine Mutter, die ihn leitete, niemals gezögert, religiöse Bedenken, falls sie solche gehabt hätte, ihrer Machtliebe zu opfern.
Nehmen wir aber an, Karl oder seine Mutter, oder, wenn man will, die Regierung hätte gegen alle Gesetze der Politik die Vernichtung der Protestanten in Frankreich beschlossen, so ist es wahrscheinlich, daß, wenn der Beschluß einmal gefaßt gewesen wäre, sie die geeignetsten Mittel zur Sicherung des Erfolges reiflichst überlegt hätten. Als sicherste Maßregel drängt sich einem aber zuerst auf, daß das Blutbad in allen Städten des Königreichs zu gleicher Zeit stattfinden müsse, damit die Reformierten, überall von überlegenen Kräften angegriffen, sich nirgends verteidigen könnten. Ein einziger Tag hätte genügt, um sie zu vernichten. So hatte Assuerus sich die Niedermetzelung der Juden gedacht.
Nun lesen wir aber, daß die ersten Befehle des Königs, die Protestanten zu töten, vom 28. August datiert waren, das heißt vier Tage nach der Bartholomäusnacht, zu einer Zeit, wo die Berichte über den Massenmord den Depeschen des Königs vorausgeeilt sein und alle Glaubensgenossen alarmiert haben mußten.
Vor allem wäre es notwendig gewesen, sich der sicheren Plätze der Protestanten zu bemächtigen. Solange diese in ihrer Gewalt waren, war die königliche Autorität nicht gewährleistet. Nehmen wir also eine Verschwörung der Katholiken an, so wäre es offenbar eine der wichtigsten Vorsichtsmaßregeln gewesen, sich am 24. August La Rochelles zu bemächtigen und zugleich im Süden Frankreichs eine Armee zu haben, um jede Zusammenrottung der Reformierten zu verhindern.
Nichts von alledem geschah.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß die gleichen Menschen ein Verbrechen mit so schwerwiegenden Folgen ersonnen haben sollten, und es so schlecht ausführten. In der Tat waren die Maßregeln so schlecht getroffen, daß wenige Monate nach der Bartholomäusnacht der Bürgerkrieg von neuem ausbrach und die Reformierten ganz gewiß den vollen Ruhm und sogar noch Vorteile daraus zogen.
Und widerlegt nicht die Ermordung Colignys, die zwei Tage vor der Bartholomäusnacht erfolgte, vollends die Annahme einer Verschwörung? Warum hätte man den Führer vor Ausbruch der allgemeinen Metzelei töten lassen? Wäre das nicht ein Mittel gewesen, die Hugenotten zu erschrecken und sie zu Vorsichtsmaßregeln zu zwingen?
Ich weiß, daß einige Geschichtschreiber dem Herzog von Guise allein das Attentat zuschreiben, das an der Person des Admirals verübt worden ist. Abgesehen aber davon, daß die öffentliche Meinung den König dieses Verbrechens bezichtigte und der Mörder vom König belohnt worden ist, entnehme ich diesem Ereignis noch einen Beweis gegen die Hypothese einer Verschwörung. Hätte diese wirklich existiert, so hätte der Herzog von Guise notwendigerweise daran teilnehmen müssen. Und warum hätte er dann seine Familienrache nicht um zwei Tage hinausgeschoben, um ihrer desto sicherer zu sein? Warum sollte er das Gelingen der ganzen Unternehmung auf diese Weise in Frage stellen, lediglich in der Hoffnung, den Tod seines Feindes um zwei Tage vorzurücken.
So scheint mir denn alles zu beweisen, daß dieses ungeheure Blutbad nicht die Folge einer Verschwörung eines Königs gegen einen Teil seines Volkes war. Die Bartholomäusnacht scheint mir das Ergebnis eines Volksaufstandes, der nicht vorausgesehen werden konnte, sondern der improvisiert war.
In aller Bescheidenheit will ich darlegen, wie ich mir des Rätsels Lösung denke.
Coligny hatte dreimal mit seinem Herrscher wie mit seinesgleichen verhandelt, Grund genug, um von diesem gehaßt zu werden. Da nach dem Tode der Jeanne D'Albret die beiden jugendlichen Prinzen, der König von Navarra und der Prinz von Condé, zu jung waren, um einen Einfluß auszuüben, so war Coligny tatsächlich das einzige Haupt der reformierten Partei. Nach seinem Tode befanden sich die beiden Prinzen inmitten eines feindlichen Lagers und sozusagen als Gefangene ganz in den Händen des Königs. So war der Tod Colignys, und zwar Colignys allein, wichtig zur Befestigung von Karls Herrschaft, der vielleicht ein Wort des Herzogs von Alba nicht vergessen hatte: daß der Kopf eines Lachses mehr wert sei als zehntausend Frösche. Entledigte sich aber der König mit einem Schlage gleichzeitig des Admirals und des Herzogs von Guise, so wurde er unfehlbar zum unumschränkten Herrscher.
Er mußte also folgenden Entschluß fassen: nämlich den Admiral ermorden zu lassen oder, wenn man so will, diesen Mord geschickt dem Herzog von Guise unterzuschieben, und dann diesen Fürsten als Mörder verfolgen und verkündigen, daß er ihn der Rache der Hugenotten preisgebe. Bekanntermaßen verließ der Herzog von Guise, ob er nun der Tat Maurevels mitschuldig war oder nicht, Paris in aller Eile, und die Reformierten, vom König zum Schein geschützt, ergingen sich in Drohungen gegen die Prinzen des Hauses Lothringen.
Die Bevölkerung von Paris war zu damaliger Zeit außerordentlich fanatisch. Die Bürger waren militärisch organisiert und bildeten eine Art von Nationalgarde, die beim ersten Schlage der Sturmglocken zu den Waffen greifen konnte. Im gleichen Mäße, wie der Herzog von Guise im Andenken an seinen Vater und um seiner eigenen Verdienste willen bei den Parisern beliebt war, waren die Hugenotten, von denen sie zweimal belagert worden waren, ihnen verhaßt. Die Art von Gunst, die letztere am Hofe genossen, im Augenblick, wo eine Schwester des Königs einen Prinzen ihrer Religion heiratete, verdoppelte deren Anmaßung und den Haß ihrer Feinde. Kurz, es genügte, daß ein Führer sich an die Spitze dieser Fanatiker stellte und ihnen zurief: ›Schlagt zu!‹, so stürzten sie sich auf ihre andersgläubigen Volksgenossen und erwürgten sie. Der Herzog, der vom Hofe verbannt und vom König und von den Protestanten bedroht war, mußte am Volk einen Rückhalt suchen. Er versammelt die Führer der Garde, berichtet ihnen von einer Verschwörung der Häretiker, fordert sie auf, letztere auszurotten, ehe diese ausbrechen kann, und erst dann wird das Blutbad geplant. Aus der Tatsache, daß zwischen dem Beschluß und der Ausführung nur wenige Stunden liegen, ist die Heimlichkeit, welche die Verschwörung umgab, und auch die Wahrung des Geheimnisses durch so viele Menschen leicht zu erklären, Dinge, die sonst außergewöhnlich erscheinen müßten.Denn vertrauliche Mitteilungen machen in Paris große Schritte.Es ist schwer, den Anteil des Königs an dem Massenmord festzulegen; stimmte er auch nicht zu, so ist es doch sicher, daß er ihn zuließ. Nach zwei Tagen des Mordens und der Gewalttätigkeit mißbilligte er alles und wollte dem Gemetzel Einhalt tun. Die Wut des Volkes war aber entfesselt, und sie ließ sich nicht durch ein wenig Blut stillen. Sie forderte mehr als sechzigtausend Opfer. Der Monarch sah sich gezwungenermaßen von dem Strom mit fortgerissen, der sich stärker erwies als er. Er widerrief seihe Begnadigungsbefehle und erließ bald andere, durch die er das Morden auf ganz Frankreich ausdehnte. Das ist meine Meinung von der Bartholomäusnacht, und ich möchte mit Lord Byron darüber sagen:
I only say, suppose this supposition.
1829
P.M.
Die deutschen Reiter
The black bands came over The Alps and their snow, With Bourbon the rover They passed the broad Po.
Lord Byron, The deformed transformed
Nicht weit von Étampes, auf dem Wege gegen Paris zu, kann man noch heute ein großes viereckiges Gebäude mit gotischen Fenstern sehen, die mit einigen groben Skulpturen verziert sind. Über der Tür befindet sich eine Nische, die ehedem eine Gottesmutter aus Stein enthielt; in der Revolutionszeit hatte diese aber das Schicksal so vieler anderer Heiligen und wurde durch den protestantischen Revolutionsklub von Larcy in aller Förmlichkeit zertrümmert. Seitdem hat man an ihre Stelle wieder eine andere Heilige Jungfrau gestellt, die zwar nur aus Gips ist, mit Hilfe einiger Seidenlappen und Glasperlen sich aber doch noch ziemlich gut ausnimmt und dem Wirtshaus von Claude Giraut einen ehrwürdigen Anstrich verleiht.
Vor mehr als zwei Jahrhunderten, im Jahre 1572 nämlich, war dieses Gebäude so wie jetzt dazu bestimmt, durstige Reisende aufzunehmen, doch hatte es damals ein ganz anderes Aussehen. Die Mauern waren mit Inschriften bedeckt, die von den verschiedenen Wechselfällen eines Bürgerkrieges Zeugnis ablegten. Neben den Worten: ›Es lebe der Prinz!‹ stand zu lesen: ›Es lebe der Herzog von Guise! Tod den Hugenotten!‹ Etwas weiter hatte ein Soldat mit Kohle einen Galgen und einen Gehenkten gezeichnet und, um kein Mißverständnis aufkommen zu lassen, die Inschrift daruntergesetzt: ›Gaspard de Châtillon‹. Doch schienen die Protestanten später in dieser Gegend die Oberhand gehabt zu haben, denn der Name ihres Führers war ausgestrichen und durch den des Herzogs von Guise ersetzt worden. Andere halbverwischte, schwer leserliche und noch schwerer in anständiger Form wiederzugebende Inschriften bewiesen, daß der König und seine Mutter ebensowenig respektiert worden waren wie die Parteiführer. Die arme Gottesmutter hatte aber anscheinend am meisten unter den bürgerlichen und religiösen Wutausbrüchen zu leiden gehabt. Die Statue, an zwanzig Stellen durch Kugeln abgesplittert, gab Zeugnis von dem Eifer der hugenottischen Soldaten im Zerstören dessen, was sie ›heidnische Bildnisse‹ nannten. Während der fromme Katholik im Vorübergehen an der Statue ehrfurchtsvoll seine Mütze abnahm, hielt sich der protestantische Reiter für verpflichtet, ihr einen Büchsenschuß zu verabfolgen; und hatte er sie getroffen, so stieg seine Meinung von sich ebensosehr, als wenn er das apokalyptische Tier erschlagen oder die Abgötterei ausgerottet hätte.
Seit mehreren Monaten war der Friede zwischen den beiden gegnerischen Sekten hergestellt; er war aber nur mit den Lippen und nicht aus dem Herzen beschworen worden; die Feindschaft zwischen den beiden Parteien bestand noch ebenso unversöhnlich fort. Alles erinnerte daran, daß der Krieg eben zu Ende gegangen war; alles kündigte an, daß der Friede nicht von langer Dauer sein könne.
Das Wirtshaus ›Zum Goldenen Löwen‹ war voll von Soldaten. An ihrem fremdländischen Akzent, ihrer sonderbaren Kleidung erkannte man die deutschenReiter,die der protestantischen Partei ihre Dienste anbieten wollten, besonders wenn diese gut zu bezahlen imstande war. Wenn die Gewandtheit, mit der diese Fremden ihre Pferde ritten, und ihre Geschicklichkeit im Gebrauch der Feuerwaffen sie am Tage der Schlacht zu furchtbaren Gegnern machten, so standen sie andernteils in dem vielleicht noch begründeteren Rufe abgefeimter Plünderer und unerbittlicher Sieger. Die Truppe, die sich in dem Wirtshause niedergelassen hatte, war fünfzig Mann stark: sie hatten am Tage vorher Paris verlassen und begaben sich nach Orléans ins Standquartier.
Während die einen ihre Pferde striegelten, die sie an der Mauer angebunden hatten, schürten andere das Feuer, drehten ihre Bratspieße und machten sich in der Küche zu schaffen. Der unglückliche Wirt betrachtete, die Mütze in der Hand und Tränen im Auge, das Bild von Verwirrung, deren Schauplatz seine Küche war. Er sah den Hühnerhof zerstört, den Keller der Plünderung preisgegeben, sah, wie man den Flaschen die Hälse abschlug, ohne sie des Entkorkens zu würdigen; und das schlimmste war, daß er sehr wohl wußte, er habe trotz der strengen Vorschriften des Königs, die Manneszucht der Kriegsleute betreffend, von jenen keine Entschädigung zu erwarten, die ihn als Feind behandelten. Es galt in dieser unglückseligen Zeit als allgemein anerkannte Tatsache, daß eine bewaffnete Schar in Krieg und Frieden überall, wohin sie kam, auf Kosten der Einwohner lebte.
Vor einem eichenen, von Fett und Rauch geschwärzten Tisch saß der Hauptmann der deutschen Reiter. Er war ein großer, beleibter Mensch von ungefähr fünfzig Jahren, mit einer Adlernase, von stark geröteter Gesichtsfarbe, mit ergrauendem und spärlichem Haar, das eine breite Narbe nur schlecht verbarg, die vom linken Ohre ausging und sich in dem dichten Schnurrbart verlor. Er hatte Panzer und Helm abgelegt und nur ein ungarisches Lederwams anbehalten, das von der Reibung der Waffen schwarz geworden und an verschiedenen Stellen sorgfältig geflickt war. Sein Säbel und seine Pistolen lagen auf der Bank in erreichbarer Nähe; nur den breiten Dolch trug er bei sich, eine Waffe, die ein vorsichtiger Mann nur ablegte, wenn er sich zu Bette begab.
Zu seiner Linken saß ein junger Mann mit sehr gerötetem Gesicht, groß und gut gewachsen. Sein Wams war bestickt, und in seiner ganzen Kleidung bemerkte man etwas mehr Sorgfalt als in der seines Gefährten. Er war jedoch nur der Kornett des Hauptmanns.
Zwei junge Frauenspersonen von zwanzig und fünfundzwanzig Jahren saßen am gleichen Tisch und leisteten ihnen Gesellschaft. In ihrer Kleidung, die nicht für sie gemacht war und die das Kriegsglück ihnen in die Hände gespielt zu haben schien, war eine Mischung von Armseligkeit und Luxus zu bemerken. Die eine trug eine Art von Mieder aus goldbrokatenem, jedoch ganz trübe gewordenem Damast über einem einfachen Leinenkleide; die andere hatte ein violettes Samtkleid an und dazu einen Männerhut aus grauem Filz, den eine Hahnenfeder schmückte. Beide waren hübsch; ihre herausfordernden Blicke und die Ungebundenheit ihrer Rede verrieten jedoch ihre Gewohnheit, mit Soldaten zusammenzuleben. Sie hatten Deutschland ohne bestimmte Beschäftigung verlassen. Die im Samtkleide war Zigeunerin; sie konnte Karten legen und Mandoline spielen. Die andere hatte einige chirurgische Kenntnisse und schien in der Achtung des Kornetts eine bevorzugte Stellung einzunehmen.
Diese vier Menschen, jeder vor einer großen Flasche und einem Glase, plauderten und tranken miteinander, während sie auf das Essen warteten.
Die Unterhaltung war ins Stocken geraten, wie bei Leuten, die sehr hungrig sind, als ein junger Mann von hohem Wuchs und in ziemlich eleganter Kleidung, der einen schönen Fuchs ritt, vor der Tür des Wirtshauses haltmachte. Der Trompeter der Reiter erhob sich von der Bank, auf der er gesessen hatte, näherte sich dem Fremden und nahm die Zügel des Pferdes. Der Fremde wollte sich eben für den vermeintlichen Höflichkeitsdienst bedanken; er wurde aber alsbald eines Besseren belehrt, denn der Trompeter öffnete dem Pferd das Maul und untersuchte mit Kennermiene dessen Zähne. Dann trat er einige Schritte zurück, besah Beine und Hinterteil des edlen Tieres und nickte mit befriedigter Miene. – »Ein schönes Pferd, Musjöh, das Ihr da reitet!« sagte er in seinem schlechten Französisch; und er fügte ein paar deutsche Worte hinzu, die seine Gefährten zum Lachen brachten, unter denen er sich wieder niederließ.
Diese so formlose Untersuchung war nicht nach des Reisenden Geschmack; er begnügte sich jedoch damit, dem Trompeter einen verächtlichen Blick zuzuwerfen, und stieg ohne jegliche Hilfe ab.
Der Wirt, der nun aus dem Hause trat, nahm ihm ehrfurchtsvoll die Zügel aus der Hand und sagte ihm so leise ins Ohr, daß es die Reiter nicht hören konnten:
»Gott helfe Euch, mein junger Edelmann! Ihr kommt zu schlechter Stunde; denn diese Bande vonSpitzköpfen,denen der heilige Christoph den Hals umdrehen möge, ist keine angenehme Gesellschaft für gute Christen wie Ihr und ich.«
Der junge Mann lächelte abweisend.
»Sind diese Herren protestantische Reiter?« fragte er.
»Und deutsche Reitersleute noch dazu«, antwortete der Wirt. »Unsere Liebe Frau vernichte sie! Seit einer halben Stunde sind sie hier, und schon haben sie die Hälfte meiner Möbel zertrümmert. Unerbittliche Plünderer sind sie alle miteinander, wie ihr Führer, Monsieur de Châtillon, dieser schöne Satansadmiral.«
»Für einen Graubart wie Ihr«, antwortete der junge Mann, »beweist Ihr recht wenig Klugheit. Wenn Ihr nun zufällig mit einem Protestanten sprächet, könnte ein derber Puff leicht die Antwort sein.« Und bei diesen Worten schlug er mit der Gerte, die er beim Reiten gebrauchte, gegen seinen weißen Lederstiefel.
»Wie! Was! Ihr ein Hugenotte! ... Protestant wollte ich sagen«, rief der verdutzte Wirt. Er wich einen Schritt zurück und betrachtete den Fremden vom Kopf bis zu den Füßen, als wollte er in seiner Kleidung irgendein Zeichen entdecken, an dem er erraten könne, welcher Religion er angehöre. Diese Prüfung und der offene und lächelnde Gesichtsausdruck des jungen Mannes beruhigten ihn nach und nach, und er fuhr leiser fort:
»Ein Protestant in einem grünen Samtgewand! Ein Hugenotte mit einer spanischen Halskrause! Oh, das ist unmöglich! Ach, junger Herr, solche Kleiderpracht findet man bei den Irrgläubigen nicht. Heilige Maria! Ein Wams aus feinem Samt, das wäre zu schön für diese Schmutzfinken da!«
Im selben Augenblick pfiff die Reitgerte, traf den armen Wirt auf die Backe und diente ihm so als das Glaubensbekenntnis des Angeredeten.
»Unverschämter Schwätzer! Das soll dich lehren, deine Zunge im Zaume zu halten. Marsch, führe mein Pferd in den Stall, und daß es ihm an nichts fehle!«
Der Wirt ließ betrübt den Kopf hängen, führte das Pferd in eine Art von Schuppen und murmelte dabei leise tausend Verwünschungen gegen die deutschen und die französischen Glaubensfeinde vor sich hin; und wäre ihm der junge Mann nicht gefolgt, um zu sehen, wie sein Pferd verpflegt würde, so wäre das arme Tier in seiner Eigenschaft als Häretiker sicherlich um seine Abendmahlzeit gekommen.
Der Fremde betrat dann die Küche und lüftete zum Gruß der dort versammelten Gäste mit Anstand den Rand seines großen, von einer gelb und schwarzen Feder überschatteten Hutes. Der Hauptmann erwiderte den Gruß, und nun betrachteten sich beide eine Zeitlang, ohne zu sprechen.
»Hauptmann«, sagte der junge Fremde, »ich bin ein protestantischer Edelmann und freue mich, hier einige von meinen Glaubensgenossen anzutreffen. Ist es Euch genehm, so wollen wir miteinander zu Abend speisen.«
Der Hauptmann, den die vornehme Haltung des Fremden und seine gewählte Kleidung zu dessen Gunsten einnahmen, antwortete, daß er es sich zur Ehre rechne. Sofort machte Mademoiselle Mila, die junge Zigeunerin, von der wir gesprochen haben, neben sich auf der Bank Platz; und da sie von Natur sehr dienstbeflissen war, gab sie dem Fremden sogar ihr Glas, das der Hauptmann alsbald füllte.
»Ich heiße Dietrich Hornstein«, sagte der Hauptmann und stieß mit dem jungen Manne an. »Sicherlich habt Ihr schon vom Hauptmann Dietrich Hornstein reden hören? Ich habe die Todesfreiwilligen in der Schlacht von Dreux geführt und später in der von Arnay-le-Duc.«
Der Fremde verstand die Umschreibung, mit der jener ihn um seinen Namen fragen wollte; er antwortete:
»Leider kann ich Euch keinen ebenso berühmten Namen nennen wie den Euren, Hauptmann; ich spreche von dem meinigen, denn der meines Vaters ist in unsern Bürgerkriegen wohlbekannt. Ich heiße Bernard de Mergy.«
»Wem sagt Ihr diesen Namen!« rief der Hauptmann aus und füllte sein Glas bis an den Rand. »Ich habe Euren Vater gekannt, Monsieur Bernard de Mergy; von den ersten Kriegen an habe ich ihn gekannt, wie man einen nahen Freund kennt. Auf seine Gesundheit, Monsieur Bernard.«
Der Hauptmann hielt ihm sein Glas entgegen und sagte auf deutsch etwas zu seinen Soldaten. Sowie der Wein seine Lippen berührte, warfen alle Reiter mit Hurrageschrei ihre Hüte in die Luft. Der Wirt hielt das für ein Zeichen der Metzelei und warf sich auf die Knie. Auch Bernard war etwas überrascht über diese außergewöhnliche Ehrung; er glaubte sich jedoch verpflichtet, diese germanische Höflichkeitsbezeigung dadurch beantworten zu müssen, daß er auf des Hauptmanns Gesundheit trank.
Die Flaschen, die schon vor seiner Ankunft tüchtig in Angriff genommen worden waren, genügten nicht mehr für den neuen Trinkspruch.
»Steh auf, Heuchler!« sagte der Hauptmann und wandte sich zu dem noch immer knienden Wirt; »steh auf und hole uns Wein. Siehst du nicht, daß die Flaschen leer sind?«
Und um es zu beweisen, warf ihm der Kornett eine Flasche an den Kopf. Der Wirt rannte in den Keller.
»Dieser Mensch ist ein Erzschuft«, sagte Mergy. »Ihr hättet ihm aber doch weher tun können, als es Eure Absicht war, wenn die Flasche ihn getroffen hätte.«
»Ach was«, sagte der Kornett mit lautem Lachen.
»Der Kopf eines Papisten«, bemerkte Mila, »ist härter als diese Flasche, wenn auch noch leerer.«
Der Kornett lachte noch lauter, und alle Anwesenden folgten seinem Beispiel, selbst Mergy, der freilich mehr dem schönen Munde der Zigeunerin zulächelte als dem grausamen Scherz.
Es wurde Wein gebracht, das Essen folgte bald, und nach einigem Schweigen fing der Hauptmann mit vollem Munde wieder an:
»Und ob ich Monsieur de Mergy gekannt habe! Er war Oberst beim Fußvolk in der ersten Unternehmung des Prinzen. Zwei Monate haben wir im gleichen Quartier gelegen während der Belagerung von Orléans. Und wie geht es ihm jetzt?«
»Ziemlich gut für sein hohes Alter, Gott sei's gedankt! Oft hat er mir von den deutschen Reitern erzählt und von den schönen Angriffen, die sie in der Schlacht von Dreux gemacht haben.«
»Auch seinen ältesten Sohn ... Euren Bruder, den Hauptmann George, habe ich gekannt, das heißt vor ....« Mergy schien verlegen.
»Das war ein tüchtiger Raufbold«, fuhr der Hauptmann fort; »aber ein Hitzkopf, alle Wetter! Es tut mir leid für Euren Vater, seine Abschwörung hat ihm wohl Kummer gemacht.«
Mergy errötete bis über die Ohren; er stotterte einige Worte, um seinen Bruder zu entschuldigen; es war aber nicht schwer zu sehen, daß er ihn noch strenger verurteilte als der deutsche Reiterhauptmann.
»Oh, ich sehe, daß es Euch Kummer macht«, sagte der Hauptmann. »Wir wollen nicht mehr davon reden. Es ist ein Verlust für die Religion und ein großer Gewinn für den König, der ihn, wie man sagt, sehr ehrenvoll behandelt.«
»Ihr kommt von Paris?« unterbrach Mergy, um das Gespräch abzulenken, »ist der Admiral angekommen? Ihr habt ihn sicherlich gesehen? Wie geht es ihm jetzt?«
»Er kam mit dem Hofe von Blois, als wir wegritten. Es geht ihm ausgezeichnet, er ist frisch und munter. Noch zwanzig Bürgerkriege hat er im Leibe, der liebe Mensch! Seine Majestät behandelt ihn mit so großer Auszeichnung, daß alle Papisten vor Ärger platzen.«
»Wirklich? Der König wird ja seine Verdienste nie genug würdigen können.«
»Gestern übrigens habe ich gesehen, wie der König auf der Treppe des Louvre dem Admiral die Hand drückte. Der Herzog von Guise, der hinter ihm ging, sah erbärmlich aus, wie ein verprügelter Dachshund, und ich, wißt Ihr, was ich dachte? Es kam mir vor, als ob ich den Mann sähe, der auf dem Jahrmarkt den Löwen zeigt; er läßt ihn die Pfote geben wie einen Hund, aber wenn Gilles auch gute Miene zum bösen Spiel macht, so vergißt er doch nicht, daß die Tatze, die er hält, fürchterliche Krallen hat. Ja, bei meinem Bart, man hätte meinen können, der König fühle die Krallen des Admirals.«
»Des Admirals Arm reicht weit«, sagte der Kornett. – Dies war eine sprichwörtliche Redensart in der protestantischen Armee.
»Er ist noch ein sehr schöner Mann für sein Alter«, bemerkte Mademoiselle Mila.
»Mir wäre er als Geliebter lieber als irgendein junger Papist«, setzte Mademoiselle Trudchen, die Freundin des Kornetts, hinzu.
»Er ist die Stütze der Religion«, sagte Mergy, um auch sein Teil zu den Lobeserhebungen beizutragen.
»Ja, aber für die Disziplin ist er verteufelt streng«, sagte der Hauptmann kopfschüttelnd. Sein Kornett zwinkerte bedeutungsvoll mit den Augen und verzog sein dickes Gesicht zu einer Grimasse, die ein Lächeln sein sollte.
»Das hätte ich von Euch nicht erwartet, Hauptmann«, sagte Mergy, »von Euch, einem alten Soldaten, daß Ihr dem Admiral die strenge Manneszucht vorwerft, auf die er in seiner Armee hält.«
»Ja, gewiß ist Zucht vonnöten, man muß aber dem Soldaten auch Rechnung tragen für alle Mühen, die er erduldet, und darf ihm nicht verbieten, es sich wohl sein zu lassen, wenn er zufällig Gelegenheit dazu findet. Aber was, jeder Mensch hat seine Fehler; und obwohl er mich hat aufhängen lassen, wollen wir doch auf die Gesundheit des Admirals trinken.«
»Der Admiral hat Euch aufhängen lassen?« rief Mergy aus. »Für einen Gehenkten seid Ihr ja recht munter.«
»Ja, Sakrament! Er hat mich aufhängen lassen; aber ich bin nicht nachtragend, trinken wir auf seine Gesundheit.«
Ehe Mergy seine Fragen erneuern konnte, hatte der Hauptmann alle Gläser gefüllt, seinen Hut abgenommen und seinen Reitern befohlen, ein dreifaches Hurra auszubringen. Nachdem die Gläser geleert waren und der Lärm sich gelegt hatte, fing Mergy wieder an:
»Warum seid Ihr denn gehenkt worden, Hauptmann?«
»Einer Kleinigkeit wegen: ein elendes Kloster in Saintonge haben wir geplündert, und nachher ist es zufällig abgebrannt.«
»Ja, aber es waren nicht alle Mönche heraus«, unterbrach der Kornett und lachte aus vollem Halse über seinen Scherz.
»Ach, was liegt dran, ob diese Canaille etwas früher oder etwas später brennt? Der Admiral aber, könnt Ihr es glauben, Monsieur de Mergy, der Admiral wurde allen Ernstes böse; er ließ mich festnehmen, und ohne viel Umstände hatte mich der Generalprofos in den Klauen. Alle Edelleute und alle vornehmen Herren, die um ihn waren, bis zu Monsieur de La Noue, von dem man weiß, daß er mit den Soldaten nicht sanft verfährt – denn La Noue knüpft auf, und er knüpft nicht los – , und alle Hauptleute baten ihn, mir zu vergeben; er schlug es glatt ab. Beim Wolfsbauch, wie war er zornig! Er zerbiß seinen Zahnstocher vor Wut; und Ihr kennt das Sprichwort: Gott behüte uns vor den Vaterunsern des Monsieur de Montmorency und vor dem Zahnstocher des Monsieur Admiral! – ›Gott verzeih mir!‹ sagte er. ›Die Marodiererei muß umgebracht werden, solange sie noch ein kleines Mädchen ist, läßt man sie zu einer Dame heranwachsen, dann bringt sie uns um.‹ Daraufhin kommt der Geistliche mit seinem Gebetbuch unterm Arm; wir werden beide unter eine gewisse Eiche geführt... Mir scheint, ich sehe sie noch, mit einem vorgestreckten Ast, der eigens dazu gewachsen schien; man legt mir den Strick um den Hals ... sooft ich an diesen Strick denke, wird mir die Kehle trocken wie Zunder.«
»Hier habt Ihr etwas zum Anfeuchten«, sagte Mila und füllte das Glas des Erzählers bis zum Rand.
Der Hauptmann leerte es auf einen Zug und fuhr folgendermaßen fort: »Ich kam mir nur mehr wie eine Eichel vor; da fiel mir ein, zum Admiral zu sagen: ›Ach Monseigneur, hängt man so einen Mann, der das Todesbataillon bei Dreux geführt hat?‹ Ich sehe, wie er seinen Zahnstocher ausspuckt und einen andern nimmt. Da sagte ich mir: Schön, das ist ein gutes Zeichen. Er rief den Hauptmann Cormier heran und sprach leise mit ihm; dann sagte er zum Profos:›Vorwärts, man ziehe den Mann in die Höhe!‹ – Und darauf dreht er sich auf dem Absatz um und geht davon. Man zieht mich also wirklich in die Höhe, aber der wackere Cormier reißt den Degen heraus und haut alsogleich den Strick durch, so daß ich von meinem Ast herunterfalle, rot wie ein gesottener Krebs.«
»Ich wünsche Euch Glück«, sagte Mergy, »daß Ihr so leichten Kaufes davongekommen seid.« Er betrachtete den Hauptmann aufmerksam und schien etwas bedrückt, sich in Gesellschaft eines Menschen zu befinden, der gerechterweise den Galgen verdient hatte; in diesen unglückseligen Zeiten waren aber Verbrechen so häufig, daß man sie nicht mit der gleichen Strenge beurteilen konnte, wie man es heutzutage tut. Die Grausamkeiten der einen Partei rechtfertigten einigermaßen die Repressalien der andern, und der religiöse Haß erstickte beinahe jedes Gefühl nationaler Zugehörigkeit. Übrigens begannen, um die Wahrheit zu sagen, die heimlichen Lockungen von Mademoiselle Mila, die ihm immer hübscher erschien, und die Betäubung des Weines auf sein jugendliches Gehirn erfolgreicher zu wirken als auf die harten Schädel der deutschen Reiter, und dieses alles gab ihm eine außergewöhnliche Nachsicht für seine Tischgenossen.
»Ich habe den Hauptmann acht Tage lang in einem gedeckten Wagen versteckt«, sagte Mila, »und ließ ihn nur nachts heraus.«
»Und ich«, fügte Trudchen hinzu, »brachte ihm zu essen und zu trinken: er kann es bezeugen.«
»Der Admiral stellte sich sehr aufgebracht gegen Cormier; aber das war alles ein abgekartetes Possenspiel der beiden. Was mich betrifft, so blieb ich lange bei der Nachhut der Armee und wagte es niemals, mich vor dem Admiral zu zeigen. Endlich bei der Belagerung von Longnac entdeckte er mich im Laufgraben und sagte zu mir: ›Dietrich, lieber Freund, da du nicht aufgehängt worden bist, so laß dich erschießen.‹ Und er zeigte mir die Bresche; ich verstand, was er meinte, lief tapfer Sturm und stellte mich am nächsten Tage auf der Hauptstraße vor, meinen Hut in der Hand, der von einem Büchsenschuß durchlöchert war. – ›Monseigneur‹, sagte ich, ›ich bin erschossen worden, wie ich gehenkt worden bin.‹ Er lächelte und gab mir seine Börse mit den Worten: ›Da hast du etwas, um dir einen neuen Hut zu kaufen.‹ – Seit diesem Tage sind wir immer gute Freunde gewesen. – Ach, wie schön war die Plünderung der Stadt Longnac! Das Wasser läuft mir im Munde zusammen, wenn ich daran denke!«
»Ach, die schönen Seidenkleider!« rief Mademoiselle Mila. »Und was für eine Menge schöner Wäsche«, rief Mademoiselle Trudchen. »Wie haben wir's uns wohl sein lassen bei den Nonnen des großen Klosters!« sagte der Kornett. »Zweihundert berittene Scharfschützen im Quartier bei hundert Klosterfrauen!...«
»Mehr als zwanzig haben dem Papismus abgeschworen«, sagte Mila, »so sehr fanden sie die Hugenotten nach ihrem Geschmack.«
»Das war damals schön«, rief der Hauptmann aus, »unsere berittenen Bogenschützen in den Meßgewändern der Priester zur Schwemme reiten zu sehen; unsere Pferde fraßen den Hafer vom Altar, und wir tranken den guten Wein der Geistlichen aus ihren silbernen Kelchen.«
Er wandte den Kopf, um zu trinken zu verlangen, und erblickte den Wirt, der mit gefalteten Händen seine Augen mit einem Ausdruck unaussprechlichen Abscheus zum Himmel erhob.
»Dummkopf!« sagte achselzuckend der tapfere Dietrich Hornstein. »Wie kann ein Mensch dumm genug sein, um an die Albernheiten der papistischen Geistlichen zu glauben! – Stellen Sie sich vor, Monsieur de Mergy, in der Schlacht von Montcontour habe ich mit einem Schuß einen Edelmann des Herzogs von Anjou getötet, und wie ich ihm sein Wams abnehme, was glauben Sie, was ich auf seinem Leib sah? Ein großes Stück Seide, ganz mit Namen von Heiligen bedeckt. Er glaubte sich dadurch gegen Kugeln gefeit. Zum Donner, ich habe es ihm beigebracht, daß kein Skapulier einer protestantischen Kugel widersteht.«
»Ja, Skapuliere!« unterbrach der Kornett; »aber in meiner Heimat verkauft man Pergamente, die gegen Blei und Eisen feien.«
»Mir wäre ein gutgeschmiedeter Panzer aus edlem Stahl lieber«, sagte Mergy, »einer von denen, wie sie Jakob Leschot macht in den Niederlanden.«
»Hört aber«, begann der Hauptmann wieder, »man kann nicht leugnen, daß man unverwundbar machen kann; ich selber, so wie ich mit Euch rede, habe in Dreux einen Edelmann gesehen, der von einem Büchsenschuß mitten in die Brust getroffen worden war; er kannte das Rezept der Salbe, die unverwundbar macht, und hatte sich unter seinem Büffelwams damit eingerieben; nun, und nicht einmal der schwarzrote Fleck war zu sehen, den sonst eine Prellung zurückläßt.«
»Und glaubt Ihr nicht, daß vielmehr das Büffelleder, von dem Ihr sprecht, genügte, den Schuß abzuschwächen?«
»Ach, ihr Franzosen wollt an gar nichts glauben! Was würdet Ihr aber sagen, wenn Ihr wie ich einen schlesischen Polizeisoldaten gesehen hättet, der seine Hand auf den Tisch legte, und niemand konnte sie verwunden, auch mit den stärksten Messerstichen nicht? – Aber Ihr lacht und glaubt nicht, daß es möglich sei? Fragt Mila! Seht Euch dies Mädchen an! Sie stammt aus einer Gegend, in welcher die Zauberer so alltäglich sind wie in diesem Lande die Mönche; die könnte Euch schreckliche Geschichten erzählen! Manchmal, wenn wir an langen Herbstabenden im Freien um das Feuer sitzen, stehen mir die Haare zu Berge von den Geschichten, die sie erzählt.«
»Ich wäre entzückt, wenn ich eine davon zu hören bekäme«, sagte Mergy, »schöne Mila, macht mir dies Vergnügen.«
»Ja, Mila«, drängte der Hauptmann, »erzähle uns irgendeine Geschichte, während wir unsere Flaschen austrinken.«
»Also hört zu«, sagte Mila, »und Ihr, junger Edelmann, der Ihr nichts glauben wollt, behaltet, wenn ich bitten darf, Eure Zweifel für Euch.«
»Wie könnt Ihr sagen, daß ich an nichts glaube?« antwortete Mergy leise; »meiner Treu, ich glaube, daß Ihr mich verhext habt, denn ich bin schon ganz verliebt in Euch.«
Mila stieß ihn sanft zurück, denn Mergys Mund berührte fast ihre Wange; und nachdem sie rasche Blicke nach rechts und links geworfen hatte, um sich zu vergewissern, daß alle zuhörten, begann sie folgendermaßen:
»Hauptmann, Ihr seid sicherlich in Hameln gewesen?«
»Nein, niemals.« »Und Ihr, Kornett?«
»Ich auch nicht.«
»Wie, ist denn keiner hier, der in Hameln gewesen wäre?«
»Ich habe ein Jahr dort verbracht«, sagte einer der Reiter und trat vor.
»Nun also, Fritz, hast du die Kirche von Hameln gesehen?«
»Mehr als hundertmal.«
»Und die gemalten Fenster?«
»Gewiß.«
»Und was war auf den Fensterscheiben gemalt?«
»Auf den Scheiben?... Auf dem linken Fenster war, glaube ich, ein schwarzer Mann, der Flöte spielt, und kleine Kinder laufen ihm nach.«
»Richtig, die Geschichte von diesem schwarzen Mann und diesen Kindern will ich Euch erzählen.
Vor vielen Jahren wurden die Bewohner von Hameln von einer unzähligen Menge von Ratten gequält, die in so dichten Scharen von Norden kamen, daß der Boden davon ganz schwarz war und daß ein Fuhrmann es nicht gewagt hätte, seine Pferde über einen Weg zu führen, auf dem diese Tiere gerade vorüberzogen. Im Handumdrehen war alles vertilgt; und diesen Ratten war es leichter, eine Tonne Getreide in einer Scheune aufzufressen, als uns, ein Glas von diesem guten Wein zu trinken.« Sie trank, wischte sich den Mund und fuhr fort:
»Mausefallen, Rattenfallen, Schlingen, Gift, alles war vergeblich. Aus Bremen hatte man ein Schiff mit elfhundert Katzen kommen lassen; aber nichts half. Wenn man tausend umbrachte, kamen zehntausend wieder, die noch hungriger waren als die ersten. Mit einem Wort, wenn man gegen diese Landplage keine Abhilfe gefunden hätte, so wäre kein einziges Getreidekorn übriggeblieben, und alle Einwohner wären Hungers gestorben.
Da stellte sich an einem gewissen Freitag dem Bürgermeister der Stadt ein großer Mann vor, sonnenverbrannt, hager, mit großen Augen, einem Mund bis zu den Ohren, in ein rotes Wams gekleidet, mit einem spitzen Hut, weiten bebänderten Hosen und grauen Strümpfen und in Schuhen, die mit feuerfarbigen Rosetten verziert waren. An der Seite hatte er eine kleine Tasche hängen. Mir ist, ich sehe ihn noch.«
Aller Augen wandten sich unwillkürlich nach der Wand, auf die Mila ihre Blicke heftete.
»Habt Ihr ihn denn gesehen?« fragte Mergy.
»Ich nicht, aber meine Großmutter; und sie erinnerte sich so gut an sein Gesicht, daß sie sein Bild hätte malen können.«
»Und was sagte er zum Bürgermeister?«
»Er bot ihm an, für hundert Dukaten die Stadt von der Plage zu befreien, die sie verheerte. Ihr könnt Euch denken, daß der Bürgermeister und die Bürger einschlugen. Sogleich zog der Fremde eine bronzene Flöte aus der Tasche, stellte sich auf den Marktplatz vor die Kirche, der er aber, beachtet das wohl, den Rücken zuwandte, und fing an, eine sonderbare Weise zu spielen, wie ein deutscher Flötenspieler sie niemals gespielt hat. Und wie sie nun die Weise hören, laufen aus allen Speichern, aus allen Mauerlöchern, unter allen Dachsparren und Dachziegeln hervor Ratten und Mäuse zu Hunderten, zu Tausenden auf ihn zu. Der Fremde bewegte sich, immer auf der Flöte spielend, gegen die Weser zu; da zog er seine Schuhe aus, ging ins Wasser, und alle Ratten von Hameln folgten ihm und ertranken sogleich. Nur eine einzige blieb in der Stadt zurück, und gleich sollt Ihr sehen, warum. Der Zauberer fragte einen Nachzügler, der noch nicht in die Weser gegangen war, warum Klauß, die weiße Ratte, noch nicht gekommen sei.
›Herr‹, antwortete die Ratte, ›sie ist so alt, daß sie nicht mehr gehen kann.‹
›Dann hole du sie selbst‹, antwortete der Zauberer. – Und sofort machte die Ratte kehrt gegen die Stadt zu und kam bald darauf mit einer dicken, alten, weißen Ratte zurück, die so alt war, so alt, daß sie sich kaum mehr schleppen konnte. Die jüngere von den beiden Ratten zog die alte am Schwanz, und so gingen beide in die Weser und ertranken wie ihre Gefährten. So wurde die Stadt von ihnen gesäubert. Als aber der Fremde sich im Rathaus einfand, um die versprochene Belohnung in Empfang zu nehmen, dachten der Bürgermeister und die Bürger, sie hätten nun nichts mehr von den Ratten zu befürchten, und glaubten, sie könnten mit einem schutzlosen Menschen leicht fertig werden, und so schämten sie sich nicht, ihm statt der versprochenen hundert Dukaten nur zehn anzubieten. Der Fremde erhob Einspruch: man schickte ihn zum Teufel. Er drohte, sich teuer bezahlt zu machen, wenn sie den Handel nicht wörtlich einhielten. Die Bürger lachten aus vollem Halse bei dieser Drohung, setzten ihn vor die Tür des Rathauses und nannten ihn den schönen Rattenfänger! Eine Beschimpfung, die die Kinder der Stadt wiederholten, indem sie ihm bis zum Neuen Tor nachliefen. Am nächsten Freitag, um die Mittagsstunde, erschien der Fremde wieder auf dem Marktplatz, diesmal trug er aber einen purpurroten Hut, der auf sonderbare Weise aufgestülpt war. Er zog eine Flöte aus seiner Tasche, die ganz anders war als die erste, und kaum hatte er angefangen, darauf zu spielen, so folgten ihm alle Knaben von sechs bis fünfzehn Jahren und gingen mit ihm aus der Stadt.«
»Und ließen die Bewohner von Hameln sie wegführen?« fragten gleichzeitig Mergy und der Hauptmann.
»Sie folgten ihnen bis zum Koppenberg zu einer Höhle, die jetzt zugeschüttet ist. Der Flötenspieler betrat die Höhle, und alle mit ihm. Einige Zeit hörte man noch den Ton der Flöte; allmählich verlor er sich, und endlich hörte man nichts mehr. Die Kinder waren verschwunden, und seitdem hat man nichts mehr von ihnen gehört.«
Die Zigeunerin hielt inne, um auf den Gesichtern ihrer Zuhörer den Eindruck zu beobachten, den ihre Erzählung gemacht hatte.
Der Reiter, der in Hameln gewesen war, nahm das Wort und sagte:
»Diese Geschichte ist so wahr, daß man in Hameln von irgendeinem außergewöhnlichen Ereignis sagt: es hat sich zwanzig Jahre, zehn Jahre nach dem Auszug der Kinder begeben ... der Herr von Falkenstein plünderte unsere Stadt sechzig Jahre nach dem Auszug unserer Kinder.«
»Das merkwürdigste aber ist«, sagte Mila, »daß zu gleicher Zeit sehr weit von dort, in Transsylvanien, Kinder auftauchten, die gut Deutsch sprachen und die nicht sagen konnten, woher sie kamen. Sie verheirateten sich im Lande, lehrten ihren Kindern ihre Sprache, und davon kommt es, daß bis heute in Transsylvanien Deutsch gesprochen wird.«
»Und das sind die Kinder von Hameln, die der Teufel dorthin entführt hat?« fragte Mergy lächelnd.
»Ich rufe den Himmel zum Zeugen an, daß es wahr ist«, rief der Hauptmann aus, »denn ich bin in Transsylvanien gewesen, und ich weiß, daß man dort Deutsch spricht, während ringsum ein höllisches Kauderwelsch geredet wird.«
Die Bestätigung des Hauptmanns war immerhin soviel wert wie manch anderer Beweis, deren es so viele gibt.
»Soll ich Euch wahrsagen?« wandte sich Mila an Mergy.
»Gern«, antwortete dieser und schlang seinen linken Arm um die Taille der Zigeunerin, während er die offene Rechte hinhielt.
Mila betrachtete sie nahezu fünf Minuten, ohne zu sprechen, und schüttelte von Zeit zu Zeit nachdenklich den Kopf.
»Nun, schönes Kind, werde ich die Frau, die ich liebe, zur Geliebten haben?«
Mila gab ihm einen Klaps auf die Hand. – »Heil und Unheil«, sagte sie; »blaue Augen bringen Gutes und Böses. Das schlimmste ist, daß du dein eigenes Blut vergießen wirst.«
Der Hauptmann und der Kornett schwiegen und schienen gleichermaßen von dem unheimlichen Schluß der Prophezeiung angetan.
Der Wirt schlug abseits große Kreuzzeichen.
»Ich will glauben, daß du wirklich eine Zauberin bist, wenn du mir sagen kannst, was ich nachher tun werde.«
»Du wirst mich umarmen«, murmelte die Zigeunerin ihm ins Ohr.
»Sie ist eine Hexe!« rief Mergy aus und umarmte sie. Er fuhr fort, sich leise mit der schönen Wahrsagerin zu unterhalten, und ihr gutes Einvernehmen schien mit jedem Augenblick zu wachsen. Trudchen nahm eine Art von Mandoline, die annähernd alle Saiten hatte, und präludierte einen deutschen Marsch. Dann, als sie einen Kreis von den Soldaten um sich sah, sang sie in ihrer Sprache ein Kriegslied, in dessen Kehrreim die deutschen Reiter aus vollem Halse einstimmten. Der Hauptmann, durch ihr Beispiel angeregt, fing mit einer Stimme, daß alle Gläser zu zerspringen drohten, ein altes hugenottisches Lied zu singen an, dessen Melodie zum mindesten ebenso barbarisch war wie der Text:
»Den Prinzen von Condé, Den hat getötet man, Jedoch den Admiral Zu Pferd man sehen kann. La Rochfoucauld es ist, Der jagt jeden Papist, Papist, Papist, Papist.«
Alle Reiter, vom Weine erhitzt, fingen an, ein jeder ein anderes Lied zu singen; Platten und Flaschen bedeckten mit ihren Scherben den Fußboden; die Küche widerhallte von Flüchen, Lachen und Trinkliedern. Bald jedoch machte der Schlaf im Verein mit der Wirkung des Weines seine Macht über die meisten der Teilnehmer an diesem wüsten Gelage geltend; der Kornett schleppte sich wankend in sein Zimmer, nachdem er zwei Posten an seine Tür gestellt hatte; der Hauptmann, der das Gefühl für die gerade Linie noch wahrte, ging ohne Zickzackbewegung die Treppe hinan zu dem Zimmer des Wirtes, das er sich als das beste im ganzen Wirtshaus ausgesucht hatte.
Und Mergy und die Zigeunerin? – Noch vor dem Liede des Hauptmanns waren sie beide verschwunden.
Am Tag nach dem Feste
Je dis que je veux avoir de l'argent tout à l'heure.
Molière, Les Précieuses ridicules
Es war längst heller Tag, als Mergy erwachte, den Kopf noch etwas wirr von den Erinnerungen des vorhergehenden Abends. Seine Kleider waren in buntem Durcheinander im Zimmer verstreut, und sein Mantelsack lag offen auf dem Fußboden. Er setzte sich auf, betrachtete eine Zeitlang dieses Bild der Zerstörung und rieb sich den Kopf, wie um sich zu besinnen. Seine Züge verrieten gleichzeitig Müdigkeit, Erstaunen und Unruhe.
Ein schwerer Schritt ließ sich auf der steinernen Treppe, die zu seinem Zimmer führte, vernehmen. Die Tür öffnete sich, ohne daß man es für nötig befunden hätte anzuklopfen, und der Wirt trat ein, mit einem noch verdrießlicheren Gesicht als am Abend vorher; es fiel aber nicht schwer, in seinen Blicken an Stelle des Ausdrucks von Angst einen solchen von Unverschämtheit zu lesen.
Er warf einen raschen Blick auf das Zimmer und bekreuzigte sich, wie von Entsetzen erfaßt, beim Anblick solcher Unordnung.
»Oho, junger Edelmann, noch im Bett?« rief er aus. »Vorwärts, jetzt heißt es aufstehen, denn wir haben noch unsere Rechnung zu machen.«
Mergy gähnte auf erschreckliche Weise und streckte ein Bein aus dem Bett.
»Woher diese Unordnung? Warum ist mein Mantelsack offen?« fragte er in einem Tone, der mindestens ebenso unzufrieden war wie der des Wirtes.
»Warum, warum?« antwortete dieser. »Was weiß ich? ich kümmere mich doch nicht um Euren Mantelsack. Ihr habt mein Haus in eine noch viel größere Unordnung gebracht. Aber beim heiligen Eustachius, meinem guten Namenspatron, Ihr werdet mir's bezahlen.«
Während er sprach, zog Mergy seine scharlachroten Kniehosen an, und durch die Bewegung, die er machte, fiel seine Börse aus der Tasche. Der Ton, den sie von sich gab, muß wohl anders gewesen sein, als er erwartete, denn er hob sie sofort beunruhigt auf und öffnete sie.
»Ich bin bestohlen worden!« rief er und wandte sich zu dem Wirt.
An Stelle der zwanzig Goldtaler, die seine Börse enthalten hatte, fand er deren nur zwei. Meister Eustache zuckte die Achseln und lächelte verächtlich.
»Ich bin bestohlen worden!« wiederholte Mergy und band in aller Eile seinen Gürtel fest. »Ich hatte zwanzig Goldtaler in dieser Börse, und ich verlange sie zurück: in Eurem Hause sind sie mir weggenommen worden.«
»Bei meinem Bart, das freut mich sehr!« sagte der Wirt unverschämt; »das wird Euch lehren, mit Hexen und Dirnen zu buhlen. Aber«, fügte er etwas leiser hinzu, »gleich und gleich gesellt sich gern. Alle diese feinen Galgenvögel, Irrgläubigen, Zauberer und Diebe gesellen sich und passen zueinander.«
»Was sagst du da, Halunke!« schrie Mergy, der in um so heftigeren Zorn geriet, als er innerlich die Berechtigung des Vorwurfs fühlte; und wie jeder Mensch, wenn er unrecht hat, ergriff er die Gelegenheit zu einem Streit beim Schöpf.
»Ich sage«, erwiderte der Wirt mit erhobener Stimme und stemmte die Faust in die Seite, »ich sage, daß Ihr in meinem Hause alles zerbrochen habt, und ich verlange, daß Ihr mir alles bis zum letzten Heller bezahlt.«
»Ich werde meine Zeche bezahlen, und keinen Deut mehr. Wo ist der Hauptmann Corn ... Hornstein?«
»Man hat mir zweihundert Flaschen«, fuhr der Wirt immer lauter schreiend fort, »man hat mir mehr als zweihundert Flaschen guten alten Weines ausgetrunken, aber Ihr seid mir dafür verantwortlich.«
Mergy war unterdessen mit dem Anziehen fertig geworden.
»Wo ist der Hauptmann?« schrie er mit dröhnender Stimme.
»Er ist vor mehr als zwei Stunden abgezogen, und möge er zum Teufel gehen samt allen Hugenotten, bis wir sie alle verbrennen!«
Eine kräftige Ohrfeige war die einzige Antwort, die Mergy in diesem Augenblicke fand. Die Überraschung und die Wucht des Schlages ließen den Wirt zwei Schritte zurücktaumeln. Der Horngriff eines langen Messers kam aus seiner Hosentasche zum Vorschein; er griff danach. Sicherlich wäre ein großes Unglück geschehen, wenn er der ersten Regung seines Zornes gefolgt wäre. Die Klugheit mäßigte jedoch die Wirkungen seines Ingrimms, da er bemerkte, wie Mergy die Hand nach dem Kopfende des Bettes ausstreckte, wo ein langer Degen hing. Sofort verzichtete er auf einen ungleichen Kampf und stürzte eiligst die Treppe hinunter, aus Leibeskräften schreiend: »Mörder! Feuer!«
Herr des Schlachtfelds, aber sehr beunruhigt über die Folgen seines Sieges, schnallte Mergy seinen Gürtel um, steckte die Pistolen ein, machte seinen Mantelsack zu, nahm ihn in die Hand und beschloß, beim nächsten Richter Klage zu führen. Er öffnete die Tür und setzte den Fuß auf den ersten Treppenabsatz, als eine feindliche Schar ihm unvermutet entgegentrat.
Voran ging der Wirt, eine alte Hellebarde in der Hand; drei Küchenjungen, mit Bratspießen und Stöcken bewaffnet, folgten ihm auf dem Fuße; ein Nachbar mit einer verrosteten Büchse bildete die Nachhut. Von keiner Seite hatte man ein so plötzliches Zusammentreffen erwartet, nur sechs oder sieben Stufen trennten die beiden feindlichen Parteien.
Mergy ließ seinen Mantelsack fallen und ergriff eine seiner beiden Pistolen. Diese feindselige Bewegung ließ in Meister Eustache und seinen Helfershelfern die Erkenntnis ihrer mangelhaften Schlachtordnung aufdämmern. Gleich den Persern in der Schlacht bei Salamis hatten sie verabsäumt, eine Stellung zu wählen, in der ihre Zahl sich vorteilhaft hätte entfalten können. Der einzige aus der Schar, der eine Feuerwaffe trug, konnte sich dieser nicht bedienen, ohne seine Vordermänner zu verwunden, während der Hugenotte mit seinen Pistolen die ganze Treppenlänge bestreichen konnte und alle mit einem einzigen Schuß über den Haufen zu werfen drohte. Das leichte Knacken des Hahns, als Mergy die Pistole lud, schallte in ihren Ohren und erschien ihnen beinahe so erschreckend wie das Losgehen der Waffe selbst. In spontaner Bewegung machte die Kolonne kehrt und suchte in der Küche ein weitläufigeres und vorteilhafteres Schlachtfeld. In der Verwirrung, die bei einem überstürzten Rückzug unausbleiblich ist, geriet dem Wirt, der seine Hellebarde drehen wollte, diese zwischen die Beine, und er fiel hin. Als großmütiger Gegner verzichtete Mergy darauf, von seinen Waffen Gebrauch zu machen, und begnügte sich damit, den Fliehenden seinen Mantelsack nachzuwerfen, der wie ein Felsblock auf sie niederfiel und, sein Tempo bei jeder Stufe beschleunigend, noch vollends die wildeste Flucht hervorrief. Die Treppe war vom Feinde gesäubert, und die zerbrochene Hellebarde blieb als Trophäe zurück.
Mergy stieg rasch zur Küche hinab, wo der Feind sich in einer Linie neu formiert hatte. Der Büchsenträger hielt die Waffe hoch und blies auf die angezündete Lunte. Blutbedeckt hielt sich der Wirt, dessen Nase beim Fallen auf das heftigste verletzt worden war, hinter seinen Freunden, gleich dem verwundeten Menelaos hinter den Schlachtreihen der Griechen. Statt Machaon und Podaleirios wischte seine Frau mit wirrem Haar und aufgeknüpfter Haube ihm das Gesicht mit einem schmutzigen Handtuch ab. Ohne Zögern ergriff Mergy seine Maßregeln. Er ging geradenwegs auf den zu, der die Büchse hielt, und richtete den Pistolenlauf auf seine Brust.
»Wirf die Lunte weg, oder du bist des Todes!« schrie er ihn an.
Die Lunte fiel zu Boden, und Mergy setzte den Stiefel auf die brennende Zündschnur und löschte sie aus. Sofort legten sämtliche Verbündeten gleichzeitig die Waffen nieder.
»So«, sagte Mergy, sich an den Wirt wendend, »Euch wird die kleine Züchtigung, die Ihr von mir erhalten habt, zweifellos lehren, künftig Fremde mit etwas mehr Höflichkeit zu behandeln. Wenn ich wollte, könnte ich Euch vom Landvogt des Ortes Euer Aushängeschild entziehen lassen; aber ich bin nicht bösartig. Wieviel bin ich für meine Zeche schuldig?«
Als Meister Eustache merkte, daß Mergy seine fürchterlichen Pistolen entladen und während des Sprechens wieder in seinen Gürtel gesteckt hatte, faßte er wieder etwas Mut, und während er fortfuhr, sich abzuwischen, murmelte er betrübt:
»Die Platten zerschlagen, die Leute prügeln, guten Christen die Nase brechen... einen Teufelslärm vollführen... ich wüßte wirklich nicht, wie man nach alledem einen ehrlichen Mann entschädigen könnte.«
»Also gut«, sagte Mergy lachend, »für Eure zerschundene Nase bezahle ich Euch, was sie nach meiner Meinung wert ist. Für Eure zerbrochenen Platten müßt Ihr Euch an die Reiter wenden, das ist ihre Sache. Fragt sich nur noch, was ich für mein gestriges Abendessen schuldig bin.«
Der Wirt sah seine Frau, seine Küchenjungen und seinen Nachbarn an, als wollte er zugleich um Rat und um Schutz bitten.
»Die Reiter, die Reiter!« sagte er, »von denen Geld zu sehen, ist nicht so einfach; ihr Hauptmann hat mir drei Livres gegeben und der Kornett einen Fußtritt.«
Mergy nahm einen der Goldtaler, die ihm noch verblieben waren.
»Nun«, sagte er, »wir wollen als gute Freunde auseinandergehen«, und er warf ihn Meister Eustache zu, der, anstatt die Hand hinzuhalten, ihn verächtlich auf den Boden fallen ließ.
»Einen Taler«, schrie er, »einen Taler... und hundert Flaschen zerschlagen; einen Taler und ein Haus zerstört; einen Taler und die Leute verprügelt!«
»Einen Taler, nur einen Taler«, fing die Frau in ebenso jämmerlichem Tone an. »Es kommen katholische Edelleute hierher, die auch manchmal ein bißchen lärmen, aber sie kennen wenigstens den Wert der Sachen.«
Wäre Mergy besser bei Kasse gewesen, so hätte er sicherlich den Ruf der Freigebigkeit seiner Partei verteidigt.
»Das mag wohl sein«, antwortete er trocken, »diese katholischen Herren sind aber auch nicht bestohlen worden. Entscheidet Euch«, fügte er hinzu; »nehmt diesen Taler, oder Ihr bekommt gar nichts.« Und er trat einen Schritt vorwärts, als wollte er ihn wieder an sich nehmen.
Die Wirtin hob ihn unverzüglich auf.
»Vorwärts, führt mir mein Pferd vor; und du, laß deinen Bratspieß fahren und trage meinen Mantelsack.«
»Euer Pferd, edler Herr?« sagte einer der Diener des Meisters Eustache und verzog sein Gesicht.
Der Wirt hob trotz seines Kummers den Kopf, und seine Augen blitzten einen Augenblick in boshafter Freude. »Ich will es Euch selber vorführen, guter Herr; ich will Euch Euer gutes Pferd vorführen.« Und er ging hinaus, das Handtuch immer noch an seine Nase haltend. Mergy folgte ihm.
Wie groß war aber sein Erstaunen, als er statt seines schönen Fuchses, der ihn hergetragen hatte, ein kleines, altes, schwarz und weiß geschecktes Pferd sah, das sich beim Fallen die Knie verletzt hatte und außerdem noch durch eine breite Narbe am Kopfe entstellt war; statt seines Sattels aus feinem flandrischem Samt sah er einen solchen aus eisenbeschlagenem Leder, wie ihn die Soldaten gebrauchten.
»Was hat das zu bedeuten? Wo ist mein Pferd?«
»Eure Herrlichkeit mag sich die Mühe nehmen und die Herren protestantischen Reiter fragen«, antwortete der Wirt mit geheuchelter Unterwürfigkeit; »diese würdigen Fremden haben es mit sich fortgeführt: sie müssen sich wohl geirrt haben wegen der Ähnlichkeit.«
»Ein schönes Pferd!« sagte einer der Küchenjungen. »Ich möchte wetten, daß es nicht mehr als zwanzig Jahre alt ist.«