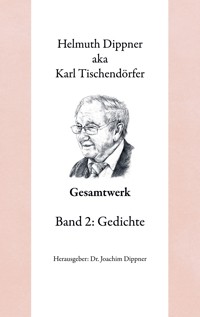
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Dieser Titel ist der zweite Band des Gesamtwerks von Helmuth Dippner und enthält Gedichte.
Das E-Book Gesamtwerk 2 wird angeboten von BoD - Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
sinnlich intellektuelle Genauigkeit,leuchtende Bildsprache,Fixierung von Augenblicken,Schönheit und Brüchigkeit,Leben und Träume
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Anmerkungen des Herausgebers
Statt eines Vorwortes
Der frühe Helmuth Dippner
In anderen Sprachen
Das Bleibende
Geleit
Erwachen
Weg zwischen Gärten
Regenfahrt im Bayerischen Wald
Das Gewitter
An den Geliebten
Jene Abende
Vor einem Brunnen
Angst
Terzinen auf den Tod des Vaters
Landstreicher Herbst
Verwelkte Sonnenblume
In der Frühe
Stillleben
Mit der Zeit
Später Sommer
Der Falke
Hora incerta
Collagen
Diskussion
Gelassenheit
In dieser Stadt
Serenade
Suche
Nachtschatten-Gedanken
Nachdenkliche Nachtfahrt
Die Wolke
Gestreifter Tag
Veränderungen
Gewitter
Nachtvogel
Das Ewige in einer Rose Glut
Sommertag 2
Nachtstück
Morgen
Trüber Tag
Press deinen Kopf um
Boothia Felix
Nachtfahrt
Die Nacht von Bethlehem
Ohne Titel
Liebe ist anders
An den Dichter
Unerfülltes Leben
Im April
Wind am Fluss
Die weißen und die schwarzen Vögel
Wo?
Vor einem Brunnen
Wort, Dolch oder Brücke?
Schlaf
Sommerlicher Weg
Schau in die Nacht
Am Stauwehr
Löwenzahn
Planlandschaft
Abendliche Terzinen
Prozession
Draußen vor der Tür
Schattenspiel
Polarkreis in Brusthöhe
Ausgesetzt
Im Gegenlicht
Aus einem April
Regentag
Entwurf einer Landschaft
Sommer im Isarmoos
Septembermorgen
Impromptu
Winterlandschaft
Das Werk Karl Tischendörfers
Schwüler Tag
Konversation
Durchs Rheintal
Derriere le miroir
Forschungsauftrag
Die Weisheit der Fichten
Momentaufnahme
Januar
Blau
Oktoberpsalm
Ausgesetzt
Eines Tages
Nebel-Parolen
Ich sehe den Tag kommen
Novembermorgen
Leere
Zeitinsel
Gesicht in der Menge
Gelassenheit
Auf dem Leuchtturm
Lichtlose Jahre
Fortsetzung der Märchen
Die Stillen im Lande
Luftstück
Warten
Traumtänzerin
März im Schöntal
Spiegelbild
Wo wir uns finden
Ein einfacher Satz
Ich achte auf Lauffeuer
Durchgänge
Einer setzt das Wort
Seltenheit
Unter dem Meer
Beschwörung
Keine Zeichen
Schneereste
Ankommen
Die Falltür
Am Floßhafen
Zwei Körper
Aufgehoben
Wie ein Volkslied
Dahinter
Bei geschlossenen Augen
Abschied von der Insel
Beschwörung
Die Muschel
Die weißen Steine
Mond und Wolke
Frau in den Dünen
Bleiben dürfen
Erinnerungs-Sonate
Unsere Wege
Brief
Nocturno
Im Gegenwind
Das Bleibende
Momentaufnahme
Unsere Zeit
Windstille
Treffpunkte
Brunnenstube
Die Zeitinsel
Graue Verse
Der Liebende
Lauffeuer
Interieur
Rückblick
Durchgänge
Rufe
Zwischen den Jahren
Wortfallen
Datumsgrenze
Konversation
Planlandschaft
Lebt sich leichter
Schweigespirale
Die Sandbank
Landüber, landunter
Vorfrühling
Man ist uns nicht grün
Keine Zeichen
Inselzeit
Zuneigung
Feierabend
Obertöne
Die Jahre, die Ringe
Das neue Ufer
Mit offenen Augen
Leere
Intermezzo
Der Pantomime
Fingerzeig
Steinsetzung
Pavane
Die Nichtssager
Wortfallen
Kurpark Baden-Baden
Nachsaison
Hauptbahnhof, z.B. Frankfurt
Frankfurt-Niederrad
Nach Darmstadt
Spessartherbst
Winterbild
Oktoberabend
Winterlicher Weg
Frühmorgens durch die Wetterau
Abend am Meer
Unter dem Meer
Das Alltägliche
Augenblick
Absichten
Das steigende Jahr
Fantasie
Mittagsgesicht
Winterschlaf
Krähen
Stimmen im Strom
Nachrichten
Wartet ein Weilchen
Worte wie junge Blätter
Eines Morgens
Raum der Stille
Nachruf
Beschwörung
Monolog
Wo ich wohne
Mir sind Raben zugeflogen
Von nichts die Rede
Erbe
Suche
Innehalten
Niemandsland
Gespräch
Es kann sein
Unterwegs
Nachtfahrt
Ländliche Bahnstation
Rauchfahnen
Flugplan
Ende August
Regentag
Frühherbst
Spät im Jahr
Plötzlich Rauhreif
Rückblick
Weiße Flecken
Probezeit
Zwischenhoch
Betäubter Tag
Altstadttreppe, Aschaffenburg
Park Schönbusch, Aschaffenburg
Am Keltergraben
An Jedermann
San Zeno di Montagna
Bardolino
Cannobio
Place Stanislas, Nancy
Place St. Pierre, Bar-le-Duc
Am Tyrifjord
Fluchtversuch
Schleifspur des Tages
Urformen
Hoffnung allein
Beim Anschauen der Wetterkarte
Verweigerung
Klopfzeichen
Verstrickung
A la mode
Aufbruch
Offene Horizonte
Maske
Unruhe
Angewiesen
Leben in Dünen
Leicht werden
Fortwährend Karneval
Nach der Schneeschmelze
Mit fünfzig Jahren
Keine Zeichen
Spuren
Münchhausen
Und nur ein Hauch von Schnee
Zeit der Stille
Ruhige Stunde am Mittag.
Fliegende Fische
Rückfahrt
Kirchheimer Dreieck
Nach Süden
Teestunde
Aus einem April
Märkische Winterreise
Sommertag
Befindlichkeit
Vielleicht
Die Sanduhr
Der letzte Tag
Plötzlich Kälte
Nachtfahrt
Ruhiger Morgen
Verlassenes Haus
Vorläufig
Die Greisin
Einzelne Bäume
Spät im März
Agadir
Elsterpfeil
Sommertag
Rückblick
Jeder Abend
Vokabeln
Maske
Schleifspur des Tages
Erben der Angst
Wasserscheide
Ende März
Lubko malt
Ländliche Gegend
Reisebericht
Weltende
Der späte Helmuth Dippner
Unsere Träume
Eure Hände
Fallen lassen
Deine Nähe
Trost
Lasciatemi cantare
Glückliche Tage
Die Erinnerung bleibt
Ernte
Schatten
Wegweiser
Dein Bild
Die Stillen im Lande
Allegro moderato
Lebensspuren
Gegenrede
Babel
Stichworte
Kartenhaus
Aufmerksam leben
Ablasszettel
Freiheit, schöne Partisanin
Konspirativ
Konspirativ 2
Was draußen vorgeht
Wen es angeht
Lautlose Veränderung
Blindekuh
Eines Tages werden hier Bienen hausen
Träume der Füchse
Erzähl es den Wölfen
Befindlichkeit
Mein Tag
Alltag
Nachtgedanken
Nicht programmiert
Vorsätze
Alter jüdischer Friedhof
Unter wachsenden Mond
Schwalben
Wanderung
Bilder einer Ausstellung
Nachruf
Herbstlektüre
An der Schwelle des Jahres
Provencalische Miniaturen
Mittag in der Provence
In Lothringen
Malta
Malta 2
Venedig
Wind in den Bäumen
Mit unseren Augen
Aus einem August
Oktobermorgen
Piemontesische Notizen
Lago Maggiore
Stresa
Isola Bella
Isola Pescatore
Isola Madre
Tronzano
Inselsommer
Das kalte Land
Zeiträume
Herbst-Sonett
Verlassener Garten
Lebenslauf
Weitere Werke
Anmerkungen des Herausgebers
Am 27. März 2018, seinem 93. Geburtstag, nahm mich mein Vater auf die Seite. „Junge“, sagte er, „ich habe in meinem Leben so viel geschrieben, ich habe beschlossen aufzuhören. Ich fühle mich leer und habe nichts mehr zu sagen. Außerdem habe ich in meinem Alter keine Lust mehr, mich mit den jungen Schnöseln von Lektoren herum zuärgern. Denen geht es nur ums Geld und nicht um Sprache. Wenn du willst, kannst du alles von mir haben und dich selbst mit dieser Mischpoke rumärgern.“ Ich war so unvorsichtig, ja zu sagen, denn ich wusste nicht, was mich erwartete. Es war ein Schrank voll mit Manuskripten von Kurzgeschichten, Theaterstücken und sehr vielen Gedichten, gefühlt eine halbe Tonne Papier. Seinen 94. Geburtstag wollte er nicht feiern. „94 ist kein Grund zu feiern, nächstes Jahr, wenn ich 95 werde, feiern wir wieder mal im großen Stil“, waren seine Worte. Diesen Geburtstag sollte er nicht mehr erleben. Am 10. Januar 2020 verstarb mein Vater, Helmuth Dippner.
Ich stand vor einem Berg Papier und vor einem Problem: Mein Vater hatte nie in seinem Berufsleben einen Computer oder ein Textverarbeitungssystem benutzt. Alles was er geschrieben hatte, schrieb er auf seiner Schreibmaschine. Um diese Texte in einen prozessierbaren Zustand zu versetzen, habe ich während der Jahre 2018–2024, der Coronazeit und der heißen Sommer, alles gescannt, formatiert, editiert etc. Während des Korrekturlesens kam ich den Texten näher und je mehr ich las, desto mehr kam ich zu der festen Überzeugung, dass ich eigentlich sehr wenig über meinen Vater wusste. Ich hatte mir immer das Gegenteil eingebildet. Aus diesem Grund fühlte ich mich auch ziemlich befangen, ein Vorwort mit einer Würdigung zu schreiben. Deshalb habe ich einen Freund der Familie, Pfarrer Markus Geißendörfer, der auch meinen Vater beerdigt hat, gebeten, mir die Trauerrede als Vorwort zur Verfügung zu stellen. Dafür danke ich Markus.
Ein Schlüssel zu seinem Werk war ein kleines fragmentarisches Tagebuch, das ich zufällig auf der Suche nach dem Familienstammbuch fand. Es war ein Geschenk seiner Mutter zur Konfirmation am 2.4.1939. Der erste Eintrag ist vom 4.4.1939 und der letzte vom 17.9.1946. Dieses Tagebuch deckt sowohl die Zeit seiner Pubertät als auch die Zeit des zweiten Weltkrieges ab.
Die erste Erkenntnis aus diesem fragmentarischen Tagebuch war, dass er schon im Alter von 14 Jahren wusste, dass er Schriftsteller werden wollte. Der zweite bemerkenswerte Aspekt war seine beeindruckende, unverdrossene Hartnäckigkeit. Zwischen 1939 und 1944 reichte er 14 Theaterstücke und Erzählungen ein, deren Veröffentlichung alle abgelehnt wurde. Dies entmutigte ihn nicht, sondern spornte ihn an, weiter zu machen. Die Themen, die er behandelte, lassen sich anhand der kurzen Darstellungen einteilen in Fernweh und Heimweh, Liebe und Treue sowie Pflichtbewusstsein oder nordisches Heldentum. Personen, mit denen er sich beschäftigte, waren Vercingetorix, die Staufer oder Graf Götzen. Von diesen sehr frühen Werken ist nichts erhalten.
Der dritte und interessanteste Punkt war zu lernen, was er dachte und fühlte und was ihn im jugendlichen Alter prägte. Es sind dies drei Dinge, das Christentum, dem er in diesem Alter besonders kritisch gegenüber stand, die NS Propaganda eines Hans Friedrich Blunck, der in der Zeit des Nationalsozialismus verschiedene kulturpolitische Positionen unter anderem die des ersten Präsidenten der Reichsschrifttumskammer inne hatte, und vor allem aber die Romantik des 19. Jahrhunderts wie z.B. die Rheinsagen von Wilhelm Ruland.
Nach Sichtung des gesamten Materials war es nahe liegend, das Gesamtwerk in die drei Bände Erzählungen, Gedichte und Theaterstücke zu unterteilen. Der Band Erzählungen ist historisch nicht sortiert, da mein Vater sehr selten Angaben zur Datierung gemacht hat. Die Geschichte „Ersatz“, die 1945 im Zeitfenster zwischen Kapitulation und Jahresende spielt, ist sein letztes Werk und seine längste Erzählung.
Nach dem Notabitur 1944 wurde er sofort zur Wehrmacht einberufen und war in den Niederlanden und in Italien bei der Artillerie an der Front. Trotz öfteren Nachbohrens war er nicht bereit, über den Krieg und seine Erfahrungen zu erzählen. Die Erzählung „Pontecorvo“ lässt ansatzweise vermuten, welche traumatischen Erlebnisse dazu führten, nicht über den Krieg sprechen zu wollen.
In einigen Erzählungen und Theaterstücken kommt die Figur eines Landstreichers oder Hausierers vor. Für ihn waren Landstreicher aus einer verklärten Romantik heraus der Inbegriff von absoluter Freiheit. Er begegnete zeitlebens diesen Menschen mit höchstem Respekt.
Beim Band „Gedichte“ war eine grobe zeitliche Zuordnung etwas einfacher, da aufgrund des Pseudonyms Karl Tischendörfer eine Dreiteilung möglich war. Deshalb ist dieser Band unterteilt in die Kapitel „Der frühe Helmuth Dippner“, „Das Werk Karl Tischendörfers“ und „Der späte Helmuth Dippner“. Er legte sich das Pseudonym zu, als er als Journalist den Arbeitgeber wechselte und vom „Main Echo“ zur „Frankfurter Rundschau“ ging. Auf meine Frage, „Warum das Pseudonym?“ war seine Antwort, er möchte den Journalisten der Frankfurter Rundschau vom Literaten trennen.
Aus dieser Zeit stammt auch ein Briefwechsel mit Karl Krolow aus Darmstadt, der ihn ermutigte, weiter zu schreiben. Eine weitere zeitliche Zuordnung war im frühen Helmuth Dippner möglich aufgrund des benutzten Papiers, das in der Nachkriegszeit rar war. Mein Vater schrieb deshalb auf alles, was ihm in die Finger kam. Ein handschriftliches Gedicht war auf der Rückseite eines DIN A5 Formblattes des Sozialgerichts Landshut geschrieben.
Der Umzug von Landshut nach Aschaffenburg änderte auch seine Landschaftsbeschreibungen, ein weiteres Hilfsmittel der zeitlichen Zuordnung. Ich lernte beim Lesen das mir bis dahin unbekannte Versmass der Terzinen kennen und war beeindruckt, zu sehen, dass er auch in jungen Jahren Sonette schrieb, bis er schließlich seine ihm eigene Bildsprache entwickelte, zu der vermutlich auch der enge Kontakt mit der Künstlerszene in Aschaffenburg und die Freundschaften mit Siegfried Rischar und Joachim Schmidt beigetragen haben.
Mein Vater liebte die Kunst, egal ob Musik, Literatur, Malerei oder Theater. Er war ein großer Freund des Boulevardtheaters, in das er gern mit der Familie ging, soweit es seine Zeit erlaubte. Seine Theaterstücke lassen sich ebenfalls kaum zeitlich zuordnen. Das älteste Stück „Der vierte Mann am Tisch“ ließ sich anhand der Papierqualität zuordnen. Vom Stück „Zur letzten Station“ gibt es drei verschiedene Schlussszenen. Hier ist dank einer zufälligen Datierung die letzte Version abgedruckt.
Ich wünsche allen Lesern viel Freude am Werk eines der letzten Romantiker.
Rostock 2025
Dr. Joachim Dippner
Statt eines Vorwortes
Liebe Trauergesellschaft,
Liebe Inge, lieber Joachim,
ich erinnere mich noch gut, als er sich mir vor 27 Jahren vorstellte, damals war er gerade drei Jahre im Ruhestand und er nannte mir gleich die gesamte Biographie: Sein Kommen aus dem Rheinland, seine erste Stelle in Landshut bei der „Isar Post“, dann „Main Echo“ mit dem mühsamen Umzug hier her nach Aschaffenburg und nächtlichen Ankunft, wie es damals noch war, in der zerstörten Stadt der Kleiderfabrikanten, dann die Chance bei der Frankfurter Rundschau, verantwortlich für die Seiten 1 und 2. Als Abschluss seiner Laufbahn sei bei der kassenärztlichen Vereinigung gewesen und, weil er nie die Chance hatte zu studieren, macht er eben jetzt Geschichte im ich weiß nicht wievielten Semester. Dann kannte er alle Künstler Aschaffenburgs und Ihre Geschichten, seine Frankreichfahrten, konnte innerhalb seiner Reiseerzählungen immer gleich die Literatur nennen, die genau diese Landschaft beschrieben hatte und die regionalen Färbungen der entsprechenden Fremdsprache präsentieren. Er überfuhr einen mit seinem Wissen, mit seinem Auftreten, mit seiner Sprachgewalt und seinem Humor. Die Show war perfekt. Aber auch anstrengend. Nie langweilig und er wiederholte sich dabei nicht. Ihre Mutter stand oft daneben und man hatte oft den Eindruck, dass sie ihn einbremsen musste in seinem überschäumenden Wesen und Wissen, das er nie vernachlässigte und immer und immer anreicherte. Ob es Medizin war und man lernte von ihm Fachbegriffe. Seine Diagnosen waren so berichtet, dass eine längere Übersetzungsarbeit notwendig wurde. Seine Referieren über Reformationsgeschichte ließen jeden Theologen alt aussehen. Dann wieder Rilke und Brecht und dann sein eigenes schriftstellerisches Arbeiten, vor allem kleinere Gedichtbände. Helmuth Dippner war ein Vulkan von Worten. Ich fand das immer sehr amüsant und dabei sehr bereichernd. So werde ich ihn auch in Erinnerung behalten.
Er stellte seine Sprache anderen zur Verfügung: Künstlern, dem Diakonischen Werk, dem Bildungswerk. Er war ehrenamtliches viel unterwegs und die Solidarität mit der Christuskirchengemeinde begleitete ihn, für die er viele Jahre ein streitbarer und kompetenter Kirchenvorsteher war. Er war immer ein überzeugter Protestant. Die Betonung lag auf Protestant. Und die Sprache war seine Art, sich zu zeigen, so ordnen und Dinge voranzutreiben und zu korrigieren. Seine Art, knapp Worte zu setzten, sie zu konzentrieren, vom allgemeinen Plauderton bis in die lyrische Verknappung. Helmuth Dippner war ein Mensch der Sprache, er verschrieb sich ihr. Und: Er hatte einen wunderbaren sarkastischen und etwas arroganten Witz. Das war manchmal sehr wohltuend.
Sprache ist bekanntlich ein Mittel der Kommunikation. Was steckte hinter seiner Freude und Lust an der Sprache?
Sicher, das Wissen, dass er das konnte. Er konnte vier Fremdsprachen. Seine Ausdrucksweise war sicher in den Sätzen, in den Begriffen und wusste, wie man auf den Punkt kam. Man musste ihm nicht immer Recht geben, weiß Gott nicht, aber man wusste immer, was er sagen wollte.
Sicher war es die Suche nach Anerkennung. Er litt immer darunter, dass er nicht studieren konnte. Seine Mutter wollte nach dem Krieg die Kosten nicht aufbringen. Deshalb war er sehr stolz und vielleicht auch mit sich innerlich versöhnt, als er im Ruhestand einen Magister machen konnte. Damit erfüllte er sich einen großen Wunsch. Vielleicht stand hinter diesem Verlangen die Angst, doch nicht mit wirklichem Wissen aufwarten zu können. Das war natürlich überflüssig.
Sicher aber verbarg sich dahinter eine intensive Suche nach Wahrheit und ganz gewiss suchte er nach Nähe. Vielleicht war die Tragik seines Lebens, dass man das nicht gleichzeitig haben kann oder nicht gleichzeitig von jedem, so ließ sein Wesen immer eine Einsamkeit spüren, aus der man ihn auch nicht herausholen konnte. Zu sehr schlugen dieses beiden Herzen in seiner Brust, die Absicht, bewundert zu werden und die Suche nach Vertrautheit. Letztlich ist es die Idee, asymmetrische Beziehungen und partnerschaftliche gleichzeitig zu haben. Er konnte nicht von einen oder anderen Abschied nehmen um seine innere Einsamkeit zu überwinden.





























