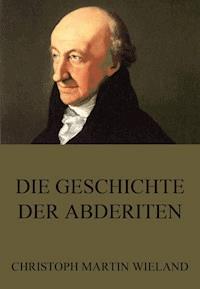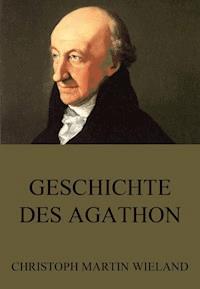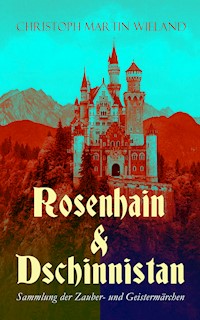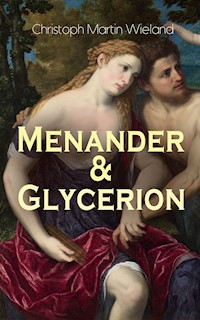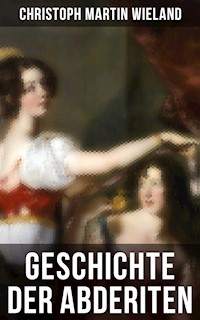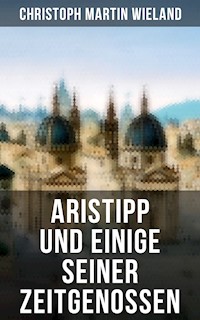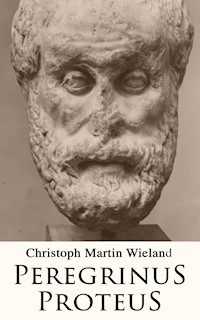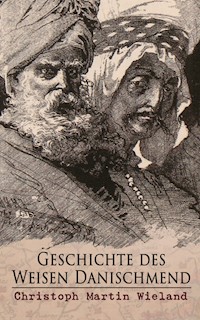
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Dieses eBook: "Geschichte des Weisen Danischmend" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Aus dem Buch: "Unterdessen hatte Danischmend, nachdem er auf Befehl des Sultans von dem Schatzmeister zu Lahor zehentausend Bahamd'or empfangen, in den Gebirgen, welche Kischmir von Tibet absondern, sich einen Wohnplatz ersehen, wo er, fern von Sultanen und Fakirn, nach seinem Geschmack und nach seinem Herzen glücklich zu leben hoffte. Es war ein langes, zwischen fruchtbaren Hügeln und waldigen Bergen sich hinziehendes Tal, Jemal genannt, von tausend Bächen und Quellen aus dem Gebirge bewässert, und von den glücklichsten Menschen bewohnt, die vielleicht damals auf dem ganzen Erdboden anzutreffen waren." Christoph Martin Wieland (1733-1813) war ein deutscher Dichter, Übersetzer und Herausgeber zur Zeit der Aufklärung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Geschichte des Weisen Danischmend
Keine Vorrede
Eine Vorrede vor ein Werk, wie die Geschichte des Philosophen Danischmend?
Nein, bei allem was gut ist, ich werde keine Vorrede dazu machen, es erfolge auch daraus was will!
Für den verständigen Leser würde die kürzeste zu lang sein: und dem unverständigen hilft keine Vorrede, und wenn sie dreimal länger wäre als das Werk selbst.
»Es gibt Leute«, sagte mir einer meiner Freunde (in der weitern Bedeutung des Wortes), »die hinter Ihren Sultanen und Bonzen ganz was andres suchen« –
»Als Sultanen und Bonzen? – Da haben die Leute unrecht, Freund!«
»Aber es gibt nun einmal solche Leser, gegen die man sich sehr kategorisch erklären muß, wenn man Unheil verhüten will. Ich dächte, Sie wären's sich selbst schuldig, diesen Leuten ein für allemal so deutlich, als nur immer möglich ist, zu sagen, wie Sie verstanden sein wollen.«
»Dies ist längst geschehen erwiderte ich. »Wie kann ich mich deutlicher erklären, als ich's im Goldnen Spiegel getan habe? Wer nun nicht versteht, will nicht, – oder befindet sich im Falle des ehrlichen Mannes, der alle Brillen eines ganzen Ladens probierte, ohne einen Buchstaben dadurch lesen zu können; am Ende zeigte sich, daß der Mann weder mit noch ohne Brille lesen konnte.«
»Schaffe mir Kinder, oder ich sterbe«, sagte Rahel zu Jakob ihrem Manne. »Bin ich denn Gott?« antwortete der Erzvater. – Dies ist gerade der Fall eines ehrlichen Autors, den unverständige Leser zwingen wollen, ihnen Verstand zu geben.
Licht ist nur Licht für den Sehenden: der Blinde wandelt im Sonnenschein, und dünkt sich im Finstern.
Also keine Vorrede!
Kapitel 1
Wie der Sultan Gebal und Danischmend aus einander kommen
Schach-Gebal, ein durch gute und böse Gerüchte bekannter Sultan, hatte, neben manchen gleichgültigern Eigenschaften, die Schwachheit – wie es seine Tadler nannten – daß er über niemand, dem er einmal hold gewesen war, lange zürnen konnte. Wahr ist's, in dem Augenblicke, wo man in seine Ungnade fiel – welches leicht begegnete – waren zwei- oder dreihundert Prügel auf die Fußsohlen das wenigste, womit er den Unglücklichen, den dieser Zufall traf, bedrohte. Aber seit die Sultanin Nurmahal von ihm erhielt, daß dergleichen Züchtigungen nie anders als in seiner Gegenwart vollzogen werden durften, hat man kein Beispiel, daß er's bis zum zehnten Streiche hätte kommen lassen.
Er ließ sich, nach der Weise der Sultanen seiner Brüder, bei solchen Anlässen große Komplimente über seine Mildherzigkeit machen. Allein das Wahre an der Sache war, daß er, trotz seiner Sultanschaft, sich nicht erwehren konnte, bei jedem Streich ein unangenehmes Zucken in seinen Nerven zu fühlen. Der Gedanke, ich bin auch ein Mensch, denkt ihr – aber dies war es nicht. Armer Schach-Gebal! du warst zu sehr und zu lange Sultan, um so etwas aus dir selbst zu denken. Aber die Natur, die Natur! die treibt ihr Werk ohne Ansehen der Person, im Monarchen wie im Bettler. Die mitzitternde Nerve wird beim Anblick des Leidens eines Menschen an dem vermeinten Halbgotte zum Verräter; er fühlt, daß er auch Fußsohlen hat. Um es eiligst wieder zu vergessen, übt er eine seiner hohen Vorzüglichkeiten aus, und ruft: Gnade!1Anonym
Wie dem auch war, gewiß ist, daß der Philosoph Danischmend, als er, ohne recht zu wissen wie ihm geschah, in des Sultans Ungnade fiel, weit leichter davon kam, als es seine guten Freunde, die Fakirn, gehofft hatten. Diese gutherzigen Seelen würden mit den dreihundert Prügeln auf die Fußsohlen, die ihm Schach-Gebal in der ersten Hitze seines Zorns versprach, als einer noch ganz leidlichen Vergütung aller Unbilden, die sie von ihm erlitten zu haben vorgaben, allenfalls zufrieden gewesen sein. Aber der Sultan fand nach kälterer Überlegung diese Strafe für ein Verbrechen, welches sein ehmaliger Itimadulet nur erst in Gedanken begangen hatte, doch ein wenig zu hart, und besann sich so lange auf eine gelindere, bis ihm die Lust zu strafen gar verging.
Danischmend lag indessen in einem Gefängnisse, wo etliche Spannen Himmel seine ganze Aussicht, und ein paar Fliegen seine ganze Gesellschaft ausmachten. Er fing bereits an zu glauben, daß nun weiter nicht mehr die Rede von ihm sein würde, als ihn der Sultan, in einer von seinen guten Launen, holen ließ.
»Danischmend«, sagte der Sultan, als er ihn mit seinem langen Barte (der inzwischen gute Zeit zum Wachsen gehabt hatte) ansichtig wurde: »– wenn einem Menschen wie du zu raten wäre, so würd ich dir raten, wie du hier stehst, die Philosophie abzuschwören und – ein Santon2Herbelot
zu werden. Den Bart dazu hättest du schon, wie ich sehe; und an Entbehrungen solltest du, denk ich, auch gewöhnt worden sein, seitdem sie dich zwischen vier Mauern eingekuffert haben. Ich sehe wenigstens kein andres Mittel, dich mit den Derwischen und Fakirn auszusöhnen, die dir, wie ich höre, so herzlich gram sind, daß ich eine Empörung besorgen müßte, wenn ich darauf bestehen wollte, dich gegen sie in Schutz zu nehmen. Ein Santon, ich habe der Sache oft nachgedacht, ein Santon ist das glücklichste Wesen in der Welt. Wenn ich nicht mein Wort gegeben hätte Sultan zu sein, ich wüßte nicht was mich hindern sollte heute noch Santon zu werden.«
»Santon?« – versetzte Danischmend. »Die Sache mag ihr Gutes haben; aber – ich wollte darauf schwören, daß ich niemals einen erträglichen Santon machen würde. Ich habe gewisse Bedürfnisse, von denen ich mich unmöglich los machen kann« –
»Bedürfnisse, Bedürfnisse«, fiel Schach-Gebal ein – »die sind immer das dritte Wort bei euch Philosophen. Ich habe keine Bedürfnisse und bin Sultan! Es ist ein häßliches, verächtliches Ding, so viele Bedürfnisse zu haben. Unter uns, was für Bedürfnisse wären es denn, von denen du nicht Lust hättest dich los zu machen?«
»Sire, Sie werden über mich lachen«, versetzte Danischmend: »aber wer kann sich helfen? Es gibt gewisse Dinge, ohne die ich weder leben noch weben kann; als da ist – die gute Mutter Natur jedes Stückchen auf mir spielen zu lassen, das sie auf mir spielen will,3DidiusWer sind die Leute, die bei allen Dingen immer Arges denken?BonhommeSchurken.Diogenes
immer auszusehen, wie mir ums Herz ist; nichts zu reden, als was ich denke; nichts zu tun, als was ich mit Freuden tue; mich mitzuteilen, wenn ich glücklich bin, und flugs in meine Schale zurück zu kriechen, so bald ich eine Fliege, die mir um die Nase summst, durch einen Wolkenbruch ertränken möchte; ferner, alles was Menschen angeht, als meine Privatsache anzusehen, und mich über ein Unrecht schrecklich zu ereifern, das vor dreitausend Jahren einem Betteljungen zu Babylon geschehen ist; allen harmlosen ehrlichen Gesichtern gut zu sein, und allen Schurken, wo ich nur an sie kommen kann, auf den Fuß zu treten; und, während daß ich die Welt gehen lasse – wie sie kann, mich (so oft ich nichts Angenehmers zu empfinden oder nicht Bessers zu tun habe) auf meinen Sofa zu lagern und Entwürfe zu machen, was ich tun wollte, wenn ich der große Lama, oder die Favoritin des Königs von Serendib, oder der Dairi von Japan wäre. Mit Einem Worte« –
»Mit Einem Worte, Herr Danischmend«, fiel ihm der Sultan lachend ins Wort, »ich sehe, daß du ein Grillenfänger bleiben wirst so lange du lebst. Aber betrüge dich nicht, mein Freund. Ich habe dir schon gesagt, daß ich nichts für dich tun kann. Es steht bei dir, ob du ein Santon oder ein Kalender, oder was du werden willst; aber aus Indostan muß ich dich verbannen, dafür hilft nichts. Die Fakirn! die Bonzen! – Um dein selbst willen muß ich's tun. Suche dir in den Wildnissen des Imaus einen Wohnort aus, wo dir's am besten gefällt; näher kann ich, wenn ich Ruhe haben will, keinen Philosophen bei mir leiden.«
»Sultan von Indien«, sagte Danischmend, »es gibt sehr anmutige Gegenden in den Wildnissen, wohin Ihre Hoheit mich zu verbannen die Gnade haben. Ich habe mir schon lange eine Vorstellung gemacht, daß sich dort eine ganz artige kleine Kolonie von glücklichen Menschen anlegen ließe.«
»Von glücklichen Menschen?« – rief Schach-Gebal: »Feenmärchen, Zauberschlösser, Freund Danischmend! Wolltest du nicht, da du mein Itimadulet warst, alle meine Untertanen zwischen dem Oxus und Ganges glücklich machen? Und wie viel fehlte noch, daß du mit dieser einzigen Grille ganz Indostan zu Grunde gerichtet hättest?4 Ich dächte, von dieser Narrheit wenigstens solltest du geheilt sein, Danischmend!«
»Was bei hundert Millionen verdorbener Menschen unmöglich gewesen wäre, gelänge mir vielleicht bei einem kleinen Häufchen roher aber noch unangesteckter Söhne und Töchter der Natur«, erwiderte der Philosoph.
Der Sultan schwieg eine Weile, wie er zu tun pflegte wenn ihm ein Einfall in den Wurf kam, mit dem er etliche Augenblicke spielen konnte. Endlich sagte er: »Weißt du wohl, Danischmend, daß ich beinahe Lust hätte dich eine Probe machen zu lassen? nur um zu sehen was heraus käme. Gut! ich gebe dir einen Befehl an meinen Schatzmeister zu Kabul: denn ohne Geld legt man keine Kolonien an; zumal wenn du sie, um eine schöne Zucht von Menschen zu bekommen, mit hübschen Tschirkassierinnen versehen wolltest. Aber nimm dich in acht, daß der Bramine der Sultanin nichts davon erfährt. Ich mag keine Fehde mehr mit diesen wackern Leuten; ich will Ruhe haben!«
»Herr«, antwortete Danischmend, »wenn mir zum letzten Mal noch erlaubt ist so freimütig wie sonst mit Ihrer Hoheit zu reden, ich habe keine Lust mich in die Wildnisse des Imaus verbannen zu lassen. Ich bin nicht selbständig genug um ohne Gesellschaft leben zu können, und schon zu alt um Waldmenschen zahm zu machen. Gern will ich für die Nachwelt pflanzen; aber dann müssen auch die Bäume schon gewachsen sein, in deren Schatten ich selbst ausruhen soll. Dem Braminen der Sultanin und allen Fakirn und Bonzen in der Welt wird es gleichgültig sein können, wo ich lebe, wenn sie nur nichts weiter von mir hören. Und hören sollen sie nichts mehr von mir, oder es müßte gar kein bewohnbarer Ort mehr auf Gottes Boden sein, wo man sicher vor ihnen atmen könnte. Ich kenne in den Gebirgen von Kischmir einen solchen Ort; ein einsames Tal, fruchtbar und anmutig wie die Gärten Schedads,5Herbelot
und von einem harmlosen Völkchen bewohnt, das keinen Begriff davon hat, wie man ein Fakir oder Santon sein kann. Wenn mir Ihre Hoheit so viel geben wollen, daß ich mir unter diesen guten Leutchen eine Hütte bauen kann, so sind alle meine Wünsche erfüllt. Fürs übrige, was man noch um glücklich zu sein haben muß, will ich schon sorgen.«
»Es sei darum«, sagte Schach-Gebal. »Wenn man einem Gutes tun will, muß man's ihm nach seiner eigenen Weise tun. Lebe wohl, Danischmend. Möchtest du in deiner Einsamkeit glücklich genug sein, zu vergessen, daß du einst der Freund eines Sultans warst!«
Danischmend war im Begriff, auf dieses gnädige Kompliment eine Antwort zu geben, die dem Sultan notwendig hätte mißfallen müssen. Aber er konnt es nicht über sein Herz bringen, den guten Herrn durch eine Wahrheit zu kränken, die am Ende doch zu nichts helfen konnte. Es gibt Wahrheiten, die ein Mann (Sultan oder nicht Sultan) sich selbst sagen muß. Tut er's nicht, oder kann er's nicht tun, so ist's Menschlichkeit, ihn damit zu verschonen. In solchen Fällen kann die Wahrheit nur demütigen, nie besser machen.
Danischmend verschwand noch an dem nämlichen Tage aus Dehly, und weder der Bramine der Sultanin, noch die Sultanin selbst, konnten jemals von Schach-Gebal erhalten, daß er ihnen gestanden hätte, was in dieser letzten Unterredung zwischen ihm und seinem ehmaligen Günstling vorgegangen. Dieses eigensinnige Stillschweigen des Sultans, und die Unmöglichkeit vom Aufenthalte des verschwundenen Philosophen etwas zu erfahren, brachte die schöne Nurmahal und alle, denen daran gelegen war, auf die Vermutung, daß ihn Schach-Gebal heimlich habe aus dem Wege schaffen lassen. »Auch dies ist so übel nicht«, sagten die Bonzen.
Kapitel 2
Danischmend läßt sich in Kischmir nieder. Sein Hauswesen. Ein neues Bedürfnis
Unterdessen hatte Danischmend, nachdem er auf Befehl des Sultans von dem Schatzmeister zu Lahor zehentausend Bahamd'or empfangen, in den Gebirgen, welche Kischmir von Tibet absondern, sich einen Wohnplatz ersehen, wo er, fern von Sultanen und Fakirn, nach seinem Geschmack und nach seinem Herzen glücklich zu leben hoffte. Es war ein langes, zwischen fruchtbaren Hügeln und waldigen Bergen sich hinziehendes Tal, Jemal genannt, von tausend Bächen und Quellen aus dem Gebirge bewässert, und von den glücklichsten Menschen bewohnt, die vielleicht damals auf dem ganzen Erdboden anzutreffen waren.
Hier war ihm vor allen Dingen nötig, sich ein kleines Hauswesen einzurichten. Denn (nach seiner Philosophie) setzt ein weiser Mann sich zuerst in seinem Mittelpunkte so waagerecht als immer möglich fest, und sorgt – für sich selbst. Dann zieht er einen Kreis mitfühlender Zuneigung und wohltätiger Wirksamkeit um sich her, schießt seine Strahlen gegen alle Punkte dieses Kreises aus, und macht, so viel an ihm ist, alles glücklich, was er erreichen kann.
Diesem Plane gemäß kaufte sich Danischmend ein kleines Gut, ungefähr so groß wie Plinius meint, daß ein gelehrter Müßiggänger eines nötig habe;6 das heißt, »gerade so viel Grund und Boden, als er brauchte, um den Kopf an einen Baum zurück zu lehnen, seine kurzsichtigen Augen an einer Aussicht ins Grüne zu laben, auf dem nämlichen Fußpfade zwischen seinem Kohlgarten und Kornfelde hin und her zu kriechen, alle seine Weinstöcke auswendig zu wissen, und über alle seine Bäumchen ein Register zu halten.«
Danischmend, der ein wenig mehr Bedürfnisse hatte als Suetonius, legte sich noch überdies ein Wäldchen an, wo er in dunkeln kunstlosen Irrgängen herum schlendern konnte, und vergaß nicht, hier und da eine Bank hinsetzen zu lassen, damit zwei oder drei Personen im Frieden neben einander Platz nehmen könnten, wenn sie des Gehens müde wären. Auch leitete er eine Felsenquelle, die seine Wohnung mit Wasser versah, durch eine Wiese, die er seinen Blumengarten nannte, pflanzte da und dort auf die Wiese und längs seines Kornfeldes Obstbäume, unter deren Schatten seine Mäher und Schnitter ausruhen konnten, und ließ in den Felsen, aus dem die Quelle kam, eine Grotte hauen (die Natur hatte schon das meiste dabei getan) wo man in der Sommerhitze, hinter einem Vordach von Eppich und Weinreben, auf einer Bank von Moos, beim Gemurmel der Quelle schlummern, oder dem Gesang der Grillen zuhören konnte so lange man wollte.
Danischmend, wiewohl er eine Art von Philosophen war, verstand wenig oder nichts von der Landwirtschaft. Kraft dieser seiner Unwissenheit wollte er nichts besser wissen als die Natur; bepflanzte seine Felder nicht mit Disteln, um eine Manufaktur von ihrer Wolle anzulegen; pflügte mit dem Pfluge seiner Voreltern, und machte keine Versuche die ihm mehr kosteten als sie wert waren. Kurz, seine Unwissenheit ersparte ihm vielleicht mehr als manchem hochgelehrten landwirtschaftlichen Metaphysiker seine Wissenschaft einträgt. Aber dafür ließ er sein Feld mit dem alten Pfluge so lange ackern bis es locker war; wo er einen leeren Platz sah, da pflanzte er einen Baum hin, oder etwas andres das besser war als nichts; und wo sich nach einem starken Regen kleine Pfützen und Sümpfe zeigten, da ließ er so lange Sand und Erde hinführen bis sie ausgefüllt waren. Die Sperlinge und die Raubvögel hatten alle Ruhe vor ihm: »denn« (sagte er) »jene tun mir gute Dienste gegen das Ungeziefer, und diese gegen die Sperlinge.« Überhaupt war er ein großer Freund von der Maxime, nichts ausrotten zu wollen was Gott erschaffen hat. »Der Urheber der Natur« (pflegte er zu sagen) »versteht gewiß die Ökonomie besser als man glaubt. Er hat durch den einzigen kleinen Umstand, daß immer eine Gattung die andre frißt, hinlänglich dafür gesorgt, daß sie einander so ziemlich die Waage halten. Ich lebe beinahe auf aller andern Gattungen Unkosten; und ich sollte so unbillig sein, nicht leiden zu wollen daß sie sich helfen wie sie können?«
Der gute Philosoph, der (wie wir schon wissen) einer von den empfindsamen war, hatte sich schon lange eine sehr einladende Vorstellung von einem in der großen Welt wenig bekannten Zustande gemacht, den er häusliche Glückseligkeit nannte. Um sich in seinem vorerwähnten Mittelpunkt in das gehörige Gleichgewicht zu setzen, schien ihm eine Gesellin, an deren Busen er ruhen könnte, unentbehrlich zu sein. Was ihm, da er noch in der Welt lebte, höchstens – und nur in gewissen Augenblicken – eine ganz behagliche Sache schien, ward in seiner jetzigen Lage zum Bedürfnis. Er dachte anfangs alle Tage beim Erwachen und alle Nächte beim Einschlafen daran. Bald darauf dacht er des Tages etlichemal und des Nachts auf seiner Matratze ganze Stunden lang daran, bis er zuletzt gar nicht mehr davor schlafen konnte; oder wenn er ja einschlief, so träumte ihm von nichts als Hochzeiten und Wochenstuben, Puppen und Steckenpferden; und wenn er des Morgens vor Sonnenaufgang ans Fenster ging frische Luft zu schöpfen, sah er aus den Wölkchen, die wie kleine Inseln im Morgenhimmel herum schwammen, lauter gelblockige und schwarzlockige, blauaugige und braunaugige Mädchenköpfe heraus gucken. Je mehr er über die Sache philosophierte, je völliger überzeugte sich der gute Mann, das schönste und beste aller Geschöpfe, der Auszug und Inbegriff alles dessen was in der Natur Reizendes ist, das lieblichste, begehrenswürdigste und unentbehrlichste aller Dinge sei – ein Weib. Kurz, er hörte nicht auf darüber zu philosophieren, bis er's endlich so weit brachte, mit ich weiß nicht welchen alten Weisen,7M. Pantaleon Onocephalus
sich selbst für die bloße Hälfte eines Menschen zu halten, die unmöglich anders als unvollkommen, dürftig, kröpelhaft und höchst unglückselig sein könne, bis sie ihre andre Hälfte gefunden, und mit ihr in Einen wahren, ganzen, vollständigen Menschen zusammen gewachsen sei. Man sieht daß es nun hohe Zeit mit ihm war.
Zwar hätte er, als ein Musulmann, sich wenigstens zwei bis drei Weiber, und allenfalls, nach alter morgenländischer Sitte, noch eben so viel Kebsweiber zulegen mögen, ohne daß weder der Imam von Mekka, noch der große Lama in Tibet, noch der Bramine der Sultanin Nurmahal sich sehr daran geärgert hätten. Denn jeder dieser würdigen Herren hatte ihrer noch viel mehr in seinem Weiberstalle. Aber Danischmenden war es nicht um Weiber, sondern um seine Hälfte zu tun: und da zwei Hälften nach dem allgemeinen Geständnis aller Menschen hinlänglich sind ein Ganzes zu machen; so wäre die dritte, vierte, fünfte usw. wie liebenswürdig sie an sich selbst hätte sein mögen, im Grunde doch nichts anders als ein Auswuchs, eine Art von Höker, Kropf oder Überbein gewesen, der, anstatt die Vollkommenheit des Ganzen zu befördern, demselben nur überlästig gefallen wäre, und die schöne Eintracht beider Hälften gestört hätte. Vernünftiger Weise blieb ihm also nichts übrig, als diese nämliche gleichartige, genau einpassende, und, mit Einem Worte, geflissentlich für ihn allein gemachte Hälfte seines Ichs je eher je lieber ausfündig zu machen.
Wer ernstlich sucht, findet immer etwas das des Auflesens wert ist; entweder das Gesuchte, oder auch wohl zuweilen etwas Besseres. Danischmend, den das edelste unter allen menschlichen Bedürfnissen – zu lieben und geliebt zu werden – plagte, suchte sich ein Weib für sein Herz und nach seinem Herzen, und fand sie, wie man einen Schatz findet, oder den Schnupfen aufliest, unversehens und ohne zu wissen wie.
Kapitel 3
Mysterien – Procul este Profani!
Unsre ehrlichen Altvordern mögen wohl nicht so unrecht gehabt haben, wenn sie glaubten, daß ein guter Genius (ob sie ihn so oder so malten tut nichts zur Sache) sich damit abgebe, einem ehrlichen Kerl in Danischmends Umständen auf die Spur zu helfen. Es ist wenigstens ein so tröstlicher und harmloser Glaube, daß ich dem Manne nicht gut sein könnte, der mir ihn abräsonieren wollte.
Eines Morgens früh, als Danischmend ausging seine Träumereien auszulüften, begegnete ihm, auf dem Wege zu seiner Grotte, ein Mädchen, das mit einem großen Wasserkrug auf dem Kopf in der Einfalt und Unschuld seines Herzens daher schritt.
Ob es eine Grille oder was es war, weiß ich nicht; aber alle Weisen aus Morgenland und Abendland hätten unserm Manne nicht aus dem Kopfe gebracht, daß er seinen Genius habe, so gut als Sokrates der Athener.8Theophil. Murrzufflus
»Alles was ich vor andern Leuten voraus habe«, pflegte er zu sagen, »ist lediglich, daß ich mir angewöhnt habe, bei allen Gelegenheiten auf die Stimme meines Genius zu lauschen, und daß mich die Natur dazu mit einem Seelenohre von der feinsten Art begabt hat.«
»Rede sie an«, rief ihm der Genius in seinem ihm allein vernehmlichen Rotwälsch zu. – Danischmend gehorchte.
»Woher so früh, schönes Mädchen?« sagte er mit einer so sanften Stimme, daß es unmöglich war seine Frage übel zu nehmen.
»Von jener Grotte«, antwortete das Mädchen, indem sie mit dem Zeigefinger der linken Hand nach dem Orte wies. Danischmend bemerkte, wiewohl nur obenhin, daß es eine kleine niedliche Hand war.
»Ich hole dort alle Morgen Wasser in diesem Kruge«, fuhr das Mädchen fort, »denn es soll das beste in der ganzen Gegend sein,«
»Und wozu brauchst du das Wasser?« fragte Danischmend. Es war eine alberne Frage; aber er wollte und mußte nun einmal etwas fragen, und in der Eile fiel ihm nichts Klügeres ein.
»Ich begieße morgens und abends einen Rosenstock damit, den ich auf das Grab meiner Mutter gepflanzt habe«, antwortete das Mädchen, mit einem Tone der Stimme, der alle empfindsam Saiten in seinem Herzen mit ertönen machte.
Er sah ihr ins Auge, oder, welches einerlei war, er sah in den Grund ihrer Seele; und in dem nämlichen Nu fühlt' er mit Gewißheit, daß dies Mädchen die Hälfte sei die er suchte.
»Sie ist's«, rief im nämlichen Nu sein Genius.
Das Mädchen war von feiner Gestalt. Alle Züge ihres Gesichts drückten die Unschuld, das zarte Gefühl und die Ruhe ihrer Seele aus. Ihr Herz war in ihren Augen und auf ihren Lippen. Man sah ihr ins Gesicht, und von Stund an war man ihr Freund, Vater, Bruder und Oheim, vertraute ihr alle seine Geheimnisse, sein Leben, seine Ehre, seine Seele und Seligkeit, wünschte sich keine andre Frau, Tochter, Enkelin, Schwester, Nichte usw. und würde lieber zehentausendmal den Tod gelitten als zugegeben haben, daß ihr ein Leid widerfahre. – Übrigens eine bloße Tochter der Natur; ohne Verzierung, ohne Ansprüche, ohne List, und so unwissend, daß sie von Danischmenden sogar küssen lernen mußte.
Dies werden wenig Mädchen glauben wollen; aber wir können sie mit Gewißheit versichern, daß es wahr ist.
»Sie ist's, sie ist's«, flüsterte der Genius noch einmal.
»Beim Himmel, ist sie's!« antwortete Danischmend!
Acht Tage darauf – die ganze Geschichte ihrer Liebe in diesen acht Tagen erlaß ich euch: sie beträgt sieben starke Oktavbände, und würde für Liebende, wie Amandus und Amanda, Herkules und Valiska, Seladon und Asträa, Aruns und Klelia, usf. höchst unterhaltend sein, wenn Liebende – Zeit zum Lesen hätten.
Acht Tage darauf vermählte sich Danischmend mit ihr, führte sie in sein Haus, und zeugte mit ihr Söhne und Töchter.
Weil dies jedermann kann – die Ausnahmen sind zu selten um in Anschlag zu kommen –, so haben sich die Leute angewöhnt, es für eine gemeine, alltägliche, verächtliche Sache zu halten, die man, ohne lächerlich zu werden, niemanden zum Verdienst anrechnen könne. Viele gehen so weit, daß sie uns gar bereden wollen, man könne mit Anständigkeit nicht einmal davon sprechen.
Man sieht wohl, daß solche Leute nie bedacht haben müssen, welch ein herrliches Geschöpf der Mensch ist! – Ja, solche Karikaturen und Grotesken zu machen, wie man sie alle Werkeltage in Menge sieht, – dabei ist freilich wenig Verdienst. Aber dies war Danischmends Sache nicht. Seine Söhne und Töchter waren die wohlgestaltesten, artigsten, seelevollsten kleinen Geschöpfe, die man mit Augen sehen konnte. Alle Mädchen in der Gegend verliebten sich in seine Buben, alle kleine Jungen waren in seine Mädchen vernarrt; und wer zu alt zum Verlieben und Vernarren war, hatte die Kinder kaum etliche Stunden um sich, so war's ihm schon als ob er ihnen Vater und Mutter sei.
Dies mochte wohl Ausnahmen leiden; denn es gibt (wie ihr wißt) Leute, die nichts lieben können als sich selbst und was sie selbst gemacht haben. Allein von solchen Selbstlern ist auch hier die Rede nicht.
Viele Leute, die nicht begreifen konnten, warum Danischmends Kinder alle so liebenswürdig waren, bildeten sich ein, er müsse ein besonderes Geheimnis besitzen.
»Es ist etwas an der Sache«, sprach er: »ich wollt es euch wohl sagen, aber unter zwanzigen würde vielleicht kaum Einer sein, dem es nützen könnte.«
»Sei's darum«, sagten sie, »und wenn unter hunderten nur Einer wäre.«
»Gut«, sagte Danischmend: »so findet mir erst einen Mann und ein Weib, deren Liebe mit jedem Jahre ihrer Verbindung wächst, immer herzlicher und zärtlicher wird, dergestalt, daß es zuweilen ein Wunder in ihren eigenen Augen ist, wie es zugehe, daß sie sich nach einer Reihe zusammen gelebter Jahre oft verliebter in einander fühlen als an ihrem Hochzeitstage. Wer die Probe machen will, dem wollt ich wohl raten« (fuhr er fort), »sich von seinem Genius eine Frau wählen zu lassen: es möchte nicht bei allen angehen. Oft sind unser Herz und unser Genius verschiedener Meinung, und seit die Welt steht ist noch nichts gut gegangen, was ein Mann wider Willen seines Genius getan hat. Ich, meines Orts, hörte den meinigen drei- oder viermal so deutlich sagen, › sie ist's‹, daß ich meiner Sache gewiß war. Auch seht ihr ob er mich betrogen hat.«
»Aber«, sagten die Leute, »es muß außerdem noch etwas andres dahinter stecken, eine Art von geheimen – eine Art von – kurz, etwas, das ihr uns wohl entdecken könntet wenn ihr wolltet.«
»Ich will's euch ins Ohr sagen«, antwortete Danischmend.
Kapitel 4
Was Danischmend den Leuten ins Ohr sagte
Ich – der Erzähler dieser gegenwärtigen Geschichte – kenne einen Arzt, dem ich – auf der Stelle eine Lobrede zu halten versucht werde, und auch sogleich eine Lobrede halten würde, wenn ich so schön reden könnte wie Isokrates und Plinius; – einen Arzt, auf dem die Erfahrungskunst, die Weisheit und die Menschenliebe des göttlichen Hippokrates ruhen; – kurz, einen Arzt, wie ich aus herzlicher Wohlmeinung mit Bösen und Guten, Gerechten und Ungerechten, wünschen möchte, daß an jedem Orte, wo ein paar tausend Menschen beisammen wohnen, einer leben und so lange leben möchte, bis er der Nachwelt einen Mann wie er an seinen Platz gestellt hätte: – und eine von den Ursachen, warum ich diesen meinen Hippokrates ehre und liebe, ist, daß er weiß, was für ein Ding das Herz des Menschen ist, und welche Wunder derjenige zuweilen tun kann – er sei nun Arzt, oder Gesetzgeber, oder Pfarrer, oder Feldherr, oder Tragödienschreiber oder was ihr wollt – der auf das Herz und auf die Einbildung (in deren Gewalt jenes fast immer ist) zu rechter Zeit den gehörigen Eindruck zu machen weiß.
Was sind Jalappa und Senesblätter und Rhabarber und Fieberrinde und Genseng und Asa Fötida gegen Mittel, die geradezu auf die Phantasie und die Leidenschaften eines Kranken wirken! Von wie viel mehr Krankheiten als man gemeiniglich glaubt, liegt die wahre Ursache in einem verwundeten oder gepreßten oder entgeisterten Herzen! Wie viele körperliche Übel zeugt, nährt und verschlimmert eine kranke Phantasie! Wie oft würde eine rührende Musik, eine scherzhafte Erzählung, eine Szene aus dem Shakspeare, ein Kapitel aus dem Don Quichotte oder Tristram Shandy, das gestörte Gleichgewicht in unsrer Maschine eher wieder herstellen, Verdauung und Schlaf besser befördern, niedergeschlagene Lebensgeister kräftiger ermuntern, Milzsucht, Mutterbeschwerungen, Hypochondrie, Schwermut, Muckerei, Intoleranz und andre böse Geister schneller vertreiben, als irgend ein Rezept im Neu verbesserten Dispensatorium!
Ein fröhliches Herz und eine rosenfarbne oder himmelblaue Phantasie sind in tausend Verrichtungen des menschlichen Lebens unentbehrlich, wenn sie uns wohl vonstatten gehen sollen. – Grau in grau mag zuweilen hingehen, wiewohl ich kein Liebhaber davon bin.– Feuerfarben, pomeranzengelb und violet sind Farben, mit denen man sich wenigstens sehr in Acht nehmen muß. – Strohgelb, apfelgrün, lilas, pompadour, sind ungefähr, was des alten Herrn Shandy neutrale Namen; ich rate niemand seine Einbildung darein zu kleiden, wenn er was Kluges beginnen will: aber in Grüngelb und Schwarzbraun geht der Teufel, darauf kann man sich verlassen.
Wenn ihr euch für zehn, oder zwanzig, oder dreißig Tomans, mehr oder weniger, eine persische Tänzerin9Mark. d'ArgensDie sind teuer! Ουκ ωνουμαι μυριων δραχμων μεταμελειαν, sagte Demosthenes.Philodemus
kommen laßt, so macht's wie ihr wollt: aber mit dem Weibe, das die Mutter eurer Kinder sein soll, wollt ich dienstlich gebeten haben ein wenig behutsam umzugehen.
Bei allem dem macht die Farbe der Einbildung allein noch nicht alles aus. –
Ich will es euch kurz und gut sagen, weil ihr's doch wissen wollt!
Man kann einen Freund herzlich lieben, ohne daß man es darum immer gleich stark fühlt wie sehr man ihn liebt; ja es gibt Augenblicke, Stunden, Tage, wo einer für sein Leben nicht fähig wäre, seinem besten Freund ein herzliches Wort zu sagen. Gerade so geht's einem Biedermanne zuweilen, ohne seine Schuld, mit seinem Weibe. Jedermann sieht, daß dies sehr vielerlei physische, moralische, politische, theologische, ökonomische, merkantilische, theatralische, musikalische, und andre Arten von Ursachen haben kann. Zum Exempel, es ist nebliges Wetter – oder man hat unruhig geschlafen – oder eine schlechte Verdauung gehabt – oder verdrießliche Briefe erhalten – oder Briefe wider Willen zu schreiben – oder unangenehme Geschäfte abzutun – oder man hat unversehens ein wenig Bonzengift in den Leib bekommen – oder ein elendes Schauspiel anhören müssen, und hundert andere solcher Zufälle mehr, die auch den fröhlichsten Menschen niederschlagen, und seine Phantasie mit Kapuzinerbraun austapezieren können.
Zum Ersatz hat ein Mann von Gefühl Tage oder Stunden, – je häufiger je besser für ihn – wo seine Seele ruhig, klar und heiter ist, wie ein stiller See; offen jedem unverfälschten Eindrucke der Natur; empfindlich für ihre leisesten Berührungen; geneigt mit allem, was lebt und webt, sich zu freuen; glücklich im Gefühl seiner selbst; glücklich durch allgemeines über die ganze Schöpfung ausfließendes Wohlwollen.
»In solchen Augenblicken« (sagte Danischmend) »spielen alle Federn, Räder, Druck- und Saugwerke unsrer Einbildung und unsers Herzens leicht und harmonisch zusammen; der Schleier der Gewohnheit fällt von den täglichen Gegenständen unsrer Zuneigung ab; sie verschönern und verklären sich in unsern entzückten Augen; jede angenehme Erinnerung erwacht, und vereinigt sich mit dem gegenwärtigen Wonnegefühl. Und nun, meine Freunde, sagt mir, gibt es einen Augenblick, der geschickter wäre als dieser, um einem glücklichen Geschöpfe das Dasein zu geben?
Es gibt noch andre herzausdehnende Augenblicke von ähnlicher Art«, fuhr er fort: »als da sind, – wenn wir eine unverhoffte Gelegenheit bekommen haben eine schöne Tat zu tun – oder wenn wir, nach trübseligen Stunden, wo dieser umwölbende grenzenlose Himmel, wie das dumpfige Gewölbe eines engen Kerkers, drückend auf uns liegt, im Arm einer redlichen Gattin Ruhe, in ihrem liebenden Blicke Trost, in der Ergießung unsers Kummers in ihr mitempfindendes Herz Erleichterung finden; wo sie uns alles ersetzt, alles vergütet, die ganze Welt für uns ist. – Erinnert euch, meine Freunde, daß wir nicht von einer Zehn-Toman sprechen, und daß es itzt nicht um Spaß zu tun ist: – die Rede, ich wiederhol es, ist von den Müttern eurer Kinder. – Wartet in Geduld solche Augenblicke ab, und haschet sie wenn sie kommen.«
»Aber wer nicht warten kann?«
»Dem hab ich nichts zu sagen«, antwortete Danischmend.
»Und doch« (fuhr er fort), »wir sind, ich gesteh es, am Ende nur arme schwache Menschlein; es gibt leichtsinnige, unempfindsame Augenblicke, über die man nicht allezeit Herr ist. In solchen wär einem Manne zu wünschen, daß eben eine hübsche Herde Ziegen und Ziegenböcke oder rüstiger Esel und Eselinnen vor seinen Augen ausgetrieben würde; – er würde sie ansehen, erseufzen, und – weise werden. Wo nicht, so wäre wenigstens zu wünschen, daß er von solchen Augenblicken des Selbstvergessens nur überfallen würde, wenn nichts zu verderben ist, – wofern dies anders jemals der Fall sein kann.«10Epiktetus
Was Danischmenden betrifft, der hatte sich – ein wenig grillenhaft wie er war – fest in den Kopf gesetzt, daß sein Genius sich auch in diese Sache mische, und daß er ihn allemal, wenn es Zeit sei, ganz deutlich höre.
Man wird nicht recht begreifen, wie er bei solchen Gelegenheiten, mitten in dem Lärm, den die Lebensgeister gewöhnlich dabei zu machen pflegen, fein genug habe hören können, um gewiß zu sein, ob sein Genius ja oder nein sage. Aber der Genius schrie ihm, wie es scheint, so stark ins Ohr, daß er ihn notwendig hören mußte. Dies war die einzige Gelegenheit, wo er so laut schrie.
»Noch eins wollt ich euch raten«, setzte Danischmend hinzu: – »es ist ein wesentlicher Umstand – um aller Welt willen das Licht nicht auszulöschen; es wäre denn, daß der keusche Mond bei heiterm Himmel eben mit vollem Lichte durch eure Vorhänge schiene.«11PhutatoriusAuch verstehen sie einen O.... von der Kallipädie!Calvidius Lätus
Kapitel 5
Bedarf keiner Überschrift
Sollt es wohl Frauen (unter denen, die uns lesen, nämlich) geben können, die unser viertes Kapitel lächerlich, oder wohl gar ärgerlich fänden?
Wir wollen das Beste hoffen.
Und doch – wenn Brantome wirklich nach der Natur gemalt hätte? – Wenn die Königinnen, Prinzessinnen, Düschessen, Markisen, Komtessen, und übrigen Damen an Heinrichs des Zweiten und Karls des Neunten Hofe in Frankreich so gewesen wären, wie er sie gekannt zu haben versichert? – und wahr wäre, daß die Menschen – Männer und Weiber – in verschiedenen Zeiten und Ländern nur in der Art ihre Leidenschaften und Sitten zu kleiden, aufzusetzen, zu schminken, zu verbrämen und zu garnieren, verschieden wären – so daß, zum Exempel, zu Heinrichs des Zweiten Zeiten die Damen in Frankreich nur mehr entblößt gegangen wären, als zu Ludwigs des Sechzehnten Mode war – im Grund aber (wie Arlekin schon vorlängst angemerkt hat) allenthalben und zu allen Zeiten einander eben so ähnlich wären als die Individua der übrigen Gattungen? – Wenn dem allen so wäre – nun ja, dann – stehe ich für nichts!
Alles was ich solchen Falls sagen kann, ist dieses: Daß ich nicht nur für meine eigene Person weder Sohn noch Vater, Oheim noch Neffe, Bruder noch Schwager, am allerwenigsten aber – Ehemann oder Kebsmann von einem solchen Weibchen sein möchte; sondern auch allen meinen Abkömmlingen männlichen Geschlechts bis ins tausendste Glied – wenn die Welt noch so lange halten sollte – hiermit ausdrücklich, und so lieb ihnen, wie ich hoffe, mein Andenken sein wird, anbefehle, sich bestens vorzusehen, damit sie mit einem solchen Frauenzimmer, sie sei Jungfrau, Ehefrau oder Witwe, in keine von allen vorbenannten Beziehungen und Verbindungen – in so fern es bei ihnen steht solches zu vermeiden – jemals verwickelt werden mögen.
Ich ersuche sie inständig samt und sonders, diesen meinen ernstlichen erzväterlichen Befehl wohl zu erwägen, und solchem getreulich nachzukommen.
Kapitel 6
Worin Danischmend die Schwachheit hat, mit einem Kalender über häusliche Glückseligkeit zu disputieren
Wir wissen nun bereits so viel von unserm Philosophen, daß wir begreifen können, wie er – ungeachtet seiner Verbannung vom Hofe und aus der großen Welt, ein glückliches Leben geführt habe.
Er pflegte allemal zu lächeln und die Achseln ein wenig zu zucken, wenn ihm einfiel, daß der Doktor Abu-Bekr-Muhamed-Ibn Bajah-Ibn Fadhl Ibn Jaafar-Alfabali12P. Onocephalus
nicht weniger als zweihundertundfünfundsechzig verschiedene Erklärungen der Glückseligkeit gesammelt, und dennoch die einzige, die unserm Manne die wahre schien, vergessen hatte.
»Häusliche Glückseligkeit ist die einzige Art glücklich zu sein, die dem Menschen hienieden bestimmt ist«, pflegte er zu sagen. »Ich habe noch nie einen Menschen mit seinem Dasein unzufrieden, neidisch über andrer Glück, boshaft und übeltätig gesehen, der in seinem Kabinett, in seiner Kinderstube und in seinem Schlafzimmer glücklich war. Auch hab ich nie gehört noch gelesen, daß ein solcher Mann eine Verräterei gegen den Staat angezettelt, oder einen Aufruhr erregt, oder sich zum Haupt einer Sekte aufgeworfen,13Sleidanus
oder an die Spitze einer Räuberbande oder Schwärmerrotte gestellt, und Unheil auf Gottes Boden angerichtet hätte. Ein Mann, der in seinem Hause glücklich ist, ist immer auch ein guter Bürger, ein guter Gesellschafter, ein guter Mensch.«
»Aber« (wandte der Kalender, mit dem er einst über diese Sache wortwechselte, ein) »um dieser Art von Glückseligkeit, der du einen so großen Wert beilegst, fähig zu sein, wird, deucht mich, eine besondere Gemütsverfassung, eine gewisse Empfindsamkeit, Mäßigung, Gutherzigkeit und Einfalt der Sitten vorausgesetzt, ohne welche das größte häusliche Glück nicht glücklich macht, mit welchen hingegen, auch ohne dieses, niemand unglücklich sein kann.«
»Unstreitig«, versetzte Danischmend lachend, »setzt der Genuß des häuslichen Glücks die Fähigkeit – es zu genießen, voraus. Aber was braucht man dazu mehr als ein Mensch zu sein, ein bloß menschlicher Mensch, der weder mehr noch weniger hat, als den Grad von Empfindung und Vernunft, womit die Natur alle Söhne und Töchter Adams ausstattet? Wo ist der Mensch, – er müßte denn im Keime schon verunglückt sein – in dessen Macht es nicht stände, wie ein Mensch zu fühlen und zu handeln? Und liegt nicht eben darin, daß die Fähigkeit zum Genuß des häuslichen Glücks unter allen Fähigkeiten der menschlichen Natur die gemeinste ist, und am Wenigsten Mitwirkung fremder Umstände, Verfeinerung und Kunst voraussetzt, liegt nicht eben darin der stärkste Beweis, daß häusliches Glück das wahre Glück des Menschen ist?
Ihr andern, die ihr euch so viel damit wißt, weiser zu sein als wir natürliche Leute, und – weil ihr's besser verstehen wollt als die Natur – euch Gott weiß welch ein System von Entbehrungen und Unabhängigkeit und erkünstelten Tugenden ausgedacht habt, das den Mangel dessen, was wir genießen, ersetzen soll, – wenn ihr aufrichtig sein wolltet! was für Geständnisse hättet ihr zu tun! Wie teuer verkauft euch die Natur die unrühmlichen Siege, die ihr über sie erfechtet!«