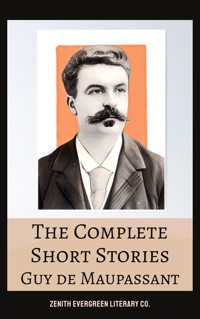Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält die folgenden Novellen des Meisters der Schauerliteratur: Die Schwestern Rondoli Die Wirtin Der Fall Luneau Selbstmorde Onkel Sosthène Das Fäßchen Er? Der Riegel Der Orden Andreas' Leiden Der Regenschirm Das Sünden-Brot Die Begegnung Der Weise Châli
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geschichten für schlaflose Nächte, Band 2
Guy de Maupassant
Inhalt:
Henri René Albert Guy de Maupassant – Biografie und Bibliografie
Die Schwestern Rondoli
Die Wirtin
Der Fall Luneau
Selbstmorde
Onkel Sosthène
Das Fäßchen
Er?
Der Riegel
Der Orden
Andreas' Leiden
Der Regenschirm
Das Sünden-Brot
Die Begegnung
Der Weise
Châli
Geschichten für schlaflose Nächte, Band 2, G. de Maupassant
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster, Deutschland
ISBN: 9783849624248
www.jazzybee-verlag.de
admin@jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Thaut Images - Fotolia.com
Henri René Albert Guy de Maupassant – Biografie und Bibliografie
Franz. Romanschriftsteller, geb. 5. Aug. 1850 auf Schloß Miromesnil in der Normandie, gest. 7. Juli 1893 in Paris, begann seine Laufbahn als Ministerialbeamter. Für den angehenden Schriftsteller war Gustave Flaubert, ein Vetter seiner Mutter, gebornen Le Pottevin, ein treuer, unnachsichtiger Berater, der sogleich erkannte, daß in der Novellistik seine Stärke lag. Bekannt wurde M. nicht durch die Gedichte »Des Vers« (1880), sondern erst durch die 1870 in Rouen spielende musterhafte Novelle »Boule de Suif«, das Glanzstück der von Zola und seinen Schülern vereinigten »Soirées de Médan« (1880). Durch Objektivität und scharfe Hervorhebung des charakteristischen Merkmals zeichnete sich M. vor den übrigen Naturalisten, auch vor Zola selbst, aus. Seine Novellen sind im ganzen seinen Romanen überlegen, weil die hastige Produktion von 27 Bänden innerhalb 10 Jahren die planmäßige Arbeit erschwerte. Hervorragend sind immerhin die beklemmend traurige Ehegeschichte »Une Vie« (1883) und der Journalistenroman »Bel-Ami« (1885). Es folgten »Mont-Oriol« (1887), »Pierre et Jean« (1888) und endlich die einen unheilvollen Einfluß Bourgets verratenden sentimentalen Romane »Fort comme la Mort« (1889) und »Notre cœur« (1890). Unter den 20 Novellenbänden ragen besonders hervor: »La Maison Tellier« (1881), »Miss Harriet« (1884), »Monsieur Parent« (1885), »Le Horla« (1887), »L'inutile Beauté« (1890). Die Novelle »Musotte« dramatisierte M. mit J. Normand 1891 mit großem Erfolg. Der direkt für die Bühne geschriebene Zweiakter »La Paix du Ménage« (1893) gelang weniger. M. verfiel, wie sein älterer Bruder und mehrere andre Verwandte, in Wahnsinn, machte in Cannes einen Selbstmordversuch und starb in der Privatanstalt Blanche zu Paris. Eine illustrierte Gesamtausgabe seiner Werke erschien in 27 Bänden 1900–04. Von den zahlreichen Übersetzungen nennen wir die von H. v. Ompteda (»Gesammelte Werke«, Berl. 1898–1903, 20 Bde.). Ein Denkmal wurde ihm 1897 im Parc Monceaux zu Paris gesetzt.Vgl. A. Lumbroso, Souvenirs sur M., sa dernière maladie, sa mort (Par. 1905).
Die Schwestern Rondoli
I.
Nein, sagte Pierre Jouvenet, Italien kenne ich nicht, obgleich ich zwei Mal auf dem Wege dahin war. Aber jedes Mal wurde ich an der Grenze durch Umstände aufgehalten, die mir's unmöglich machten, weiter zu kommen. Und doch haben mir diese beiden Versuche einen reizenden Begriff von den Sitten dieses schönen Landes beigebracht. Die Städte, Museen, die Meisterwerke der Kunst, mit denen Italien begnadet ist, muß ich erst noch kennen lernen. Sobald ich irgend kann, werde ich einen erneuten Versuch machen, mich auf dieses mir bisher unerreichbare Gebiet zu begeben.
– Sie verstehen nicht was das heißen soll? – Gut, ich will es Ihnen erklären.
Im Jahre 1874 bekam ich Lust einmal Venedig, Florenz, Rom, Neapel zu besuchen. Der Wunsch kam mir so gegen den 15. Juni, zur Zeit wo die Frühlingsdüfte uns den Drang in die Weite, den Drang nach Liebe in's Herz zaubern. Doch ich bin nicht eigentlich eine Reisenatur. Mir dünkt der Ortswechsel zwecklos und ermüdend. Nächte auf der Eisenbahn, der Halbschlaf beim Rütteln des Zuges, bei Kopf- und Gliederschmerzen, die Schmutzkruste, die sich auf der Haut bildet, der Staub, der in die Augen kommt und sich in die Haare setzt, der Kohlengestank, das fürchterliche Essen an den Büffets, wo es immer zieht, all das ist nach meinem Geschmack ein schrecklicher Anfang für eine Vergnügungsreise.
Nach dieser Einleitung im Schnellzuge kommt die Unbehaglichkeit des Hotels, einer großen, menschenerfüllten und doch öden Karawanserei, in der man sich in ungewohnten, traurigstimmenden Räumen befindet und einen ein zweifelhaftes Bett erwartet. – Über mein Bett geht mir nichts. Es ist das Allerheiligste des Lebens. Ihm übergiebt man seinen müden Leib, daß er sich erhole im Weiß der Linnen, in der Wärme der Kissen.
Dort verleben wir die süßesten Stunden des Daseins, die Stunden der Liebe und des Schlafes. Das Bett ist geheiligt. Wir müssen es verehren und lieben als das Beste und Süßeste, das es auf der Erde giebt.
Das Betttuch in einem Hotel kann ich nicht ohne Ekel berühren. Was geschah darin die vergangene Nacht. Was für abstoßende, unreinliche Menschen haben auf diesen Matratzen gelegen. Und ich denke an alle gräßlichen Wesen, die man täglich trifft, an widerliche Krüppel, an Ausschlagbehaftete, an schmutzige Hände, die unwillkürlich einen Rückschluß auf das Übrige herausfordern. Ich denke an die, bei deren Begegnen einem ein unüberwindlicher Knoblauch- oder Schweißgeruch entgegenweht. Ich denke an Mißgestaltung und Krankenausdünstung, an alles Häßliche, an alle Unreinlichkeiten der Menschen.
Alles das hat in dem Bett gelegen, in dem ich schlafen soll. Wenn ich nur einen Fuß hineinsetze, wird mir schlecht.
Und erst die Diners im Hotel, die lange Table d'hôte mitten zwischen langweiligen oder albernen Menschen! Und die gräßlichen, einsamen Mahlzeiten an jenen kleinen Tischen im Restaurant, auf denen ein armseliges Licht mit Lampenschirm brennt.
Und die trüben Abende in einem Ort, den man nicht kennt? Giebt es etwas Gräßlicheres, als wenn die Nacht hereinbricht in einer fremden Stadt? Man geht seines Weges mitten im Menschengewühl, mitten in einem Treiben, das einem vorkommt wie ein Traum. Man erblickt Gesichter, die man nie gesehen und nie wiederschauen wird, man hört Stimmen über Dinge sprechen, die einem gleichgültig sind in einer Sprache, die man nicht einmal versteht. Da überschleicht einen das furchtbare Gefühl grenzenloser Einsamkeit. Das Herz zieht sich zusammen, die Füße wollen nicht mehr fort, die Seele fühlt sich ermattet. Man geht als wolle man fliehen, man geht nur, um nicht in's Hotel zurückzukehren, wo man sich noch verlorener fühlen würde, weil man zwar daheim ist, aber doch nur im bezahlten Allerweltsheim. Und endlich findet man sich in irgend einem Café wieder, dessen Goldklexereien und grelles Licht einen noch tausend Mal mehr bedrücken als das Dunkel der Straße. Da fühlt man sich bei seinem schmutzigen Glase Bier, das ein eilfertiger Kellner gebracht, so unerhört einsam, daß einen eine Art Irrsinn packt: der Drang zu fliehen, irgend wohin zu eilen, ganz gleich wohin, nur um nicht hier zu bleiben vor diesem Marmortisch unter diesem strahlenden Licht. Und jäh kommt einem die Erkenntnis, daß man aller Orten, überall auf dieser Erde allein ist, aber daß zu Haus uns nur die stete Berührung mit unseren Nächsten das Gefühl der Verwandtschaft vorgaukelt. In diesen Stunden der Verlassenheit, des tiefsten Alleinseins in ferner Stadt, werden die Gedanken weiter, klarer und tiefer. Dann übersieht man das Leben mit einem Blick jenseits des Gesichtswinkels ewiger Hoffnung, ohne die Täuschung der Gewohnheit, und man wartet nicht mehr auf ein immer nur geträumtes Glück.
Wenn man in die Ferne geht, begreift man erst wie alles klein ist, beschränkt und öde. Wer das Unbekannte sucht, dem wird offenbar, wie alles eitel ist und vergänglich. Wer die Erde durchschweift, sieht erst wie winzig sie ist und überall gleich.
Ach ich kenne sie, diese dunklen Abende, wenn man auf's Geratewohl durch unbekannte Straßen irrt. Ich fürchte sie mehr denn alles Andere.
Da ich nun um keinen Preis allein nach Italien reisen wollte, so überredete ich meinen Freund Paul Pavilly mich zu begleiten.
Sie kennen Paul. Für ihn giebt es, wie für viele Männer, auf der ganzen Welt, im ganzen Leben nur eines: Frauen. Ihm verklären und erleuchten die Frauen das Dasein. Er findet die Erde nur bewohnbar, weil es Frauen giebt. Die Sonne scheint hell und warm, weil sie ihnen leuchtet. Die Luft atmet sich süß, weil sie ihre Wangen umspielt und die Härchen an der Schläfe flattern macht. Er liebt den Mond, weil sie im Mondenschein träumen und dieser der Liebe einen schmachtenden Reiz verleiht. Alles was Paul thut, hat eine Frau als Hintergrund. Alle seine Gedanken drehen sich um sie, er bemüht sich nur um sie, er hofft nur von ihnen.
Ein Dichter hat diese Art von Männern so gebrandmarkt:
»Vor allem hasse ich den Barden, der mit Thränen Im Auge zu den Sternen einen Namen fleht, Der die Natur verlassen, öde würde wähnen, Wenn ihm nicht eine Grete an der Seite geht.
Köstliche Leute wahrlich, die sich Mühe geben, Damit man einen flücht'gen Blick schenkt der Natur, Mit Unterröcken alle Baume zu bekleben, Zu säen Weiberhäubchen auf die grüne Flur!
Sie können nicht die Klänge der Natur belauschen, Sie können ihre hehren Wunder nicht verstehn, Die nicht im Thal allein, allein im Waldesrauschen, Die nur mit Weibsgedanken ihres Weges gehn!«
Als ich Paul von Italien sprach, weigerte er sich zuerst durchaus Paris zu verlassen. Aber ich fing an, ihm Reiseabenteuer zu erzählen, und sagte ihm wie reizend die Italienerinnen seien. In Neapel versprach ich ihm ausgesuchte Vergnügungen, dank einer Empfehlung, die ich von einem gewissen Signor Michele Amoroso erhalten, dessen Verbindungen den Reisenden nützlich sind. Das gewann ihn.
II.
An einem Donnerstag Abend, am 26. Juni, stiegen wir in den Schnellzug. Um diese Jahreszeit fährt man eigentlich nicht nach dem Süden. Wir waren allein im Coupé, beide schlechter Laune, denn wir ärgerten uns Paris zu verlassen. Diese Reise war zu dumm und wir dachten sehnsüchtig an das kühle Marly, an die schöne Seine zurück, an die hübschen Ufer, die wonnigen Tage wenn wir im Boot saßen, die träumenden Abende in der Dämmerung auf dem Fluß.
Paul lehnte sich in seine Ecke und erklärte, sobald sich der Zug in Bewegung gesetzt:
– Das ist zu blödsinnig, da runter zu fahren.
Da es nun zu spät war, entgegnete ich:
– Du brauchtest ja nicht mitzukommen.
Er antwortete nicht. Aber er machte ein so wütendes Gesicht, daß ich lachen mußte. Er sah dabei ganz aus wie ein Eichhörnchen. Übrigens hat jeder von uns unter seinen Menschenzügen ein Tiergesicht, wie ein Überrest seiner einstigen Abstammung. Wie viele Leute haben nicht etwas von einer Bulldogge, von einem Ziegenbock, Kaninchen, Fuchs, Pferd oder Ochsen! Paul ist das Mensch gewordene Eichhörnchen. Er hat die lebhaften Augen dieses Tieres, sein rötliches Haar, seine spitze Nase, seinen kleinen, zarten, biegsamen und beweglichen Körper und vor allem ganz ähnliche Hand- und Körperbewegungen, die die Erinnerung hervorrufen. Endlich fielen wir beide in jenen Eisenbahnschlummer, der fortwährend durch einen eingeschlafenen Arm, durch Genickschmerzen, durch das jähe Halten des Zuges unterbrochen wird.
Als wir längs der Rhone hinfuhren, wachten wir auf. Und bald hörten wir das ununterbrochene Zirpen der Cikaden durch die Fenster. Dieses Zirpen, das einem vorkommt wie die Stimme des Südens, der Gesang der Provence. Es zauberte uns das heitere Bild des Südens vor, den Geschmack der sonnverbrannten Erde, der steinigen, lichtdurchfluteten Heimat der kurzstämmigen Olive mit ihrem graugrünen Laub.
Als der Zug wieder hielt, lief ein Beamter an den Wagen entlang und rief schallend: »Valence«. Ein richtiges Valence im Tonfall des Südfranzosen, ein Valence, das uns wieder die Provence zu Sinnen führte wie vorhin das Zirpen der Cikaden.
Bis Marseille geschah nichts Besonderes.
Wir stiegen aus, um am Buffet zu frühstücken.
Als wir wieder einstiegen, saß eine Frau im Coupé.
Paul warf mir einen freudigen Blick zu, drehte mechanisch den kurzen Schnurrbart und fuhr sich wie mit einem Kamm mit allen fünf ausgespreizten Fingern durch das nach der Nachtfahrt ungeordnete Haar. Dann setzte er sich der Unbekannten gegenüber.
Mich plagt es immer, jedesmal wenn ich ein neues Gesicht sehe, sei es auf Reisen, sei es in der Gesellschaft, zu erraten, was für eine Art von Mensch, welcher Geist welcher Charakter sich hinter den Zügen verbirgt. Es war eine junge Frau, jung und hübsch, sicher ein Kind des Südens. Sie hatte wundervolle Augen und prachtvolles schwarzes gewelltes Haar. Es war ein wenig gekräuselt und so dicht, stark und lang, daß es schwer aussah und den Eindruck machte, als müsse es den Kopf belasten. Da sie elegant, aber mit einer gewissen südländischen Geschmacklosigkeit gekleidet ging, so hatte sie einen leichten Anstrich von etwas Gewöhnlichem. Ihre regelmäßigen Züge besaßen nicht jene Anmut und Zartheit, die Aristokratenkinder bei der Geburt mitbekommen, als Erbschaft eines dünnflüssigen Blutes.
Sie trug Armbänder, die zu breit waren, als daß sie hätten aus echtem Golde sein können, und Ohrringe mit hellen Steinen, aber wiederum zu groß für Brillanten. In ihrem ganzen Wesen hatte sie etwas von den unteren Schichten. Man ahnte förmlich, daß sie übermäßig laut sprechen würde und hastig gestikulieren.
Der Zug fuhr ab.
Sie blieb regungslos sitzen und starrte vor sich hin mit wütendem Gesichtsausdruck. Nicht eines Blickes hatte sie uns gewürdigt.
Paul unterhielt sich mit mir. Er sagte Dinge, die Eindruck machen sollten, indem er Sachen auskramte, von denen er annahm, sie würden ihre Aufmerksamkeit erregen, wie Geschäftsleute ausgesuchte Waren in's Schaufenster legen, um die Kauflust anzuregen.
Aber es war, als hörte sie nichts von alledem.
– Toulon! Zehn Minuten Aufenthalt. Buffet! rief der Beamte.
Paul gab mir ein Zeichen auszusteigen und fragte sobald wir auf dem Bahnsteig standen:
– Wofür hältst Du sie?
Ich lachte:
– Ich? Das weiß ich nicht. Ist mir auch höchst Wurst!
Er war ganz aufgekratzt:
– Das Mädel ist riesig hübsch und frisch! Diese Augen! Aber sehr zufrieden sieht sie nicht aus! Sie muß Unannehmlichkeiten gehabt haben. Auf nichts zeichnet sie.
Ich brummte:
– Du verpuffst Dein Pulver umsonst!
Aber er wurde böse:
– Ich verpuffe gar kein Pulver, lieber Freund. Ich finde das Mädel sehr hübsch. Das ist alles. – Man müßte sie anreden! Aber was soll man sagen? Fällt Dir nicht was ein? Hast Du denn keinen Schimmer wer sie sein könnte?
– Keine Spur. Ich taxiere sie auf 'ne kleine Schauspielerin von 'ner Schmiere, die, nachdem sie wegen 'ner Liebesgeschichte durchgebrannt war, nun ihrer Truppe nachreist.
Er schien gekränkt, als hätte ich ihm etwas Verletzendes gesagt:
– Woraus willst Du denn das schließen? Ich finde im Gegenteil, daß sie sehr anständig aussieht.
Ich gab zurück:
– Verehrter, nun sieh Dir doch mal die Armbänder, die Ohrringe, das Kleid an. Ich würde mich nicht weiter wundern, wenn es eine Tänzerin wäre, oder selbst was aus dem Cirkus, aber eher noch 'ne Tänzerin. Sie hat was an sich, das ganz nach Theater riecht.
Diese Vermutung störte ihn offenbar:
– Lieber Freund, dazu ist sie zu jung. Sie ist kaum zwanzig.
– Aber guter Kerl, man kann vielerlei vor zwanzig Jahren machen: Tanz oder Deklamation. Dabei will ich was Anderes noch gar nicht mitrechnen, das sie vielleicht ganz allein betreibt.
– Einsteigen. Schnellzug nach Nizza, Ventimiglia! rief der Schaffner.
Wir mußten in's Coupé. Unsere Nachbarin aß eine Orange. Nein, etwas Vornehmes hatte sie nicht. Sie hatte ihr Taschentuch auf den Knieen ausgebreitet und die Art und Weise wie sie die Schale abriß, den Mund öffnete um die Stücke zwischen die Zähne zu nehmen, die Kerne aus dem Fenster spuckte, ließ über ihre schlechte Erziehung keinen Zweifel.
Übrigens schien sie noch mürrischer zu sein und würgte eilig ihre Orange mit einem furchtbar komischen Wutausdruck hinunter.
Paul verschlang sie mit den Blicken. Er suchte auf alle Weise ihre Aufmerksamkeit zu erregen und ihre Neugierde zu wecken. Und er fing wieder eine Unterhaltung mit mir an, machte einen großen Aufwand an hervorragenden Gedanken indem er vertraulich bekannte Namen nannte. Sie achtete nicht im Geringsten auf seine Anstrengungen.
Wir fuhren durch Fréjus, Saint-Raphaël, durch einen ewigen Garten, ein wahres Rosenparadies, durch blühende Orangen- und Citronen-Wälder, die nebeneinander weiße Blüten und goldene Früchte tragen, durch das Reich der Düfte, das Blumeneden an dieser Wunderküste hin von Marseille bis Genua.
Im Juni muß man hier sein, wo in den engen Thälern, auf Hügelhang, wild und frei die schönsten Blumen sprießen. Überall sieht man Rosen, ganze Felder, Hecken, Wälder von Rosen. Sie klettern an den Mauern empor, blühen auf den Dächern, ranken sich an Bäumen hinauf, leuchten aus dem Laube, weiß, rot, gelb, klein oder riesig, dürftig im glatten, einfachen Kleide oder prächtig in schwerem, glänzenden Gewand.
Ihr starker Duft, der immer strömt, schwängert die Luft, macht sie köstlich und ermattend. Und der noch stärkere Geruch der Orangen scheint das Atmen zu versüßen.
Die weite Küste mit ihren braunen Felsen streckt sich vor uns aus vom regungslosen Mittelmeer umspült. Wie ein feuriges Gespinnst liegt die mächtige Sommersonne auf den Bergen, auf den langen Sandstrecken des Ufers, auf der stahlblauen See. Immer weiter fährt der Zug, tritt in Tunnel ein um die vorspringenden Felswände zu überwinden, gleitet an sanftgewellten Hügeln hin und rollt hoch über dem Wasser auf Simsen an senkrechter Wand. Und ein wohliger, leiser Salzgeruch, ein Dunst von trockenen Algen mischt sich ab und zu mit dem mächtigen, berauschenden Duft der Blumen. Aber Paul sah und spürte nichts. Unsere Mitreisende hatte seine Aufmerksamkeit ganz in Anspruch genommen.
In Cannes gab er mir wieder ein Zeichen auszusteigen. Er wollte nochmals mit mir reden. Wir hatten kaum den Wagen verlassen, als er meinen Arm nahm:
– Hör' mal, sie ist reizend. Sieh nur mal ihre Augen an! Und ihr Haar. Lieber Freund, so was hab' ich noch nie gesehen!
Ich antwortete:
– Na da beruhige Dich doch, oder wenn Du Absichten hast, riskiere mal 'n Vorstoß. Wenn sie auch 'n bißchen brummig ist, so sieht sie mir doch nicht aus, als ließe sie nicht mit sich reden!
Er gab zurück:
– Könntest Du sie nicht mal anreden? Ich kann keinen Anfang finden. Wenn's losgehen soll bin ich blödsinnig verlegen. Ich hab's nie fertig gekriegt auf der Straße eine anzureden. Ich laufe hinterher, schnuppere drum rum, komme ran, und weiß nie wie ich anfangen soll. Ein einziges Mal habe ich 'ne Unterhaltung angefangen. Als ich genau sah, daß man nur erwartete ich sollte loslegen, und da ich durchaus irgend etwas reden mußte, stammelte ich: »Sonst geht's Ihnen gut?« Sie lachte mir in's Gesicht und ich riß aus.
Ich versprach Paul mir alle Mühe zu geben, eine Unterhaltung zu beginnen, und als wir unsere Plätze wieder eingenommen, fragte ich artig unsere Nachbarin:
– Stört es Sie, gnädige Frau, wenn wir rauchen?
Sie antwortete:
– Non capisco.
Sie war also Italienerin. Ich mußte an mich halten nicht herauszuplatzen. Da Paul kein Wort Italienisch verstand, so mußte ich den Dolmetscher spielen. Ich fing also gleich an und sagte in jener Sprache:
– Ich erlaubte mir zu fragen, ob es Sie im Geringsten stören würde, wenn wir rauchen.
Sie herrschte mich wütend an:
– Che mi fa!
Nicht einmal den Kopf hatte sie gewendet, noch mich angeblickt und ich war ganz verblüfft, da ich nicht wußte, ob ich dieses »Was geht's mich an!« für »ja«, für »nein«, für ein Zeichen ihrer Gleichgültigkeit halten sollte oder für ein einfaches: »Laß mich in Frieden!«
Ich fing wieder an:
– Wenn Sie der Rauch nur im Mindesten stört. .
Da antwortete sie »mica« in einem Ton, der etwa einem »Sie können mir den Buckel raufkriechen!« entsprach. Aber es war eine Erlaubnis und ich sagte zu Paul:
– Du darfst rauchen.
Er blickte mich mit jenem erstaunten Ausdruck an, den man annimmt, wenn man Leute verstehen will, die in unserer Gegenwart eine fremde Sprache sprechen. Und er fragte sehr komisch:
– Was hast Du ihr gesagt?
– Ich habe sie gefragt, ob wir rauchen dürften.
– Sie spricht also nicht Französisch?
– Nicht einen Ton!
– Was hat sie geantwortet?
– Wir möchten thun und lassen was wir wollten.
Dabei steckte ich mir eine Cigarre an. Paul begann von neuem:
– Weiter hat sie nichts gesagt?
– Lieber Freund, wenn Du ihre Worte gezählt hättest, so würdest Du gemerkt haben, daß sie gerade sechs gesagt hat. Davon sollten mir zwei begreiflich machen, daß sie kein Französisch verstünde. Bleiben also vier. Na und mit vier Worten kann man wahrhaftig nicht alles Mögliche ausdrücken.
Paul schien ganz unglücklich, enttäuscht und ratlos zu sein.
Aber plötzlich fragte mich die Italienerin mit dem ihr – wie's schien – eigenen unzufriedenen Ton:
– Wissen Sie um wieviel Uhr wir in Genua ankommen?
– Um elf Uhr abends! antwortete ich und fügte nach einer Minute hinzu:
– Mein Freund und ich fahren auch nach Genua. Wenn wir Ihnen unterwegs etwa irgend wie nützlich sein könnten, so würde es uns sehr freuen!
Da sie nicht antwortete, so fing ich wieder an:
– Sie sind allein und wenn wir Ihnen einen Dienst leisten könnten....
Sie brummte ein neues »mica«, aber so grob, daß ich sofort schwieg. Paul fragte:
– Was hat sie gesagt?
– Sie hat gesagt, sie fände Dich riesig nett.
Aber er war nicht zum Scherzen aufgelegt und bat mich trocken, nicht mit ihm zu spaßen. Da übersetzte ich ihm die Frage der jungen Frau und meinen so schroff abgelehnten ritterlichen Vorschlag.
Er war wirklich aufgeregt wie ein Eichhörnchen im Käfig, und sprach:
– Wenn man nur rauskriegen könnte, in welchem Hotel sie absteigt. Dann könnten wir in's selbe gehen. Sieh doch mal zu, daß Du das mit Schläue ausbaldowerst und wieder einen Vorwand findest, mit ihr zu reden.
Es war wirklich nicht leicht! Mir machte es zwar selbst Spaß, mit diesem schwierigen Mädchen anzubinden, aber ich wußte nicht, was ich mir ausdenken sollte.
Wir kamen durch Nizza, Monaco, Mentone und der Zug hielt an der Grenze zur Zollabfertigung.
Obgleich ich die unerzogenen Leute nicht vertragen kann, die im Coupé frühstücken und essen, holte ich eine ganze Ladung von Vorräten, um einen letzten Angriff auf die Naschhaftigkeit unserer Reisegefährtin zu unternehmen. Ich hatte das bestimmte Gefühl, daß dieses Mädchen für gewöhnlich ganz vernünftig war. Irgend eine Widerwärtigkeit stimmte sie nur so reizbar. Aber möglicherweise bedurfte es bloß einer Kleinigkeit, eines Wunsches, der ihr kam, eines Wortes, irgend eines Anerbietens, das ihr paßte, um ihr die Wolken von der Stirn zu scheuchen, sie umzustimmen und sie zu gewinnen.
Wir fuhren weiter. Wir drei immer noch allein. Ich breitete meine Vorräte aus, zerlegte das Huhn, legte die Schinkenschnitten schön in einer Reihe auf Papier, dann baute ich dicht neben der jungen Frau sorgsam unser Dessert auf: Erdbeeren, Pflaumen, Kirschen, Kuchen Bonbons.
Als sie sah, daß wir anfingen zu essen, holte sie ihrerseits aus einem Täschchen ein Stück Chokolade nebst zwei Hörnchen hervor und begann mit ihren spitzen schönen Zähnen das knusprige Gebäck und die Tafel zu zerbeißen.
Paul sagte halblaut zu mir:
– Lade sie doch ein!
– Das will ich auch, lieber Freund, nur sind die Anfangsworte nicht gleich so da.
Während dem warf sie ab und zu einen Blick auf unsere Vorräte und ich ahnte, daß sie, wenn sie ihre Hörnchen aufgegessen, wohl noch Hunger haben würde. – Ich ließ sie also ihr einfaches Essen beenden. Dann sagte ich:
– Sie würden uns eine große Freude machen, wenn Sie diese Früchte einmal versuchen wollten!
Wieder antwortete sie »Mica!«, aber in weniger bösem Tone als bisher und ich fuhr fort:
– Darf ich Ihnen einen Schluck Wein anbieten? Ich sehe Sie haben nichts zu trinken. Der Wein ist aus Ihrer Heimat – Italienischer. Da wir nun bei Ihnen sind, so würde es uns freuen, wenn der Mund einer hübschen Italienerin von uns, den französischen Nachbarn, etwas annähme.
Ganz leise schüttelte sie den Kopf. Sie wollte ablehnen, aber der Wunsch anzunehmen schimmerte durch. Doch wiederum sagte sie »mica«, aber ein »mica«, das beinahe höflich klang. Ich ergriff die auf italienische Art strohumflochtene Flasche, füllte ein Glas und bot es ihr an mit den Worten:
– Trinken Sie, es soll unsern Willkomm in Ihrem Vaterlande bedeuten.
Sie nahm das Glas mit mürrischer Miene und leerte es auf einen Zug, wie eine, die sehr durstig ist. Dann gab sie es mir zurück ohne ›Danke‹ zu sagen.
Da bot ich ihr Kirschen an:
– Bitte langen Sie zu. Sie sehen, daß es uns Freude macht.
Sie musterte von ihrer Ecke aus die vor ihr ausgebreiteten Früchte und sagte so schnell, daß ich Mühe hatte ihr zu folgen:
– Amo non pacciono ne le ciliegie ne le susine amo soltanto le fagole.
– Was sagt sie? fragte Paul sofort.
– Sie meint, sie liebt weder Kirschen noch Pflaumen, sondern nur Erdbeeren.
Und ich legte ihr eine Düte voll Walderdbeeren auf den Schoß. Sofort machte sie sich darüber her, nahm sie mit den Fingerspitzen und warf sie in großem Bogen in ihren Mund, der sich schelmisch reizend aufthat, sie zu empfangen.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: