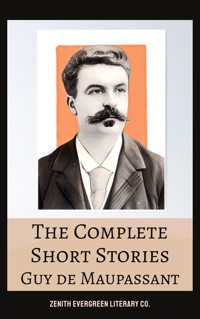Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält die folgenden Novellen des Meisters der Schauerliteratur: Mondschein Ein Staatsstreich Der Wolf Das Kind Weihnachtsmärchen Königin Hortense Die Verzeihung Legende vom Mont Saint-Michel Eine Witwe Fräulein Cocotte Die Schmucksachen Vision Die Thür Der Vater Moiron Unsere Briefe Die Nacht
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geschichten für schlaflose Nächte, Band 5
Guy de Maupassant
Inhalt:
Henri René Albert Guy de Maupassant – Biografie und Bibliografie
Mondschein
Ein Staatsstreich
Der Wolf
Das Kind
Weihnachtsmärchen
Königin Hortense
Die Verzeihung
Legende vom Mont Saint-Michel
Eine Witwe
Fräulein Cocotte
Die Schmucksachen
Vision
Die Thür
Der Vater
Moiron
Unsere Briefe
Die Nacht
Geschichten für schlaflose Nächte, Band 5, G. de Maupassant
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster, Deutschland
ISBN: 9783849624279
www.jazzybee-verlag.de
admin@jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Thaut Images - Fotolia.com
Henri René Albert Guy de Maupassant – Biografie und Bibliografie
Franz. Romanschriftsteller, geb. 5. Aug. 1850 auf Schloß Miromesnil in der Normandie, gest. 7. Juli 1893 in Paris, begann seine Laufbahn als Ministerialbeamter. Für den angehenden Schriftsteller war Gustave Flaubert, ein Vetter seiner Mutter, gebornen Le Pottevin, ein treuer, unnachsichtiger Berater, der sogleich erkannte, daß in der Novellistik seine Stärke lag. Bekannt wurde M. nicht durch die Gedichte »Des Vers« (1880), sondern erst durch die 1870 in Rouen spielende musterhafte Novelle »Boule de Suif«, das Glanzstück der von Zola und seinen Schülern vereinigten »Soirées de Médan« (1880). Durch Objektivität und scharfe Hervorhebung des charakteristischen Merkmals zeichnete sich M. vor den übrigen Naturalisten, auch vor Zola selbst, aus. Seine Novellen sind im ganzen seinen Romanen überlegen, weil die hastige Produktion von 27 Bänden innerhalb 10 Jahren die planmäßige Arbeit erschwerte. Hervorragend sind immerhin die beklemmend traurige Ehegeschichte »Une Vie« (1883) und der Journalistenroman »Bel-Ami« (1885). Es folgten »Mont-Oriol« (1887), »Pierre et Jean« (1888) und endlich die einen unheilvollen Einfluß Bourgets verratenden sentimentalen Romane »Fort comme la Mort« (1889) und »Notre cœur« (1890). Unter den 20 Novellenbänden ragen besonders hervor: »La Maison Tellier« (1881), »Miss Harriet« (1884), »Monsieur Parent« (1885), »Le Horla« (1887), »L'inutile Beauté« (1890). Die Novelle »Musotte« dramatisierte M. mit J. Normand 1891 mit großem Erfolg. Der direkt für die Bühne geschriebene Zweiakter »La Paix du Ménage« (1893) gelang weniger. M. verfiel, wie sein älterer Bruder und mehrere andre Verwandte, in Wahnsinn, machte in Cannes einen Selbstmordversuch und starb in der Privatanstalt Blanche zu Paris. Eine illustrierte Gesamtausgabe seiner Werke erschien in 27 Bänden 1900–04. Von den zahlreichen Übersetzungen nennen wir die von H. v. Ompteda (»Gesammelte Werke«, Berl. 1898–1903, 20 Bde.). Ein Denkmal wurde ihm 1897 im Parc Monceaux zu Paris gesetzt.Vgl. A. Lumbroso, Souvenirs sur M., sa dernière maladie, sa mort (Par. 1905).
Mondschein
Abbé Marignan trug seinen Schlachtennamen mit Recht. Er war ein großer, hagerer, fanatischer Priester, etwas überspannt, aber grundehrlich. Sein Glaube stand felsenfest. Nie kam ihm ein Zweifel. Er meinte seinen Gott genau zu kennen, seine Wege, seinen Willen, seine Absichten.
Wenn er mit großen Schritten in der Allee seines kleinen Pfarrgartens auf und nieder ging, stieß ihm manchmal die Frage auf: »Warum hat Gott das gemacht?« Dann suchte er beharrlich, indem er sich in Gedanken an Gottes Stelle versetzte und fand fast immer eine Antwort. Er war nicht der Mann, in frommer Demut zu sagen: »Herr, deine Wege sind unerforschlich!« Nein, er meinte: »Ich bin Gottes Diener! Daher muß ich die Gründe seiner Handlungen kennen und wenn ich sie nicht kenne, muß ich sie erraten.«
Ihm erschien alles in der Natur mit bewundernswerter, strenger Logik geschaffen. Das ›Warum‹ und, das ›Darum‹ hielt sich immer die Wage. Das Morgenrot war geschaffen zu einem fröhlichen Erwachen, der Tag zum Reifen der Ernte, der Regen, sie zu begießen, die Abende, in den Schlaf hinüberzuleiten und die dunkle Nacht zur Ruhe.
Die vier Jahreszeiten entsprachen völlig allen Bedürfnissen der Landwirtschaft, und der Gedanke wäre dem Priester niemals gekommen, daß die Natur keine Absichten hat und alles, was lebt, sich im Gegenteil der harten Notwendigkeit der Zeiten, des Klimas und der Materie beugt.
Aber er haßte die Frauen, er haßte sie unbewußt und er verachtete sie aus Instinkt. Oft wiederholte er Christi Worte: »Weib, was habe ich mit Dir zu schaffen!« Und er fügte hinzu: »Man sollte meinen, daß Gott selbst mit seinem Werke unzufrieden gewesen.«
Das Weib war für ihn zwölf Mal unrein, wie der Dichter sagt. Sie war die Versucherin, die den ersten Mann verführt und ihr verfluchtes Handwerk noch immer trieb; ein schwaches, gefährliches und geheimnisvoll aufregendes Wesen. Und mehr noch als ihren verderbenden Leib haßte er ihre liebende Seele.
Oft hatte er ihre Zärtlichkeit gefühlt und obgleich er unnahbar war, so setzte ihn doch dieses nimmer ruhende Bedürfnis nach Liebe in Verzweiflung.
Nach seiner Ansicht hatte Gott die Frau nur geschaffen, den Mann zu versuchen und zu prüfen. Man durfte sich ihr nur mit größter Vorsicht nahen immer vor einer Falle auf der Hut. Und waren nicht in der That die ausgebreiteten Arme, der zum Küssen geöffnete Mund eine Falle für jeden Mann?
Duldsam war der Abbé nur gegen Nonnen, die ihr Gelübde unnahbar gemacht. Und dennoch behandelte er sie mit Härte, weil er immer im Grunde ihres eingekerkerten, demütigen Herzens noch diese ewige Zärtlichkeit ahnte, die sogar bis zu ihm drang, wenn er auch Priester war. Er fühlte sie in ihren Augen, die feuchter in Frömmigkeit glänzten als die der Mönche, in ihrer religiösen Verzückung, in die sich ihr Geschlecht mischte, in ihrer Liebe zu Christus, die ihn empörte, weil sie Weibesliebe, Fleischesliebe war. Er fühlte diese verfluchte Zärtlichkeit sogar in ihrem Gehorsam, er hörte sie süß aus ihren Stimmen, wenn sie mit ihm sprachen, er las sie in ihren zu Boden geschlagenen Augen und in ihren schicksalsergebenen Thränen, wenn er sie hart zurechtwies.
Und wenn er das Kloster verließ, schüttelte er sein Priestergewand und ging mit langen Schritten davon, als ob er einer Gefahr entronnen wäre.
Er hatte eine Nichte, die mit ihrer Mutter in einem kleinen Hause der Nachbarschaft lebte. Und er gab sich alle Mühe, aus ihr eine Ordensschwester zu machen.
Sie war hübsch, ein wenig leichtsinnig und spottsüchtig. Wenn der Abbé ihr eine scharfe Predigt hielt, so lachte sie, und wenn er böse gegen sie ward, umarmte sie ihn heftig und drückte ihn ans Herz, während er verzweifelt versuchte, sich aus der Umarmung zu befreien, die ihm doch leise Wonne ins Herz goß, da sie in seinem Herzen das väterliche Gefühl erweckte, das in jedem Manne schläft.
Oft sprach er ihr von Gott, von seinem Gott, wenn er an ihrer Seite durch die Felder schritt. Sie hörte ihm kaum zu, betrachtete den Himmel, die Wiese, die Blumen, mit einer Lust zu leben, die aus ihrem Auge leuchtete. Ab und zu lief sie davon, um einen Schmetterling zu haschen, und wenn sie ihn brachte, rief sie: »Sieh doch, Onkel, wie hübsch er ist! Ich möchte ihn küssen!« Dieses Bedürfnis, die kleinen Schmetterlinge oder irgend eine bunte Blüte zu küssen, erregte und empörte den Priester, der darin immer diese unausrottbare Zärtlichkeit wieder fand, die in jedem Frauenherzen schlummert.
Da teilte ihm plötzlich die Frau des Sakristans, die dem Abbé Marignan die Wirtschaft führte, vorsichtig mit, seine Nichte hätte einen Geliebten. Das regte ihn fürchterlich auf, und er blieb vor Schrecken stehen, wie er war, mit eingeseiftem Gesicht, denn er rasierte sich gerade.
Sobald er soviel Fassung wiedergewonnen, daß er nachdenken und sprechen konnte, rief er:
– Das ist nicht wahr, Melanie! Sie sagen die Unwahrheit.
Aber die Bäuerin legte die Hand aufs Herz:
– Unser Herr Gott soll mich strafen, wenn ich lüge, Herr Pfarrer. Ich sage Ihnen, jeden Abend läuft sie hin, wenn Ihre Schwester zu Bett gegangen ist. Sie treffen sich am Flusse. Sie brauchen nur mal hinzugehen zwischen zehne und Mitternacht.
Da hörte er mit Rasieren auf und lief heftig hin und her, wie er es immer that, wenn er ernst nachdachte. Und als er wieder anfing, sich den Bart zu kratzen, schnitt er sich dreimal von der Nase bis ans Ohr.
Den ganzen Tag über redete er vor Empörung und Zorn kein Wort. Zur Wut des Priesters über die unbesiegliche Liebe kam noch die Verzweiflung des Pflegevaters und Vormundes, des Seelenhirten, der sich betrogen, bestohlen und hintergangen fühlte von seinem Kinde, jene egoistische Beklemmung der Eltern, denen die Tochter anzeigt, daß sie sich, ohne sie zu fragen und gegen ihren Willen, selbst einen Mann gewählt.
Nach seinem Essen versuchte er ein wenig zu lesen, aber er konnte es nicht. Er wurde immer verzweifelter, und als es zehn Uhr schlug, nahm er seinen Stock, einen mächtigen Eichenknüttel, dessen er sich bei seinen nächtlichen Gängen zu bedienen pflegte, wenn er einen Kranken besuchte. Und der dicke Knotenstock, den er in seiner kräftigen Bauernfaust herumwirbelte, schien ihn anzulachen. Da hob er ihn plötzlich und ließ ihn zähneknirschend auf einen Stuhl niederfallen, dessen Lehne zerbrochen zu Boden fiel.
Er öffnete die Thüre, um zu gehen. Aber auf der Schwelle blieb er gebannt stehen. Er war ganz überrascht über den Mondenschein, der so hell leuchtete wie fast niemals. Und da er schwärmerischen Sinnes war, schwärmerisch wie wohl einst die Kirchenväter, diese träumenden Dichter, so zerstreute ihn das plötzlich und die großartige klare Schönheit der fahlen Nacht bewegte ihn sehr.
Sein Garten war Licht-überflutet. Die Reihe der Obstbäume warf einen schmalen Schatten auf die Allee, während große Geisblattpflanzen, die sich an der Mauer seines Hauses emporrankten, süße Düfte ausströmten und in den milden hellen Abend etwas aushauchten wie eine Seele. Er atmete lang und tief und sog die Luft ein wie der Trinker den Wein. Dann ging er mit langsamen Schritten beglückt und verzückt dahin und hatte beinahe seine Nichte vergessen.
Sobald er aus dem Dorfe war, blieb er stehen, um die Landschaft zu betrachten, die von dem weichen Lichte übergossen war und ganz eingetaucht in den süßen schmachtenden Reiz dieser stillen Nacht. Ab und zu klang das kurze metallische Quaken der Frösche, und in der Ferne sangen die Nachtigallen, deren leichte zitternde Musik einen träumen läßt und die Gedanken verlöscht, einen zur Liebe stimmt und zum Schwärmen im Mondenschein.
Der Abbé setzte sich wieder in Gang und sein Herz wurde schwach. Er wußte nicht warum. Er fühlte sich plötzlich wie müde, wie ermattet. Er hatte Luft sich niederzusetzen, hier zu bleiben, zu betrachten und Gott zu bewundern in seiner Schöpfung.
In der Ferne zog sich schlängelnd, den Biegungen des kleinen Flüßchens folgend, eine lange Pappelreihe hin. Feiner Dunst, wie weißer Dampf, den die Mondenstrahlen durchbrachen, lag silbrig leuchtend über den Ufern und bedeckte den gewundenen Lauf des Wässerchens wie mit leichter durchsichtiger Watte.
Der Priester blieb wieder stehen. Die Bewegung seiner Seele wuchs und bedrängte ihn.
Ein Zweifel, eine unbestimmte Unruhe bemächtigte sich seiner. Er fühlte in sich eine jener Fragen aufsteigen, die er sich oftmals stellte:
»Warum hatte Gott das gemacht?« Da doch die Nacht für den Schlaf bestimmt ist, wo das Nachdenken aufhört, wo man ruhen soll und alles vergessen! Warum hatte er sie reizender gemacht als den Tag? Süßer als das Morgenrot und den Abend? Warum leuchtete dieses langsam dahinwandelnde lockende Gestirn dort oben, das poetischer ist als die Sonne und bestimmt scheint, mit seinem milden Scheine Dinge zu bestrahlen, die zu zart und wundersam sind für das helle Licht des Tages, warum leuchtete das durch die Nebel?
Warum ruhte der kunstvollste Sänger der Vogelwelt sich nicht aus wie die anderen? Warum sang er die Nacht hindurch in der verwirrenden Dämmerung?
Warum lag dieser Schleier über der Erde? Warum bewegten diese Schauer sein Herz? Warum griff es ihm in die Seele? Warum ward sein Körper matt?
Wozu all' diese Schönheit und Verführung, die die Menschen doch nicht sahen, da sie schliefen? Wem war dieses Wunderschauspiel bestimmt? Dieser Überfluß an Poesie, die der Himmel auf die Erde senkte?
Der Abbé begriff es nicht.
Aber da erschienen drüben am Wiesenrande unter dem Blätterdach der in Dunst getauchten Bäume zwei Schatten, Seite an Seite.
Der Mann war größer und hielt die Geliebte umschlungen. Ab und zu küßte er sie auf die Stirn. Und sie belebten plötzlich diese unbewegte Landschaft, die sie wie ein göttlicher Rahmen umgab, eigens für sie gemacht. Beide schienen eins, ein Wesen, für das diese stille schweigende Nacht bestimmt war. Und sie kamen auf den Abbé zu wie eine lebendige Antwort, wie die Antwort, die der Herr auf seine Frage gab.
Der Priester blieb stehen, mit klopfendem Herzen, ganz verwirrt. Er meinte, ein biblisches Bild zu sehen, wie die Liebe von Ruth und Boas, die Erfüllung des göttlichen Willens, in einem der Vorbilder, von denen die heilige Schrift erzählt. Und in seinem Kopfe summten die Verse des Hohen Liedes, der Liebeszwiegesang, die versengende Poesie dieses glühenden Buches der Liebe.
Und er sagte sich: »Vielleicht hat Gott solche Nächte geschaffen, um die Liebe der Menschen in einen Zauberschleier zu hüllen.«
Er wich vor diesem Paar zurück, das immer noch eng umschlungen dahin ging. Und doch war es seine Nichte. Aber jetzt fragte er sich, ob er nicht im Begriff sei gegen Gottes Willen zu handeln? Erlaubte denn Gott nicht die Liebe, da er sie augenscheinlich mit solcher Herrlichkeit umgab?
Und er floh erschrocken davon, Er schämte sich fast, als ob er in einen Tempel eingedrungen, den er nicht das Recht hatte zu betreten.
Ein Staatsstreich
In Paris war eben der Fall von Sedan bekannt geworden. Die Republik war proklamiert, und jener Wahnsinn brach aus, unter dem ganz Frankreich bis über die Tage der Kommune hinaus stöhnen sollte. Im ganzen Lande spielte man Soldat.
Ehrsame Strumpfwirker wurden Oberste und thaten Generalsdienste. Revolver und Dolch steckten im roten Gürtel über dicken Philisterbäuchen. Kleine Bürger waren plötzlich Krieger geworden, kommandierten Bataillone freiwilliger Schreier und fluchten wie Fuhrleute, um sich ein Ansehen zu geben.
Die Thatsache allein, eine Waffe zu besitzen und mit einem Gewehre umgehen zu können, machte diese Leute, die sich bis dahin um nichts gesorgt als um ihre Bilanzen, ganz verrückt und gab ihnen ohne jeglichen Grund ein fürchterliches Aussehen für jeden, der sie erblickte. Unschuldige wurden verurteilt, um zu beweisen, daß man töten könne. Man lief durch die Gegenden, wo sich noch kein Preuße gezeigt, schoß die Hunde nieder, die friedlich weidenden Kühe und kranke Pferde, die auf der Weide grasten.
Jeder meinte sich in diesen Tagen zu großer militärischer Laufbahn bestimmt. Die Wirtshäuser der kleinsten Dörfer, die von allerlei uniformierten Geschäftsleuten wimmelten, hatten das Aussehen von Kasernen oder Lazaretten bekommen.
Der Ort Canneville hatte noch keine Nachrichten von der Armee und aus der Hauptstadt erhalten. Aber seit einem Monat herrschte große Aufregung und zwei feindliche Parteien standen einander gegenüber.
Der Bürgermeister Vicomte de Varnetot, ein kleiner magerer, älterer Herr, der, bisher Legitimist, sich erst seit Kurzem aus Ehrgeiz dem Kaiserreich wieder angeschlossen, hatte plötzlich einen entschiedenen Gegner bekommen in der Person des Doktor Massarel, eines dicken sanguinischen Mannes, der das Oberhaupt der republikanischen Partei im Arrondissement war. Dazu war er Meister vom Stuhl der Freimauer-Loge des Hauptortes, Präsident der landwirtschaftlichen Gesellschaft und der freiwilligen Feuerwehr. Dazu Organisator der Landmiliz, die das Vaterland retten sollte.
Im Laufe von vierzehn Tagen war es ihm gelungen, dreiundsechzig Freiwillige für die Verteidigung des Vaterlandes zu gewinnen. Es waren alles verheiratete Leute und Familienväter, verständige Bauern und Kaufleute aus dem Ort. Jeden Morgen exerzierte er sie auf dem Platze vor dem Rathause.
Wenn der Bürgermeister sich zufällig dem Rathause näherte, ließ Oberst Massarel, der ganz bespickt war mit Pistolen und stolz, den Säbel in der Faust, vor der Front seiner Truppe stand, seine Soldaten brüllen: »Es lebe das Vaterland!« Man hatte bemerkt, daß dieser Ruf den kleinen Vicomte ärgerte. Er sah darin ohne Zweifel eine Drohung, eine Herausforderung und zu gleicher Zeit eine hassenswerte Erinnerung an die große Revolution.
Am Morgen des fünften September hielt der Doktor in Uniform, den Revolver auf den Tische, seine Sprechstunde ab. Ein altes Bauernpaar war gerade zur Konsultation erschienen. Der Mann litt seit sieben Jahren an Krampfadern und hatte solange gezögert einen Arzt zu befragen, bis seine Frau auch welche bekommen hatte. Da brachte der Briefträger die Zeitung.
Herr Massarel öffnete sie, erbleichte, richtete sich plötzlich auf und hob in überspannter Weise die Arme gen Himmel, während er die beiden Landleute mit lauter Summe anbrüllte:
– Es lebe die Republik! Es lebe die Republik! Es lebe die Republik!
Dann fiel er in seinen Stuhl zurück, ganz schwach vor Bewegung. Und wie der alte Bauer fortfuhr:
– Es fing an mit Ameisenloofen sozusagen die Beene runter!, rief Doktor Massarel:
– Lassen Sie mich in Frieden, ich habe keine Zeit mich um Ihre Dummheiten zu kümmern. Die Republik ist proklamiert. Der Kaiser ist gefangen, Frankreich ist gerettet! Es lebe die Republik!
Dann lief er zur Thür und schrie:
– Coelestine, schnell, Coelestine!
Das Mädchen kam mit entsetztem Ausdruck gerannt, und er stotterte, so rasend schnell sprach er:
– Meine Stiefel, meinen Säbel, meine Patrontasche und den spanischen Dolch, der auf dem Nachttisch liegt, aber schnell!
Als der dickköpfige Bauer den Augenblick des Schweigens benutzte, und fortfuhr:
– Dann ist's ganz dicke gewurden, wie 'n paar Taschen, die mir beim Gehen weh dhun!, – heulte der Arzt verzweifelt:
– Himmel Sakrament! Lassen Sie mich doch zufrieden! Wenn Sie sich die Füße gewaschen hätten, wär 's nicht vorgekommen.
Dann packte er ihn beim Kragen und schrie ihn an:
– Weißt Du nicht, daß wir jetzt in der Republik leben, Du dreifacher Horn-Ochse?
Aber der Gedanke an die Würde seines Berufes brachte ihn wieder zur Ruhe, und er drängte das bestürzte Ehepaar zur Thür hinaus, während er wiederholte:
– Kommt morgen wieder, guten Leute. Heute habe ich keine Zeit.
Während er sich bis an die Zähne bewaffnete, gab er dem Mädchen wiederum eine Reihe von dringenden Aufträgen:
– Lauf mal schnell zu Leutnant Picart und zu Unterleutnant Pommel und sag ihnen, daß ich sie sofort hier erwarte. Dann schick mir mal gleich Torchebeuf her mit seiner Trommel, aber schnell, schnell!
Und als Coelestine hinausgegangen war, sammelte er sich ein wenig und bereitete sich vor, die Schwierigleiten der Lage zu überwinden.
Die drei Leute trafen zusammen ein in ihren Arbeitsröcken. Der Oberst, der darauf gerechnet hatte, sie in Uniform zu sehen, bekam einen furchtbaren Schrecken:
– Sakrament, wißt ihr denn noch nichts? Der Kaiser ist gefangen! Die Republik ist proklamiert. Jetzt heißt's handeln. Meine Stellung ist schwierig, ich kann sogar sagen gefährlich.
Seine Untergebenen machten ganz erschrockene Gesichter. Er dachte einen Augenblick nach. Dann begann er von neuem:
– Jetzt heißt es handeln und nicht zögern. Minuten bedeuten in solchen Augenblicken Stunden. Alles hängt von der Schnelligkeit des Entschlusses ab. Sie, Picart, gehen sofort zum Herrn Pfarrer und fordern ihn auf, die Sturmglocke läuten zu lassen, damit der ganze Ort zusammenströmt.
– Sie, Torchebeuf, schlagen Generalmarsch in der ganzen Gemeinde bis draußen zu den Höfen von Gerisaie und Salmare, damit die Miliz auf dem Markte unter Waffen tritt. Sie, Pommel, ziehen sofort Ihre Uniform an, nur Rock und Käppi und wir werden zusammen das Rathaus besetzen und Herrn de Varnetot zwingen, mir die Zügel der Regierung zu überlassen! Verstanden?
– Ja.
– Also, nun los und schnell. Pommel, ich begleite Sie bis nach Hause, weil wir zusammen handeln müssen.
Fünf Minuten später erschienen der Oberst und sein Untergebener, bis an die Zähne bewaffnet, auf dem Markte gerade in dem Augenblick, als der kleine Vicomte de Varnetot mit eiligen Schritten von der anderen Seite der Straße kam. Er trug Jagdgamaschen und das Gewehr über der Schulter. Drei Jäger in grünen Anzügen, den Hirschfänger an der Seite, das Gewehr geschultert, folgten ihm.
Während der Doktor ganz erstaunt stehen blieb, drangen die vier Männer in das Rathaus, dessen Thür sich hinter ihnen schloß.
– Sie sind uns zuvorgekommen, murmelte der Arzt. – Jetzt müssen wir auf Verstärkung warten; für den Augenblick ist nichts zu machen.
Leutnant Picart erschien und meldete:
– Der Pfarrer hat sich geweigert, zu gehorchen. Er hat sich sogar mit dem Kirchendiener und dem Schweizer in die Kirche eingeschlossen.
Auf der anderen Seite des Platzes, dem weiß getünchten Rathause gegenüber lag die Kirche stumm und schwarz mit ihrem riesigen eisenbeschlagenen Eichenthor.
Als nun die Einwohner neugierig den Kopf zum Fenster hinaussteckten oder auf der Schwelle ihrer Häuser erschienen, klang plötzlich ein Trommelwirbel und Torchebeuf kam daher, wie verrückt die drei Wirbel des Generalmarsches schlagend. Im Laufschritt lief er über den Platz und verschwand im Feldwege.
Der Oberst zog seinen Säbel und trat allein vor, etwa in die Mitte zwischen die beiden Gebäude, in denen sich der Feind verbarrikadiert hatte. Dann schwang er seine Waffe über dem Kopf und brüllte mit aller Kraft seiner Lungen:
– Es lebe die Republik! Tod allen Verrätern!
Darauf zog er sich zu seinen Offizieren zurück.
Der Fleischer, der Bäcker und der Apotheker schlossen ängstlich ihre Fensterläden. Nur der Materialwarenhändler behielt offen. Während dessen kam allmählich die Miliz an. Die Leute waren ganz verschieden angezogen, nur trugen alle ein schwarzes Käppi mit rotem Streifen; darin bestand die ganze Uniform des Corps. Bewaffnet waren sie mit ihren alten verrosteten Gewehren, die seit dreißig Jahren in der Küche über dem Herd gehangen. Eigentlich machten sie den Eindruck einer Abteilung Feldhüter. Als der Oberst einige dreißig Leute um sich sah, setzte er sie mit ein paar Worten aufs Laufende. Dann wandte er sich zu seinem Stabe und sagte:
– Nun heißt's handeln.
Die Einwohner strömten zusammen und sahen sich neugierig um. Der Arzt hatte schnell seinen Feldzugsplan entworfen:
– Leutnant Picart, Sie werden jetzt ans Rathaus herangehen und Herrn de Varnetot auffordern, mir das Rathaus im Namen der Republik zu übergeben.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: