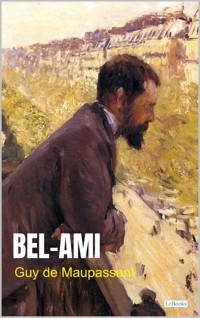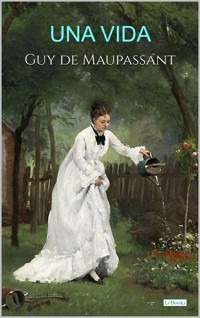Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält die folgenden Novellen des Meisters der Schauerliteratur: Dickchen Der Bursche Allouma Hautot Vater und Hautot Sohn Ein Abend Die Stecknadeln Duchoux Das Stelldichein Die Tote
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Geschichten für schlaflose Nächte, Band 8
Guy de Maupassant
Inhalt:
Henri René Albert Guy de Maupassant – Biografie und Bibliografie
Dickchen
Der Bursche
Allouma
Hautot Vater und Hautot Sohn
Ein Abend
Die Stecknadeln
Duchoux
Das Stelldichein
Die Tote
Geschichten für schlaflose Nächte, Band 8, G. de Maupassant
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster, Deutschland
ISBN: 9783849624309
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Thaut Images - Fotolia.com
Henri René Albert Guy de Maupassant – Biografie und Bibliografie
Franz. Romanschriftsteller, geb. 5. Aug. 1850 auf Schloß Miromesnil in der Normandie, gest. 7. Juli 1893 in Paris, begann seine Laufbahn als Ministerialbeamter. Für den angehenden Schriftsteller war Gustave Flaubert, ein Vetter seiner Mutter, gebornen Le Pottevin, ein treuer, unnachsichtiger Berater, der sogleich erkannte, daß in der Novellistik seine Stärke lag. Bekannt wurde M. nicht durch die Gedichte »Des Vers« (1880), sondern erst durch die 1870 in Rouen spielende musterhafte Novelle »Boule de Suif«, das Glanzstück der von Zola und seinen Schülern vereinigten »Soirées de Médan« (1880). Durch Objektivität und scharfe Hervorhebung des charakteristischen Merkmals zeichnete sich M. vor den übrigen Naturalisten, auch vor Zola selbst, aus. Seine Novellen sind im ganzen seinen Romanen überlegen, weil die hastige Produktion von 27 Bänden innerhalb 10 Jahren die planmäßige Arbeit erschwerte. Hervorragend sind immerhin die beklemmend traurige Ehegeschichte »Une Vie« (1883) und der Journalistenroman »Bel-Ami« (1885). Es folgten »Mont-Oriol« (1887), »Pierre et Jean« (1888) und endlich die einen unheilvollen Einfluß Bourgets verratenden sentimentalen Romane »Fort comme la Mort« (1889) und »Notre cœur« (1890). Unter den 20 Novellenbänden ragen besonders hervor: »La Maison Tellier« (1881), »Miss Harriet« (1884), »Monsieur Parent« (1885), »Le Horla« (1887), »L'inutile Beauté« (1890). Die Novelle »Musotte« dramatisierte M. mit J. Normand 1891 mit großem Erfolg. Der direkt für die Bühne geschriebene Zweiakter »La Paix du Ménage« (1893) gelang weniger. M. verfiel, wie sein älterer Bruder und mehrere andre Verwandte, in Wahnsinn, machte in Cannes einen Selbstmordversuch und starb in der Privatanstalt Blanche zu Paris. Eine illustrierte Gesamtausgabe seiner Werke erschien in 27 Bänden 1900–04. Von den zahlreichen Übersetzungen nennen wir die von H. v. Ompteda (»Gesammelte Werke«, Berl. 1898–1903, 20 Bde.). Ein Denkmal wurde ihm 1897 im Parc Monceaux zu Paris gesetzt.Vgl. A. Lumbroso, Souvenirs sur M., sa dernière maladie, sa mort (Par. 1905).
Dickchen
Tagelang waren in Auflösung begriffene Truppenteile durch die Stadt geeilt. Das waren keine Soldaten mehr, sondern zuchtlose Horden: die Leute trugen wilde ungepflegte Bärte, zerfetzte Uniformen, und ohne Fahne, ohne Ordnung bummelten sie regellos hin. Alle machten einen schlappen, erschöpften Eindruck, schienen unfähig, auch nur einen Gedanken oder einen Entschluß zu fassen, liefen bloß aus Gewohnheit weiter und weiter und fielen vor Müdigkeit um, sobald sie einmal Halt machten. Meist waren es Landwehrmänner, friedliebende Leute, ruhige Rentner, die unter der Last des Gewehres fast zusammenbrachen, kleine Kerls, die ebenso leicht das Entsetzen packte, wie die Begeisterung, kurz die ebenso gut angriffen wie ausrissen; unter ihnen ein paar Rothosen, Überreste irgend einer Division, die in einer großen Schlacht zersprengt worden. Dunkel uniformierte Artilleristen sah man zwischen Infanteristen, und ab und zu tauchte auch der glänzende Helm eines Dragoners auf, der, schwer zu Fuß, Mühe hatte, den schnellen Schritten der Linientruppen zu folgen.
Dann kamen Francs-tireurs-Legionen mit heroischen Namen: »Rächer der Niederlage«, »Bürger des Grabes«, »Genossen des Todes«. Sie sahen aus wie Banditen.
Ihre Anführer waren ehemalige Tuch- oder Getreidehändler, Talg- oder Seifenfritzen, die ein Zufall zu Soldaten gemacht, die Offiziere geworden wegen ihres Geldes oder wegen der Länge ihrer Schnurrbärte. Sie waren mit Waffen gespickt, mit Tressen und Litzen behängen, führten laute Reden, sprachen über den Feldzugsplan und thaten, als ob sie ganz allein noch das sterbende Frankreich aufrecht erhielten. Aber manchmal fürchteten sie sich vor ihren eigenen Leuten, die zwar sehr tapfer waren, aber Plünderer und Räuber.
Es hieß, die Preußen würden in Rouen einmarschieren.
Die Nationalgarde, die seit zwei Monaten in den benachbarten Wäldern sehr ängstlich rekognoszierte, ab und zu ihre eigenen Posten anschoß und sich zum Kampfe rüstete, wenn im Dickicht sich nur ein Karnickel regte, war wieder eingerückt. Ihre Waffen, Uniformen, alle ihre Mordwerkzeuge, mit denen sie bisher die Heerstraßen drei Meilen in der Runde in Schrecken versetzt, waren plötzlich verschwunden.
Die letzten französischen Soldaten hatten eben die Seine überschritten, um über Saint-Sever und Bourg-Achard, Pont-Audemer zu erreichen. Hinter ihnen folgte zu Fuß zwischen zwei Ordonnanzoffizieren ihr verzweifelter General, der mit diesen Heerestrümmern nichts wagen durfte, und der niedergeschmettert war über den gewaltigen Zusammenbruch seines sieggewohnten Volkes, das überall geschlagen war, trotz seiner sprichwörtlichen Tapferkeit.
Dann hatte sich tiefe Stille, entsetzensvolle bange Erwartung über die Stadt gesenkt. Viele durch friedliches Gewerbe verweichlichte Bürger erwarteten ängstlich den Sieger, in steter Furcht, daß man etwa ihren Bratspieß und ihre großen Küchenmesser als Waffen ansehen könnte.
Alles Leben schien erstorben, die Läden waren geschlossen, stumm lag die Straße da. Ab und zu schlich ein Einwohner, verängstigt durch diese unheimliche Stille, eiligst längs der Mauern hin.
In der Qual der Erwartung erhoffte man beinahe die Ankunft des Feindes.
Am Nachmittag des Tages, nach dem Abmarsch der französischen Truppen, sprengten plötzlich ein paar Ulanen, die gekommen, man wußte nicht woher, durch die Stadt. Kurz darauf bewegte sich eine schwarze Masse den Abhang von Sainte-Catherine herab, während auf der Straße von Darnetal und Boisguillaume zwei weitere Abteilungen anrückten. Die Avantgarden der drei Heerkörper trafen genau zu gleicher Zeit auf dem Rathausplatz zusammen: durch alle Nachbarstraßen marschierten die deutschen Truppen ein, wälzten sich ihre Bataillone, unter deren scharfen Marschtritt das Pflaster erdröhnte.
Schnarrende Kommandos in unbekannter Sprache schallten an den Häusern hinauf, die tot und verlassen schienen, während man hinter den geschlossenen Läden die Sieger erspähte, »nach Kriegsrecht« nun Herren über Stadt, Besitz und Leben. Die Einwohner saßen verstört in ihren dunklen Zimmern, wie stets bei jenen großen Katastrophen und gewaltigen Umwälzungen dieser Erde, gegen die all unsere Weisheit, Schlauheit und Gewalt nichts auszurichten vermag. Denn dasselbe Gefühl bemächtigt sich immer der Menschen, sobald die bestehende Ordnung umgestürzt ist, sobald es keinen Halt mehr giebt, sobald alles, was unter dem Gesetz von Mensch oder Natur Schutz fand, einer brutalen, ungezügelten Gewalt überantwortet ist: beim Erdbeben, das unter einstürzenden Häusern eine ganze Bevölkerung begräbt; wenn ein Strom über die Ufer tritt, Leichen ertrunkener Bauern neben ersoffenem Vieh und Dächern zusammengebrochener Häuser mit sich reißt; beim Nahen einer siegreichen Armee, die niedermacht wer sich wehrt, alles andere gefangen fortführt, plündert mit dem Säbel in der Faust nnd beim Donner der Kanonen Gott preist! Das alles sind furchtbare Heimsuchungen, die den Glauben an die ewige Gerechtigkeit erschüttern und alles Vertrauen untergraben, das man uns gelehrt hat, in der himmlischen Gnade und in menschlicher Vernunft zu suchen.
Kleine Truppenabteilungen klopften an alle Thüren und verschwanden dann in den Häusern. So wurde Besitz ergriffen nach dem Einmarsch; jetzt mußten die Besiegten sich gegen die Sieger entgegenkommend zeigen.
Als nach einiger Zeit der erste Schrecken vorüber war, ward es wieber ruhig. In vielen Familien aß der deutsche Offizier mit am Tisch. Manchmal war er taktvoll und beklagte Frankreichs Schicksal aus Artigkeit, drückte sein Bedauern aus, am Kriege teilnehmen zu müssen. Dafür war man ihm dankbar, – und dann konnte man heute oder morgen vielleicht seines Schutzes bedürfen. Am Ende bekam man gar, wenn man zuvorkommend gegen ihn war, ein paar Leute weniger Einquartierung. Und warum sollte man einen Menschen verletzen, von dem man ganz und gar abhing. Eine solche Handlungsweise wäre weniger Mut als Verwegenheit gewesen. Tollkühnheit aber kann man den Bürgern von Rouen heute nicht mehr verworfen wie zur Zeit jener heldenmütigen Verteidigungen, die die Stadt berühmt machten. Schließlich sagte man sich, unter Berufung auf seine französische Wohlerzogenheit, daß es sehr wohl erlaubt sei, daheim höflich zu sein, wenn man sich nur nicht gerade öffentlich mit den fremden Soldaten intim zeigte. Außerhalb des Hauses kannte man sich nicht, aber innerhalb seiner vier Pfähle schwatzte man gern, und der Deutsche blieb mit jedem Abend länger am gemeinsamen Kamin sitzen.
Die Stadt nahm allmählich ihr gewohntes Aussehen wieder an. Die Franzosen gingen zwar kaum aus, aber von feindlichen Soldaten wimmelte es in den Straßen. Übrigens schienen die Offiziere der blauen Husaren, die anmaßend ihre großen Mordwaffen auf dem Pflaster schleppen ließen, auf den einfachen Bürger durchaus nicht etwa mit mehr Verachtung herabzublicken als die französischen Jägeroffiziere, die ein Jahr vorher im selben Café gesessen.
Und doch lag etwas in der Luft. Etwas Fremdes, Rätselhaftes, ein seltsam unerträglicher Druck lastete auf allen: die Anwesenheit des Feindes. Sie machte sich fühlbar in den Wohnungen, auf den öffentlichen Plätzen, schien das Essen zu verbittern, rief den Eindruck hervor, als befände man sich gar nicht zu Haus, sondern weit fort, unter barbarischen wilden Völkerschaften.
Die Sieger verlangten Geld, viel Geld; die Einwohner zahlten immerfort. Übrigens waren sie reich. Aber je wohlhabender ein normannischer Kaufmann ist, desto mehr leidet er unter jedem Geldopfer, thut ihm jedes Teilchen seines Vermögens weh, das er in fremde Hände übergehen sieht.
Zwei oder drei Meilen unterhalb der Stadt, den Fluß hinab, bei Croisset, Dieppedalle oder Biessart, zogen die Fischer und Seeleute oft irgendwo die Leiche eines Deutschen aus dem Wasser, aufgeschwemmt, noch mit der Uniform bekleidet, durch Messerstiche oder einen Schlag getötet, den Kopf mit einem Steine zertrümmert, oder von einer Brücke in das Wasser hinuntergestoßen. Der Schlamm des Flusses verbarg die Opfer dieser dunklen, wilden Rachethaten, dieses stillen Heldenmutes, dieser stummen Angriffe, die gefährlicher waren als die Schlachten am hellen Tage, nur nicht wie sie Anerkennung und Ruhm erwarben.
Denn der Haß gegen den Feind bewaffnet immer ein paar Verwegene, die bereit sind für eine Idee zu sterben.
Als nun aber endlich die Eindringlinge, obwohl sie die Stadt ihrer unbeugsamen Manneszucht unterworfen, keine jener Greuel-Thaten vollbrachten, die sie dem Gerücht nach auf ihrem bisherigen Siegeszug begangen hatten, faßte man Mut, und der Wunsch, Geschäfte zu machen, schlich sich wieder in das Herz der Kaufleute der Gegend. Mehrere von ihnen hatten in Havre, das von der französischen Armee besetzt war, notwendig zu thun und wollten versuchen den Hafen zu erreichen, indem sie über Land nach Dieppe fuhren, um dann von dort aus die Reise auf dem Seewege fortzusetzen.
Durch den Einfluß der deutschen Offiziere, deren Bekanntschaft man gemacht, verschaffte man sich vom kommandierenden General die Erlaubnis abzureisen.
Ein großer Postwagen mit vier Pferden bespannt wurde für diese Reise bereit gestellt, und beim Besitzer hatten sich zehn Personen dazu einschreiben lassen. Eines Dienstag morgens vor Tagesanbruch, um Aufsehen zu vermeiden, sollte abgefahren werden.
Seit einiger Zeit schon war der Boden durch die Kälte hart gefroren, und am Montag nachmittag gegen drei kamen schwere Wolken von Norden, brachten Schnee, der ununterbrochen den ganzen Abend, die ganze Nacht fiel. Um halb fünf Uhr morgens trafen die Reisenden im Hof des »Hôtel de Normandie« zusammen, um einzusteigen.
Sie waren noch ganz verschlafen und zitterten vor Kälte. In der Dunkelheit konnte man sich kaum erkennen, und in den schweren Winterkleidern sahen alle aus wie beleibte Pfaffen in langen Priesterröcken. Zwei von den Herren erkannten sich, und ein dritter mischte sich in ihr Gespräch. Sie begannen zu schwatzen.
– Ich fahre mit meiner Frau – sagte der eine.
– Ich gleichfalls!
– Und ich auch.
Der erste fügte hinzu:
– Wir kehren nicht nach Rouen zurück und wenn die Preußen nach Havre kommen, gehen wir nach England. –
Alle hatten die gleichen Pläne und Absichten.
Aber der Wagen wurde noch nicht angespannt. Eine kleine Laterne, die ein Stallknecht trug, huschte von Zeit zu Zeit aus einer dunklen Thür, um sofort wieder in einer anderen zu verschwinden. Aufstampfen von Hufen auf den Boden klang, durch Dünger gedämpft, und im Stall hörte man einen Mann mit ben Tieren sprechen und fluchen. Ein leises Klirren von Schellen zeigte, daß angeschirrt wurde. Das Klirren tönte bald lauter, bald schwieg es, je nach den Bewegungen des Pferdes, das ab und zu stillhielt, sich dann wieder schüttelte und unruhig mit den Hufen den Boden scharrte.
Plötzlich wurde die Thür geschlossen. Der Lärm hörte auf. Die frierenden Reisenden schwiegen gleichfalls und blieben erstarrt und unbeweglich.
Unausgesetzt fielen die weißen Flocken zur Erde nieder; sie verwischten die Formen, bestäubten alles mit eisigem Moos, und im großen Schweigen der stillen, winterbegrabenen Stadt hörte man nur noch das unbestimmte kaum zu unterscheidende Geräusch des niedersinkenden Schnees, mehr Einbildung als ein wirklicher Laut, – ein Durcheinanderschütteln von Atomen, die den ganzen Luftraum zu erfüllen schienen und die Welt bedeckten.
Nun erschien der Mann mit seiner Laterne und zog an einem Strick einen müden Gaul nach sich, der nicht recht vorwärts wollte. Er stellte ihn an die Deichsel, machte die Stränge an, hantierte lange um das Pferd herum, das Geschirr zu befestigen, denn er konnte nur mit einer Hand zugreifen, weil er in der anderen das Licht trug. Als er das zweite Tier holte, sah er die Reisenden unbeweglich stehen, schon ganz weiß vom niederstiebenden Schnee, und sagte:
– Warum steigen Sie denn nicht immer ein? Dann sind Sie doch wenigstens im Trockenen!
Sie waren wahrscheinlich noch garnicht auf die Idee gekommen und stürzten nun in den Wagen. Die drei Herren brachten zuerst ihre Frauen unter, und stiegen dann nach; darauf nahmen die übrigen vermummten Gestalten die letzten Plätze ein, ohne ein Wort zu wechseln.
Auf dem Boden des Wagens lag Stroh; sie steckten die Füße hinein. Die zuerst eingestiegenen Damen hatten kleine kupferne Wärmflaschen mitgebracht mit einer Heizmasse. Sie steckten ihre Apparate an, priesen einige Zeit leise die Vorteile dieser Dinger und wiederholten Sachen, die sie alle längst wußten.
Als endlich der Stellwagen mit sechs Pferden bespannt war, statt vieren, weil er wegen des Schnees schwerer laufen würde, fragte draußen eine Stimme:
– Sind alle eingestiegen?
Eine andere Stimme antwortete:
– Ja. – Es ging fort.
Der Wagen kam ganz langsam vorwärts, nur im Schritt. Die Räder wühlten sich in den Schnee ein, das ganze Gefährt stöhnte und ächzte dumpf. Die Pferde stampften dahin, keuchten, dampften und unausgesetzt klatschte die riesige Peitsche des Kutschers, schwuppte nach allen Seiten, krümmte sich zusammen und entrollte sich wieder wie eine dünne Schlange, um kurz irgend eine der gerundeten Pferdekruppen zu treffen, die sich dann in neuem Anzuge streckte.
Und es ward immer mehr Tag. Die leichten Flocken, die einer der Reisenden, als rechtes Kind von Rouen, einem Wollregen verglich, fielen nicht mehr. Ein fahler Schein durchdrang die dichten, dunklen, schweren Wolken, die das Weiß der Landschaft noch mehr hoben, in der hier und da die Umrisse eines großen, bereiften Baumes auftauchten, da und dort ein Gehöft mit einer Schneehaube auf dem Dach.
Die Insassen des Wagens betrachteten sich neugierig beim traurigen Schein dieser Morgendämmerung.
Auf den besten Plätzen ganz hinten im Wagen schlummerten, einander gegenüber sitzend, Herr und Frau Loiseau, Weingroßhändler aus der Rue Grand- Pont. Als ehemaliger Angestellter eines verkrachten Weinhändlers hatte Loiseau das Geschäft gekauft und sein Glück gemacht. Er verkaufte den kleinen Weinschänkern auf dem Lande zu sehr billigen Preisen sehr schlechten Wein; seine Bekannten hielten ihn für einen ganz gerissenen Kunden, einen richtigen Normannen, jovial, aber mit allen Hunden gehetzt. Er galt für einen so betrogenen Kerl, daß eines Abends auf der Präfektur Herr Tournel, eine Lokalgröße, Verfasser von beißend witzigen Geschichten und Couplets, den Damen, die ein wenig schläfrig geworden waren, vorgeschlagen hatte, sie wollten doch eine Partie »L'oiseau-vole« spielen. Das Wort machte die Runde durch die Salons des Präfekten, gelangte dann in die Stadt und belustigte vier Wochen lang die ganze Provinz.
Loiseau war selbst bekannt dafür, daß er Ulk allerlei Art liebte und schlechte und gute Witze riß. Niemand konnte von ihm reden ohne sofort hinzuzufügen:
– Der Loiseau ist doch unbezahlbar!
Er war klein, und über seinem ballonartig gewölbten Bauch, saß zwischen grauen Backenbärten ein gerötetes Antlitz.
Seine Frau war groß, stark, sehr entschieden, redete laut, war schnell von Entschluß und vertrat Ordnung und Pünktlichkeit in dem Handelshause, das des Mannes fröhliche Geschäftigkeit belebte.
Neben ihnen saß, etwas würdiger, der besseren Gesellschaft angehörend, Herr Carré-Lamadon, eine gewichtige Persönlichkeit, Wollhändler, Besitzer von drei Spinnereien, Offizier der Ehrenlegion, Mitglied des Generalrates. Er war während des ganzen Kaiserreiches Führer der wohlwollenden Opposition gewesen, nur um sich seine Annäherung an die Ideen, die er mit anständigen Mitteln bekämpfte, wie er selbst sagte, teurer zahlen zu lassen. Frau Carré-Lamadon, viel jünger als ihr Mann, war der Trost der Offiziere aus guter Familie, die nach Rouen in Garnison kamen.
Sie saß ihrem Mann gegenüber: klein, niedlich, reizend, tief in ihren Pelz vermummt und sah sich trostlos im traurigen Innern des Wagens um.
Ihre Nachbarn, Graf und Gräfin Hubert de Bréville trugen einen der ältesten, angesehensten Namen der Normandie. Der Graf, ein alter sehr vornehm aussehender Edelmann, suchte durch allerlei Toilettenkniffe seine natürliche Ähnlichkeit mit dem »Roy« Heinrich IV. noch besonders augenfällig zumachen; dem Roy, der nach glorreicher Überlieferung der Familie einst eine Bréville Mutter gemacht, wofür deren Gemahl Graf und Gouverneur einer Provinz geworden.
Graf Hubert, ein Kollege des Herrn Carré- Lamadon im Generalrat, vertrat im Departement die orleanistische Partei. Die Geschichte seiner Heirat mit der Tochter eines kleinen Rheders aus Nantes war immer etwas dunkel geblieben. Aber da die Gräfin sehr vornehm aussah, besser repräsentierte als irgend jemand anderes und sogar das Gerücht ging, einer der Söhne Louis Philipps habe eine Neigung zu ihr gehabt, ward sie gefeiert vom ganzen Adel und ihr Salon blieb der erste der Provinz, der einzige, in dem die alte Galanterie noch lebte, und in den es schwierig war eingeführt zu werden.
Das Vermögen der Bréville, lauter Liegenschaften, warf wie es hieß eine halbe Million Rente ab.
Diese sechs Personen im Hintergrund des Wagens waren die Vertreter der anständigen, begüterten Gesellschaft: ehrenwerte Leute von Würde und Stellung, religiös und von Grundsätzen.
Durch ein seltsames Spiel des Zufalls saßen alle Damen auf derselben Seite. Die Nachbarinnen der Gräfin waren zwei barmherzige Schwestern, die lange Rosenkränze abbeteten und unausgesetzt ihr Pater-noster und Ave-Maria murmelten. Die eine war alt, von Blatternarben entstellt, als ob sie eine Schrotladung gerade ins Gesicht bekommen hätte. Die andere sah etwas kümmerlich aus, hatte auf einer schwindsüchtigen Brust einen hübschen, kränklichen Kopf, mit dem Ausdruck jenes fanatischen Glaubens, der Märtyrer und Verzückte gebiert.
Den beiden Nonnen gegenüber zogen ein Mann und eine Frau die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich.
Der Mann, eine bekannte Persönlichkeit, war der Demokrat Cornudet, der Schrecken aller anständigen Menschen. Seit zwanzig Jahren tauchte er seinen großen, roten Bart in alle Bierseidel der demokratischen Cafés. Er hatte mit Freunden und Genossen ein ziemlich bedeutendes Vermögen, das er von seinem Vater, einem ehemaligen Konditor geerbt hatte, durchgebracht und wartete ungeduldig, von einer republikanischen Regierung endlich die Stellung, die er sich durch so viele Mahlzeiten in revolutionären Kneipen verdient zu haben meinte – zu erhalten. Am 4. September hatte er, wohl Opfer eines Ulks, sich eingebildet, er wäre zum Präfekten ernannt worden. Aber als er seine Thätigkeit antreten wollte, hatten die Bureaudiener, die allein auf dem Platz geblieben waren, sich geweigert, ihn anzuerkennen. Das bewog ihn zum Rückzüge. Sonst ein ungefährlicher, gefälliger, guter Kerl, hatte er jetzt unendlichen Eifer darauf verwendet, alles zur Verteidigung herzurichten. Er hatte in der ganzen Ebene um Rouen Löcher auswerfen lassen, alle jungen Bäume der nächsten Wälder niedergelegt, auf allen Straßen Verhaue fertiggestellt, um, beim Nahen des Feindes, sich wohlzufrieden mit allen seinen Vorbereitungen, eiligst in die Stadt zurückzuziehen. Er meinte sich jetzt in Havre, wo neue derartige Befestigungen notwendig erschienen, nützlicher machen zu können.
Das weibliche Wesen an seiner Seite gehörte der Halbwelt an. Es war bekannt durch seine frühreife Wohlbeleibtheit, die ihm den Beinamen »Dickchen« eingetragen. Das Mädchen war klein, rund überall, fett, wie gemästet, mit molligen Fingern, die Einschnitte an den Gelenken hatten, so daß sie aussahen wie ein Kranz von kleinen Würstchen. Ihre Haut war prall und glänzend. Sie besaß einen riesigen Busen, der sich unter dem Kleide blähte, hatte aber trotzdem etwas Appetitliches und war sehr beliebt wegen ihrer Frische. Ihr Gesicht glich einem rotbäckigen Apfel, einer aufbrechenden Päonien- Knospe, und daraus schauten zwei wundervolle, schwarze Augen, wie verschleiert durch die dichten Wimpern, die sie beschatteten. Ihr Mund war reizend, klein, ewig feucht, zum Kuß einladend, mit leuchtenden winzigen Zähnchen.
Außerdem hatte sie, wie es hieß, noch viele unschätzbare Eigenschaften.
Sobald man sie erkannt hatte, tuschelten die ehrbaren Damen miteinander und die Worte »Prostituierte« und »Schandfleck« fielen so laut, daß Dickchen den Kopf hob. Sie blickte ihre Nachbarn so herausfordernd und frech an, daß sofort allgemeine Stille eintrat und außer Loiseau, der sie lauernd betrachtete, alle die Augen niederschlugen.
Aber bald begannen die drei Damen, welche die Gegenwart des Mädchens schnell einander freundschaftlich verbunden, ja fast zu Vertrauten gemacht hatte, sich wieder zu unterhalten. Es war ihnen, als müßten sie dieser schamlosen Käuflichen gegenüber mit ihrer Frauenwürde ein Bündnis schließen, denn die gesetzlich gestattete Liebe rümpft immer die Nase über ihre freie Schwester.
Und auch die drei Männer, die beim Anblick Cornudets ein gemeinsamer konservativer Instinkt vereinigt, begannen über Geldsachen zu reden, in einem für Arme verletzenden Ton. Graf Hubert erzählte von der Verwüstung, die bei ihm die Preußen angerichtet, von den Verlusten, die ihm aus gestohlenem Vieh und verlorener Ernte erwuchsen, mit der Sicherheit eines großen Herrn und zehnfachen Millionärs, den so etwas, kaum weiter stört.
Herr Carrße-Lamadon, in der Wollindustrie wohl erprobt, war vorsichtig gewesen und hatte 600000 Franken nach England geschickt, ein Notpfennig, den er sich für alle Fälle aufhob. Loiseau aber hatte es fertig bekommen der französischen Militär-Intendanz alle gewöhnlichen Weine, die er noch im Keller hatte, aufzuhängen, so daß ihm der Staat eine bedeutende Summe schuldete, die er hoffte in Havre erheben zu können.
Alle drei warfen sich flüchtige Blicke des Einverständnisses zu. Obgleich aus verschiedenen Kreisen, fühlten sie sich doch durch das Geld eins, Mitglieder des Freimaurerordens der Besitzenden, derer, die da klimpern können, wenn sie die Hand in die Tasche stecken.
Der Wagen fuhr so langsam, daß man um zehn Uhr morgens noch nicht vier Meilen zurückgelegt hatte. Drei mal stiegen die Herren aus, um bei Steigungen des Weges, zu gehen. Man sing an sich zu beunruhigen, denn in TÔtes sollte gefrühstückt werden, und man mußte jetzt beinah daran verzweifeln es noch vor Anbruch der Nacht zu erreichen. Sie spähten alle nach einem Wirtshaus am Wege aus, da versank der Wagen in einer Schneewehe, und sie brauchten zwei Stunden um ihn wieber flott zu machen.
Der Appetit wuchs und beschäftigte aller Sinne und Gedanken. Aber kein Garkoch, kein Weinhändler zeigte sich. Die Nähe der Preußen und der Durchmarsch der verhungerten französischen Truppen hatten alle Wirte ins Bockshorn gejagt.
Die Herren liefen in die Bauernhöfe am Wege, um Lebensmittel aufzutreiben. Aber sie fanden nicht einmal Brot, denn die mißtrauischen Bauern hatten ihre Reservevorräte versteckt, in der Befürchtung, von den Soldaten, die nichts zu beißen hatten und gewaltsam nahmen was sie fanden, geplündert zu werden.
Gegen ein Uhr nachmittags erklärte Loiseau, daß er jetzt verfluchten Hunger habe. Alle empfanden längst dasselbe Gefühl und da der Heißhunger immer heftiger wurde, hörte allmählich jede Unterhaltung auf.
Ab und zu gähnte jemand: das steckte an. Und nun öffnete der Reihe nach, einer nach dem andem den Mund: je nach Charakter, Lebensart oder gesellschaftlicher Stellung riß er ihn weit auf, oder öffnete ihn bescheiden, um sofort den gähnenden Schlund, aus dem der Atem dampfte, mit der Hand zu verbergen.
Dickchen beugte sich mehrmals nieder, als ob sie unter ihren Kleidern etwas suchte. Sie zögerte eine Sekunde, blickte ihre Nachbarn an und richtete sich dann ruhig wieder auf. Aller Gesichter waren bleich und verzerrt. Loiseau schwor, er gäbe gleich tausend Franken für einen Schinken. Seine Frau wollte auffahren, beruhigte sich aber wieder. Es war ihr geradezu schrecklich von Geldverschwendung sprechen zu hören und sie verstand nicht einmal Spaß in diesem Punkt.
– Jedenfalls fühle ich mich nicht wohl, sagte der Graf; daß ich auch nicht daran gedacht habe, etwas zu essen mitzunehmen!
Jeder machte sich denselben Vorwurf.
Cornudet hatte eine Feldflasche voll Rum, die er anbot. Man lehnte kühl ab. Nur Loiseau nahm zwei Schluck an und als er die Flasche zurückreichte dankte er mit den Worten:
– Das hat wohlgethan! Das wärmt und man kommt über den Hunger weg.