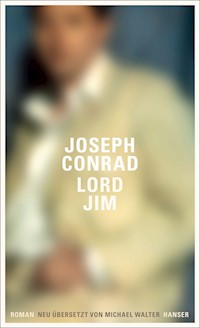9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Joseph Conrad, Gesammelte Werke in Einzelbänden
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
»Geschichten vom Hörensagen« vereint die wichtigsten Erzählungen Joseph Conrads. Selten erzählt Joseph Conrads direkt: Erzähltes wird weitererzählt, Perspektiven verschoben und vertieft. So entstehen die für Conrads Werk charakteristischen »Geschichten vom Hörensagen«, ein Titel, den er selbst für diese Sammlung vorgesehen hatte, deren Zusammenstellung aber erst nach seinem Tod erfolgte. Darin zeigt sich die ganze Bandbreite des großen Schriftstellers: Auf Geschichten tragischer Intensität folgen kuriose Anekdoten mit Happy End, auf Kindheitserinnerungen folgen nebelhafte Episoden aus dem damals noch andauernden Ersten Weltkrieg. Der Band enthält drei bedeutende Erzählungen, die bereits zu Lebzeiten publiziert wurden, und vier posthum veröffentlichte Geschichten, darunter die Neufassung der ersten Erzählung Conrads.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Ähnliche
Joseph Conrad
Geschichten vom Hörensagen
Aus dem Englischen von Fritz Lorch
FISCHER E-Books
Inhalt
Die englischen Originaltitel der sieben Erzählungen: ›Falk. A Reminiscence‹, ›Amy Foster‹, ›To-Morrow‹, ›The Black Mate‹, ›Prince Roman‹, ›The Warrior’s Soul‹, ›The Tale‹.
Die ersten drei Erzählungen erschienen 1903 in dem Band ›Typhoon and Other Stories‹. 1925, posthum, erschienen ›Tales of Hearsay‹, enthaltend ›The Warrior’s Soul‹, ›Prince Roman‹, ›The Tale‹, ›The Black Mate‹.
Der Autor zu ›Falk‹, ›Amy Foster‹, ›Morgen‹
Dies sind keine Erlebnisgeschichten im genauen Sinn des Wortes. Erlebnis ist bei ihnen bloß die Leinwand für das vorschwebende Bild. Jede Geschichte enthält mehr als eine Absicht. Bei einer jeden stellt sich die Frage, was der Schriftsteller aus der sich ihm bietenden Gelegenheit gemacht hat; und jede beantwortet die Frage für sich selbst – mit Worten, die, wenn ich es, ohne ungebührlich feierlich zu werden, so sagen darf, unter gewissenhaftester Beachtung der Wahrheit meiner eigenen Empfindungen niedergeschrieben wurden. Und jede dieser Geschichten muß sich, wenn sie überhaupt etwas bedeuten will, auf ihre eigene Weise rechtfertigen vor dem Gewissen eines jeden ihrer Leser.
›Falk‹ beleidigte durch einige Absonderlichkeiten des Themas das Zartgefühl mindestens eines meiner Kritiker. Aber welches ist eigentlich das Thema von ›Falk‹? Ich persönlich bin mir darüber nie klar geworden. Der Leser möge es selbst herausfinden. Meine Absicht bei der Niederschrift von ›Falk‹ war nicht, zu schockieren. Wie in den meisten meiner Schriften geht es mir nicht um die Ereignisse selbst, sondern um deren Wirkung auf die Personen in der Erzählung. Aber mit allem, das ich geschrieben habe, war immer die eine unabänderliche Absicht verknüpft, des Lesers Aufmerksamkeit dadurch zu wecken, daß ich sein Interesse fesselte und sein Mitgefühl aufrief für den behandelten Gegenstand, welcher Art er auch sein mochte, innerhalb der Grenzen der sichtbaren Welt und im Bereich menschlichen Fühlens.
Ich darf wohl sagen, daß Falk genau meiner Erfahrung mit gewissen freimütigen Menschen entspricht, die eine vollkommen natürliche Rücksichtslosigkeit mit einem bestimmten Maß an moralischem Zartgefühl verbinden. Falk gehorcht dem Gesetz der Selbsterhaltung ohne den geringsten Zweifel an seinem Recht; doch an einem kritischen Punkt dieses so rücksichtslos sich erhaltenden Lebens lehnt er es ab, der Wahrheit auszuweichen. Da er als feinfühlig genug hingestellt wird, um für alle Zeiten durch ein bestimmtes ungewöhnliches Erlebnis gezeichnet zu sein, mußte ich dieses Erlebnis dem Leser möglichst lebhaft vor Augen führen, aber es ist nicht das Thema der Geschichte. Kümmerten wir uns bloß um Fakten, dann ginge es in der Geschichte vor allem um Falks Bestreben, zu heiraten, in welches Bestreben mit seiner Rücksichtslosigkeit und seinem Zartgefühl gleichermaßen der Erzähler der Geschichte sich unerwartet einbezogen sieht.
Falk genießt zusammen mit einer anderen Geschichte von mir (›Die Rückkehr‹ in ›Geschichten der Unrast‹) die Auszeichnung, nie in Fortsetzungen veröffentlicht worden zu sein. Das Manuskript wurde zwar dem Redakteur irgendeiner Zeitschrift vorgelegt, doch wies dieser es empört zurück mit der einzigen Begründung, »das Mädchen sage nie etwas«. Das stimmt. Von Anfang bis Ende der Geschichte äußert Hermanns Nichte kein Wort – und zwar nicht, weil sie stumm wäre, sondern aus dem einfachen Grund, weil sie immer, wenn sie ins Blickfeld des Erzählers tritt, entweder nichts zu sagen hat oder zu tief bewegt ist, um etwas sagen zu können. Der Redakteur, der die Geschichte offensichtlich gelesen hatte, hätte das erkennen müssen. Anscheinend tat er es nicht, und ich nahm davon Abstand, ihn auf die Unmöglichkeit solchen Sprechens hinzuweisen, denn da er immerhin nicht zu behaupten wagte, »das Mädchen« sei nicht lebendig, scherte mich seine Entrüstung weiter nicht.
Alle anderen Geschichten wurden in Fortsetzungen veröffentlicht. ›Amy Foster‹ erschien in The Illustrated London News mit einer schönen Zeichnung von Amy an ihrem freien Tag, wie sie zu Hause, einen Hut mit großer Feder auf dem Kopf, den Kindern den Tee reicht. ›Morgen‹ erschien erstmals im Pall Mall Magazine. Von dieser Geschichte möchte ich nur soviel sagen, daß vielen Leuten ihre Übertragbarkeit auf die Bühne auffiel, was mich darauf brachte, sie zu dramatisieren – bis zum heutigen Tag mein einziger Versuch in dieser Richtung. Ich möchte noch erwähnen, daß verschiedene Kritiker eine jede Geschichte bei Erscheinen des Bandes als die »beste der Reihe« herausgestellt und das Buch mit einer Wärme der Wertschätzung und des Verständnisses, einer sympathievollen Einsicht und einer Freundlichkeit der Ausdrucksweise besprochen haben, für die ich nicht dankbar genug sein kann.
1919
J. C.
Falk
Eine Erinnerung
Einige von uns, sämtlich mehr oder weniger der See verbunden, speisten in einem kleinen Gasthaus am Flußufer, nicht weiter als dreißig Meilen von London entfernt und keine zwanzig von jenem seichten und gefährlichen Tümpel, dem die Küstenfahrer den hochtrabenden Namen »Deutscher Ozean« geben. Und durch die großen Fenster bot sich uns ein Blick auf die Themse; ein Blick, der die ganze Länge der Lower Hope Reach beherrschte. Aber das Essen war miserabel – einen Festschmaus hatten nur die Augen.
Der Duft des Salzwassers, des Lebenswassers für so viele von uns, durchströmte unser Gespräch. Wer einmal die Bitternis des Ozeans gekostet hat, der wird den Geschmack für alle Zeiten auf der Zunge behalten. Aber einer oder zwei unter uns, vom Leben an Land Verwöhnte, klagten über Hunger. Es war unmöglich, das Zeug zu essen. Und tatsächlich haftete allem eine sonderbare Muffigkeit an. Der hölzerne Speiseraum stak wie ein Pfahlbau im schlammigen Flußufer; die Bodendielen wirkten morsch; ein klappriger alter Kellner wankte trübselig vor einem vorsintflutlichen, wurmstichigen Buffet auf und ab; die angestoßenen Teller hätten sehr wohl aus der Müllgrube in der Nähe einer Pfahlbausiedlung stammen können; und das Fleisch darauf gemahnte an noch ältere Zeiten. Der Gedanke an die Nacht der Vorzeit drängte sich auf, als der Urmensch aus seinem trüben Bewußtsein die ersten Ansätze zu einer Kochkunst entwickelte und daranging, über brennenden Holzscheiten Stücke Fleisches zu schmoren, in Gesellschaft anderer guter Kerle; hernach, gesättigt und glücklich, lehnte er sich zurück zwischen den abgenagten Knochen, um seine Erlebnisse zu erzählen – simple Geschichten von Hunger und Jagd – oder auch von Frauen, wer weiß!
Aber glücklicherweise war der Wein so alt wie der Kellner. Und darum geschah es, daß wir uns, vergleichsweise leeren Magens, aber im Ganzen doch einigermaßen glücklich, zurücklehnten und uns unsere simplen Geschichten erzählten. Wir redeten von der See und allen ihren Werken. Die See ändert sich nie, und ihre Werke, ungeachtet des Geredes der Menschen, sind von Geheimnis umhüllt. Aber wir waren einer Meinung darüber, daß sich die Zeiten geändert hatten. Und wir redeten von alten Schiffen, von Unfällen auf See, von Schiffbruch, Entmastung; und von einem, der mittels eines Notruders sein Schiff sicher den ganzen Weg vom Río de la Plata nach Liverpool brachte. Wir redeten von Wracks, von knappen Rationen und von Heldenmut – oder doch von dem, was die Zeitungen Heldentum auf See nennen – eine Bekundung von Tugenden durchaus anderer Art als die des Heldentums primitiver Zeiten. Und dann und wann verstummten wir alle und schauten hinaus auf das, was der Fluß unseren Blicken bot.
Ein P. & O.-Schiff fuhr stromabwärts vorüber. »Hübsche Menus gibt es auf diesen Schiffen«, bemerkte einer aus unserer Schar. Ein Mann mit scharfen Augen las den Namen des Schiffes am Bug: Arcadia. »Ein Bild von einem Schiff!« murmelten einige. Ihm folgte ein kleiner Frachtdampfer, und die Flagge, die man gerade einholte, während wir zuschauten, wies das Schiff als einen Norweger aus. Es entwickelte einen fürchterlichen Qualm, und ehe der sich verzogen hatte, erschien vor den Fenstern eine kurze hölzerne Bark mit viel Freibord, in Ballast und im Tau eines Schaufelrad-Schleppers. Die ganze Mannschaft war auf dem Vorschiff mit dem Klarmachen des laufenden Gutes für das Segelsetzen beschäftigt; und achtern, ganz allein dort mit dem Mann am Steuer, schritt eine Frau in roter Kappe die Länge der Poop auf und ab, ihr graues Strickzeug in den Händen.
»Vermutlich deutsch«, murmelte einer. »Der Kapitän hat seine Frau an Bord«, bemerkte ein anderer, und der Glanz des purpurnen Sonnenuntergangs, flammend hinter dem Londoner Dunst, warf ein bengalisches Licht auf die Masten der Bark und verdämmerte über der Lower Hope Reach.
Dann sagte einer von uns – er hatte bisher geschwiegen, ein Mann von gut fünfzig Jahren, der ein Vierteljahrhundert lang Schiffe befehligt hatte –, während er der Bark nachblickte, die nun schon in weiter Ferne dahinglitt, schwarz auf dem schimmernden Fluß:
Das erinnert mich an eine groteske Episode in meinem Leben vor vielen Jahren, als ich erstmals das Kommando einer Eisenbark erhalten hatte, die in einem bestimmten östlichen Hafen Fracht nahm. Der Hafen war zugleich Hauptstadt eines orientalischen Königreiches und lag an einem Fluß, so wie London an unserer alten Themse liegt. Mehr braucht über die Lokalität nicht gesagt zu werden; denn derlei hätte sich zutragen können, wo immer es Schiffe, Kapitäne, Schlepper und verwaiste Nichten von unbeschreiblicher Schönheit gibt. Und das Groteske an der Episode betrifft nur mich, meinen Feind Falk und meinen Freund Hermann.
Eine besondere Betonung schien auf den Worten ›Mein Freund Hermann‹ zu liegen, was einen von uns bewog (denn wir hatten soeben über Heldentum auf See gesprochen), nachlässig und beiläufig zu fragen:
»Und dieser Hermann war ein Held?«
Keineswegs, sagte unser angegrauter Freund. Ganz und gar kein Held. Er war ein Schiffsführer. So nennen sie in Deutschland, was bei uns der Master Mariner ist. Ich ziehe unsere Bezeichnung vor. Die Alliteration ist gut, und diese Nomenklatur enthält das, was uns, als einer Gemeinschaft, den Sinn eines korporativen Daseins vermittelt: Matrose, Maat, Meister, in dem alten, ehrwürdigen Handwerk der See. Was meinen Freund Hermann anlangt, hätte er sehr gut als ein vollkommener Meister des ehrwürdigen Handwerks gelten können, aber er wurde offiziell Schiffsführer genannt und hatte die schlichte, schwerfällige Erscheinung eines wohlhabenden Bauern in Verbindung mit der gutmütigen Schlauheit eines Kleinkrämers. Mit seinem glattrasierten Kinn, seinen plumpen Gliedmaßen und den schweren Augenlidern wirkte er nicht eben wie ein Schwerarbeiter und noch weniger wie ein Abenteurer der See. Indessen arbeitete er schwer auf den Meeren, in seiner Weise, ungefähr so, wie sich ein Krämer abarbeitet hinter seinem Ladentisch. Und sein Schiff war das Mittel, mit dem er seine wachsende Familie ernährte.
Es war ein schweres, starkes Ding mit stumpfem Bug, das Gedanken an urtümliche Festigkeit weckte, gleich dem hölzernen Pflug unserer Vorväter. Und es wies auch noch andere Züge rustikal heimeliger Natur auf. Die enorme hölzerne Heckgalerie, wie sie mir bei keinem Schiff sonst begegnet ist, ließ mir sein wuchtiges viereckiges Heck wie die Hinterseite eines Müllereifuhrwerkes erscheinen. Aber die vier Heckfenster der Kajüte, von denen ein jedes mit sechs kleinen grünlichen Scheiben verglast und deren hölzernes Rahmenwerk braun gestrichen war, hätten sehr wohl die Fenster eines kleinen Landhauses sein können. Die weißen Vorhängchen und das Grün der Blumentöpfe hinter den Scheiben machten die Ähnlichkeit vollkommen. Bei ein, zwei Gelegenheiten, als ich unter dem Heck des Schiffes vorüberfuhr, entdeckte ich von meinem Boot aus einen runden Arm, der gerade mit einer Kanne die Blumen goß, und den geneigten, glattgekämmten Kopf eines Mädchens, das ich stets Hermanns Nichte nennen werde, weil ich tatsächlich nie seinen Namen erfahren habe, ungeachtet meines höchst vertraulichen Verkehrs mit der Familie.
Dieser Verkehr ergab sich jedoch erst später. Einstweilen wurde ich – wie der Rest der Schiffahrt in jenem östlichen Hafen – nicht im Zweifel gelassen über Hermanns Begriff von hygienischer Bekleidung. Offensichtlich glaubte er an guten, festen Flanell unmittelbar auf der Haut. Meistens waren auf seinem Schiff kleine Röcke und Schürzen zu sehen, die in der Besan-Takelage trockneten, oder eine Reihe winziger Socken, die am Flaggenfall flatterten; aber einmal alle vierzehn Tage wurde die Familienwäsche in voller Stärke vorgeführt. Sie bedeckte die Poop ganz und gar. Die Nachmittagsbrise brachte dann eine unheimliche, schlacksige Bewegung in diese Bekleidungsformationen, die entfernt an eine ertrunkene, verstümmelte, plattgewalzte Menschheit erinnerten. Rümpfe ohne Köpfe winkten mit Armen ohne Hände; Beine ohne Füße schlugen in phantastischen, in sich zusammenfallenden Schlenkern aus; und da gab es lange weiße Gewänder, die, wenn sie den Wind richtig durch ihre spitzenbesetzten Halsöffnungen einließen, sich für einen Moment gewaltig aufblähten, wie wenn ein dickwanstiger, aber unsichtbarer Körper hindurchgeschlüpft wäre. An solchen Tagen konnte man das Schiff schon von weitem an dem bunten grotesken Aufruhr erkennen, der achtern des Besanmastes im Gange war.
Das Schiff hatte gerade vor mir seinen Liegeplatz, und es hieß Diana – Diana nicht von Ephesus, sondern von Bremen. Das wurde in weißen, fußhohen Lettern kundgetan, die mit weiten Abständen (nicht unähnlich der Schrift auf einem Ladenschild) unter den Landhausfenstern über das Heck liefen. Dieser lächerlich unpassende Name wirkte wie eine Beleidigung jener bezauberndsten unter den Göttinnen; denn abgesehen von dem Umstand, daß das alte Schiff physisch zu einer Jagd, in welcher Form immer, unfähig war, gehörte auch noch eine Schar von vier Kindern zu ihm. Sie spähten über die Reling nach den vorüberfahrenden Booten und ließen bisweilen die sonderbarsten Gegenstände in diese hineinfallen. So erhielt ich, einige Zeit bevor ich mit Hermann in Verbindung trat, eine gräßliche Lumpenpuppe auf den Hut, die Hermanns ältester Tochter gehörte. Indessen, diese Kinder waren im Ganzen recht wohl geraten. Sie hatten blonde Haare, runde Augen, runde kleine Knollennasen, und sie ähnelten sehr ihrem Vater.
Die Diana von Bremen war ein höchst unschuldiges altes Schiff und schien nichts zu wissen von den Tücken der See, wie es an Land Haushalte gibt, die nichts wissen von der verderbten Welt. Und die Empfindungen, die das Schiff weckte, waren alles andere als ungewöhnlich, vielmehr vor allem häuslichen Charakters. Sie war ein Heim. Alle diese lieben Kinder hatten auf dem Achterdeck gehen gelernt. Solchen Vorstellungen haftet etwas Hübsches, sogar Rührendes an. Ihre Zähne, denke ich, bissen sie an den ausgefransten Enden des laufenden Gutes durch. Ich habe oftmals das Baby (Nikolaus mit Namen) beobachtet, wie es damit beschäftigt war, an dem hanfenen Fall der Fore-Royal zu knabbern. Nikolaus’ Lieblingsplatz war unter der Nagelbank des Großmastes. Sobald er losgelassen wurde, krabbelte er dorthin, und der erste Matrose, der ihm in die Quere kam, brachte ihn, mit teerigen Händen sorgsam das Kind in die Höhe haltend, zur Kabinentür zurück. Ich vermute, daß es da eine stehende Dienstanweisung dieses Inhalts gab. Im Verlauf solcher Überführungen versuchte das Baby, das die einzige hitzige Person an Bord war, den standhaften jungen deutschen Matrosen kräftig ins Gesicht zu schlagen.
Frau Hermann, eine einnehmende, behäbige Hausfrau, trug an Bord stets weite, blaue Kleider mit weißen Punkten. Wenn ich sie, was ein-, zweimal geschah, an einem eleganten kleinen Waschzuber dabei betraf, wie sie energisch weiße Kragen, Babystrümpfe und Hermanns Sommerkrawatten schrubbte, errötete sie in mädchenhafter Verwirrtheit, hob die nassen Hände und grüßte mich von Weitem mit freundlichem Kopfnicken. Ihre Ärmel waren über die Ellbogen hochgerollt, und ihr goldener Ehering blitzte durch den Seifenschaum. Ihre Stimme war angenehm, sie hatte eine heitere freie Stirn, weiches, sehr blondes Haar und gutmütig dreinblickende Augen. Sie war mütterlich und maßvoll gesprächig. Wenn diese schlichte Matrone lächelte, bildeten sich jugendliche Grübchen auf ihren breiten, frischen Wangen. Hermanns Nichte hingegen, eine Waise und sehr schweigsam, sah ich nie lächeln, auch nicht andeutungsweise. Dies war aber nicht einer Düsternis ihres Gemütes zuzuschreiben, sondern der Zurückhaltung jugendlichen Ernstes.
Sie hatten die Waise während der letzten drei Jahre bei sich gehabt, damit sie bei den Kindern helfe und Frau Hermann Gesellschaft leiste, wie Hermann mir gegenüber einmal bemerkte. Das sei auch dringend nötig gewesen, solange die Kinder klein waren, fügte er mit verdrossener Miene hinzu. Es war ihr Arm, ihr Kopf mit dem glatt gescheitelten Haar gewesen, den ich eines Morgens durch die Heckfenster erspäht hatte, als sie sich über die Fuchsien und Reseden beugte; doch als ich sie zum ersten Mal in voller Größe erblickte, kapitulierte ich vor ihren Körperproportionen. Mit diesen prägte sie sich meinem Gedächtnis ein, so wie sonst große Schönheit, große Klugheit, Schlagfertigkeit oder Herzensgüte eine Frau erinnernswert machen können.
Bei ihr waren es Form und Größe. Es war ihre physische Person, die diesen eindrucksvollen Zauber ausübte. Vielleicht war sie überdies in außerordentlichem Maß witzig, klug und gütig. Ich weiß es nicht, und es kommt nicht darauf an. Ich weiß nur, daß sie großartig gebaut war. Gebaut ist das einzig passende Wort hier. Sie war gleichsam mit königlicher Großzügigkeit angelegt und ausgeführt. Es verschlug einem den Atem, wenn man diese unbekümmerte Verschwendung kostbarer Materialien auf so ein junges Ding sah. Sie war jugendlich und doch vollkommen reif, als sei sie eine glückhaft Unsterbliche gewesen. Vielleicht war sie dabei auch wuchtig von Gestalt, aber das hatte nichts zu besagen. Es erhöhte nur den Eindruck des Dauerhaften. Sie war kaum neunzehn. Aber was für Schultern! Was für runde Arme! Welch geheimnisvolle Andeutung mächtiger Gliedmaßen, wenn sie mit drei langen Schritten das Deck überquerte, um den umgepurzelten Nikolaus aufzuheben – schier unbeschreiblich! Sie schien ein gutes, stilles Kind zu sein, sorgsam zu wachen über Lenas Bedürfnisse, Gustavs Purzelbäume, Karls aufgeschlagene liebe kleine Nase – war gewissenhaft, fleißig und all das. Aber was für prachtvolles Haar sie hatte! Üppig, lang, dicht, von goldbrauner Farbe. Es hatte den Schimmer kostbaren Metalls. Sie trug es fest zu einem einzigen Zopf geflochten, der ihr mädchenhaft den Rücken hinabhing und bis zum Gürtel reichte. Die Festigkeit des Zopfes war überraschend. Wahrhaftig, er gemahnte an einen Knüppel. Ihr Gesicht war groß, lieblich, von gelassenem Ausdruck. Sie hatte eine glatte Haut, und ihre blauen Augen waren so fahl, daß es schien, als blicke sie mit der leeren, weißen Aufrichtigkeit einer Statue in die Welt. Hübsch konnte man sie nicht nennen. Es war etwas viel Eindrucksvolleres. Die Schlichtheit ihrer Gewandung, die Fülle ihrer Formen, ihre erstaunliche Figur und die Ahnung unerhörter Lebenksraft, die von ihr ausging wie der einer Blume entströmende Duft, verliehen ihr eine Schönheit von erdhafter und olympischer Art. Ihr zuzusehen, wenn sie zur Wäscheleine emporlangte, die Arme hoch über den Kopf erhoben, ließ einen in heidnisch frommer Andacht vergehen. Die sackartigen Baumwollgewänder der ausgezeichneten Frau Hermann hatten noch einige andeutungsweise Rüschen an Kragen und Saum; die Kattunkleider der Nichte aber wiesen nicht das mindeste Gekräusel auf; nichts als ein paar gerade Falten in ihrem bis zu den Füßen reichenden Rock; und diese hatten, wenn sie still stand, ein strenges, statuenhaftes Aussehen. Von Natur aus neigte sie zur Stille, ob sie nun saß oder stand. Ich möchte jedoch damit nicht sagen, daß sie statuenhaft war. Dafür war sie von zu strotzender Lebendigkeit; aber sie hätte für eine allegorische Statue der Erde Modell stehen können. Ich meine nicht die ausgelaugte Erde, die wir besitzen, sondern eine junge Erde, einen jungfräulichen Planeten, ohne Ahnung von einer Zukunft, die von monströsen Ausgeburten des Lebens wimmelt und erfüllt ist vom Lärm der grausamen Schlachten des Hungers und des Denkens.
Der wackere Hermann selbst war nicht sehr unterhaltend, wiewohl sein Englisch einigermaßen verständlich war. Frau Hermann, die jedesmal, wenn ich kam, mindestens eine Rede in einladend herzlichem Ton (auf Plattdeutsch, nehme ich an) über mich ausschüttete, konnte ich nicht verstehen. Ihre Nichte, wie wohltuend ihr Anblick auch wirkte (und sie gab einem irgendwie eine hoffnungsvolle Vorstellung von dem Schicksal der Menschheit ein), leistete uns bescheiden und schweigsam Gesellschaft. Meistens war sie mit Nähen beschäftigt; nur dann und wann verfiel sie, wie ich bemerkte, über dieser Arbeit in einen Zustand mädchenhaften Sinnens. Die Tante saß ihr gegenüber, gleichfalls mit Nähen beschäftigt, die Füße auf einem kleinen Schemel. Auf der anderen Seite des Decks hatten Hermann und ich uns auf zwei aus der Kabine geholten Stühlen zu einer Raucher-Partie niedergelassen, während derer wir dann und wann friedlich ein paar Worte wechselten. Ich kam beinahe jeden Abend hin. Hermann traf ich dann in Hemdsärmeln. Sobald er von Land auf sein Schiff zurückkehrte, war sein Erstes, daß er den Rock auszog; dann setzte er eine gestickte, runde Mütze mit Quaste auf und tauschte seine Stiefel mit einem Paar Stoffpantoffeln. Hernach rauchte er seine Pfeife an der Kabinentür und schaute den Kindern zu – ein Bild bürgerlicher Tugendhaftigkeit –, bis eines nach dem anderen eingefangen und in den verschiedenen Wohnräumen zu Bett gebracht wurde. Zuletzt trank er sein Glas Bier in der Kabine, die mit einem hölzernen Tisch auf gekreuzten Beinen und mit schwarzen geradlehnigen Stühlen eingerichtet war – mehr wie eine Bauernküche als ein Schiffssalon. Die See und alle nautischen Belange schienen sehr weit fortgerückt von der Gastlichkeit dieser vorbildlichen Familie.
Und mir behagte das, weil ich damals eine recht aufreibende Zeit auf meinem eigenen Schiff durchlebte. Ich war ex officio durch den britischen Konsul als Kapitän dieses Schiffes eingesetzt worden, nachdem dort plötzlich ein Mann gestorben war und seinem Nachfolger zu dessen Orientierung nur einige verdächtig unquittierte Rechnungen zurückgelassen hatte, ein paar Aufstellungen über Dockungen im Trockendock, die Bestechung argwöhnen ließen, und eine stattliche Anzahl von Belegen für übertrieben hohe Ausgaben während dreier Jahre; all das hatte durcheinandergeworfen in einem staubigen alten Geigenkasten mit rotem Samtfutter gelegen. Ich stieß außerdem auf ein großes Kontobuch, das ich aber, als ich es hoffnungsvoll öffnete, zu meiner unendlichen Verblüffung angefüllt mit Versen fand – Seite um Seite mit gereimten Knittelversen von heiter unpassender Art, aufgezeichnet in der zierlichsten Handschrift, die sich denken läßt. In jenem Fiedelkasten fand sich auch noch eine Photographie meines Vorgängers, unlängst aufgenommen in Saigon, vor einem Gartenprospekt, in Begleitung eines sonderbar gewandeten weiblichen Wesens – ein ältlicher, untersetzter vierschrötiger Mann, mit strengem Blick in schlecht sitzendem Anzug aus feinem schwarzen Wollstoff, und das Schläfenhaar derart nach vorn gebürstet, daß es an die Hauer eines Ebers erinnerte. Von der Fiedel fehlte an Bord, außer ihrer leeren Hülse, jede Spur; von den Frachtgeldern, die das Schiff in letzter Zeit zweifellos verdient hatte, waren jedoch nicht einmal die Hülsen übrig. Es war unmöglich festzustellen, wo all das Geld hingewandert war. Es war nicht an Bord, es war nicht nach Hause überwiesen worden; denn in einem Brief des Eigentümers, der durch reinen Zufall in einer Tischschublade erhalten geblieben war, wurde milde genug beklagt, daß man während der letzten achtzehn Monate keines Schriftzuges von der Hand des Kapitäns gewürdigt worden sei. Es gab nahezu keine Vorräte an Bord, keinen Zoll Reservetauwerk oder Segeltuch. Das Schiff hatte nie den Verbrauch ergänzt, war aller Vorräte bar, und ich sah Schwierigkeiten ohne Ende voraus, ehe ich es wieder seeklar haben würde.
Da ich damals jung war – keine dreißig Jahre alt –, nahm ich mich und meine Probleme sehr wichtig. Der alte Steuermann, der bei der Beerdigung des Kapitäns als Hauptleidtragender aufgetreten war, zeigte sich nicht sehr erbaut über mein Erscheinen. Aber der Bursche war nun einmal für eine Kapitänsstelle nicht gesetzlich qualifiziert, und der Konsul war verpflichtet, wenn möglich einen ordentlich ausgewiesenen Mann einzusetzen. Was den Zweiten anlangte, so kann ich von ihm nur sagen, daß er Tottersen oder ähnlich hieß. Er hatte die Angewohnheit, in diesem tropischen Klima eine räudige Pelzmütze auf dem Kopf zu tragen. Ohne Zweifel war er der törichtste Mensch, der mir je an Bord eines Schiffes begegnet ist. Und so sah er auch aus. Er sah so unbeschreiblich töricht aus, daß ich schon überrascht war, wenn er, beim Namen gerufen, antwortete.
Ich zog, gelinde gesagt, keinen großen Trost aus solcher Gesellschaft; und die Aussicht auf eine Seereise mit diesen beiden Burschen war einigermaßen bedrückend. Die anderen Gedanken, denen ich in meiner Einsamkeit nachhing, waren auch nicht gerade heiter. Die Mannschaft kränkelte. Die Ladung kam nur sehr langsam herein. Ich sah großen Verdruß mit den Charterern voraus und bezweifelte, daß sie mir genügend Geld vorschießen würden, um die Ausgaben für das Schiff zu decken. Ihr Verhalten mir gegenüber war nicht wohlwollend. Kurz gesagt, ich kam nicht voran. Immer wieder beschlich mich die Erkenntnis (gewöhnlich gegen Mitternacht), daß ich völlig unerfahren sei, in Geschäftsdingen höchst unwissend, hoffnungslos ungeeignet für eine Kapitänsstelle; und als auch noch der Steward ins Krankenhaus mußte, wegen choleraähnlicher Symptome, fühlte ich mich des einzigen anständigen Menschens auf dem Achterdeck beraubt. Zwar wurde fest damit gerechnet, daß er sich erhole, er mußte aber in der Zwischenzeit durch irgendeinen Diener ersetzt werden. Und auf Empfehlung eines gewissen Schomberg, Besitzers des kleineren der beiden Hotels am Platze, stellte ich einen Chinesen ein. Schomberg, ein stämmiger, haariger Elsässer und ein schreckliches Klatschmaul, versicherte mir, daß ich eine gute Wahl getroffen hätte. »Ausgezeichneter Boy. Kam in der suite Seiner Exzellenz, des Regierungskommissars Tseng hierher – Sie wissen doch. Seine Exzellenz logierten drei Wochen bei mir.«
Er sprach sehr salbungsvoll von der chinesischen Exzellenz, aber das Exemplar aus seiner suite machte keinen vielversprechenden Eindruck. Damals wußte ich freilich noch nicht, welch ein unzuverlässiger Aufschneider Schomberg war. Der »Boy« hätte vierzig aber auch hundertundvierzig Jahre alt sein können, wer mochte das sagen – einer jener Chinesen mit totenkopfähnlichem Gesicht und absolut undurchschaubar. Ehe drei Tage verstrichen waren, stellte sich heraus, daß er ein notorischer Opiumraucher, ein Spieler, ein verwegener Dieb und ein erstklassiger Schnelläufer war. Als er in höchster Geschwindigkeit und mit zweiunddreißig Gold-Sovereigns meiner sauer verdienten Ersparnisse abzog, gab mir das den Rest. Ich hatte mir das Geld für den Fall beiseitegelegt, daß meine Schwierigkeiten unüberwindlich würden. Nun war es fort, und ich kam mir so arm und nackt vor wie ein Fakir. Ich hing an meinem Schiff, ungeachtet all des Verdrusses, den es mir bereitete. Was ich aber nicht ertragen konnte, das waren die langen einsamen Abende in der Kajüte, wo die Atmosphäre, verstänkert durch eine leckende Lampe, auch noch von dem Schnarchen des Steuermanns aufgerührt wurde. Dieser Bursche schloß sich Punkt acht in seine stickige Kammer und hub an, widerliche, unflätige Geräusche von sich zu geben, ähnlich denen aus einer vollgelaufenen Posaune. Es war abscheulich, sich nicht einmal in Ruhe Sorgen machen zu können auf seinem eigenen Schiff. Alles auf dieser Welt, dachte ich, sogar die Kapitänsstelle auf einer netten kleinen Bark, konnte zum Irrsinn ausschlagen, zum Fallstrick werden, wenn der unvorsichtige Geist des Stolzes einen Menschen regierte.
Vor solchen Gedanken flüchtete ich mich gern auf das Deck jener Bremer Diana. Dort hatte offensichtlich nie das Flüstern weltlicher Schändlichkeiten Einlaß gefunden. Und doch fuhr das Schiff auf der weiten See: und die tragische, komische See, die See mit ihren Schrecken und besonderen Ärgernissen, die See, die von Menschen bevölkert und von eiserner Notwendigkeit regiert wird, ist unzweifelhaft ein Teil dieser Welt. Aber dieser patriarchalische alte Kasten ließ, einer heiligen Klause gleich, in sich nichts von alledem widerhallen. Das Schiff war undurchlässig gegen die Welt. Seine ehrwürdige Unschuld schob den brüllenden Begierden der See anscheinend einen Riegel vor. Und doch kannte ich die See zu lange, um an ihren Respekt vor Wohlanständigkeit zu glauben. Eine elementare Gewalt ist unerbittlich, schonungslos. Es mochte selbstverständlich Hermanns geschickter Seemannskunst zuzuschreiben sein – aber mich dünkte, als hätten die vereinigten Ozeane aus reiner Zurückhaltung bisher davon abgesehen, diese hohen Schiffswände einzuschlagen, das klotzige Ruder loszureißen, die Kinder zu schrecken und der Familie insgesamt die Augen zu öffnen. Es sah nach Zurückhaltung aus. Die rücksichtslose Enthüllung wurde am Ende einem Mann überlassen, einem Mann, der stark und selber elementar genug war, um, getrieben von der Macht einer schlichten und elementaren Begierde, einige der Geheimnisse der See zu lüften.
Dies jedoch geschah viel später, und einstweilen suchte ich frühabendlich Zuflucht auf dem freundlichen alten Schiff. Die einzige Person an Bord, die ihre Kümmernisse hatte, war die kleine Lena, und ich begriff sehr bald, daß der Gesundheitszustand ihrer Lumpenpuppe äußerst labil war. Dieses Ding führte eine Art Dasein »in extremis«, in einem hölzernen Kasten, der gegen den Steuerbord-Doppelpoller gelehnt war, und es wurde mit der größten Teilnahme und Sorgfalt von allen Kindern gepflegt, die es genossen, ernste Gesichter zu machen und auf Zehenspitzen zu gehen. Nur das Baby – Nikolaus – sah der Sache mit einem kalten, spitzbübischen Lächeln zu, als gehe sie ihn nichts an. Lena grämte sich unausgesetzt, über die Schachtel gebeugt, und alle waren sie todernst. Es war wunderbar, wie diese Kinder sich in ihr Mitleid mit diesem verschmierten Ding steigerten, das ich auch mit einer Zange nicht hätte anrühren wollen. Ich nehme an, sie übten und entwickelten an dieser Puppe die ihrem Volk eigene Sentimentalität. Wie Frau Hermann zulassen konnte, daß Lena diesen Lumpenbalg, der doch gar zu liederlich und unsauber war, in solchem Maße herzte und koste, setzte mich immer wieder in Erstaunen. Aber wenn Frau Hermann ihre scharfen, mütterlichen Augen von der Näharbeit hob, um mit belustigter Sympathie den Kindern zuzuschauen, dann schien sie irgendwie gar nicht zu erfassen, daß dieses Objekt der Zärtlichkeit ein Makel an der Reinheit des Schiffes war. Reinheit, nicht Sauberkeit, ist das richtige Wort. Sie wurde so weit getrieben, daß ich auch hierin schließlich einen Auswuchs des Sentimentalen zu entdecken meinte, als sei Schmutz durch Liebe getilgt worden. Es ist unmöglich, Ihnen einen Begriff von der peinlichen Ordnung dort zu geben. Es war, als werde das ganze Schiff allmorgendlich energisch ausgeputzt – mit einer Zahnbürste. Sogar dem Bugsprit wurde dreimal in der Woche Toilette gemacht mit einem Stück Seife und einem weichen Flanelltuch. Geschmückt – ich muß sagen: geschmückt –, kunstlos geschmückt mit blendendem Weiß am Holzwerk und dunklem Grün an den Eisenteilen, weckte diese einfältige Farbverteilung in mir Bilder arglosen Friedens, arkadischer Glückseligkeit; und die kindische Krankenbett-Komödie erschien mir bisweilen wie ein abscheulich realer Fleck auf diesem idealen Zustand.
Ich genoß ihn sehr – und brachte von meiner Seite eine kleine, sanfte Erregung hinein. Unser vertraulicher Verkehr nämlich entsprang der gemeinsamen Verfolgung jenes Diebes. Es war Abend, und Hermann, der entgegen seiner Gewohnheit an jenem Tag länger an Land geblieben war, wand sich gerade rückwärts aus einer kleinen Kutsche am Flußufer, seinem Schiff gegenüber, als die Jagd an ihm vorüberstürmte. Er begriff, als hätte er Augen in den Schulterblättern gehabt, sogleich die Situation, schloß sich mit einem Satz uns an und übernahm die Führung. Der Chinese floh schweigend wie ein fliegender Schatten über den Staub einer äußerst orientalischen Straße dahin. Ich folgte. Weit hinter mir keuchte und zeterte mein Steuermann wie ein Wilder. Ein junger Mond warf sein verschämtes Licht über die Ebene, die einer riesigen öden Fläche glich: die Gebäudemasse eines buddhistischen Tempels zeichnete sich weit vor uns in stumpfem Schwarz gegen den Himmel ab. Selbstverständlich entkam der Dieb; aber noch in meiner Enttäuschung mußte ich die Geistesgegenwart Hermanns bewundern. Die Geschwindigkeit, die dieser untersetzte Mann im Interesse eines ihm vollkommen fremden Menschen entwickelt hatte, verdiente meine wärmsten Dank – in diesem Kräfteeinsatz lag etwas von ehrlicher Herzlichkeit.
Er schien, wie ich selbst, betrübt über unseren Mißerfolg zu sein und achtete kaum auf meine Dankesworte. »Keine Ursache«, sagte er und lud mich unverzüglich ein, auf sein Schiff zu kommen und ein Glas Bier mit ihm zu trinken. Wir stocherten noch eine Weile ungewiß in den Büschen herum und spähten ohne Hoffnung in ein, zwei Gräben. Kein Laut war zu hören: Schlammlachen schimmerten schwach zwischen dem Röhricht herauf. Langsam trotteten wir zurück, mit hängenden Köpfen, unter der kleinen Sichel des Mondes, und ich hörte, wie er vor sich hinmurmelte: »Himmel! Zwei-und-dreißig-Pfund!« Er war beeindruckt von der Summe des verlorenen Geldes. Das Keuchen und Zetern des Steuermanns vernahmen wir schon lange nicht mehr.
Dann sagte er zu mir: »Jeder hat seine Plage«, und während wir weitergingen, bemerkte er noch, daß er nie etwas von der meinigen erfahren hätte, wäre er nicht durch einen Zufall von Kapitän Falk an Land aufgehalten worden. Er sei nicht gern so spät noch an Land – fügte er mit einem Seufzer hinzu. Den Anflug von Schmerzlichkeit in seinem Ton erklärte ich mir selbstverständlich mit seiner Teilnahme an meinem Mißgeschick.
An Bord der Diana drückten Frau Hermanns klare Augen mir viel Interesse und Mitgefühl aus. Wir trafen die beiden Frauen beim Nähen, einander gegenüber, unter dem geöffneten Deckslicht, beim hellen Schein einer Lampe sitzend. Hermann schritt voraus, zog noch in der Tür seine Jacke aus und ermunterte mich mit lautem, einladendem Rufen: »Treten Sie ein! Hier! Treten Sie ein, Kapitän!« Sogleich, die Jacke in der Hand, begann er, seiner Frau den ganzen Hergang zu erzählen. Frau Hermann faltete die rundlichen Hände im Schoß; ich lächelte und verneigte mich mit schwerem Herzen: die Nichte erhob sich von ihrer Näharbeit, um Hermann seine Pantoffeln und die gestickte Kalotte zu bringen, die er sich mit päpstlicher Feierlichkeit aufs Haupt setzte, ohne seine Mitteilung (über mich) zu unterbrechen. Wogen weißen Stoffes lagen auf dem Kabinenboden zwischen den Stühlen; ich hörte, wie die Worte »Zwei-und-dreißig Pfund« mehrmals wiederholt wurden, und dann kam sogleich das Bier, das ich köstlich fand, mit meiner vom Rennen und der Erregung der Jagd ausgedörrten Kehle.
Ich ging erst nach Mitternacht fort, lange nachdem die Frauen sich zurückgezogen hatten. Hermann hatte drei Jahre oder mehr im Osten Handel getrieben. Meistens hatte er Reis oder Holz geladen. Sein Schiff war in den Häfen von Wladiwostok bis Singapur bekannt. Es gehörte ihm selbst. Die Einkünfte waren zwar bescheiden, aber der Handel warf genügend ab – solange die Kinder klein waren, hieß das. Übers Jahr, so hoffte er, würde er in der Lage sein, die Diana für einen guten Preis an eine japanische Firma zu verkaufen. Er beabsichtigte dann heimzukehren, nach Bremen, im Postschiff, zweiter Klasse, mit Frau Hermann und den Kindern. Er erzählte mir das alles einigermaßen umständlich, zwischen langen Zügen an seiner Pfeife. Ich bedauerte sehr, als er, nachdem er die Pfeife ausgeklopft hatte, begann, sich die Augen zu reiben. Ich hätte noch bis zum nächsten Morgen dort sitzen mögen. Warum sollte ich an Bord meines eigenen Schiffes zurückeilen? Um die aufgebrochene, ausgeplünderte Schublade in meinem Kajütsraum anzustarren? Puh! Der bloße Gedanke bereitete mir Übelkeit.
Ich wurde täglicher Gast dort, wie Sie schon wissen. Ich glaube, Frau Hermann betrachtete mich von Anfang an als eine romantische Figur. Gewiß raufte ich mir nicht coram populo das Haar über meinen Verlust, und sie hielt eben das für noble Gelassenheit. Später habe ich ihnen wohl einige meiner Abenteuer erzählt – was die auch wert sein mochten –, und sie verwunderten sich höchlich über den Reichtum meiner Erfahrungen. Hermann pflegte die Stellen, die ihn am erstaunlichsten dünkten, zu übersetzen. Er stand dann auf und wandte sich, als wolle er einen Vortrag über ein bestimmtes Thema halten, gestikulierend an die beiden Frauen, die ihre Handarbeit langsam in den Schoß sinken ließen. Währenddessen saß ich vor einem Glas von Hermanns Bier und versuchte, bescheiden dreinzublicken. Frau Hermann sah rasch zu mir hinüber und stieß leise einige »Ach!« aus. Die Nichte brachte nie einen Laut über die Lippen. Nie. Aber auch sie hob bisweilen die fahlen Augen, um mich anzuschauen auf ihre nichts wahrnehmende, sanfte Art. Ihr Blick war keineswegs töricht; er leuchtete sanft und weit wie der Mond über einer Landschaft – anders als das forschend eindringende Blitzen der Sterne. Man tauchte ein in ihn, kam sich selbst wie ausgelöscht vor. Und doch muß dieser Blick, wenn er sich auf Christian Falk richtete, so wirkungsvoll gewesen sein wie das Suchlicht eines Schlachtschiffes.
Falk war der andere ausdauernde Besucher an Bord, wiewohl man, seinem Benehmen nach zu urteilen, hätte denken können, er sei bloß gekommen, um sich das Achterdeck-Gangspill anzuschauen. Er starrte es auch wirklich ziemlich ausgiebig an, wenn er uns Gesellschaft leistete dort vor der Kabinentür, den einen seiner muskulösen Arme über die Stuhllehne geworfen und die mächtigen, wohlgeformten Beine in sehr engen weißen Hosen lang ausgestreckt. Diese Beine endeten in einem Paar schwarzer Schuhe, die geräumig waren wie ein Flußkahn. Beim Eintreffen schüttelte er murmelnd Hermanns Hand, verbeugte sich gegen die Frauen und nahm neben uns mit seiner teilnahmslosen und misanthropischen Miene Platz. Abrupt brach er dann auf, sprang in die Höhe, ließ einige Grunzlaute hören, schüttelte allen die Hand, verneigte sich, das Ganze wie in Panik. Bisweilen näherte er sich in einer diskreten und krampfhaften Anstrengung den Frauen und wechselte einige leise Worte mit ihnen, höchstens ein halbes Dutzend. Bei diesen Gelegenheiten wurde Hermanns gewohnter Blick ausgesprochen glasig, und Frau Hermanns freundliches Gesicht rötete sich. Das Aussehen des Mädchens indessen veränderte sich nicht im mindesten.
Falk war Däne oder vielleicht auch Norweger, ich weiß es nicht. Jedenfalls Skandinavier, und ein anmaßend ausbeuterischer Monopolist. Möglich, daß ihm das Wort unbekannt war, aber von der Sache selbst hatte er eine klare Vorstellung. Sein Gebührentarif für das Herein- und Hinausschleppen von Schiffen war das brutalste und rücksichtsloseste derartige Dokument, das mir je vor Augen gekommen ist. Er war der Kapitän und Eigentümer des einzigen Schleppers auf dem Fluß, eines sehr schmucken, weißen Fahrzeugs von 150 Tonnen oder mehr, elegant wie eine Yacht gebaut, mit einem rund gehaltenen Ruderstand, der sich wie eine verglaste Kanzel hoch über den schnittigen Bug erhob, und mit einem einzigen schlanken, lackierten Pfahlmast auf dem Vorschiff. Ich möchte meinen, daß es noch ein paar Kapitäne auf See gibt, die sich an Falk und seinen Schlepper erinnern. Er knüpfte einem jeden von uns Handelsschiffen seine anderthalb Pfund Fleisch mit einer unerbittlichen Rücksichtslosigkeit ab, die ihn zu einem verhaßten, ja sogar gefürchteten Menschen werden ließ. Schomberg pflegte zu sagen: »Ich rede nicht mit dem Kerl. Er trinkt keine sechs Glas bei mir von einem Ende des Jahres zum andern. Doch, meine Herren, sehen Sie zu, daß Sie, wenn irgend möglich, nichts mit ihm zu tun haben, das ist mein Rat.«
Diesem Rat war, abgesehen von den unvermeidlichen Geschäftsbeziehungen, leicht Folge zu leisten, denn Falk drängte sich niemandem auf. Der Vergleich eines Schlepperkapitäns mit einem Zentaur mag abwegig erscheinen; aber er erinnerte mich entfernt an einen Stich in einem meiner Knabenbücher, auf dem Zentauren an einem Bach dargestellt waren – und da war insbesondere einer im Vordergrund, der mit Pfeil und Bogen in der Hand einherstolzierte. Er hatte gleichmäßige, strenge Züge und einen gewaltigen, lockigen Bart, der ihm über die Brust floß. Falks Gesicht erinnerte mich an diesen Zentaur. Zudem war er auch ein Mischwesen. Kein Pferd-Mensch, das stimmt zwar, aber ein Boot-Mensch. Er lebte auf seinem Schlepper, der immer den Fluß hinauf- und hinunterjagte vom frühen Morgen bis zum tauigen Abend. Im letzten Strahl der untergehenden Sonne sah man ihn noch weit draußen in der Mündung, mit wehendem Bart, hoch auf dem weißen Gebilde, wie er den Fluß heraufdampfte, um für die Nacht vor Anker zu gehen. Da waren der weißgekleidete Körper des Mannes und das tiefbraune Haar und nichts unterhalb seines Gürtels als die querschiffs verlaufenden weißen Linien der Brückenverschanzung, an denen der Blick weiterlief zu den schnittigen weißen Linien des Bugs, der das lehmige Wasser des Flusses durchpflügte.
Getrennt von seinem Boot schien er, mir wenigstens, unvolständig. Der Schlepper, ohne seinen Kopf und Torso auf der Brücke, wirkte wie verstümmelt. Doch er verließ sein Schiff sehr selten. Während der Zeit, da ich im Hafen lag, sah ich ihn nur zweimal an Land. Das erste Mal bei meinen Charterern, bei denen er menschenverächterisch eintrat und Bezahlung für das Hinausschleppen einer französischen Bark forderte. Das zweite Mal traute ich kaum meinen Augen, denn ich gewahrte ihn, zurückgelehnt unter seinem Bart in einem Korbstuhl des Billardzimmers in Schombergs Hotel.
Es war sehr lustig zu beobachten, wie Schomberg ihn geflissentlich ignorierte. Die Künstlichkeit dieses Benehmens kontrastierte deutlich mit Falks natürlicher Unbeteiligtheit. Der massige Elsässer redete laut mit seinen anderen Gästen, während er von einem Tischchen zum andern schritt, doch an Falks Platz ging er, den Blick geradeaus gerichtet, vorüber. Falk saß da, ein unberührtes Glas Bier neben sich. Er mußte jeden Weißen im Raum vom Sehen und vom Namen her gekannt haben, aber er wechselte mit niemandem ein Wort. Er quittierte mein Erscheinen mit dem Senken seiner Augenlider, und das war alles. Hingeflegelt in seinem Sessel, fuhr er sich von Zeit zu Zeit mit beiden Handflächen über das Gesicht, und dabei erfaßte ihn jeweils ein leichter, kaum wahrnehmbarer Schauder.
Es war eine Angewohnheit, und ich war selbstverständlich mit ihr vertraut, da man, wenn man während einer Stunde in seiner Gesellschaft weilte, nicht umhin konnte, sich über solch eine leidenschaftliche und unerklärliche Gebärde zu verwundern, die eine lange anhaltende Reglosigkeit unterbrach. Er pflegte diese Gebärde bei jeder Gelegenheit zu machen; bestimmt beispielsweise, wenn er der kleinen Lena und ihrem Geplapper über die leidende Puppe zugehört hatte. Die Kinder Hermanns belagerten seine Beine stets ziemlich heftig, obschon er sich ihrer Zudringlichkeit auf sanfte Weise zu entziehen suchte. Er schien jedoch eine große Zuneigung zu der ganzen Familie zu hegen. Zu Hermann insbesondere. Er suchte seine Gesellschaft. In diesem Fall beispielsweise mußte er nur auf ihn gewartet haben, denn sobald Hermann eintrat, erhob sich Falk hastig, und sie gingen miteinander hinaus. Danach entwickelte Schomberg in Hörweite von mir vor drei oder vier Leuten seine Theorie, daß Falk hinter Kapitän Hermanns Nichte her sei, daß aber, so versicherte er vertraulich, nichts daraus werde. Letztes Jahr sei es dasselbe gewesen, als Kapitän Hermann hier Ladung aufgenommen habe.
Natürlich schenkte ich Schomberg keinen Glauben, aber ich muß gestehen, daß ich doch eine zeitlang genau beobachtete, was vorging. Alles was ich entdeckte, war eine gewisse Ungeduld auf Hermanns Seite. Wurde er Falks ansichtig, wenn dieser über die Gangway herüberkam, fing der vorzügliche Mann zu brummen an und zischte etwas wie ein deutsches Fluchwort. Ich bin jedoch, wie ich schon sagte, nicht vertraut mit der Sprache, und Hermanns sanfter, rundäugiger Gesichtsausdruck änderte sich nicht. Während er ungerührt geradeaus blickte, grüßte er Falk mit »Wie geht’s« oder in kehligem Englisch mit »How are you?« Das Mädchen blickte dann kurz auf und bewegte leise die Lippen. Frau Hermann ließ die Hände in den Schloß sinken, um einige Minuten lang wortreich und in freundlichem Ton mit ihm zu plaudern, bevor sie sich wieder ihrer Näharbeit zuwandte. Falk warf sich in einen Stuhl, streckte seine langen Beine aus und fuhr sich, so sicher wie das Amen in der Kirche, mit den Händen leidenschaftlich über das Gesicht. Mir gegenüber verhielt er sich nicht ausgesprochen unverschämt: es war geradezu, als könne er mit einer Lapalie wie meiner Existenz unmöglich behelligt werden; und da er ein Monopol besaß, stand er schließlich nicht unter dem Zwang, sich freundlich zu erweisen. Er war sicher, seine erpresserischen Schleppgebühren aus mir herauszuholen, ob er nun lächelte oder die Stirn runzelte. Tatsächlich tat er keines von beidem: doch ehe einige Tage ins Land gegangen waren, gelang es ihm, mich nicht wenig in Erstaunen und Schombergs Plappermaul mehr denn je in Bewegung zu setzen.
Das kam so. Vor der Mündung des Flusses befand sich eine seichte Barre, die hätte niedergehalten werden müssen; aber die Regierungsstellen jenes Staates waren gerade zu dieser Zeit gottesfürchtig damit beschäftigt, die große buddhistische Pagode frisch zu vergolden, und hatten kein Geld übrig für Baggerarbeiten. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber zu der Zeit, von der ich spreche, war diese Sandbank für die Schifffahrt ein großes Ärgernis. Ihr war es zu danken, daß Schiffe von bestimmtem Tiefgang nicht im Fluß zuende beladen werden konnten. Nachdem sie soviel wie möglich geladen hatten, mußten sie auslaufen, um draußen ihre Ladung zu komplettieren. Die ganze Prozedur war ein einziger Verdruß. Wenn man der Meinung war, man habe so viel an Bord, wie das Schiff sicher über die Barre bringen könnte, gab man seinem Agenten Bescheid. Der wiederum verständigte Falk, daß Kapitän So-und-so zum Auslaufen bereit sei. Dann erschien Falk (angeblich, wenn es sich mit seinen anderen Arbeiten vereinbaren ließ, in Wirklichkeit aber, wenn es seinem launenhaften Sinn so paßte und nachdem er sich vorher auf dem Kontor sorgsam versichert hatte, daß hinreichend Geld zur Begleichung seiner Rechnung verfügbar war) mürrisch längsseits, starrte einen aus seinen gelben Augen von der Brücke her an und schleppte einen, wie unklar die Takelage und die Decks auch sein mochten, mit gefühlloser Eile hinaus, so als gehe es zum Richtplatz. Und er bestand darauf, daß man das Ende seiner eigenen Schlepptrosse heraufnahm, wofür dann selbstverständlich eine Sondergebühr erhoben wurde. Auf die Einwände, die man gegen diese Beutelschneiderei hinüberbrüllte, schüttelte dieser hochragende Torso, die eine Hand auf dem Maschinentelegraphen, nur den bärtigen Kopf über dem Platschen, dem Gestrudel, dem Lärm und den Rauchwolken, in denen der Schlepper, mit den Schaufelrädern zurückgehend und die Schlepptrosse spannend, sich wie ein wildes und ungebärdiges Wesen aufführte. Seine Mannschaft bestand aus der unverschämtesten Bande von Laskars, die mir je vorgekommen ist. Ihnen war erlaubt, einem die beleidigendsten Schimpfworte an den Kopf zu werfen; und sobald man fest war, zerrte einen Falk aus dem Liegeplatz, als schere es ihn nicht, was dabei zu Bruch gehe. Achtzehn Meilen mußte man hinter ihm den Fluß hinunterfahren und dann nochmal drei, die Küste entlang dorthin, wo eine Gruppe unbewohnter felsiger Eilande einen geschützten Ankerplatz umschloß. Hier mußte man dann liegen bleiben, vor einem einzigen Anker, die Masten mit ihren Rahen und den festgemachten Segeln seewärts gekehrt über jene kahlen Landkrümel hinweg, die auf dem tiefblauen Meer verstreut waren. Es gab nichts zu sehen außer einem langweiligen Ufer, dem schlammigen Rand der braunen Ebene, in der sich fahlgrün die Windungen des soeben verlassenen Flusses abzeichneten, und der Großen Pagode, die sich einsam und massig erhob mit schimmernden Kurven und Spitzen, wie die prunkvoll steinerne Blüte eines tropischen Felsens. Man hatte nichts zu tun, als ungeduldig auf den Rest der Ladung zu warten, der mit der größten Unregelmäßigkeit den Fluß hinuntergesandt wurde. Und es stand einem frei, sich mit dem Gedanken zu trösten, diese Phase des Verdrusses bedeute immerhin, daß die Stunde des Abschieds von jenem Gestade näher rücke.
Wir mußten beide durch diese Phase hindurch, Hermann und ich, und es gab eine Art geheimen Wettstreits zwischen unseren Schiffen, welches wohl als erstes zum Auslaufen bereit sei. Wir blieben Kopf an Kopf beinahe bis zum Ende, als ich das Rennen dadurch gewann, daß ich persönlich vormittags zum Agenten ging und Bescheid gab; während Hermann, der sich nicht so schnell entschließen konnte, an Land zu gehen, erst am späten Nachmittag in das Kontor des Agenten kam. Die Leute teilten ihm dort mit, daß mein Schiff am nächsten Morgen als erstes an der Reihe sei; und ich glaube, er sagte ihnen, er habe es nicht eilig. Es passe ihm besser, tags darauf auszulaufen.
An jenem Abend saß er, an Bord der Diana, auf seinem Stuhl, die plumpen Schenkel gespreizt, starrte vor sich hin und sog an dem gebogenen Mundstück seiner Pfeife. Plötzlich sagte er mit einiger Ungeduld zu seiner Nichte, sie möge die Kinder zu Bett bringen. Frau Hermann, die mit Falk sprach, unterbrach sich und sah beunruhigt zu ihrem Mann hinüber. Aber das Mädchen erhob sich sogleich und trieb die Kinder vor sich her in die Wohnung. Bald darauf mußte Frau Hermann uns verlassen, um drinnen eine, den herausdringenden Geräuschen nach zu urteilen, gefährliche Meuterei niederzuwerfen. Das veranlaßte Hermann, vor sich hin zu brummen. Während einer weiteren halben Stunde rutschte Falk, mit uns allein gelassen, auf seinem Stuhl hin und her, seufzte leise, sprang schließlich, nachdem er sich mit den Händen über das Gesicht gestrichen, vom Stuhl und sagte, als lasse er alle Hoffnung fahren, sich uns verständlich zu machen (er hatte nicht ein einziges Mal den Mund aufgetan), auf Englisch: »Dann … Gute Nacht, Kapitän Hermann.« Er blieb einen Augenblick vor meinem Stuhl stehen und sah mich unentwegt an, ja, starrte mich an und ging gar so weit, ein tiefes Geräusch in seiner Kehle hören zu lassen. All das war derart auffällig, daß er in mir zum ersten Mal während unseres auf Kopfnicken und Brummlaute beschränkten Verkehrs etwas wie Interesse erregte. Aber im nächsten Augenblick enttäuschte er mich wieder – denn er schritt eilig von dannen, ohne auch nur mit dem Kopf genickt zu haben.
Sein Benehmen war zwar immer absonderlich gewesen, und ich hatte ihm gleichwohl wenig Aufmerksamkeit gezollt, diese Art dunkler Vorsätzlichkeit aber, die da unter seiner Teilnahmslosigkeit zu lauern schien wie ein wachsamer alter Karpfen im Teich, war bisher noch nie so dicht an die Oberfläche gekommen. Entschieden hatte er Erwartungen in mir geweckt. Ich könnte nicht sagen, was ich erwartete, jedenfalls nicht die unglaublichen Ereignisse, mit denen er mich sogleich in der Frühe des nächsten Tages überraschte.
Ich erinnere mich nur noch, daß sein Verhalten an jenem Abend bemerkenswert genug war, um mich, nachdem er gegangen war, laut die Überlegung anstellen zu lassen, was er wohl damit habe zum Ausdruck bringen wollen. Hierauf antwortete Hermann, der die Beine übereinander schlug und grimmig seinen Stuhl zurückschob: »Der Bursche weiß nicht, was er will.«
Diese Bemerkung mochte eine wahre Einsicht enthalten. Ich sagte nichts darauf, und noch immer abgewandt, fügte Hermann hinzu: »Als ich letztes Jahr hier lag, war es dasselbe mit ihm.« Eine Eruption von Tabaksqualm verhüllte seinen Kopf, als sei sein Mißmut wie Schießpulver explodiert.
Ich war im Begriff, ihn geradeheraus zu fragen, ob er nicht wenigstens den Grund wisse, weshalb Falk, der doch ein notorisch ungeselliger Mensch war, Gefallen daran fand, ihn derart ausgiebig auf seinem Schiff zu besuchen. Nach allem, mußte ich plötzlich denken, war das doch höchst erstaunlich. Ich überlege mir jetzt, was wohl Hermann geantwortet hätte. Aber er ließ mich nicht dazu kommen, die Frage zu stellen. Er hatte anscheinend Falk ganz vergessen und begann einen Monolog über seine Zukunftspläne: den Verkauf des Schiffes, die Heimkehr; und dann kam er ins Sinnen und Kalkulieren und murmelte zwischen Wolken ausgespienen Rauches etwas von den Kosten. Die Notwendigkeit, das Überfahrtsgeld für seine ganze Sippe auf den Tisch zu legen, schien ihn in einer Weise zu beunruhigen, die um so mehr verblüffte, als er sonst keine Spuren von Geiz aufwies. Und doch verweilte er bei dem Vorhaben dieser Heimreise im Postschiff, als sei er ein Gemüsehändler, der sich in den Kopf gesetzt hat, die Welt kennen zu lernen. Er war, nehme ich an, von seiner Nationalität her haushälterisch, und es mag ihm etwas völlig Neues gewesen sein, für Reisen zahlen zu müssen – für das Reisen auf See, das doch für die Familie das normale Lebenselement war – von der Wiege an, was die Mehrzahl ihrer Mitglieder betraf. Ich erkannte, daß ihm jeder Shilling leid tat, den er so widersinnig ausgeben sollte. Komisch. Er geriet ins Lamentieren darüber, und dann wieder seufzte er verdrießlich und kam zu dem Schluß, daß ihm nun nichts anderes übrig bleibe, als drei Schiffskarten zweiter Klasse zu kaufen – und daneben noch für die vier Kinder zu zahlen. Ein Batzen Geld, der da aufzubringen sei. Ein hübscher Batzen.
Ich blieb bei ihm sitzen und lauschte (nicht zum ersten Mal) diesen Grübeleien, bis ich sehr schläfrig wurde; und dann verließ ich ihn und ging an Bord meines Schiffes zu Bett. Bei Tagesanbruch wurde ich vom Gekreisch schriller Stimmen geweckt, begleitet von einem mächtigen Wassergestrudel und den kurzen, tyrannischen Stößen einer Dampffeife. Falk mit seinem Schlepper war erschienen, um mich zu holen.
Ich kleidete mich an. Erstaunlich war, daß die antwortenden Stimmen an Bord meines Schiffes wie auch das Getrappel der Füße über meinem Kopf plötzlich verstummten. Aber ich hörte entferntere kehlige Rufe, die Überraschung und Ärger auszudrücken schienen. Dann drangen laute Proteste, die mein Steuermann einer entfernteren Person zurief, an mein Ohr. Andere, offensichtlich entrüstete Stimmen mischten sich hinein; ein Chor von Schmährufen, so klang es, antwortete. Dann und wann kreischte die Dampffeife dazwischen.
Dieser unnötige Aufruhr war höchst verwirrend; doch ich nahm ihn unten in meiner Kabine gelassen hin. Im nächsten Augenblick, dachte ich, würde ich diesen elenden Fluß hinabfahren, und in spätestens einer weiteren Woche hätte ich diesen widerwärtigen Ort mit all seinen widerwärtigen Menschen vollends hinter mir.
Überaus beflügelt von diesem Gedanken, griff ich zu den Haarbürsten, besah mich im Spiegel und begann mich zu bürsten. Plötzlich verstummte der Lärm draußen, und ich hörte (die Bullaugen meiner Kammer waren aufgestoßen) – hörte eine tiefe, ruhige Stimme, die auf Englisch, aber mit deutlich fremdländischem Akzent energisch rief: »Voll voraus!«
Es mag Gezeitenströme in den menschlichen Dingen geben, die, sobald Flut eintritt … und so weiter. Ich persönlich bin noch immer auf der Suche nach jener entscheidenden Wende. Ich fürchte jedoch, daß die meisten von uns dazu verurteilt sind, für alle Zeiten in einem stehenden Gewässer umherzuzappeln, dessen Ufer wahrlich nicht reizvoll sind. Aber ich weiß auch, daß es in den menschlichen Dingen – unerwarteter, ja unsinniger Weise – erhellende Augenblicke gibt, wenn ein sonst belangloser Laut, vielleicht nur eine völlig alltägliche Gebärde genügt, um uns die ganze Unvernunft, die alberne Unvernunft unserer Selbstgefälligkeit vor Augen zu führen. »Voll voraus!«, auch mit fremdländischem Akzent ausgesprochen, sind keine besonders eindrucksvollen Worte; aber sie ließen mich zu Stein erstarren, gerade als ich mir im Spiegel entgegenlächeln wollte. Und dann rannte ich, da ich meinen Ohren nicht mehr traute und bereits vor Wut kochte, zur Kabine hinaus und an Deck.
Es stimmte unglaublicher Weise. Es stimmte vollkommen. Ich hatte nur noch Augen für die Diana