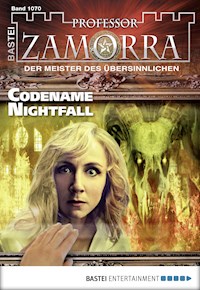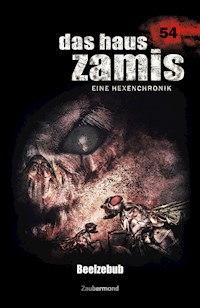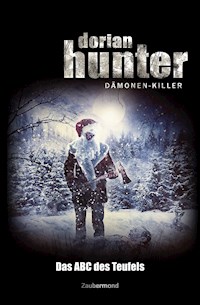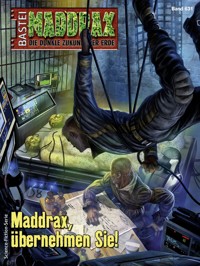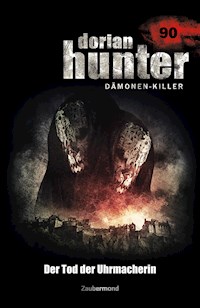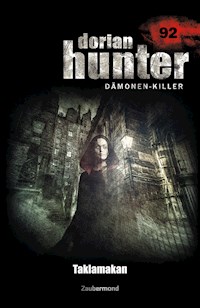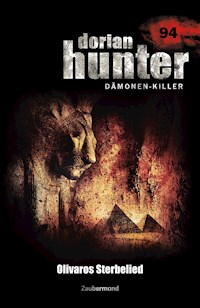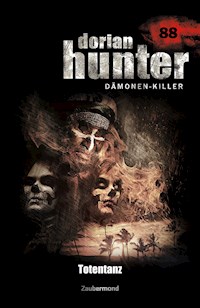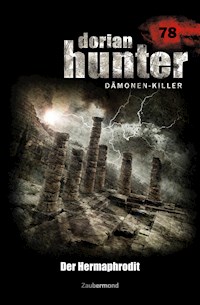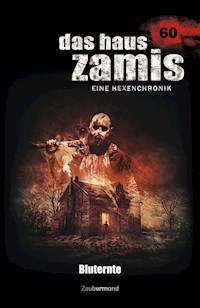1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Gespenster-Krimi
- Sprache: Deutsch
Das Meer ist glatt und endlos. Pechschwarz erstreckt es sich bis zum Horizont, und über ihm prangt ein leerer Himmel. Leer ... bis auf den Mond.
Solch einen Mond habe ich noch nie gesehen. Ich sitze in einem winzigen Ruderboot auf dem weiten Ozean und starre ihn an. Er hat die Form eines gewaltigen Totenschädels - und er scheint nicht, er leuchtet! Sein Licht ist geprägt von einem regelrecht krank machenden Grün, das sich in jede meiner Poren zu bohren scheint.
Nichts davon kommt mir seltsam vor. Warum nur? Nichts von diesem Anblick des blanken Horrors macht mir Angst.
Er aber schon ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Die Nacht der grünen Feuer
Kapitel 1 Gestrandet
Kapitel 2 Der Schrecken aus der Themse
Kapitel 3 Küste der Verlorenen
Kapitel 4 Der talentierte Mister Gideon
Kapitel 5 Kein Ausweg mehr!
Kapitel 6 Zwei Joker
Kapitel 7 Die Nacht der grünen Feuer
Epilog Mission Zukunft
Special
Vorschau
Impressum
Die Nacht der grünen Feuer
von Simon Borner
Das Meer ist glatt und endlos. Pechschwarz erstreckt es sich bis zum Horizont, und über ihm prangt ein leerer Himmel. Leer ... bis auf den Mond.
Solch einen Mond habe ich noch nie gesehen. Ich sitze in einem winzigen Ruderboot auf dem weiten Ozean und starre ihn an. Er hat die Form eines gewaltigen Totenschädels – und er scheint nicht, er leuchtet! Sein Licht ist geprägt von einem regelrecht krank machenden Grün, das sich in jede meiner Poren zu bohren scheint.
Nichts davon kommt mir seltsam vor. Warum nur? Nichts von diesem Anblick des blanken Horrors macht mir Angst.
Er aber schon ...
An die betreffenden Stellen.
Sehr verehrte Herren,
mir ist bewusst, wie absurd Ihnen die folgenden Zeilen vorkommen werden. Auch hege ich nicht die Absicht, meinen guten Ruf zu schmälern, indem ich sie Ihnen schreibe. Und doch: Ich kann sie nicht nicht schreiben. Genauso wenig wie ich ignorieren kann, was hier neben mir liegt – jenen kleinen und so unschuldig anmutenden Stapel Papier, dicht und von sicherer Hand beschrieben.
Meine Herren, es handelt sich um ein Manuskript. Mehr noch, um ein bislang unbekanntes Werk eines äußerst bekannten Autors. Dr. John H. Watson zählt, so darf man wohl sagen, zu den größten Stars der Literatur unserer Zeit. Jahrzehntelang protokollierte er mit nüchternem Stil und geflissentlicher Ordnung, was sein Freund und Kompagnon, der Meisterdetektiv Sherlock Holmes, erlebte. Die Kriminalfälle, die Holmes und Watson gemeinsam lösten, sind inzwischen weltbekannt – eben dank der Niederschriften Doktor Watsons.
Und doch ...
Es gibt eine Phase in all der Zeit, die überspringt der sonst so gründliche Chronist. Mehrere Jahre im Leben des Detektivs fehlen, und auch über Watsons eigenes Befinden in jener Zeit wissen wir treuen Leser erstaunlich wenig. Warum?
Das Manuskript, welches ich diesem Schreiben beifügen werde, erklärt es uns endlich. Ich bekam es auf Wegen, über die zu schweigen ich beim Leben meiner Kinder geschworen habe. Wege, die eines Christenmannes und rechtschaffenen Engländers wie mir zutiefst fremd sind. Wege, die mir auch heute noch, Wochen später, eine Angst bereiten, die mich Nacht für Nacht um den Schlaf bringt.
Genau wie das Manuskript. Was Sie auf den beiliegenden Seiten, verfasst in Doktor Watsons unverkennbarer Handschrift, sehen werden, übersteigt alles, was wir über ihn und Holmes zu wissen geglaubt haben. Die Geschichte ihrer beider Leben – ach, was sage ich: die Geschichte der Welt! – muss neu geschrieben werden, sofern es stimmt, was uns Watsons unveröffentlichter Text nahelegt. Mehr noch: Es stellt alles in Frage, was wir Menschen des neuen Jahrtausends zu wissen glauben.
Ist dies überhaupt noch unsere Zeit, unser Planet? Oder gibt es da Mächte – auch für uns in diesen Tagen der Aufklärung und des Fortschritts –, denen wir so wenig gewachsen sind wie ein Leck geschlagenes Ruderboot der stürmischen See? Mächte, die unser sicheres Ende bedeuten können, zu jeder Zeit und an jedem Ort?
Meine Herren, mir ist klar, wie wirr meine Worte auf Sie wirken müssen. Nichts von dem, was ich Ihnen hier schreibe, klingt glaubwürdig, nichts davon wirkt sinnhaft. Ein bislang unbekannter Watson? Dunkle Mächte aus Verliesen jenseits der Wirklichkeit? Auch ich würde mir nicht glauben, das versichere ich Ihnen. Auch ich würde diese Zeilen für die kranke Fantasie eines Wahnsinnigen halten.
Doch ich bin Ihnen einen entscheidenden Schritt voraus, Gentlemen. Ich habe das beiliegende Manuskript gelesen.
Von daher beschwöre ich Sie: Falls Sie je gut von mir dachten, dann gewähren Sie mir jetzt diese eine Bitte. Lesen Sie den Text ebenfalls! Urteilen Sie selbst, ob es sich bei dem, was uns das rätselhafte Manuskript mitteilen will, um einen schlechten Scherz handelt ... oder um grauenvolle Wirklichkeit!
Ich flehe Sie an, urteilen Sie selbst.
Um Ihretwillen!
In Erwartung Ihrer Rückantwort und mit aufrichtigen Grüßen ... und aufrichtiger Sorge
Lord Jameson T. Rimmer
Barclay Hall, Sussex
Kapitel 1Gestrandet
Irgendwo in England, 1893
Das Schlimmste war dieser Nebel.
Geoffrey Coulson schlug den Kragen seines Mantels höher und schlang die Arme um den Oberkörper. Dennoch wusste er dem kalten Dunst nichts entgegenzusetzen. Wann immer der Mittvierziger aus dem Fenster der kleinen Kutsche sah, fand er wenig mehr als die grauweißen Schwaden, die das Mondlicht reflektierten. Sie wirkten, als wollten sie das Land für sich beanspruchen. Für immer und ewig.
»He!«, rief Coulson. »Kutscher! Sind wir bald da?«
Die brüchige Stimme des Alten mischte sich unter das stete Geklapper der Räder. »Nicht mehr lange, Sir. Nur noch eine gute Stunde oder so.«
Coulson verzog das Gesicht und sparte sich jede Erwiderung. Die nächtliche Fahrt war nicht die Idee des Alten gewesen, also durfte er sie ihm auch nicht übel nehmen.
Sondern mir selbst, dachte er grimmig. Mir Wahnsinnigem
Nichts rechtfertigte diese Tortur. So einfach war das. Seine Geschäfte drüben in London waren dringend, das stimmte. Aber sie hätten es auch überlebt, wenn er die Nacht in dem winzigen Dorf geblieben wäre, das sie vorhin passiert hatten.
Aber nein: Coulson selbst hatte nicht so lange warten wollen.
Und jetzt darf ich mich auch nicht beschweren.
Dabei gab es weiß Gott Grund dafür. Coulson hatte eine irrationale Angst vor Nebel. Sie ging auf seine Kindheit zurück, wo er sich einmal in den grauen Schwaden verirrt und geglaubt hatte, nie wieder aus ihnen herausfinden zu können.
Seit damals plagten ihn Albträume, die er einfach nicht loswurde – nicht einmal mit den Medikamenten, die die Ärzte verschrieben. Ärzte, wohlgemerkt, die ihn nicht ernst nahmen, wenn er von seiner Angst sprach.
Vielleicht sollte er sich doch einmal nach anderen Medizinern umsehen. Erst kürzlich hatte er gehört, dass drüben auf dem Kontinent eine neue Art der Behandlung die Runde machte. Eine, die sich auf den Geist konzentrierte, weniger auf den Körper.
Ich könnte ...
Er kam nicht dazu, den Gedanken zu beenden. Denn die Kutsche machte plötzlich einen gewaltigen Satz – nur um einen Sekundenbruchteil später leicht zur Seite zu kippen. Coulson hatte gar keine Zeit, sich zu erschrecken. Ehe er begriff, wie ihm geschah, wurde er auch schon aus seinem Sitz geschleudert, stieß unsanft mit der Schläfe gegen die Seitenwand der kleinen Kabine und kam dann ächzend auf ihrem Fußboden zum Halt.
»Goddammit!«, fluchte der Alte vorn auf dem Bock. »Das hat jetzt gerade noch gefehlt. Sind Sie in Ordnung, Sir?«
Coulson stemmte sich vom Boden auf und ging zur Kabinentür. Warum war alles auf einmal so schief? »Ich lebe, Winston«, antwortete er laut. »Was, in aller Welt, ist da draußen los?«
»Ich fürchte, das müssen Sie sich selbst ansehen, Sir«, erwiderte der Alte. »Gottverflucht, was für ein Mist!«
Zögernd stieg Coulson ins Freie. Der Nebel begrüßte ihn wie einen alten Freund, war sofort da und überall. Dennoch konnte der Reisende leidlich gut sehen, zumindest auf kurze Distanz.
Was er sah, war allerdings eine Katastrophe. Die Kutsche hing mit der rechten Seite im Graben, hier auf freiem Gelände. Bei der Rutschpartie im matschigen Boden hatte eines der Räder Schaden genommen. Es war nicht zerbrochen, hing aber bemerkenswert schief an der hölzernen Achse. So konnte niemand weiterfahren, das war selbst Coulson klar.
»Sehen Sie sich das an«, brummte Winston.
Er kauerte am Boden und im Schein der beiden schwachen Laternen, die vom Kutschbock herabhingen. Sein schwarzer Bowler-Hut glitzerte vor Feuchtigkeit, die vom Nebel herrühren musste. Wie immer, wenn Coulson den Mann sah, fühlte er sich an ein Eichhörnchen erinnert. Der weiße Backenbart des anderen Mannes und dessen langgezogenes Gesicht legten den Vergleich mehr als nur nahe.
»Das elende Ding ist halb von der Achse gesprungen«, fuhr Winston fort. »Bis das repariert ist, dauert es ein Weilchen.«
»Aber Sie können es reparieren?«, fragte Coulson. Unsicher sah er sich um. Er wusste nicht, wo genau sie waren. Irgendwo an der Küste, so viel war allerdings klar. Er roch den salzigen Duft des Meeres und hörte es auch leise rauschen. »Wir sitzen hier nicht fest, Mann. Oder?«
»Nee«, brummte Winston. »Das nicht. Dauert halt nur. Vielleicht vertreten Sie sich ein wenig die Beine, während ich arbeite? Wenn Sie nicht zu weit gehen, dann hören Sie mich schon, wenn ich Sie rufe und es weitergehen kann.«
Spazieren gehen? Jetzt und ausgerechnet hier? Der Gedanke entsetzte Coulson mehr als er in Worte kleiden konnte. Und doch ... Wollte er unnütz in der Kabine sitzen, während Winston sich abrackerte?
»Kann ich Ihnen nicht vielleicht zur Hand gehen?«, fragte er. »Zwei Männer schaffen mehr als einer, und dann geht es schneller.«
Der Alte lachte humorlos. »Nichts für Ungut, Sir, aber Sie würden mich eher behindern. Ich weiß schon, was ich tue. Nur Geduld. Nutzen Sie die Gelegenheit einfach, um die steifen Glieder ein wenig zu strecken.«
Widerwillig fügte Coulson sich dem Vorschlag. Er nahm eine der Laternen, die Winston ihm anbot, und trat ein paar Schritte von der Kutsche weg. Dann ein paar mehr. Ob er das Meer besuchen sollte? Er roch es ja, hörte es. Das Ufer musste recht nah sein.
Nur ein kurzer Abstecher, beschloss er. Um die Zeit totzuschlagen. Weiter nichts.
Er hob die Laterne, und ihm war, als wiche der Nebel vor ihrem Schein zurück. Ein letztes Mal sah Coulson zur Kutsche, dann ging er endgültig los – der Nase nach und dem Ufer entgegen.
Das war sein zweiter Fehler in dieser Nacht.
†
Das Haus stand direkt an der Klippe. Coulson sah es im wenigen Mondlicht, das den Weg durch den Nebel fand – ein alter Kasten, dessen wettergegerbte Mauern sich den Launen der Natur schon seit Jahrhunderten widersetzen mussten. Es hatte hohe Fenster, ein spitz zulaufendes Dach und eine vergitterte Einfahrt. Wäre da nicht das flackernde grüne Licht im obersten Fenster gewesen, man hätte es für verlassen und vergessen halten können.
Wer wohnt denn ausgerechnet hier draußen?, wunderte sich Coulson.
Als bekennender Stadtmensch waren Land und Einsamkeit ihm fremd. Nie im Leben würde er freiwillig in solch eine Einöde ziehen – auch nicht für die wahrhaft atemberaubende Aussicht.
Die war wirklich bemerkenswert. Coulson war keine Viertelstunde gegangen, da hatte er die Küste auch schon erreicht. Genauer gesagt die Klippe, an der er nun stand und hinunter aufs Meer sah. Der majestätische Ozean schlug ein knappes Dutzend Meter unter ihm ans Ufer, schwarz und unglaublich mächtig. Coulson wollte gerade die Laterne heben, um es noch besser zu erkennen, da fielen ihm Bewegungen in der Nacht auf. Waren da etwa Menschen?
Tatsächlich! Dort unten, wo das Wasser auf die Felsen und den weißen Sandstein traf, hielten sich Menschen auf. Mitten in der Nacht.
Coulson zählte fünf Gestalten, war sich aufgrund der Entfernung aber unsicher. Sie schienen Mäntel zu tragen. Oder waren es Umhänge? Und irrte er sich, oder bildeten sie einen Kreis?
Für einen kurzen Moment dachte er daran, ebenfalls ans Ufer hinunterzusteigen und sie anzusprechen. Immerhin mussten die Menschen aus dem alten Haus auf der Klippe stammen, und vielleicht konnten sie Winston mit der Kutsche helfen.
Dann aber zögerte er. Denn inmitten ihres Kreises entstand etwas, das nicht sein durfte!
Coulson kniff die Augenlider enger zusammen. Spielte die Nacht ihm einen Streich? Eine Art Feuer war im Rund der Kuttenträger erschienen, plötzlich und wie aus dem Nichts. Grünes Feuer. Es loderte immer höher, und doch wirkte es absolut kalt, absolut fremdartig.
Gleichzeitig begann der Gesang. Coulson hörte ihn im Wind, der vom Ufer hinaufwehte. Das waren Laute, die einem menschlichen Mund fremd sein mussten. Laute, wie er sie noch nie gehört hatte. Die Menschen in ihrem Kreis sangen, und das grüne Feuer brannte dazu.
Eine Gänsehaut zog über Coulsons Rücken, die nichts mit der Nacht oder den Nebelschwaden zu tun hatte. Er wusste, dass es für alles, was er da unten beobachtete, eine rationale Erklärung gab. Dennoch spürte er, dass es nichts Rationales an sich hatte. Was er hier sah, war fremd. War böse.
Keuchend wich er zurück. Als er sich umwandte, fiel sein Blick einmal mehr auf das alte Haus auf der Klippe. Das grüne Licht brannte inzwischen in all seinen Fenstern – und die Einfahrt war plötzlich sperrangelweit offen. Eine sechste Gestalt stand inmitten der Einfahrt, das unnatürliche Licht des Hauses in ihrem Rücken, und sah direkt zu Coulson herüber!
Einen Herzschlag später hörte er den Schrei. Winston! Großer Gott, das war Winston!
Sofort lief Coulson los, zurück in Richtung Weg und Kutsche. Er war froh, die Küste hinter sich zu lassen. Der Anblick der nächtlichen Gestalten hatte ihn mehr entsetzt, als er in Worte fassen konnte. Irgendetwas Seltsames ging dort oben vor sich, und je weniger er darüber wusste, desto besser. Das spürte er.
Nach einigen Minuten erreichte er die Kutsche. Hier hinten am matschigen Weg war der Nebel wieder viel dichter. Nur mit Mühe konnte Coulson sich in ihm orientieren, zumal die Laterne in seiner Hand nervös zu flackern begonnen hatte.
»Winston?«, rief er. Seit dem ursprünglichen Schrei, der markerschütternd und klagend gewesen war, hatte er den Alten nicht wieder gehört. »Sind Sie hier irgendwo? Winston!«
Ein leises Ächzen ließ ihn zusammenzucken. Erst auf den zweiten Blick fand er den anderen Mann. Winston lag halb unter der Kutsche verborgen, gekrümmt wie ein getretener Hund. Und er stöhnte.
»Was ist denn?« Coulson stellte die Laterne ab und kauerte sich neben ihn. »Winston, was haben Sie? Sind Sie verletzt?«
»Da ...«, murmelte der Alte, ohne sich umzudrehen. Er wandte seinem Herrn noch immer den Rücken zu, rührte sich kaum. »Da war etwas. Im Nebel. Es ... Es kam ganz plötzlich. Ich konnte es nicht verhindern.«
»Was?« Abermals zog ein kalter Schauer über Coulsons Rücken. »Wovon reden Sie denn da, Mann? Was war im Nebel?«
»Sie kommen, Sir!«, antwortete der Kutscher – ächzend und flüsternd wie bei einem Geheimnis. »Die Herren des grünen Feuers!«
Dann drehte er sich um, und das schwache Licht der Laterne fiel auf sein Gesicht, dessen Züge sich komplett verändert hatten.
Geoffrey Coulson schrie auf, zuckte zurück und riss den Arm vor sein eigenes Gesicht. Ekel stieg in ihm auf, mischte sich zwischen seine Angst und die vielen offenen Fragen. Was geschah hier? Was, in aller Welt, war mit Winston geschehen?
Einen Herzschlag später hörte er den Singsang wieder. Und mit einem Mal wusste er es.
†
Einige Tage später, London
Die Kugel schlug dicht über meinem Kopf in die Wand. Putz bröckelte in meinen Nacken, und ich roch den unverkennbaren Duft verbrannten Pulvers. Sofort kehrten die Erinnerungen zurück und machten die ohnehin schon unerträgliche Situation noch unerträglicher. Ich erstarrte an Ort und Stelle, gelähmt von der Furcht, die mit den geistigen Bildern aus meiner Vergangenheit einherging.
Meinem Begleiter ging es da anders. Zum Glück.
»Grundgütiger, sind Sie wahnsinnig geworden?«, rief Sherlock Holmes. Mit beneidenswerter Reaktionsschnelle trat er vor und schlug der Dame vor uns die Waffe aus der erhobenen Hand. »Sie könnten jemanden mit dem Ding töten!«
Genau das, so wusste ich, war ihre Absicht gewesen. Lady Agatha Montgomery hatte nicht damit gerechnet, dass Holmes sie überführte. Sie hatte uns engagiert, um jeglichen Verdacht von sich weisen zu können – als Alibi und Augenwäscherei. Stattdessen war durch ihren viel publizierten Auftrag die Wahrheit erst ans Licht gekommen. Und nun wollte sie ihrer ursprünglichen Schandtat offenbar eine zweite, nicht minder schändliche Tat folgen lassen: den Mord an Holmes und mir.
Doch dazu kam es nicht. Holmes fing die Waffe auf, noch bevor sie den Boden der Baker Street 221b berühren konnte. Im selben Augenblick kehrte das Leben in mich zurück. Ich trat vor und packte Lady Agatha am Oberarm.
»Es ist vorbei«, sagte ich. »Geben Sie auf, Madam.«
Einen Herzschlag später eilte Mrs. Hudson ins Zimmer. »Was ist denn hier für ein Lärm?«, klagte unsere Vermieterin. »Man meint ja, es wäre ... Oh.«
Sie verstummte, als sie uns drei sah, und ihre Augen wurden groß.
»Es ist alles in Ordnung, Mrs. Hudson«, versprach Holmes. Er verstaute die abgefeuerte Waffe in der Tasche seines karierten Morgenmantels. »Lady Agatha hat sich soeben ergeben. Das haben Sie doch, Teuerste. Oder?«
Die Angesprochene verzog das Gesicht. »Sie können mir gar nichts, Holmes«, zischte sie.
»Ich fürchte, dass sehen Doktor Watson und ich anders«, entgegnete der Meisterdetektiv ungerührt. »Und wenn unsere Aussage nicht genügen sollte, Sie hinter Schloss und Riegel zu bringen, dann ist da ja immer noch die Kugel, die Sie freundlicherweise in die Wand über Mrs. Hudsons Kamin gefeuert haben. Ich gehe doch recht in der Annahme, dass sie aus der Waffe kommt, die schon Ihren Gatten ermordete?«
»Mein Mann starb durch seine eigene Hand«, beharrte die Adelige.
Ihr weißes Haar und die himmelblauen Augen verliehen ihr ein distinguiertes Aussehen. Doch ihr Benehmen war alles andere als vornehm, seit Holmes ihr gesagt hatte, was wir wussten.
»Und das äußerst kurz nachdem er Ihnen sein gesamtes Hab und Gut vermacht hatte«, sagte Holmes. »Wie überaus passend, finden Sie nicht auch? Wie lange waren Sie zum Zeitpunkt seines Todes verheiratet, Mylady? Zwei Wochen? Oder waren es schon drei?«
»Mrs. Hudson«, wandte ich mich an unsere gute Seele. »Seien Sie so freundlich, und schicken Sie nach Inspektor Lestrade. Wir benötigen seine Dienste in der Baker Street, und er darf gern zwei Kollegen mitbringen, die unseren adeligen Gast ins Zuchthaus eskortieren.«
»S... Sicher, Doktor«, stammelte Mrs. Hudson und verschwand.
»Sie können mir gar nichts, Holmes«, zischte die Lady.
»Das sagten Sie bereits«, gab mein Begleiter zurück. »Und doch haben meine Ausführungen von vorhin Sie derart erregt, dass Sie eine Schusswaffe zückten und versuchten, meinen lieben Freund Watson zu erledigen. Ist alles in Ordnung bei Ihnen, alter Knabe?«
»Unkraut vergeht nicht«, antwortete ich und unterdrückte ein weiteres Schaudern. »Ich habe schon Schlimmeres erlebt, Holmes.«
Das stimmte. Sogar viel Schlimmeres. Niemand wusste das besser als er, war er doch dabei gewesen.
Seit unserem Abenteuer in Crannock Hall war einige Zeit verstrichen.* Holmes und ich waren nach London zurückgekehrt, wo wir seitdem weitermachten wie bisher – zumindest dem Anschein nach. Hinter der Fassade der Baker Street 221b ging aber weit mehr vor sich als der detektivische Alltag, den wir vor jener schicksalhaften Nacht als Normalität betrachtet hatten. Zu viel war in Crannock Hall geschehen, zu viel hatte sich dadurch verändert. Es