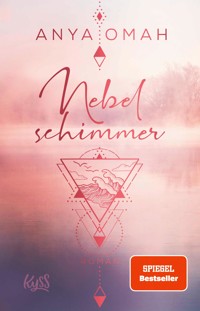9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sturm-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Ich kann dich nicht hassen Ausgerechnet Leo. Wieso muss es ausgerechnet sie sein, die ihm im Krankenhaus beisteht, nachdem sein Vater einen Unfall hatte? Und wieso fühlt es sich so gut an, von ihr gehalten zu werden, wo Aaron sie doch seit ihrer gemeinsamen Kindheit immer wieder von sich stößt? Ich will dich nicht lieben Ausgerechnet jetzt. Wieso muss Aaron ausgerechnet jetzt anfangen, nett zu sein, wo Leos Herz vor Sorge um ihren Ziehvater eh schon Risse bekommen hat? Denn wenn Aaron diesmal wieder in sein übliches Verhalten zurückfällt, könnte er ihr endgültig das Herz brechen … Drei Freundinnen. Drei Städte. Drei Herzensbücher. Enemies to Lovers ... Band 3 der Sturm-Trilogie. Unabhängig lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Anya Omah
Gewitterleuchten
Roman
Über dieses Buch
Ich kann dich nicht hassen
Ausgerechnet Leo. Wieso muss es ausgerechnet sie sein, die ihm im Krankenhaus beisteht, nachdem sein Vater einen Unfall hatte? Und wieso fühlt es sich so gut an, von ihr gehalten zu werden, wo Aaron sie doch seit ihrer gemeinsamen Kindheit immer wieder von sich stößt?
Ich will dich nicht lieben
Ausgerechnet jetzt. Wieso muss Aaron ausgerechnet jetzt anfangen, nett zu sein, wo Leos Herz vor Sorge um ihren Ziehvater eh schon Risse bekommen hat? Denn wenn Aaron diesmal wieder in sein übliches Verhalten zurückfällt, könnte er ihr endgültig das Herz brechen …
Dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Wenn du dich darüber informieren möchtest, findest du auf unserer Homepage unter www.endlichkyss.de/gewitterleuchten eine Content-Note.
Vita
Anya Omah, geboren in Nordrhein-Westfalen, hat als Laborassistentin und Wirtschaftspsychologin gearbeitet, bevor sie sich als Autorin selbstständig machte. Über diese Entscheidung sagt sie: «Ich war verrückt genug, dem sicheren Bürojob den Rücken zu kehren und meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Aber mal ehrlich: Wie verrückt kann es sein, seinen Traum zu leben?» Im März 2014 veröffentlichte sie ihr Debüt, es folgten zahlreiche weitere New-Adult-Romane. Mit der Sturm-Trilogie erscheint sie nun erstmals bei KYSS.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Patrycja Krol; Shutterstock
ISBN 978-3-644-01014-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meinen Papa.
Ich weiß, dass du mich siehst und stolz auf mich bist.
Playlist
Birthday Cake – Dylan Conrique
I See You – MISSIO
Good Days – SZA
Yummy (Summer Walker Remix) – Justin Bieber & Summer Walker
Do It Like a Dude – Jessie J
Freaks – Surf Curse
Make me think of you – ELIS NOA
Fantasy – Black Atlass
Vibin’ Out – FKJ & ((( O )))
Wonder – Shawn Mendes
Fix It to Break It – Clinton Kane
Falling – Harry Styles
Where Are Ü Now – Skrillex & Diplo (with Justin Bieber)
Arcade – Duncan Laurence
i hate u, i love you – gnash (feat. Olivia O’Brien)
Been Like This – Doja Cat
Someone to Stay – Vancouver Sleep Clinic
you were good to me – Jeremy Zucker & Chelsea Cutler
get you the moon – Ryan Walker
golden hour – JVKE
To Build a Home – The Cinematic Orchestra (feat. Patrick Watson)
Hallo Papa
Eigentlich glaube ich nicht mehr an Gott seit du gestorben bist. Aber kann es ohne Gott Engel geben? Weil ich nähmlich glaube das du ein Engel geworden bist und gemacht hast das jetzt Teddy für mich da ist. Wenn ich traurig bin nimmt mich Teddy mit in seine Werkstat und wir reparieren zusammen dein Mortorad. Teddy sagt das es bald wider wie neu aussehen wird. Schade das das nicht auch bei Menschen geht. Wenn ich einen einzigen Wunsch frei hätte würde ich mir einen Schraubenschlüssel wünschen der dich wider lebendig macht. Aber nur Babys glauben an Wunder. Deshalb wünsche ich mir nur das Mama Teddy und Lydia alle meine Freunde Oma Opa Tante Luisa Onkel Frederik und alle Menschen die ich sonst noch lieb habe niemals sterben. Und Aaron. Obwohl er fis zu mir ist. Gestern hat er gesagt das ich mich wie ein Junge beneme und er hat mich Karottenkopf genant. Ich wollte ihm das zurückgeben aber dann kahm Teddy. Er darf nicht hören wie ich gemeine Sachen zu seinem Sohn sage. Sonst hört er bestimmt auf mich lieb zu haben und nimmt mich nicht mehr in seine Werkstat mit. Außerdem will ich mich garnicht mit Aaron streiten. Ich wäre viel lieber mit ihm befreundet.
Hab dich ganz doll lieb
Deine Leo
1Leona
Ich tauche meinen Zeigefinger in den cremigen Teig und lecke ihn mit geschlossenen Augen ab. «Mhmmm.» Das hier ist der beste Teil am Kuchenbacken. Das Probieren des Teigs, bevor man ihn in die Form gibt. Der Ofen ist bereits vorgeheizt. Wie jedes Jahr am 15. August backe ich spätabends Teddys Lieblingskuchen. Schokolade mit Kokos – diesmal mit einem Schuss Rum. Ich lasse den Kuchen über Nacht auskühlen, um ihn morgen direkt nach der Uni mit nach Lüneburg zu nehmen. Teddy wird sechsundsechzig. Daher auch der Rum. Ein bisschen von seinem Lieblingsschnaps, wegen der Schnapszahl. Vermutlich bin ich die Einzige, die diesen Einfall genial findet. Aber das ist mir egal.
Ich bin dabei, die Springform mit Margarine einzufetten, als hinter mir mein Handy vibriert. Mit der Form in der Hand drehe ich mich zum Küchentisch, um einen kurzen Blick aufs Display zu werfen. Damit ich weiß, wen ich gleich zurückrufen muss. Aber als ich den Namen «Möchtegern-Hipster-Ken» auf dem Bildschirm lese, wird aus dem kurzen Blick aufs Display ein ungläubiges Starren. Schnösel-Aaron ruft mich normalerweise nie an. Ich ignoriere den Anruf. Was auch immer er will, er kann mir wie ein normaler Mensch eine Nachricht schreiben oder mir auf die Mailbox sprechen. Keine Sekunde nachdem mein Handy verstummt ist, vibriert es jedoch erneut. Wieder ist es Aaron. Ich verdrehe die Augen und stelle die Backform auf die Arbeitsfläche. Drei Atemzüge lang spiele ich mit dem Gedanken, ihn wegzudrücken. Aber was, wenn es wichtig ist? Es könnte um den Geburtstag seines Vaters gehen – eine spontane Ortsänderung oder Überraschung, in die er mich einweihen will.
Als ob Schnösel-Aaron jemals so nett zu mir wäre. Kopfschüttelnd nehme ich mit der sauberen Hand mein Telefon vom Küchentisch und wische den grünen Kreis nach rechts.
«Wirst du jetzt zum Stalker, oder was soll der Telefonterror, Aaron?»
«Hi, Leo.»
Sämtliche Härchen an meinem Körper stellen sich auf. Was zur Hölle ist mit Aarons Stimme passiert? Sie klingt viel zu kratzig, viel zu rau und irgendwie … abgenutzt. Total fertig. Wie die eines kettenrauchenden Heavy-Metal-Sängers nach einem Heulkrampf. Aber definitiv nicht wie die von Möchtegern-Hipster-Ken, Schrägstrich Schnösel-Aaron, der mich, seit ich denken kann, Karottenkopf nennt. Immer. Ist das Teil eines Streichs, um mich in Sicherheit zu wiegen?
«Was ist los?», frage ich vorsichtig.
«Der Geburtstag meines Vaters fällt aus.» Jetzt bricht seine Stimme. Das kann nicht gespielt sein.
«Warum?»
Keine Antwort. Bloß ein hartes Schlucken, was mein Herz so heftig pochen lässt, dass es in meinen Ohren dröhnt.
«Aaron?»
«Er hatte einen Unfall … in der Werkstatt und ist jetzt im Krankenhaus.»
«Du verarschst mich, oder?» Meine Frage ist eher ein Flehen. Ich würde alles dafür tun, dass er sie mit Ja beantwortet. Doch stattdessen …
«Nein.»
Mit noch fettigen Fingern ertaste ich die Tischkante. Ich fühle mich, als würde ich stürzen. «Wie schlimm ist es?»
«Die Hebebühne ist zusammengebrochen und … er wurde unter ihr eingeklemmt. Mama meinte, dass er reanimiert werden musste.»
Mein Herz krampft sich zusammen und sackt wie ein Stein in meinen Magen. Übelkeit steigt in mir auf.
«Er wird gerade notoperiert und …» Ich höre die Angst in Aarons Stimme. Die Panik. Und die Tränen, die ihn schließlich verstummen lassen. Tief luftholend ringt er um Beherrschung, während ich die Augen schließe.
Bitte nicht. Ich schüttele gefühlt hundertmal den Kopf, in der Hoffnung, dass seine Worte nicht wahr sind. Das erste Mal in meinem Leben wünsche ich mir, dass Aaron gemein zu mir ist. Dass es nur ein grausamer Streich ist, dass er – so makaber es auch wäre – gleich schadenfreudig ins Telefon lacht. Aber der Teil von mir, der gerade zu zerbrechen droht, weiß, dass das nicht passieren wird. Als ich meine Lider wieder öffne, erkenne ich die Umrisse der Küche nur noch verschwommen. «In welchem Krankenhaus liegt er?»
«Im Klinikum Lüneburg.»
Die Klinik, in der Papa gestorben ist. Ich zwinge mich, nicht daran zu denken, und nicke, was bei Aaron natürlich nur als Schweigen ankommt.
«Bist du noch da?»
«Klinikum Lüneburg», antworte ich tonlos. «Ich … ich mache mich auf den Weg.»
«Okay … dann sehen wir uns da, schätze ich. Muss jetzt auflegen, das Flugzeug startet gleich.»
Flugzeug? Es dauert einen kurzen Moment, bis mir wieder einfällt, dass er in München studiert und mit dem Zug oder Auto viel länger unterwegs wäre.
Obwohl er inzwischen aufgelegt hat, halte ich noch immer mein Handy ans Ohr. Alles, was ich höre, ist das Rauschen meines Blutes und mein wild pochendes Herz, das Angst durch meine Adern pumpt. Angst, die sich in meinem ganzen Körper ausbreitet. Erst in der Brust, dann im Bauch, im Kopf und von dort aus in Beine und Arme. Ich spüre sie sogar in den Fingern. Sie fangen an zu kribbeln, versteifen sich. So wie auch der Rest meines Körpers.
Papa ist eingeschlafen, Leona. Er kommt nicht mehr zu uns zurück.
Alles in mir fühlt sich schwer an, als würde flüssiges Blei durch meine Venen fließen. Ich muss zu Teddy, bevor es zu spät ist. Ich muss sofort zum Bahnhof. Aber meine Beine bewegen sich nicht.
«Reiß dich zusammen, Leo», befehle ich mir und schalte meinen Kopf auf Autopilot. Wie immer, wenn ich drohe in Schockstarre zu verfallen, erteile ich mir simple Anweisungen: «Leg das Telefon weg, Leo. Wasch dir die Hände.» Ich lege mein Telefon auf den Tisch und gehe zur Spüle, wo ich mir das Fett von den Fingern schrubbe.
«Jetzt mach den Ofen aus.» Ich mache den Ofen aus.
«Nimm dein Handy. Geh in dein Zimmer und zieh dich um.» Mit beinahe mechanischen Bewegungen führe ich meine Befehle aus. Ich tausche meine Schlabberklamotten gegen irgendeine Jeans, greife mit zittrigen Händen nach dem nächstbesten T-Shirt und schlüpfe hinein. Dann schreibe ich Lissa eine kurze Nachricht, dass ich schon heute nach Lüneburg fahre, damit sie sich später nicht wundert, wo ich bin. Sie und Simon sind gerade im Kino. Teddys Unfall behalte ich vorerst für mich. Weil Lissa mich sonst direkt anrufen und ich vermutlich in Tränen ausbrechen würde. Aber das geht nicht. Ich kann jetzt nicht weinen. Ich darf nicht zusammenbrechen.
Nachdem die Nachricht abgeschickt ist, öffne ich die Wetter-App. Kein Gewitter. Ein flüchtiger Moment der Erleichterung, bevor ich mir die nächste Zugverbindung nach Lüneburg raussuche und ein Taxi rufe. Meine Beine setzen sich wieder in Bewegung. Schwerfällig, als würde ich mich unter Wasser befinden und gegen den Druck ankämpfen.
Eine halbe Stunde später sitze ich im Zug und schicke Stoßgebete ins Universum: Bitte tu mir das nicht an. Bitte lass mich nicht schon wieder jemanden verlieren, den ich liebe.
Die Uhr über der Tür zur Notaufnahme tickt und tickt und tickt. Und nichts passiert. Seit vier Stunden sitzen wir hier und warten auf eine Nachricht, wie Teddys Operation gelaufen ist. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr frisst die Angst nicht nur meinen Magen auf, sondern verschlingt auch mehr und mehr die Hoffnung, dass alles gut werden wird. Ich kann einfach nicht länger auf diese Uhr starren, also schließe ich die Augen. Aber plötzlich blitzen Bilder auf. Worst-Case-Szenarien, die alle damit enden, dass Teddy es nicht schafft. Ein undefinierbarer, halb erstickt klingender Laut presst sich aus meiner Kehle, und ich reiße die Augen wieder auf.
«Leo? Bist du okay?»
Mein Kopf dreht sich zu Aaron, der vor knapp zwei Stunden eingetroffen ist und die Hand seiner Mutter Lydia hält. Seine Stimme hört sich immer noch etwas rau und fremd an. Genauso fremd wie die Tatsache, dass wir in einem Raum sein können – sogar nebeneinandersitzen –, ohne zu diskutieren oder genervt voneinander zu sein. Er fragt mich sogar, ob ich okay bin. Ich. Wo doch sein Vater gerade unterm Messer liegt. Ein schlechtes Gewissen gesellt sich zu meiner Sorge um Teddy. Wegen all der Streitereien mit Aaron, die mir plötzlich so sinnlos und unwichtig vorkommen. Wann habe ich Aaron zuletzt etwas Nettes gesagt?
«Ich … ich hoffe einfach nur, dass alles gut wird», krächze ich. Mein Hals fühlt sich vor Trockenheit ganz wund an, als ich mühsam schlucke. «Die Warterei macht mich fertig.»
Aaron nickt und streicht sich sein blondes kinnlanges Haar hinters Ohr. Für den Bruchteil einer Sekunde macht es den Anschein, als wollte er noch was sagen, doch sein Mund klappt zu, ohne sich wieder zu öffnen. Mir fällt mal wieder auf, wie ähnlich Aaron seinem Vater sieht. Genau genommen haben sie sich noch nie so ähnlich gesehen wie jetzt. Und das nicht nur wegen des kantigen Kinns, der kräftigen Kieferpartie oder den vollen Lippen. Es ist die Sorge, die Aaron ins Gesicht geschrieben steht. Die Angst. Sie hat ihn altern lassen. Er bemüht sich, diese Gefühle nicht zu zeigen. Das erkenne ich an dem ständigen Auf und Ab seines Kehlkopfs. Aber Angst lässt sich nicht schlucken. Sie kontrolliert deinen Herzschlag, deine Atmung, deine Muskeln – bis sie dich komplett lähmt und sich irgendwann entlädt. Diesen Moment scheint er, genauso wie ich, hinauszuzögern.
Lydia schreckt als Erste auf, als eine Ärztin durch die Glastür der Notaufnahme auf uns zukommt. Sie und Aaron springen auf, während ich sitzen bleibe. Die Furcht vor dem, was die Ärztin uns jetzt mitteilen könnte, lässt mich erstarren. Das hindert mich aber nicht daran, in das Gesicht der jungen Frau zu blicken und nach Anzeichen für eine Hiobsbotschaft oder einem Hoffnungsschimmer zu suchen. Doch ihr Ausdruck ist unergründlich. Ihre Mundwinkel zeigen weder nach unten noch nach oben.
«Ich bin Dr. Perez. Fachärztin der Neuro- und Unfallchirurgie. Sind Sie die Angehörigen von Theodor Sanders?»
«Ja, ich bin seine Frau.» Lydias Stimme zittert.
Aaron nickt nur.
Ich halte die Luft an.
«Die Operation ist gut verlaufen …» Die angestaute Luft entweicht aus meinen Lungen, doch das «… aber …» lässt meine Atmung sofort wieder stocken.
«Aber … was?», fragt Lydia.
«Aufgrund eines Schädel-Hirn-Traumas haben wir ihn in ein künstliches Koma versetzt …»
Lydias Finger krallen sich in Aarons Unterarm.
«… um den Körper ihres Mannes zu entlasten und die Behandlung zu erleichtern. Er schwebt nicht akut in Lebensgefahr und hat die Operation, wie gesagt, den Umständen entsprechend gut überstanden. Es gab keine Komplikationen, und damit es dabei bleibt, haben wir diese vorübergehende Maßnahme ergriffen.»
«Wie vorübergehend?», höre ich mich sagen und stehe nun doch auf. Keine Ahnung, wie meine Beine das überhaupt anstellen.
In den Augen der Ärztin steht eine Frage, die von Lydia mit einem Nicken beantwortet wird. «Sie gehört zur Familie.»
Die Selbstverständlichkeit ihrer Worte lässt mein Herz nur noch schwerer werden. Die Lippen aufeinandergepresst, kämpfe ich gegen das Beben meines Kinns an, während Dr. Perez erklärt: «Wir hoffen, dass wir ihn nicht länger als zwei oder drei Tage im künstlichen Koma halten müssen …»
Zwei, drei Tage … Keine Wochen oder Monate. Die Rocky Mountains sind nichts im Vergleich zu dem Gebirge, dass gerade von meiner Brust kracht.
«O Gott sei Dank.» Lydia sinkt aufschluchzend gegen Aarons Schulter.
«Dann könnte er übermorgen schon wieder aufwachen?», frage ich.
«Im besten Fall. Es kann aber auch länger dauern. Das lässt sich leider nur schwer vorhersagen. Er befindet sich zur Überwachung auf der Intensivstation.»
Lydia wischt sich schniefend über die Wangen. «Können wir zu ihm?»
«Ja, aber nur kurz. Ihr Mann braucht jetzt vor allem Ruhe.» Die Ärztin teilt uns die Zimmernummer mit und wie wir dorthin gelangen. «Maximal zu zweit», fügt sie noch an, was mir gelegen kommt.
Denn ich merke, wie mein Autopilot langsam runterfährt, und brauche einen Moment für mich.
«Ich … ich geh eben zur Toilette», sage ich mit heiserer Stimme und wende mich ab. Zehn Schritte weiter entladen sich Angst, Hilflosigkeit, aber vor allem Erleichterung in Tränen, die heiß über meine Wangen laufen. Ich flüchte um die nächste Ecke, in den Gang, der zu den Fahrstühlen und den Treppen führt. Weil hier gerade niemand ist, bleibe ich stehen. Und weine. Leise in meine Hand. Bis ich von rechts Schritte höre. Ich drehe mich weg und erkenne im Augenwinkel Aaron, der an mir vorbeirauscht. Sein Kopf ist gesenkt, weshalb er mich vermutlich nicht wahrnimmt. Und noch während ich mich frage, ob ich ihm folgen sollte, gehe ich ihm nach.
Aaron war die ganze Zeit über still, hat keinen Ton gesagt, als die Ärztin bei uns war. Und anstatt jetzt bei seinem Vater zu sein, eilt er so schnell über den Flur Richtung Ausgang, als wäre ein Axtmörder hinter ihm her. Mein Instinkt sagt mir, dass er jetzt nicht allein sein sollte.
2Aaron
Einmal, als Leo und ich auf den Baum in unserem Garten um die Wette geklettert sind, ist der Ast, auf dem ich stand, abgebrochen. Ich fiel runter und prallte auf den Rücken. Ein Gefühl, als wäre die komplette Luft aus meinen Lungen gepresst worden. Ich konnte nicht atmen, mich nicht bewegen, war unfähig zu sprechen. Lag einfach da. Benommen.
Genauso geht es mir jetzt, während das Wort Koma in meinem Schädel herumspringt, sich durch meine Eingeweide wühlt und schließlich einen Schraubstock um meine Brust legt. Immer enger. Immer fester. Bis ich das Gefühl habe, zu ersticken oder mich übergeben zu müssen. Vielleicht auch beides gleichzeitig. Ich sage Mama, dass ich kurz an die frische Luft muss und gleich nachkomme. Ihre Sorge um Vater scheint zu groß, um sich zu fragen, was mit mir los ist. Oder ich bin einfach nur ein verdammt guter Schauspieler.
In dem Wissen, dass Leo gleich bei ihr sein wird, drücke ich Mamas Hand. Gebe ihr das letzte bisschen Zuversicht, das ich aufbringen kann. Dann drehe ich mich um und haste durch den Gang. Folge der Beschilderung Richtung Ausgang, ringe um Atem. Aber als ich endlich draußen bin und sich meine Lungen mit der abgekühlten Luft füllen, wird mir klar, dass mir etwas anderes den Hals abgeschnürt hat. Kein Schraubstock. Sondern die Tränen, die ich die letzten sieben Stunden mit aller Macht zurückgehalten habe. Während der Telefonate mit Mama und Leo. Im Flugzeug. Und hier, im Krankenhaus. Ich wollte stark sein, damit Mama schwach sein kann. Aber die Angst um Vater, das Warten, diese Ungewissheit, jetzt die Erleichterung darüber, dass er die OP überlebt hat … All das war zu viel.
Ich sinke auf eine Bank. Meine Unterarme auf die Beine gestützt, atme ich tief ein. Dann wieder aus. Ein. Aus. Versuche, mich so schnell wie möglich zu beruhigen. Ich sollte Mama nicht allein lassen. Aber die bloße Vorstellung, dass Vater, an irgendwelche Schläuche angeschlossen, im Koma liegt, schnürt mir schon wieder die Luft ab.
Was, wenn er nicht mehr aufwacht?
Oder bleibende Schäden davonträgt?
Wie zur Hölle konnte dieser Unfall überhaupt passieren? Und …
«Aaron?» Leos Stimme dringt von hinten an meine Ohren und lässt mich erstarren. Reflexartig wische ich mit dem Handrücken über meine Augen und Wangen, richte mich auf. Als könnte eine gerade Haltung darüber hinwegtäuschen, dass ich geweint habe.
Ihre Schritte kommen näher. Zögerlich. «Ich wollte nur kurz nach dir sehen … Kommst du klar?»
Wenn klarkommen heißt, wieder atmen zu können, dann ja. Also nicke ich. Sprechen ist angesichts des Kloßes in meinem Hals nicht drin. Ich schlucke und spüre im nächsten Moment die Wärme ihrer Hand durch den dunklen Stoff meines Hemdes. Dann ein zaghaftes Drücken meiner Schulter – und zack, verschwimmt schon wieder meine Sicht. Dass sie nun die Bank umrundet und sich neben mich setzt, macht es nicht besser.
«Ich komme klar», wiederhole ich. Diesmal mit Worten. In der Hoffnung, dass sie mir glaubt und geht. Aber das Zittern in meiner Stimme straft meine Worte Lügen. Ich spüre ihren Blick auf meinem Gesicht.
«Aber das musst du nicht, Aaron. Schon gar nicht allein», sagt sie, was mich schon wieder um Fassung ringen lässt. Als würde Leos unerwartete Fürsorge … ihre Nähe etwas in mir lostreten.
Die Hände zu Fäusten geballt, starre ich in der Ferne irgendeinen Punkt an. Fixiere ihn, klammere mich an ihm fest, um nicht auf die Idee zu kommen, Leo zu umklammern. Keine Ahnung, wo dieser Drang plötzlich herkommt. Das Gefühl, sie zu brauchen. Ausgerechnet Leo. Die letzte Person, der ich mich so zeigen möchte. Gleichzeitig gibt es wohl niemanden, der besser nachvollziehen könnte, wie es mir momentan geht. Ich kämpfe trotzdem dagegen an, sie in meine Arme zu ziehen.
Aber ihr geflüstertes «Ich bin für dich da» zwingt mich in die Knie. Ein rauer, undefinierbarer Laut, den ich nicht zurückhalten kann, löst sich aus meiner Kehle und verklingt an Leos Haut, als ich den Kopf in ihre Halsbeuge presse. Sie drückt mich an sich. Streicht über meinen Rücken und flüstert, dass alles gut wird. Ihre Worte klingen wie ein Versprechen, das sie wie ein Mantra aufsagt. Wieder und wieder – bis ein Teil der Anspannung meine Muskeln verlässt. Meine Fäuste lösen sich. Ich erwidere ihre Umarmung, vergrabe mein feuchtes Gesicht in ihren kupferroten Haaren und atme so tief ein, dass mir ein fruchtig-süßer Geruch in die Nase kriecht. Erdbeeren. Ein Duft, den ich an ihr zum ersten Mal wahrnehme. Weil wir uns noch nie so nah waren. Obwohl ich sie schon mein ganzes Leben lang kenne. Vermutlich fühlt sich das hier … von ihr gehalten und getröstet zu werden, deshalb so seltsam vertraut an. Und … gut.
Ich rede mir ein, dass das nichts mit Leo an sich zu tun hat. Sondern mit der Gesamtsituation. Und damit, dass ich lieber Erdbeerhaare anstatt den scharfen, fast schon ätzenden Geruch von Desinfektionsmittel einatme, der im Gebäude hinter uns auf mich wartet. Es wird Zeit, wieder reinzugehen. Ich verstecke mich schon viel zu lange hier draußen, anstatt mich drinnen der Realität zu stellen: Vater, der im Koma liegt, und Mama, die sich vermutlich an seinem Bett die Augen ausheult und sich fragt, wo ich bleibe. Mein schlechtes Gewissen nagt mir ein Loch in den Magen. Weil ich mich nicht zusammengerissen habe und bei ihr geblieben bin. Weil sie allein das Zimmer betreten musste, in dem Vater liegt.
Verdammt.
Ich kämpfe die Übelkeit nieder und muss mich fast zwingen, Leo loszulassen. Sanft schiebe ich sie von mir und begegne ihrem besorgten Blick. Der feuchte Schimmer in ihren grünen Augen macht mir mal wieder bewusst, wie stark sie ist. Sie repariert nicht nur Maschinen, sie ist ganz offensichtlich selbst eine. Anders kann ich mir nicht erklären, wie sie es schafft, die Tränen wegzublinzeln. Bei all den Erinnerungen, dem Schmerz, den dieses Krankenhaus in ihr auslösen muss.
«Geht’s wieder?», fragt sie.
Ich nicke. «Und bei dir?»
Sie nickt.
Beinahe synchron erheben wir uns von der Bank und gehen zur Tür. Als ich warte, um ihr den Vortritt zu lassen, zögert sie einen kurzen Moment. Ich höre, dass sie Luft holt. Wie um sich zu wappnen, bevor wir wieder das Krankenhaus betreten. Ohne darüber nachzudenken, greifen meine Finger nach ihren. Und Leo zögert keine Sekunde, meine Hand zu nehmen, die sie auf dem Weg zur Intensivstation kein einziges Mal loslässt.
Als wir eine Aufzugfahrt später an dem Zimmer ankommen, in dem mein Vater liegt, öffnet sich die Tür. Mama kommt heraus. Mit hängenden Schultern und eingefallenen Wangen. Das Gesicht zerfurcht von Falten, die bei meinem Besuch vor zwei Monaten noch nicht da waren. Ihre blauen Augen sind rot unterlaufen. Hoffnung, aber auch Angst schimmert in ihrem Blick. Angst, die sich automatisch auf mich überträgt und meine Muskeln schon wieder starr werden lässt. Meine Beine fühlen sich wie Zementblöcke an. Aber ich zwinge mich weiterzugehen, lasse Leos Hand los, um Mama in den Arm zu nehmen. Ich gebe ihr ein Kuss aufs Haar, bevor ich mich wieder von ihr löse.
«Alles wird gut», wiederhole ich Leos Worte, auch um mir selbst etwas Mut zu machen. «Er schafft das.» Aber nur zehn Sekunden später, im Krankenzimmer meines Vaters, fällt alle Zuversicht in sich zusammen.
«Nicht länger als fünf Minuten», hat der Nachtpfleger zu uns gesagt. Keine Ahnung, ob ich den Anblick meines Vaters auch nur für dreißig Sekunden ertrage. Sein Kopf ist bandagiert, und sein Gesicht sieht aus, als wäre er verprügelt worden. Voller Blutergüsse. Seine Lider sind so zugeschwollen, dass er die Augen vermutlich selbst dann nicht aufbekommen würde, wenn er bei vollem Bewusstsein wäre. Ein Schlauch, der seitlich aus seinem Mund ragt, verbindet ihn mit einer Beatmungsmaschine. Aus einer Art Drainage läuft Wundsekret, das sich in einem Beutel sammelt.
Tief Luft holend, gehe ich weiter. Trete näher ans Bett, das mir für seinen fast zwei Meter großen Körper viel zu klein vorkommt. Ich bleibe stehen und sehe jetzt erst, dass sein rechter Arm von mehreren Metallstäben eines Drahtgestells durchbohrt wird. Seine Knochen müssen komplett zertrümmert worden sein.
«Oh Teddy …»
Dass Leo mit mir gekommen ist, habe ich ganz vergessen. Sie schüttelt mit einer Hand vor dem Mund den Kopf. Bis auf die vielen rotbraunen Sommersprossen scheint alle Farbe aus ihrem Gesicht gewichen zu sein. Selbst ihre Lippen wirken blutleer. Sie sieht aus, als würde sie jeden Moment umkippen. Aber vielleicht suche ich auch nur nach einem Vorwand, um hier rauszukommen, um mir nicht mal wieder wie der mieseste Sohn auf Erden vorzukommen, weil ich die verbleibenden zwei oder drei Minuten Besuchszeit nicht ausreizen will. Nicht ausreizen kann.
«Lass uns gehen», sage ich, aber Leo rührt sich nicht.
Sie wirkt wie erstarrt.
Ich bin mir nicht mal sicher, ob meine Worte zu ihr durchgedrungen sind. Wenn es in ihren Ohren nur halb so laut rauscht wie in meinen, wird sie mich nicht gehört haben. Ich lege meine Hand an ihren Rücken und spüre, dass sie zittert.
«Hey … Lass uns wieder zu meiner Mama.»
Ich übe leichten Druck aus, lege den Arm um ihre Taille, weil ich das Gefühl habe, sie stützen zu müssen. Sie wehrt sich nicht, setzt beinahe mechanisch einen Fuß vor den anderen, als ich sie nach draußen führe.
Und wir meinen Vater allein zurücklassen.
3Leona
Es ist zwei Uhr morgens, als ich vor meinem Elternhaus aus dem Taxi steige. Ich habe mir die Fahrt mit Aaron und seiner Mama geteilt. Eigentlich hätten die beiden schon vier Hausnummern vor mir aussteigen müssen, aber sie bestanden darauf, mich zuerst absetzen zu lassen, und ich hatte keine Kraft zu widersprechen. Die vergangenen sechs Stunden haben mich emotional so ausgelaugt, dass sich mein Körper ganz taub anfühlt. Taub vor Schmerz und Angst. Aber auch Müdigkeit. Vermutlich werde ich trotzdem die restliche Nacht wach liegen, weil mich die Bilder von Teddy verfolgen werden. Ein Teil von mir wünscht sich, dass ich das Zimmer niemals betreten hätte.
Ich verabschiede mich von Aaron und Lydia. Morgen Vormittag treffen wir uns wieder im Krankenhaus. Was bereits in wenigen Stunden ist. Vielleicht reicht die Zeit für ein Wunder, und Teddy wacht bis dahin von ganz allein aus dem Koma auf.
Die Scheinwerfer des Taxis leuchten mir die wenigen Meter zum Hauseingang. Meine Beine setzen sich in Bewegung. An der Tür angekommen, suche ich in meinem Shopper nach meinen Schlüsseln und finde sie auf Anhieb. Dank des großen Maulringschlüssels, den ich vor Jahren mal aus Teddys Werkzeugkasten gemopst und als Schlüsselanhänger umfunktioniert habe. Seitdem hat das ewig lange Herumwühlen in meiner Tasche ein Ende. Klimpernd hole ich die Schlüssel hervor. Und damit auch Erinnerungen von Teddy und mir beim Schrauben. Manchmal bis spät in die Nacht hinein. Wird es solche Tage je wieder geben?
Ich versuche positiv zu denken, aber die Angst ist stärker. Meine Finger fangen an zu zittern. So sehr, dass ich gefühlt hundert Jahre brauche, um den Schlüssel ins Schloss zu bekommen. Ich öffne die Tür genauso leise, wie ich sie hinter mir wieder zuziehe. Das Licht im Flur lasse ich aus, um Mama nicht zu wecken. Ich hatte ihr aus dem Krankenhaus geschrieben, dass Teddys OP gut verlaufen ist und dass ich ihr morgen früh alles erzähle. Damit sie nicht die ganze Nacht auf mich wartet, aber auch weil mir nicht nach Reden zumute ist. Selbst Lissa und Calla wissen noch nichts von Teddys Unfall. So ganz begreife ich es ja selbst noch nicht. Ich war dabei, einen Kuchen für ihn zu backen. Wir wollten seinen Geburtstag feiern. Stattdessen wird er an seinem Geburtstag nicht mal wach sein.
Er liegt im Koma.
Weil er einen Unfall hatte.
Wie Papa damals.
Ich kann die Schluchzer nicht mehr zurückhalten, sinke mitten im Flur zu Boden und presse die Hand fest gegen meinen Mund, um nicht zu laut zu sein.
Vergeblich.
Das vertraute Quietschen der Schlafzimmertür zerreißt die Stille der Nacht. Über mir sind Schritte zu hören.
«Leona!? Bist du das?» Mamas besorgte Stimme dringt von der Treppe aus in den Flur.
Ich nehme die Hände runter, um zu antworten, aber Tränen schnüren mir die Kehle zu. Der Kloß in meinem Hals versperrt sämtlichen Worten den Weg aus meinem Mund.
Mamas Schritte kommen näher, werden schneller und lauter. Sie eilt die Stufen runter. «O Gott. Leona!» Fast wäre sie über mich drüber gestolpert. «Was machst du denn da unten am Boden? Bist du gefallen?»
«Tut mir … l-eid, i-ch wollte dich nicht … wecken», entschuldige ich mich unter Tränen, die nun ungehindert über meine Wangen laufen.
«Du weinst ja. Ist was mit Teddy?» Sie klingt besorgt und hockt sich zu mir auf den Parkettboden.
«Er … liegt im Koma, Mama.»
«A-Aber ich dachte, die OP wäre gut verlaufen. Gab es Komplikationen?»
Mein Versuch, die Worte der Ärztin wiederzugeben, scheitert daran, dass mich meine eigenen Schluchzer immer wieder unterbrechen. Meine Atmung ist hektisch und jeder Satz abgehackt. Ich fange an zu zittern.
Mama schließt die Arme um mich. So fest, dass sich die Beben, die meinen Körper erschüttern, auf ihren übertragen. Ich weine inzwischen hemmungslos. Kein Autopilot der Welt könnte das jetzt noch verhindern.
«Ich hab Angst, dass … dass er es nicht schafft», bringe ich irgendwann hervor. Meine Worte werden von Mamas Morgenmantel gedämpft. Der flauschige Stoff fühlt sich unter meiner Wange ganz feucht an.
Meine Mutter streicht mir übers Haar und sagt dann «Komm». Sie bugsiert mich ins Bett, und tatsächlich schlafe ich fast sofort ein. Aber es ist ein unruhiger Schlaf, bei dem mich Albträume ständig hochschrecken lassen. Und jedes Mal habe ich die Hoffnung, dass die letzten Stunden einfach nur ein weiterer schrecklicher Albtraum waren.
Aber als Mama und ich nur wenige Stunden später ins Krankenhaus fahren, rammt die schmerzhafte Realität wieder ihre Klauen in meine Brust. Teddys Zustand ist unverändert. Was eigentlich etwas Gutes ist, da es keine Verschlechterung gibt. Eine Verbesserung jedoch auch nicht, wie die behandelnde Ärztin Lydia und Aaron nun mitteilt, während Mama und ich etwas abseitsstehen. Aber nah genug, um die Unterhaltung zu verfolgen. «Unser Ziel ist es natürlich, die Sedierung Ihres Mannes – also, das künstliche Koma – so kurz wie möglich zu halten. Aber wir können die Aufwachphase erst dann einleiten, wenn die Akutphase überstanden ist.»
«Akutphase?», fragt Lydia, Aarons Hand haltend.
«Das bezeichnet den Zeitraum vom Eintreten des Ereignisses – in diesem Fall des Schädel-Hirn-Traumas – bis zum Ausschließen schwerer Komplikationen. Aber die Vitalfunktionen, wie zum Beispiel Herzfrequenz, Blutdruck und die Sauerstoffversorgung, sind stabil, das ist ein gutes Zeichen», erklärt die Ärztin, bevor sie sich verabschiedet und ins nächste Zimmer verschwindet. Es ist gerade Visite. Wir hatten Glück, sie abzufangen, nachdem sie bei Teddy war. Leider hat sie uns auch streng mitgeteilt, dass wir noch nicht zu ihm hineindürfen. Die offiziellen Besuchszeiten sind erst zwischen sechzehn und achtzehn Uhr. Wir haben gerade mal elf. Dass wir ihn gestern Nacht, kurz nach seiner OP, sehen durften, war eine Ausnahme. Lydias Bitte, eine weitere zu bekommen, hat die Ärztin freundlich, aber bestimmt abgewiesen.
«Lass uns nach Hause, Mama. Damit du dich etwas hinlegen kannst. Wir kommen heute Nachmittag wieder», schlägt Aaron, der zu Recht besorgt klingt, vor. Denn die Erschöpfung ist Lydia deutlich anzusehen. Sie hat dunkle, beinahe schwarze Schatten unter den Augen, die bis zu den Wangenknochen reichen. Und das sonst so strahlend klare Blau ihrer Iris wirkt trübe und matt. Aber auch Aaron sieht total fertig aus. Darüber kann sein akkurat frisierter Half Bun und das knitterfreie Hemd mit dem obligatorischen Stehkragen nicht hinwegtäuschen.
«Ich bleibe hier», antwortet Lydia. Trotz und Verzweiflung schwingen in ihrem Widerspruch mit; sie sieht sich um, wirkt dabei etwas verloren. «Kann man sich hier denn nirgendwo hinsetzen?»
«Wir stehen hier mitten im Gang. Und der ist kein Wartebereich, Mama. Außerdem bist du schon über achtundvierzig Stunden wach. Du hast weder getrunken noch gegessen. Du solltest dich wirklich ein bisschen stärken und ausruhen. Wir kommen zur Besuchszeit wieder, okay?»
«Und wenn er wach wird und niemand da ist? Heute ist sein Geburtstag. Da kann ich ihn doch nicht allein lassen.»
Lydias Worte, das Zittern in ihrer Stimme brechen mir fast das Herz. Weil ich weiß, dass Teddy nicht plötzlich wie von Zauberhand wach werden wird. Und weil das Leben so verdammt unfair ist. Niemand sollte an seinem Geburtstag im Koma liegen.
«Wenn ich schon nichts tun kann, dann … dann will ich wenigstens in seiner Nähe sein.»
«Niemandem ist geholfen, wenn du hier zusammenbrichst, Mama. Bitte. Bitte lass mich dich nach Hause fahren.» Aarons Stimme ist genauso flehend wie der Ausdruck, mit dem er Lydia zu beschwören versucht. «Nur für ein oder zwei Stunden.»
In Lydias Blick ist ein zögerliches Nachgeben erkennbar. «Aber … wer bleibt dann so lange hier?»
«Ich», platzt es aus mir heraus. Trotz der Beklemmung, die allein das Wort Krankenhaus bei mir auslöst, kann ich nicht anders, als meine Hilfe anzubieten. Ich würde es nicht ertragen, wenn Lydia tatsächlich zusammenbricht und wir uns auch noch um ihre Gesundheit sorgen müssen.
Aaron wirft mir einen dankbaren Blick zu, aber Mama legt Einspruch ein.
«Nein, Leo. Du fährst mit Lydia und Aaron nach Hause. Ihr braucht nämlich alle etwas Schlaf. Ich bleibe so lange im Krankenhaus und rufe an, falls es Neuigkeiten gibt.»
«Musst du denn nicht ins Hotel?», fragt Lydia.
«Das kommt für ein paar Stunden auch mal ohne mich aus.» Mama drückt Lydias Hand, womit die Entscheidung getroffen ist.
Aaron bedankt sich mit einem Nicken. Ich nehme Mama in den Arm und frage nur für sie hörbar: «Bist du sicher? Oder soll ich mit dir hierbleiben?»
«Du gehst dich schön ausruhen», flüstert sie. Ich bilde mir ein, so was wie Unbehagen in ihren Worten zu hören. Womöglich ist das aber auch nur mein schlechtes Gewissen, sie an diesem Ort allein zu lassen. Mit all den schmerzhaften Erinnerungen an Papas Tod, die dieses Krankenhaus mit sich bringt. Ich weiß, dass sie das hauptsächlich Lydia zu Liebe macht. Sie sind so was wie Freundinnen in der Not. Immer füreinander da, wenn es hart auf hart kommt. So wie ich und Aaron, schießt es mir durch den Kopf. Nicht zum ersten Mal frage ich mich, ob wir es diesmal schaffen werden, auch darüber hinaus – wenn es Teddy wieder besser geht und hoffentlich Normalität eingekehrt ist – nett zueinander zu sein. Wobei ich mich liebend gern für den Rest meines Lebens mit Aaron streite, wenn dafür Teddy morgen wieder wach wäre.
Bevor wir das Krankenhaus verlassen, bittet Lydia eine Pflegekraft, meine Mama zu Teddy zu lassen, falls er aufwachen sollte, bevor sie wieder zurück ist. Die junge, groß gewachsene Frau sieht Lydia mitleidig an. Der Ausdruck in ihren Augen lässt nicht gerade darauf hoffen, dass dieser Fall eintreten wird. Aber sie ist empathisch genug, Lydia nicht die Hoffnung zu rauben.
«Ich mache einen Vermerk, damit auch meine Kolleginnen und Kollegen Bescheid wissen.»
Kurze Zeit später versuche ich auszublenden, dass wir in Teddys Auto sitzen. Aaron fährt, während ich auf der Rückbank eine Nachricht an Calla und Lissa schreibe, um sie wissen zu lassen, was passiert ist. Es dauert keine Minute, bis mir beide antworten.
O Gott, Leo! Das tut mir so so so leid. Soll ich kommen?, schreibt Lissa.
Calla reagiert nicht minder betroffen und bietet ebenfalls an, sich sofort in einen Zug nach Lüneburg zu setzen. Obwohl klar war, dass meine Freundinnen alles stehen und liegen lassen würden, um für mich da zu sein, brennen schon wieder Tränen hinter meinen Augen. Vor Rührung und Dankbarkeit. Ich muss ein paar Mal blinzeln, um das Handydisplay zu erkennen und eine Antwort eintippen zu können.
Ich hab euch so lieb ♥! Aber das ist wirklich nicht nötig. Ich bin ja nicht alleine hier und wir fahren später wieder ins Krankenhaus.
Bist du sicher?, erscheint es gleich doppelt auf meinem Handy.
Ja, ganz sicher. Ich komme klar.
Wie um mich selbst davon überzeugen zu müssen, straffe ich die Schultern und hole ganz tief Luft. Aber die Enge in meiner Brust bleibt.
Bitte melde dich, wenn du reden willst, okay? Und halte uns über Teddys Zustand auf dem Laufenden. Fühl dich ganz fest gedrückt, ja? ♥ Ich hoffe so sehr, dass alles gut wird.
Das hoffe ich auch, schreibt Calla. Ich schicke dir, Aaron und Lydia ganz viel Kraft, Leo! Und vergiss nicht: Wir sind sofort da, wenn du uns brauchst. ♥
Schniefend nicke ich, als könnten meine Freundinnen mich jetzt sehen. Wenn dem so wäre, säßen sie wahrscheinlich innerhalb der nächsten sechzig Minuten im Zug nach Lüneburg. Das Einzige, was sie davon abhält, ist meine Bitte, nicht zu kommen. Aber sie sind beide mitten im Lernstress, und ich will sie nicht noch zusätzlich belasten. Insbesondere Lissa, die durch den Unfalltod ihrer Mama auch über zehn Jahre später immer noch unter Panikattacken leidet. Das Letzte, was ich möchte, ist, sie zu triggern. Und Calla versucht, nach über einem Jahr Studienpause und einer unfassbar schweren Zeit in den USA wieder an ihr Studium anzuknüpfen. Außerdem hätte ich gerne etwas Zeit für mich allein. In Teddys Werkstatt mit Papas Motorrad und ein paar Autos, an denen ich rumschrauben kann. Also antworte ich meinen Freundinnen, dass sie sich keine Sorgen zu machen brauchen und dass ich mich melde. Ich schicke noch drei Herzen hinterher, bevor ich Aaron bitte, einen kurzen Umweg zu fahren und mich an der Werkstatt rauszulassen.
«Ich werde sowieso nicht schlafen können», erkläre ich Aaron, der mir über den Rückspiegel einen skeptischen Blick zuwirft.
Vermutlich weil es der Ort ist, an dem der Unfall passiert ist. Aber aus genau diesem Grund möchte ich da hin. Ich will sehen, wo es passiert ist, um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte.
«Bist du sicher?», fragt Aaron.
Ich nicke. «Könntet ihr mich auf dem Weg ins Krankenhaus wieder einsammeln?»
«Willst du denn so lange bleiben?»
«Ja.» Aktuell ist das sogar der einzige Ort, an dem ich sein kann, ohne mich nutzlos zu fühlen. An einem von Teddys Oldtimern zu schrauben, hatte schon immer etwas Heilsames. Weil ich dabei die Zeit vergesse – und damit vielleicht auch, dass Teddy im Koma liegt.
4Aaron
Ich konnte Mama überreden, eine halbe Portion Rührei zu essen und einen Kamillentee zu trinken. Die beruhigende Wirkung der Kamille lässt nicht lange auf sich warten. Mama hat sich kaum aufs Sofa gesetzt, da werden ihre Augenlider schwer. Wobei das weniger am Tee als an der Müdigkeit liegen dürfte. Ich sitze ihr gegenüber auf dem Fernsehsessel, beobachte, wie sich ihre Lider in immer kürzeren Abständen senken und schließlich geschlossen bleiben.
Ich warte ein paar Minuten ab. Horche. Bis ihr Atem schwer und ruhig geworden ist. Als ich sicher bin, dass sie fest schläft, erhebe ich mich vom Sessel, nehme die Tagesdecke von der Sofalehne und breite sie über ihrem Schoß aus. Dann schnappe ich mir eins der Sofakissen, aber bevor ich ihren Kopf anheben kann, lässt mich ein gewaltiger Knall zusammenzucken. Gefolgt von einem Prasseln. Ich hebe den Blick zur Fensterfront und sehe, dass es regnet. Die Sonne ist fort. Vertrieben von grauen Sturmwolken, die gerade von einem hellen Blitz durchzuckt werden, bevor die Luft erneut explodiert. Mama rührt sich nicht, gibt keinen Ton von sich. Auch nicht, als ich ihren Kopf auf das Kissen bette. Wie sie bei dem Krach weiterschlafen kann, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, ist mir ein Rätsel. Wobei … wenn man bedenkt, wie lange sie auf den Beinen war. Es bestätigt nur, wie dringend sie den Schlaf braucht. Mir geht es ähnlich. Gefühlt könnte ich auf der Stelle einpennen. Aber als ich wieder sitze und die Augen schließe, sehe ich Vater vor mir. In diesem Bett liegend. Mit all den Schläuchen und diesem Gestell, das seinen Arm durchbohrt.
Ich schüttle den Kopf, bis das Bild verschwindet, nur um mich schon wieder mit der Frage zu quälen, wie lange es wohl dauern wird, bis er wieder wach wird. Ob überhaupt. Und wie seine Chancen stehen, dann wieder komplett gesund zu werden. Auf der Suche nach Antworten, die uns vorhin nicht mal der Arzt geben konnte, pule ich mein Handy aus der Hosentasche meiner Chino und fange an, im Internet zu recherchieren:
Künstliches Koma
Künstliches Koma wie lange
Künstliches Koma Risiken
Künstliches Koma nach Schädel-Hirn-Trauma
Aufwachen nach künstlichem Koma
Wie ein Schwamm sauge ich alles auf, was ich zu diesen Suchbegriffen finde. Texte. Blogbeiträge. Zeitungsartikel. Von Fachleuten, aber auch Betroffenen. Bilder und Videos. Wobei ich mich bewusst auf das Negative konzentriere. Um für sämtliche Worst-Case-Szenarien gewappnet zu sein. Passend zur Weltuntergangsstimmung, die draußen herrscht. Obwohl ich kein abergläubischer Mensch bin, nährt das Gewitter mein schlechtes Gefühl. Ich spüre schon wieder diesen Druck im Magen, der sich in Übelkeit zu verwandeln droht, und stehe auf. Ich laufe im Wohnzimmer umher. Auf und ab. Wie ein Getriebener. Als könnte ich der Realität dadurch irgendwie entkommen. Ich brauche Ablenkung, muss irgendwas tun, mich beschäftigen. Egal womit. Ich greife nach der Fernbedienung, als mein Handy vibriert. Mein Herzschlag verdoppelt sich, weil mir sofort der Gedanke durch den Kopf schießt, dass das Krankenhaus anruft, um uns das Schlimmste mitzuteilen. Ich halte den Atem an und stoße ihn geräuschvoll wieder aus, als ich den Namen «Mo» auf meinem Display lese.
Mohamed ist einer von Vaters Mechanikern und in meinem Alter. Als ich noch zu Hause gewohnt habe, sind wir öfter zusammen feiern gewesen. Da war er noch in der Ausbildung. Inzwischen haben wir kaum noch Kontakt. Vermutlich ruft er nur an, weil er sich nach Vater erkundigen will. Nicht gerade die Art von Ablenkung, die ich gerne hätte.
Ich gehe aus dem Wohnzimmer und hebe auf dem Weg in die Küche ab.
«Hey, Mo.»
«Aaron, bist du zufällig in der Nähe?»
Ich runzele die Stirn, weil das nicht die Begrüßung ist, mit der ich gerechnet habe. «Ähm … In der Nähe wovon?»
«Der Werkstatt.» Er klingt gehetzt.
«Ja, ich bin bei meinen Eltern. Warum?»
«Kannst du kommen? Ich weiß, du hast gerade echt andere Sorgen mit Theos Unfall. Aber ich wusste nicht, ob ich dich oder einen Krankenwagen rufen sollte.»
Mich oder einen Krankenwagen? Wieso …
Leo! Sie ist in der Werkstatt!
Ich reiße die Augen auf. «Was ist los?»
«Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber mit Leona stimmt was nicht.»
Mein Herz fängt an zu hämmern.
«Ich hab sie zusammengekauert im Büro unter Theos Schreibtisch gefunden. Sie redet nicht, zittert am ganzen Körper. Und hält sich die Ohren zu.»
«Wieso hält sie sich die Ohren zu?»
«Keine Ahnung.»
«Ist sie ansonsten okay … Ich meine körperlich?»
«Ja, ihr scheint nichts zu fehlen. Soweit ich das beurteilen kann. Glaub, Theos Unfall hat sie ziemlich mitgenommen. Hier ist auch der … Fleck. Den hat sie vermutlich gesehen, und das hat ihr den Rest gegeben.»
«Welcher Fleck?»
«Von … Theos Blut. Als er eingeklemmt war.»
Mein Magen verknotet sich. Ich schlucke.
«Sie scheint unter Schock zu stehen, Aaron.»
Vorhin wirkte Leo, genau wie gestern Nacht, so gefasst. Sie hat sogar angeboten, im Krankenhaus zu bleiben. Ich hätte sie trotzdem lieber nach Hause anstatt an den Ort des Unfalls fahren sollen. Zumindest ist die Werkstatt der letzte Platz, an dem ich jetzt sein möchte.
«Okay. Bin sofort da», sage ich – ohne zu wissen, wie und ob ich Leo überhaupt helfen kann. Sollte ich lieber ihrer Mutter Bescheid geben? Aber vom Krankenhaus bis nach Kreideberg sind es fünfzehn Minuten. Ich hingegen brauche höchstens fünf.
«Behalt sie bitte so lange im Auge, okay?»
«Alles klar. Ich warte, bis du da bist.»
Wir legen auf, und ich eile ins Wohnzimmer, wo Mama noch immer schläft. Ich beschließe, sie nicht aufzuwecken, und schreibe ihr eine Notiz.
Bin kurz in der Werkstatt, aber spätestens um drei wieder da. Ruf mich an, wenn was ist. Bis gleich.
Aaron
Dass es Leo nicht gut geht, behalte ich bewusst für mich. Ich will nicht, dass Mama sich auch noch um sie Sorgen macht.
Den Zettel lege ich auf den Beistelltisch und beschwere ihn mit dem Kuli. Als könnte er vom Wind, der draußen tobt, weggeweht werden. Ich kontrolliere vorsichtshalber, ob alle Fenster und die Tür zum Garten geschlossen sind. Mir ist eigentlich nicht wohl dabei, Mama allein zu lassen – aber hierzubleiben nach dem, was Mo erzählt hat, fühlt sich noch beschissener an. Also nehme ich meinen Anorak vom Garderobenhaken, ziehe die Kapuze über meinen Kopf und laufe durch den Regen zu Vaters BMW.
Unbehagen breitet sich in meinem Körper aus. Ich spüre, wie es meine Muskeln versteifen lässt, und muss mich zwingen, nicht langsamer zu fahren oder gar anzuhalten, als ich von Weitem die Werkstatt erblicke. Den Ort, an dem ich mich nie wohlgefühlt habe. Nie gut genug. Nie geschickt genug. Im Gegensatz zu Leo. Meine Abneigung gegen diesen Ort ist durch Vaters Unfall nur verstärkt worden. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal hier war.
Ich fahre auf den fast leeren Vorhof. In meiner Erinnerung parkten hier immer bis zu zehn Autos, die auf eine Reparatur, einen Reifenwechsel oder Sonstiges warteten. Aktuell sind nicht mal ein Drittel der Kundenparkplätze belegt, was vermutlich daran liegt, dass heute Samstag ist. Denn Vaters Unfall kann sich so schnell nicht rumgesprochen haben, oder?
Weil es noch immer wie aus Eimern schüttet, parke ich das Auto direkt vor dem Eingang. Das Rolltor öffnet sich, und Mo rudert übertrieben mit den Armen, als hätte er Angst, von mir übersehen zu werden. Ich steige schnell aus, eile drei Schritte durch den Regen. Im Vorbeigehen begrüße ich Mo per Handschlag und betrete den containerartigen Raum. Der Geruch von Motorenöl, Reifengummi und Metall liegt schwer in der Luft. Ich rümpfe die Nase.
«Geht es Leo …» wieder besser, wollte ich fragen, aber die letzten beiden Worte bleiben mir im Hals stecken, als mein Blick die Hebebühne streift. Ich gehe langsamer, entdecke den Fleck auf dem Boden. Rostbraun. In der Größe eines Fußballs. Stammt das Blut aus seinem Arm? Dem Kopf? Wie lange hat er dort gelegen, bevor man ihn fand?
«Leo hockt noch immer unter Theos Tisch.» Mos Antwort auf meine halbe Frage verhindert, dass ich erstarre.
Ich folge ihm. In den hinteren Bereich. Ins Büro, wo Leo sich unter dem Schreibtisch zusammengerollt hat, die Beine an die Brust gezogen, die Handflächen an die Ohren gepresst. Genauso wie Mo es beschrieben hat. Aber eines hat er nicht erwähnt: die Tränen, die über ihre Wangen laufen, ohne dass sie auch nur einen Ton von sich gibt.
Warum ist sie nicht einfach gegangen, wenn hier zu sein zu viel für sie ist? Wieso musste sie sich ausgerechnet in Vaters Büro unter seinem Schreibtisch verkriechen? Aber was auch immer ihre Gründe waren. Keiner davon spielt jetzt wirklich eine Rolle. Die viel wichtigeren Fragen sind: Wie kann ich ihr helfen? Was soll ich tun? Und die Antwort darauf lautet: keine Ahnung.
Also folge ich meinem Instinkt, hocke mich vor sie.
Hinter mir sind Mos Schritte zu hören. «Ich lass euch dann allein, okay?»
Ich nicke nur knapp. Meine Aufmerksamkeit gilt voll und ganz Leo.
«Hey. Was machst du denn hier unten?»
Keine Antwort. Wie auch, wenn sie sich die Ohren zuhält.
Ich suche ihren Blick. Aber sie sieht mich nicht mal richtig an … eher durch mich hindurch. In ihren Augen schwimmt ein Ausdruck, als wäre sie ganz woanders. Da sie nicht vor mir zurückgewichen ist, setze ich mich neben sie auf den Boden. Mit meiner Hand nähere ich mich ihr langsam, lege sie tröstend auf ihr Knie und warte … Darauf, dass sie sich wieder beruhigt oder mir eine Idee kommt, was ich sonst tun könnte.
Und so sitze ich still da, während Leo weint.
5Aaron
So unauffällig wie möglich schiele ich auf mein Handgelenk. Ich will Leo nicht das Gefühl geben, es eilig zu haben, wenn ich die Uhrzeit checke. Wobei ich nicht mal sicher bin, ob sie es überhaupt mitbekommen würde. Erst nach über einer Stunde hat sie aufgehört zu weinen. Dafür ist sie jetzt – eine weitere Stunde später – total verschwitzt. Ihre angezogenen Beine verdecken zwar ihr Oberteil, aber wenn ich über den hellen Stoff streichen würde, wäre er vermutlich genauso feucht wie ihr Haar. Strähnen haften an ihrer Wange und ihrem Hals, um den – wie immer – eine feine Kette liegt. Aus Silber, mit einem kleinen Motorradanhänger. Diese Kette hat sie schon seit Ewigkeiten. Ich kann mich nicht erinnern, Leo schon mal ohne sie gesehen zu haben. Zumindest als wir uns noch täglich über den Weg gelaufen sind. Dass ich das so genau weiß, überrascht mich gerade selbst ein bisschen. Da ich eigentlich immer versucht habe, sie zu ignorieren. Die Betonung liegt wohl auf «versucht». Wirklich gelungen ist mir das nie. Schon gar nicht, wenn es ihr schlecht ging. Woran, als wir Kinder waren, nicht selten ich schuld war.
Aber so wie heute habe ich sie noch nie erlebt. Dermaßen unter Schock. Doch er scheint abzuklingen. Sie nimmt die Hände von den Ohren und umklammert jetzt stattdessen ihre Beine. Wenn ich mit ihr reden würde, könnte sie mich nun zumindest hören. Damit werde ich aber noch ein paar Minuten warten. In der Hoffnung, dass sie den Anfang macht. So beschämt, wie sie meinem noch immer besorgten Blick ausweicht und auf ihre Knie starrt, scheint ihr die Situation ziemlich unangenehm zu sein. Also versuche ich geduldig zu sein, um ihr zu vermitteln, dass es dafür keinen Grund gibt.
Allerdings … ich habe Mama geschrieben, dass ich um drei wieder da bin. Dazu müsste ich in einer Viertelstunde losfahren. Und um vier ist Besuchszeit im Krankenhaus.
Als Leo nach zehn Minuten immer noch nichts gesagt hat, wage ich mich vorsichtig vor. «Wie fühlst du dich? Geht’s wieder?»
Sie nickt.
«Okay.» Abwartend sehe ich sie an, aber es bleibt beim Nicken. Keine Erklärung, was die letzten zwei Stunden mit ihr los war. Leo macht nicht gerade den Eindruck, als wollte sie darüber reden. Also hake ich nicht nach. Schlucke alle Fragen, die mir auf der Zunge liegen, runter und stelle lediglich eine: «Brauchst du irgendwas? Etwas zu trinken oder so?»
Ich rechne wieder mit einem Nicken oder Kopfschütteln. Stattdessen räuspert sie sich und antwortet mit einem heiseren «Ja, Wasser. Bitte».
Ich richte mich auf und gehe in die kleine Kaffeeküche nebenan. Es ist mehr eine Nische als ein Raum. Gerade groß genug für einen Tisch, auf dem ein Kaffeeautomat und eine Mikrowelle stehen, ein kleiner Kühlschrank befindet sich darunter. Ich entdecke auch eine Metalldose mit Süßigkeiten. Inklusive einer Rolle Smarties. Früher hat Leo sich von diesen Dingern ernährt. Ich weiß noch, wie ich, nur um sie zu ärgern, einmal eine komplette Großpackung verdrückt habe, die Vater ihr aus dem Großmarkt mitgebracht hatte. Danach hatte ich die übelsten Bauchkrämpfe und Durchfall. Im Nachhinein war es wohl die gerechte Strafe.
Ich nehme die Smarties, hole eine kleine Wasserflasche aus dem Kühlschrank und kehre zu Leo zurück.
«Schau mal, was ich gefunden habe», sage ich und schüttle die Papprolle.
Das Klackern lässt Leo aufsehen, als ich ihr gegenüber wieder auf dem Boden Platz nehme.
«Smarties.» Für den Bruchteil einer Sekunde huscht so was wie Freude über ihr Gesicht. Aber vielleicht ist das auch nur Einbildung. Weil ich sie gerne aufheitern würde, aber keine Ahnung habe, wie.
«Ja, die magst du doch noch, oder?» Beides – die Flasche und die Süßigkeit – lege ich zwischen uns auf den Boden.
Dass sie zuerst nach den Smarties greift und sie futtert, als wäre sie auf Entzug gewesen, lasse ich unkommentiert. Ebenso das leichte Zittern ihrer Hand, während sie aus der Flasche trinkt. Halb leer stellt Leo sie neben sich. Dann atmet sie mehrmals tief durch, als hätte sie eine Weile nicht ausreichend Luft bekommen.
«Was ist los?» Diesmal geht es nicht anders, ich muss sie das fragen. Zumal man echt kein Psychologe sein muss, um zu erkennen, dass sie so was wie eine Panikattacke hatte. Die Frage ist nur, warum?
«Das … ist nicht so leicht zu erklären. Aber es geht schon wieder.»
«Soll ich dich nach Hause fahren?»
«Ich … würde lieber noch ein bisschen hierbleiben.»
«Unterm Tisch? Auf dem harten Boden?» Ich kann meine Verwunderung nicht verbergen und ziehe die Augenbrauen hoch. Weil mir ihr Verhalten gerade hundert Rätsel aufgibt.
Leo antwortet nicht und umklammert schon wieder ihre Beine. Beinahe verängstigt sieht sie mich an. Als wäre ich der böse Wolf, der sie aus ihrem sicheren Bau locken will.
«Ich weiß, wie gerne du dich hier aufhältst Leo, aber …» Kurz halte ich inne, um so viel Verständnis wie möglich in meine Stimme zu legen. «Vielleicht ist die Werkstatt aktuell nicht der richtige Ort für dich. Zumindest machst du nicht den Eindruck, als würdest du dich wohlfühlen.»
«Es liegt nicht an der Werkstatt», gesteht sie und schlägt seufzend die Augen nieder.
«Sondern?», hake ich vorsichtig nach.