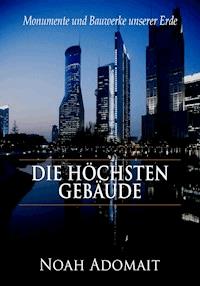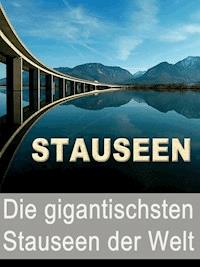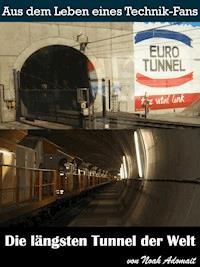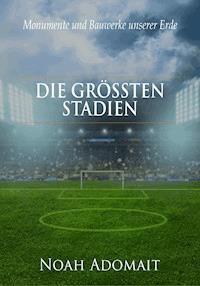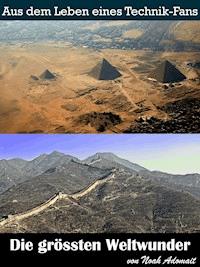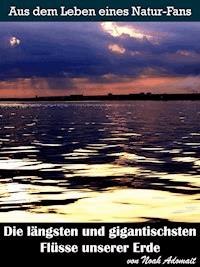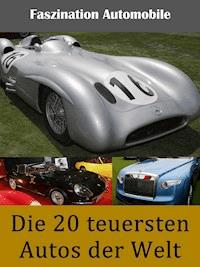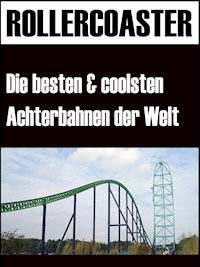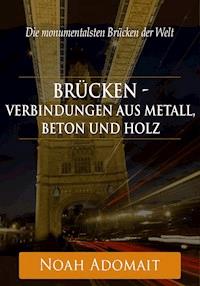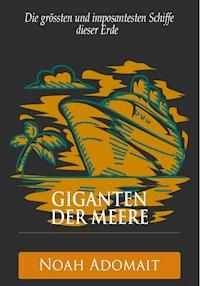
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Sehnsucht nach der See ist sprichwörtlich. So auch oft bei mir. Ich möchte Sie in diesem Buch einladen mit uns die Geschichte der Seefahrt bis zu den Megaschiffen der Neuzeit zu erleben. Sie werden die größten Schiffe der Welt kennen lernen und lesen was diese ausmacht: - Die größten Segelschiffe der Welt - Die größten Holzschiffe der Welt - Die größten Motoryachten der Welt - Die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Noah Adomait
Giganten der Meere - Die grössten und imposantesten Schiffe dieser Erde
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Ahoi – Ein Vorwort
Vorher - Grundlagen
Die 15 größten Segelschiffe der Welt
Die größten Holzschiffe der Welt
Die größten Motoryachten der Welt
Die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt
Rechtlicher Hinweis
Impressum neobooks
Ahoi – Ein Vorwort
Die Sehnsucht nach der See ist sprichwörtlich. So auch oft bei mir. Ich möchte Sie in diesem Buch einladen mit uns die Geschichte der Seefahrt bis zu den Megaschiffen der Neuzeit zu erleben.
Sie werden die größten Schiffe der Welt kennen lernen und lesen was diese ausmacht.
Und nun wünsche ich Ihnen viel Spass bei der Lektüre
Vorher - Grundlagen
Bevor wir uns den Giganten zuwenden hier einige Erklärungen und Informationen vorab:
Was ist eigentlich ein Schiff?
Ein Schiff ist ein größeres Wasserfahrzeug, das nach dem archimedischen Prinzip schwimmt. Vom Floß unterscheidet sich ein Schiff durch den eigenen Antrieb, vom Boot in erster Linie durch seine Größe.
Der Aufbau eines Schiffes
Der Bug ist das Vorderteil des Schiffsrumpfes.
Der Bugwulst zur Verbesserung der Strömungseigenschaften senkt den Treibstoffverbrauch.
Der Anker dient dem Halt des Schiffes im Wasser, wenn es nicht fährt.
Die Backbordseite ist die linke Seite des Schiffes (nachts rotes Licht).
Der Propeller, auch Schiffschraube genannt, dient dem Antrieb des Schiffes.
Das Heck bezeichnet den hinteren (achteren) Teil des Schiffes.
Der Schornstein ist für die Abgase des Schiffsmotors notwendig.
Die Aufbauten bezeichnen alle Aufbauten oberhalb des Oberdecks.
Das Oberdeck ist das Deck, das den Rumpf nach oben abschließt.
Die Steuerbordseite ist die rechte Seite des Schiffes (nachts grünes Licht).
So hat alles angefangen:
Vor mindestens 50.000 Jahren (vgl. Die Besiedlung Australiens über Südasien) ist der moderne Mensch (Homo sapiens) nach Australien eingewandert. Dank niedrigerem Meeresspiegel gab es damals zwar kürzere Seewege von Asien nach Australien als heute, über dem Timorgraben mussten aber mindestens 100 km Ozean überquert werden. Dafür waren hochseetaugliche Wasserfahrzeuge nötig. Doch bleibt der Nachweis indirekt, da man bisher weder fossile Hinweise auf Schiffe noch Darstellungen aus dieser Zeit kennt.
Die ältesten fossilen Nachweise von Wasserfahrzeugen sind Einbaum- und Paddelfunde (Duvensee) in Nordeuropa, die bis ca. 7500 v. Chr. zurückdatiert werden können. Der älteste Nachweis eines Segels ist eine Felszeichnung in der Nubischen Wüste, die ca. um 5000 v. Chr. entstand. Bis ca. 3500 v. Chr. reichen Modelle aus Ägypten zurück.
Von den Ägyptern sind die ältesten größeren Schiffe direkt belegt. Sie wurden vermutlich vorwiegend für den Binnenverkehr auf dem Nil gebaut, später auch für den Seekrieg (Darstellungen von Kriegsschiffen mit Rammsporn und hochgezogenem Achtersteven auf der Insel Syros, 2800 v. Chr.) und für den Fernhandel (Pharao Sahu-Re sandte um 2500 v. Chr. Schiffe nach Syrien, Somalia und Ostafrika).
Ebenfalls aus Ägypten stammt der älteste erhaltene Schiffsfund (Cheops-Bestattungsschiff, 2650 v. Chr.), der von einer bereits ausgereiften Schiffbaukunst zeugt. Das Schiff hatte keinen Kiel und wurde mit Hilfe längs gespannter Taue in Form gehalten. Die Planken aus importiertem libanesischen Zedernholz waren ebenfalls mit Tauen vernäht.
Ein Schiffsfund in Jang-Shao (China) beweist, dass die Chinesen um etwa 2000 v. Chr. ebenfalls Schiffe bauen konnten und auch Querschotts schon bekannt waren.
Die 15 größten Segelschiffe der Welt
Schiffsname: France II
Seehöhe in Meter: 146
Breite in Meter: 17
Verdrängung in Tonnen: 10.710
Bruttoregistertonnen: 5.633
Segelfläche in Quadratmeter: 6.350
Baujahr(e): 1911-1922
Takelage: Fünfmastbark, (Aux.)
Schiffsname: R. C. Rickmers
Seehöhe in Meter: 146
Breite in Meter: 16,3
Verdrängung in Tonnen: 10.500
Bruttoregistertonnen: 5.548
Segelfläche in Quadratmeter: 6.045
Baujahr(e): 1906-1917
Takelage: Fünfmastbark, Aux.
Schiffsname: Thomas W. Lawson
Seehöhe in Meter: 144
Breite in Meter: 15
Verdrängung in Tonnen: 10.860
Bruttoregistertonnen: 5.218
Segelfläche in Quadratmeter: 4.330
Baujahr(e): 1902-1908
Takelage: Siebenmastgaffelschoner
Schiffsname: Preußen
Seehöhe in Meter: 147
Breite in Meter: 16.4
Verdrängung in Tonnen: 11.150
Bruttoregistertonnen: 5.081
Segelfläche in Quadratmeter: 6.806
Baujahr(e): 1902-1910
Takelage: Fünfmastvollschiff
Schiffsname: Royal Clipper
Seehöhe in Meter: 132,2
Breite in Meter: 16
Verdrängung in Tonnen: ~8.000
Bruttoregistertonnen: 5.000
Segelfläche in Quadratmeter: 5.000
Baujahr(e): 2000-
Takelage: Fünfmastvollschiff, Aux.
Schiffsname: Potosi
Seehöhe in Meter: 133
Breite in Meter: 15
Verdrängung in Tonnen: 8.580
Bruttoregistertonnen: 4.026
Segelfläche in Quadratmeter: 5.250
Baujahr(e): 1895-1925
Takelage: Fünfmastbark
Schiffsname: København
Seehöhe in Meter: 131,9
Breite in Meter: 15
Verdrängung in Tonnen: 7.900
Bruttoregistertonnen: 3.901
Segelfläche in Quadratmeter: 4.644
Baujahr(e): 1921-1928
Takelage: Fünfmastbark
Schiffsname: Maria Rickmers
Seehöhe in Meter: 135
Breite in Meter: 14.6
Verdrängung in Tonnen: 8.900
Bruttoregistertonnen: 3.822
Segelfläche in Quadratmeter: 5.300
Baujahr(e): 1891-1892
Takelage: Fünfmastbark
Schiffsname: France I
Seehöhe in Meter: 133
Breite in Meter: 14,8
Verdrängung in Tonnen: 7.800
Bruttoregistertonnen: 3.784
Segelfläche in Quadratmeter: 4.550
Baujahr(e): 1890-1901
Takelage: Fünfmastbark
Schiffsname: Wyoming
Seehöhe in Meter: 137
Breite in Meter: 15
Verdrängung in Tonnen: 8.000
Bruttoregistertonnen: 3.731
Segelfläche in Quadratmeter: 3.700
Baujahr(e): 1909-1924
Takelage: Sechsmastgaffelschoner
Schiffsname: Sedow
Seehöhe in Meter: 117,5
Breite in Meter: 14,6
Verdrängung in Tonnen: 6.148
Bruttoregistertonnen: 3.556
Segelfläche in Quadratmeter: 4.192
Baujahr(e): 1921
Takelage: Viermastbark
Schiffsname: Great Republic
Seehöhe in Meter: 121
Breite in Meter: 16.2
Verdrängung in Tonnen: 5.400
Bruttoregistertonnen: 3.356/4.555
Segelfläche in Quadratmeter: 5.400/6.500
Baujahr(e): 1853-1872
Takelage: Viermastbark (Klipper)
Schiffsname: Star Clipper
Seehöhe in Meter: 115,5
Breite in Meter: 15
Bruttoregistertonnen: 2298
Segelfläche in Quadratmeter: 3365
Baujahr(e): 1991
Takelage: Viermastbarkentine
Schiffsname: Krusenstern
Seehöhe in Meter: 114,5
Breite in Meter: 14,4
Verdrängung in Tonnen: 6.400
Bruttoregistertonnen: 3.141
Segelfläche in Quadratmeter: 3.900
Baujahr(e): 1926
Takelage: Viermastbark
Schiffsname: Pamir
Seehöhe in Meter: 114,5
Breite in Meter: 14
Verdrängung in Tonnen: 6.350
Bruttoregistertonnen: 3.020
Segelfläche in Quadratmeter: 3.800
Baujahr(e): 1905-1957
Takelage: Viermastbar
Beschreibung der France II
Die französische stählerne Bark France war der größte je gebaute Windjammer. Weiterhin war sie nach der France I der zweite Großsegler dieses Namens und wird daher auch als France II bezeichnet.
Geschichte
Die France wurde 1911 bei „Chantiers et Ateliers de la Gironde“ in Bordeaux für die Reederei „Société Anonyme des Navires Mixtes“ (Prentout–Leblond, Leroux et Compagnie) aus Rouen gebaut. Der Schiffbauingenieur Gustave Leverne entwarf sie nach den speziellen Wünschen des Reeders Henri Victor Prentout-Leblond (1850–1915). Sie wird als sein persönliches Meisterwerk betrachtet. Nach ihrem Stapellauf am 9. November 1911 ging die Jungfernfahrt unter ihrem Kapitän Victor Lagniel im Januar 1912 nach Thio, Neukaledonien. Danach war sie noch zweimal in der Nickelerzfahrt zwischen Europa und Neukaledonien eingesetzt. Daraufhin transportierte sie Kohle nach und Wolle, Stückgut und Kistenöl aus Australien, Nord- und Südamerika (Rio de Janeiro, Montevideo). Sie galt als schnelles Schiff, so erreichte sie 1913 Neu-Kaledonien von Glasgow kommend mit einer Ladung Kohle in 92 Tagen, die Rückreise dauerte 102 Tage. Nach Prentout-Leblands Tod kam die große Bark im November 1916 zur Compagnie Française de Marine et de Commerce (Französische Seefahrt- und Handelsgesellschaft), ebenfalls in Rouen ansässig. Zum Eigenschutz wurde sie dann während des Ersten Weltkrieges mit einem bzw. zwei 90-mm-Geschützen ausgestattet. Am 21. Februar 1917 verließ sie im Auftrag ihrer neuen Eigner Glasgow für eine Kohlenfahrt nach Montevideo. Auf dieser Reise wurde sie am 27. Februar im Rahmen des U-Boot-Krieges von einem deutschen U-Boot angegriffen, konnte aber bei Einbruch der Dunkelheit entkommen. Während der letzten beiden Kriegsjahre segelte die France zwischen Nordamerika, Australien, Neu-Kaledonien und Afrika, um dann ab 1919 wieder europäische Häfen wie Bordeaux und Le Havre) anzulaufen. Sie transportierte auf diesen Reisen verschiedene Güter wie Getreide, Rohleder, Kaffee, Rohöl, Mahagoniholz, Erdnüsse und wiederum Nickel. Im September 1921 lieferte sie auf einer Reise von Wellington nach London die größte Warenladung aus, die jemals auf einem Segelschiff Neuseeland verließ. Sie umfasste 11.000 Ballen Wolle und 6.000 Fässer Talg.
Strandung
In der Nacht zum 12. Juli 1922 befand sich das Schiff auf der der Fahrt nach Pouembout als sie durch die Dünung auf das Ouano-Riff, ungefähr 43 Seemeilen nordwestlich von Nouméa vor der Provinz La Foa auf Position 21° 48' 30? S, 165° 38' 48? O auflief. Die Australian Salvage Company schickte zunächst einen Bergeschlepper zur Bergung, dieses Vorhaben wurde aber aufgrund der verfallenen Frachtraten verworfen. Letztendlich wurde der Havarist im Dezember 1922 an ein örtliches Abwrackunternehmen zum Ausschlachten verkauft. Bis 1944 lag sie als bekannte Landmarke auf dem Riff, wurde dann aber von amerikanischen Bombern als Übungsziel genutzt und zerstört. Die Reste des verrosteten Wracks sind noch heute zu sehen.
Technische Beschreibung
Das stählerne 5.633 BRT große Schiff war als Dreiinselschiff konzipiert; der verwendete Stahl war im Siemens-Martin-Verfahren hergestellt worden. Durch ihre auffällige Deckslinie war sie gut zu erkennen. Diese zeichnete sich durch eine 34,5 Meter lange Back, gefolgt durch eine 35,36 Meter lange Mittschiffinsel mit Kommandobrücke und abgeschlossen von der 43,2 m langen Poop aus. Die Inseln ließen zwei kurze Bereiche des Decks offen, in denen je eine der Großluken eingelassen war. Alle Decks waren mit Laufbrücken verbunden. Zunächst war sie in der besonders durch die französische Großreederei Antoine-Dominique Bordes & Fils bevorzugten Farbgebung mit grauem Rumpf und schwarz-weißem klassischem Portenband bemalt. Dies führt auch häufig dazu, dass das Schiff dieser Reederei zugeschrieben wird. Später war der Rumpf einfarbig gehalten, entweder in grau oder schwarz. Auf Poop und Mittschiffsdeck waren je zwei Rettungsboote für je circa 15 Personen untergebracht. Am Heck stand ein separates Ruderhaus. Bei ihrer Galionsfigur handelte es sich um die Marianne als Allegorie auf Frankreich. Für Passagiere waren sieben Kajüten sowie ein luxuriös mit Ledersesseln, Sofas, Holzmöbeln und Teppich ausgestatteter holzgetäfelter Salon mit Flügel und Bücherei vorhanden. Eine Besonderheit war eine Dunkelkammer und ein Seewassertherapieanlage. Die France erhielt zunächst zwei Schneider Dieselaggregate, die ihre zwei Propeller antrieben, diese wurden jedoch 1919 entfernt. Dadurch verbesserten sich die Segeleigenschaften des Schiffes deutlich. Sie führte ein Jubiläumsrigg.
Beschreibung der R. C. Rickmers
Die R. C. Rickmers war die zweite deutsche Fünfmastbark und der fünfte Fünfmastrahsegler der Welthandelsflotte. Ebenso wie ihr Schwesterschiff Maria Rickmers war sie im Gegensatz zu den vor ihr gebauten Fünfmastern mit einer Dampfmaschine als Hilfsantrieb (Auxiliar-Segler) ausgerüstet. Nach zwei hölzernen Vollschiffen – 1.080 BRT (1868) und 1.760 BRT (1888) – war sie das dritte Schiff dieses Namens, unter dem auch heute ein modernes Frachtschiff fährt. Nach den Havarien der Preußen und der Thomas W. Lawson 1907 war sie bis zum Stapellauf der France II 1911 das größte Segelschiff der Welt. 1914 wurde sie als Kriegsbeute beschlagnahmt und in Neath umbenannt.
Beschreibung
Im Jahre 1906 wurde die R. C. Rickmers für die Rickmers Reismühlen Rhederei und Schiffbau A.-G. (Firmenname seit 1889) auf der hauseigenen Werft in Geestemünde unter der Baunummer 147 gefertigt. Ihr Rumpf, Masten und Rahen waren aus Stahl gefertigt. Benannt nach dem Firmengründer Rickmer Clasen Rickmers (1807–1886) sollte sie die auf der Jungfernfahrt verschollene Maria Rickmers ersetzen. Wie alle Rickmers-Schiffe war der Schiffskörper entsprechend der Firmentradition in den Reedereifarben grün (Überwasserschiff) und rot (Wasserpass, Unterwasserschiff) gestrichen. Nach einigen Marineautoren galt sie als Prestigebau und Antwort auf die beiden F. Laeisz-Fünfmaster Potosi und Preußen. Als sie vom Stapel lief, übertraf sie mit ihren 5.548 BRT sogar das damals größte Rahsegelschiff, das Fünfmast-Vollschiff Preußen, um 467 BRT, wurde aber wegen der Hilfsmaschine nie als Deutschlands größtes Segelschiff eingetragen. Einige Seeleute nannten sie wegen ihrer Dampfmaschine und des gewaltigen Schornsteins hinter dem Mittelmasten eher einen „Segeldampfer“ denn ein Segelschiff. Ihre maximale Ladekapazität von 7.900 tons und damit die Wirtschaftlichkeit war durch die 600 t Kohlebunker reduziert. Das große Schiff machte etliche Furore, besonders in den USA, und zeigte aufgrund von Linienführung und Rigg gute Etmale, die allerdings unter Zuhilfenahme der Dampfmaschine entstanden. Nach dem Umbau zum Segelschulschiff besaß die große Bark ein überlanges Poopdeck bis zum Mittelmast. Das riesige Schiff benötigte eine besonders geschulte Mannschaft, da nicht alle Seeleute und Kapitäne einen Fünfmastrahsegler zu führen verstanden. Das zeigte sich später im Krieg bei der Übernahme der Bark durch die Briten, die den internierten Kapitän baten, die Schiffsführung (speziell die Segelkommandos) zu erklären, da man in England keine Erfahrung mit Fünfmastrahseglern hatte.
Geschichte
Hauptfahrziele der Bark waren Ostasien (Singapur, Kobe/Hiogo Japan, Saigon – Jungfernreise), Sibirien (Wladiwostok), die amerikanische Westküste (San Francisco, Portland in Oregon), Australien (New South Wales) und Südamerika (Chile). Ausreisend beförderte das Schiff meist Kohle aus Wales und anderen Ländern, heimreisend hauptsächlich Reis für die firmeneigenen Reismühlen. 1912 und 1913 machte sie zwei große Reisen:
Cardiff – Philadelphia – Kap der guten Hoffnung – Kobe (Japan) – Portland (Oregon) – Antwerpen
Cardiff – Philadelphia – Kap der guten Hoffnung – Japan – Wladiwostok – Indischer Ozean – Hull
Ein besonderes Ereignis war 1912 der Besuch des russischen Zaren Nikolaus II. auf dem Schiff während des Aufenthaltes in Wladiwostok.
Wegen des laderaumverringernden Kohlebunkers (rund 600 t), des für die Wartung der Dampfmaschine zusätzlichen Personals (2 Maschinisten, 2 Trimmer, 2 Heizer) und des anfallenden Kohleverbrauchs war die R. C. Rickmers nicht wirtschaftlich. Bei der Umstellung der Rickmers-Linie auf Dampf zwischen 1910 und 1913 stieß die Reederei alle Großsegler ab. Für die große Bark fand sich kein Käufer, weshalb sie 1913/1914 auf der eigenen Werft zum reedereieigenen Schulschiff zur Ausbildung des Seeoffiziersnachwuchses umgebaut wurde. Bei Beginn des Ersten Weltkriegs lag die große Bark in Cardiff zur Übernahme einer Kohlenladung; die britische Admiralität beschlagnahmte sie und taufte sie in Neathzum, nach einem Orts- und Flussnamen in Süd-Wales; walisisch Nedd [n??]. Die britische Schiffsmannschaft hatte wegen fehlender Erfahrung mit diesem Schiffstyp Probleme mit der Führung des riesigen Seglers. Unter englischer Flagge wurde sie am 27. März 1917 – mit einer Ladung Zucker von Mauritius kommend – 30 Seemeilen südöstlich von Fastnet (Irland) vom Unterseeboot U 66 der Kaiserlichen Deutschen Kriegsmarine versenkt.
Beschreibung der Thomas W. Lawson
Die Thomas W. Lawson war der einzige Siebenmastschoner der Welthandelsflotte, dazu das größte je gebaute Segelschiff ohne Hilfsantrieb, der größte je gebaute Schoner und der einzige Siebenmaster überhaupt in neuer Zeit. Er war einer von wenigen Stahlbauten der späten Segelschiffszeit in den Vereinigten Staaten.
Das im selben Jahr vom Stapel gelaufene Fünfmastvollschiff Preußen war der größte reine Rahsegler und das zweitgrößte je gebaute Segelschiff ohne jeglichen Hilfsantrieb. Größer waren die Auxiliar-Fünfmastbarken R. C. Rickmers (1906) und die 1911 in Betrieb genommene France, die nach Ausbau ihrer Motoren 1919 auch zum größten Segelschiff wurde.
Die Thomas W. Lawson sollte für seinen Reeder große Kohlemengen für die Bay State Gas Co. heranschaffen, deren Präsident der Namensgeber des Schiffes war. Wegen der nicht ausnutzbaren Vollbeladung von 11.000 tn.l. wurde er 1903 nach Abtakeln der Stengen als Schleppkahn mit Notbesegelung für Kistenöl verchartert. Nach dem Umbau zum Segeltankschiff 1906 sollte sie auch Transatlantikfahrten unternehmen, scheiterte aber bereits vor Ende ihrer ersten Atlantikreise in den frühen Morgenstunden des 14. Dezember 1907 vor den Scilly-Inseln in einem Sturm, was 17 der 19 Mann an Bord das Leben kostete. Die bei diesem Unglück entstandene Ölpest ist eine der ersten, wenn nicht sogar die erste der Seefahrtsgeschichte.
Historisches Umfeld
Die Zeit der „großen Schoner“ begann am 14. August 1900, als in Camden im US-Bundesstaat Maine der erste Sechsmastgaffelschoner aus Holz, die George W. Wells, bei Holly M. Bean vom Stapel lief. Acht Sechsmaster aus Holz und einer aus Stahl sollten folgen, als letzter die 1909 bei Percy & Small in Bath (Maine) vom Stapel gelaufene Wyoming, das mit 137 m Lüa (108 m Rumpflänge) längste je gebaute Holzschiff.
Der Superlativ
Die Thomas W. Lawson war einer von nur drei in den Vereinigten Staaten gebauten Großschonern aus Stahl. Sie und ihr Werftschwesterschiff, der Sechsmastschoner William L. Douglas (Baunr. 113; Stapellauf: 25. August, Jungfernfahrt: 11. November 1903, 3.708 BRT), wurden auf den Helligen der Fore River Ship & Engine Building Co. in Quincy (Massachusetts) für die in Boston (Massachusetts) ansässige Coastwise Transportation Co. (John G. Crowley) gebaut. Konstrukteur war der für seine schnellen Jachten bekannte Schiffbauer Bowdoin Bradlee Crowninshield (1867–1948). Namensgeber Thomas William Lawson hatte das Schiff besichtigt, war aus unbekannten Gründen aber beim Stapellauf nicht anwesend. Helen Watson, die Tochter des Werftgründers Thomas A. Watson, taufte das Schiff vor über zwanzigtausend Zuschauern.
Der Schoner war ein Glattdecker mit zwei durchgehenden Decks sowie erhöhter Poop und Back, dazu hohem Freibord. Deckaufbauten standen auf dem Poopdeck - das große Deckshaus mit Kapitänsunterkunft (drei Räume mit höchstem Komfort - Edelhölzmöbeln, Ledersitzgarnitur, elektrischem Licht, Telefon etc.), Kartenhaus, Offiziermesse und ein separates Ruderhaus, weiterhin auf dem achteren Teil des Hauptdecks um den 5. und hinter dem 6. Mast. Auf der Back, der Unterkunft der Seeleute, stand ein großes Spill und die sturmfesten Positionslampen. Alle bewohnten und wichtigen Räume, selbst die einfachen Unterkünfte für die max. 12 Seemann starke Mannschaft vor dem Mast, hatten Dampfheizung.
Aus Stahl waren die sieben (gleich hohen) Untermasten, die sieben Gaffelbäume, die Maststengen, Gaffeln und alle weiteren Spieren aus Holz (Seidenkiefer). An Deck waren 14 Mastwinden - an jedem Mast zwei - stationiert, dazu zwei schwere Dampfwinden unter der Back und hinter Mast Nr. 6. Die Mastwinden waren elektrisch betrieben und wurden durch Generatoren versorgt, die auch den Strom für das elektrische Licht und den drahtlosen Telegraphen erzeugten und von einer zentralen Dampfmaschine im Achterschiff (Deckshaus an Mast Nr. 6 mit waagerechter Dampfabführung auf dem Dach) betrieben wurden. Diese unterstützte auch das Dampfruder.
Die obersten Decks waren mit Teakholz gedeckt, die unteren mit Kiefer. In das Hauptdeck waren sechs Großluken eingelassen, über die maximal 11.000 tons geladen werden konnten. Da der vom Konstrukteur vorgesehene Tiefgang von mehr als zehn Metern die damaligen Wassertiefen der Ostküstenhäfen, ausgenommen Newport News (Virginia), überschritt, musste die ursprünglich vorgesehene Ladekapazität meist um rund ein Drittel auf ca. 7.500 tons verringert werden, was einen schweren Einschnitt in die erhoffte Wirtschaftlichkeit bedeutete.
Der anfänglich hell gestrichene Schiffsrumpf (zunächst mit grünem, dann mit rotem Wasserpass) wurde später, wie andere seiner Zeit, schwarz gemalt. Am Heck hing die Kapitänsgig an zwei Davits, ein weiteres typisches Konstruktionsmerkmal amerikanischer Segler dieser Zeit. Dazu gab es ein weiteres Rettungsboot und ein Rettungsfloß an Deck.
Benannt wurde das Schiff wie viele andere nach einer damals berühmten Person, nämlich nach dem Millionär, Börsenmakler, Fachbuchautor und damaligen Präsidenten der Bay State Gas Co. in Delaware, Thomas William Lawson (1857–1925).
Die Schiffsbesatzung betrug höchstens 18 Mann (Kapitän, 2 Steuerleute (1. & 2. Maat (Offizier)), Maschinist für die Dampfanlage für Ruder, Generator und Dampfwinden zum Heißen der Segel und Lasten, Steward mit Kabinenjunge und nie mehr als 12 Seeleute vor dem Mast).
Im Gegensatz zu den europäischen Fünfmast-Rahseglern vergleichbarer Größe war die Thomas W. Lawson nach dem Urteil mancher Seeleute und Marineautoren wegen der hohen Fülligkeit des Rumpfes und der dafür zu geringen Segelfläche ein sehr schwer zu navigierendes und wenig schönes Schiff (es gab Vergleiche mit „Badewanne“ und „gestrandetem Wal“). Sie soll „vor Topp und Takel“, also ohne gesetzte Segel, bei achterlichem Sturm rund 13 kn gemacht haben, was auch nötig gewesen sei, um nicht aus dem Ruder zu laufen. Segelmanöver wurden oft auf den Wachwechsel verschoben, da die riesige Segelfläche besonders der Großsegel die kleine Mannschaft extrem forderte.
Den erhofften wirtschaftlichen Gewinn fuhr das Schiff nicht ein, da es selten ausgelastet war. Als einzigartiges seiner Art und dazu imposantes Schiff machte es dennoch Geschichte.
Geschichte