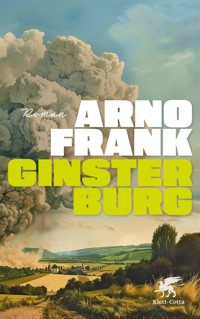
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der große Roman von Arno Frank über Menschlichkeit in unmenschlichen Zeiten Nach der Machtergreifung ist in Ginsterburg ein neuer Alltag eingekehrt. Manche Einwohner der kleinen Stadt leiden, andere profitieren – und die meisten versuchen, sich mit der neuen Ordnung zu arrangieren. Allmählich aber öffnet sich unter dem Alltag der Abgrund. Ein feinfühliger und atmosphärischer Roman über Liebe, Familie, Freundschaft – und persönliche Verstrickungen in den Jahren 1935 bis 1945. Lothar träumt vom Fliegen. Eben noch ein kleiner Junge, kann seine Mutter Merle nur ohnmächtig zusehen, wie sein Traum von der Freiheit ihren Sohn in die Arme der Hitlerjugend treibt. Eine neue Zeit ist angebrochen. So sehr Merle ihr auch misstraut, kann sie ihr doch nicht entkommen – nicht in ihrer Buchhandlung, nicht in den Gesprächen mit Eugen, dem Feuilletonisten der Lokalzeitung von Ginsterburg. Doch während die einen verstummen und einige sich langsam korrumpieren lassen, verstehen andere es, die neue Machtverteilung zu ihren Gunsten zu nutzen. Blumenhändler Gürckel schwingt sich zum Kreisleiter auf, Fabrikant Jungheinrich macht beste Geschäfte, und auch der Arzt Hansemann wittert völlig neue Möglichkeiten. Im Lichtspielhaus spielt weiter Heinz Rühmann, über den Nürburgring schießen Runde für Runde die Silberpfeile. Doch der Krieg, an fernen Fronten geschlagen, ist bald auch im Mikrokosmos der Stadt zu spüren, in den erschütterten Beziehungen und Seelen der Menschen. Und über allem schwebt ein britischer Bomberpilot, der sich dem einstmals beschaulichen Ginsterburg unaufhaltsam nähert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Arno Frank
Ginsterburg
Roman
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2025 Arno Frank
Für diese Ausgabe
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und
Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Cover: © Anzinger und Rasp Kommunikation GmbH, München unter Verwendung einer KI-generierten Abbildung (Midjourney)
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-96648-0
E-Book ISBN 978-3-608-12397-5
Inhalt
1935
I
Zola Vovoni verliert den Verstand
II
Wenn du den Angriff beginnst
III
Stell dir vor, die Silberpfeile
IV
Jugend muss wagen
1940
I
Gargouille
,
Gargoyle
, Gurgler
II
Der Abend wechselt langsam die Gewänder
III
Kleine Stadt will schlafen geh’n
IV
Glanz und Gloria
1945
I
Opfer müssen gebracht werden
II
Wir haben hier keine bleibende Stadt
III
Der blaue Fuchs
IV
Und finster plötzlich wird der Himmel
Und finster plötzlich wird der Himmel
Und über dem Theater hin
Sieht man in schwärzlichtem Gewimmel
Ein Kranichheer vorüberziehn.
Schiller
Jetzt hat es sie erwischt.
Ein zartes Zittern ist durch den Rumpf gelaufen. Mehr nicht. Hinten in seiner Kuppel hat Alfie es kaum gespürt. Dann aber sind sie über die rechte Tragfläche aus dem Verband gekippt. Und da wusste er, dass es sie erwischt hat. Aus seinem Luftraum jedenfalls kam das nicht, den hält er sauber. Auf dieser Mission hat Alfie bisher keinen Schuss abgeben müssen. Keine Nachtjäger, im Visier seiner beiden Zwillingsmaschinengewehre nur Dunkelheit. Seit Antwerpen hatte er einen Teil der anderen Maschinen schön im Blick gehabt. Die ganze Flotte in versetztem Flug, ihr Auf und Ab im Mondlicht, ein schwankender Schwarm disziplinierter Hornissen.
Jetzt nicht mehr.
Jetzt ist ihre Lancaster nach rechts gekippt, und Alfie sieht nur noch das Dunkelblau des Himmels. Leuchtspur spritzt durch die Nacht. Das Flugzeug zieht einen schwarzen Schweif aus fettigem Rauch hinter sich her. Aber es fängt sich, schwenkt wieder nach links. Gutes Zeichen.
Alfie presst die Kopfhörer gegen den Schädel. Verwirrtes Geschrei. Sein eigener Atem in kurzen Stößen. Über die Intercom ein Fiepen, hochfrequent wie Holz beim Verbrennen. Mehr ist von der vertrauten Stimme des Skippers nicht übrig. Eine andere Stimme, das muss Barry sein: »Heilige Scheiße!«
So außer sich hat Alfie ihren Bombenschützen noch nie gehört.
Was zum Teufel ist da vorne los?
Alfie spürt, dass der Schwenk nach links kein Ende nimmt. Und wie sich ihm die Hoden zusammenziehen.
Sie schmieren ab. Sie schmieren tatsächlich ab.
Sind schon auf dem Weg nach unten.
So fühlt sich das also an, wenn es passiert.
Helium im Magen.
Stecknadeln im Trommelfell.
.
.
.
Raus. Jetzt.
Finger, taub von Kälte, nesteln an Verschlüssen. Füße stemmen sich gegen den Kabinenboden. Ja, so geht es. Kaum hat er sich von den Gurten befreit, schlägt sein Kopf gegen das Plexiglas der Kuppel. Die Maschine muss ins Trudeln geraten sein. Trudeln ist schlecht.
Raus?
Um an seinen Fallschirm zu kommen, muss Alfie die Luke hinter seinem Rücken öffnen. Es ist der Zugang zum Tunnel, durch den er vor wenigen Stunden in seine Stellung geklettert ist. Kurz vor ihrem Start am Morgen hatte der Skipper noch seinen üblichen Witz gemacht. Über Bordfunk, damit auch alle darüber lachen konnten.
Bist du unserer Lady auch schön tief in den Arsch gekrochen, Alfie?
Die Kuppel des Heckschützen einer Avro Lancaster ist der tödlichste Ort überhaupt in diesem Krieg. Die Kuppel des Heckschützen einer Avro Lancaster ist zu eng für einen Fallschirm. Deshalb liegt er griffbereit gleich hinter ihm im Tunnel. Alfie öffnet die Luke.
Hitze schlägt ihm entgegen, verbrennt seine Augenbrauen. Mit beiden Händen greift er in die Flammen, ertastet ein Bündel, bekommt es zu fassen, zerrt es hervor. Das Bündel brennt. Hastig verriegelt Alfie wieder die Luke zum Ofen, in den sich das Flugzeug verwandelt hat.
Er zerrt den Fallschirm auf seinen Schoß, versucht, das Feuer zwischen Oberschenkeln und Oberkörper zu ersticken. Gibt auf und schnallt sich das Bündel um, wie es ist, schwelend. Mit verbrannten Fingern tastet er nach dem Hebel für den Schwenkmechanismus. Ein Handgriff, den er in der Ausbildung wieder und wieder und wieder trainiert hat. Um einhundertachtzig Grad muss er die Kuppel gedreht bekommen. Erst dann ist die rückwärtige Aussparung im Plexiglas groß genug, dass der Heckschütze seitlich zur Flugrichtung aussteigen kann. Vorausgesetzt, auf dem System ist noch genug Druck.
Wenn die Hydraulik etwas abbekommen hat, ist er gefangen.
Wenn die Hydraulik funktioniert, ist er frei.
Alfie atmet ein und zieht bis zum Anschlag. Öl spritzt ihm ins Gesicht. Folgsam dreht sich die Kuppel. Das Öl fängt Feuer. Er wischt es weg. Die Öffnung zur Luke ist jetzt eine Öffnung ins Nichts. Alfie atmet aus.
Und lässt sich fallen.
.
.
.
.
.
.
Wie ruhig es plötzlich ist. Zwischen den Wolken. Fünf Meilen über Deutschland. Kein Heulen mehr, kein Dröhnen, Fauchen, Fiepen oder Fluchen. In seinen Ohren nur Wind.
Wieder wissen seine Hände, was zu tun ist. Greifen an die Sturmhaube. Die Brille ist weg, schon treibt ihm Wind die Tränen in die Augen. Verschwommen erkennt er den abstürzenden Bomber, brennender Güterzug auf einem vertikalen Nachbargleis, spürt seine Hitze. Die linke Tragfläche ist weg.
Jetzt sieht Alfie die Maschine nicht mehr. Jetzt sieht er den Vollmond.
Jetzt wieder die Maschine auf ihrem Weg nach unten, ihre Schleppe aus Licht. Jetzt den Mond. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder.
Alfie überschlägt sich. Ruhig, ruhig. Er breitet Arme und Beine aus, wie er es wieder und wieder und wieder trainiert hat. Nach einer Weile steht ruhig und voll der Mond, wo er stehen soll.
Und da steht ein Dreirad.
In einem Hausflur. Vier Meilen über Deutschland. Der Hausflur riecht nach Bohnerwachs. Dort liegt ein roter Ball in einer Dachrinne. Er liegt dort schon so lange, dass seine Farbe vom Regenwasser ganz ausgebleicht ist. Dort sitzt eine Möwe auf einem Pfahl. Wind zerzaust ihr Gefieder. Ruhig schaut sie in die Ferne. Dort werden Hüte geschwenkt. Es wippt ein weißer Federbusch. Jemand hebt ihn hoch. Er winkt und ruft über die Köpfe einer Menge hinweg. Lang lebe der König. Dort fällt Licht durch ein Fenster. Die Haut seiner Mutter ist weiß. Ihre Haare sind hochgesteckt. Sie bewegt die Lippen. Alfie versteht nicht, was sie sagt. Sie ist jung und hat noch alle ihre Zähne. Dort streicht eine Böe über ein weites Feld. Der Weizen wechselt in schnellem Umschlag immer wieder die Farben. Seine blonden Ähren wiegen sich in weichen Wellen. Erste Tropfen auf dem Feldweg. Mineralischer Duft erfüllt die Luft. Dort sitzt ein fremder Hund und will sein Brot. Ein Auge ist blau. Das andere ist braun. Butter und Erdbeermarmelade. Alfie schüttelt stumm den Kopf. Der fremde Hund versteht und geht. Da ist ein wütendes Prasseln auf den Heuschober, in dem er Unterschlupf gefunden hat vor dem Gewitter. Das Brot schmeckt köstlich. Alfie trinkt aus der Traufe. Dort beugt sich sein Vater über ihn. Das Gesicht schwarz von Kohle. Zähne weiß wie Schnee. Er lächelt. Alfie lächelt zurück. Das feuchte Tuch auf seiner Stirn lindert das Fieber. Er will etwas sagen, bekommt aber keinen Ton heraus. Daddy ist schon viel zu lange tot, denkt er …
… und wird sich seiner Lage wieder bewusst.
Seine Lage ist aussichtslos. Sie wird nicht lange währen. Er hat einmal gelesen und für ein Märchen gehalten, dass vor dem Tod sein Leben in Bildern vor dem inneren Auge vorbeizieht. Alfie mag Filme.
Also lässt er es laufen.
Drei Meilen über Deutschland.
1935
I
Zola Vovoni verliert den Verstand
Am Tag, als Zola Vovoni den Verstand verlor, waren die Kraniche zurückgekehrt. Früh am Morgen zeichneten sie ihr V an das Blau des Himmels über dem Heizkraftwerk. Über den Förderkränen am Binnenhafen schwenkte der Schwarm nordwärts und folgte dem silbrigen Pfad der Gleise in die Stadt. Hinweg über die Schindeln und Schornsteine und Blumenbeete der Vorstadtvillen. Hinweg über die Wellpappe und Fähnchen und Rhabarberbeete der Schrebergartensiedlung. Hinweg über spiegelnde Gewächshäuser, die Flachdächer des Schlachthofs und die Sägezahndächer der Papierfabrik. Ihr Erscheinen beunruhigte sogar die Krähen dort auf dem Hof. Sie unterbrachen ihr Gestocher in den gepressten Ballen aus feuchter Pappe, flogen schimpfend auf und empört davon. Hinter den Querriegeln der Mietskasernen, wo die Gleise in enger Kurve der gläsernen Doppelkuppel des Bahnhofs entgegenstrebten, orientierte der Schwarm sich schon am Fluss. Wer die Vögel entdeckte, hielt inne und freute sich an der zielstrebigen Heiterkeit ihrer unverhofften Erscheinung. Hände in die Hüften, Mütze in den Nacken. Sieh an, die Kraniche.
Auf der Kaiserstraße kam die elektrische Straßenbahn mitten auf der Kreuzung zum Stehen, weil der Fahrer einen Blick auf den Schwarm werfen wollte. Am Stadttor mit seinem Zwillingsturm liefen die Kinder ein paar Meter hinterher und versuchten, die Vögel mit Steinen zu treffen. Auf der alten Brücke über die Ginster hielt eine Dame sich erschrocken den Hut, so tief flogen die Tiere kurz vor ihrem Ziel, den verschlungenen Auen am Fuß des Wolfsbergs. Sie werden ihre Gründe gehabt haben. Immer haben die Gefiederten Gründe für alles, vom winzigsten Reflex bis zu Route und Zeit ihrer Wanderschaft. Trotzdem waren die Kraniche auffällig spät in diesem Jahr. Es war überhaupt nicht ihre Zeit.
•
Wo das Gelände des Sportfelds zum Fluss hin verwilderte, beendete Zola Vovoni gerade ihre Morgentoilette. Mit gerafften Röcken stand sie bis zu den Knöcheln im Wasser. War eben zum Pinkeln in die Hocke gegangen, als sie das Flügelflattern hörte. Ein Geräusch, als würden tausend Leinentücher ausgeschüttelt. Versonnen hob sie ihre mit Henna eingefärbte Linke und hielt sie gegen das Sonnenlicht. Der Schwarm war schon auf ihrer Höhe, da hob Zola einen Arm und schwenkte ihn in der Luft wie ein Schilfrohr im Wind, langsam und ruhig. Ein geheimer Gruß für Entfernungen, die sich nicht mehr in Metern messen lassen, geeignet, die Kluft zwischen zwei Gattungen zu überbrücken.
»Da seid ihr ja endlich«, flüsterte sie. »Habt ihr uns also wieder einmal eingeholt. Ich warte schon seit Tagen!«
Ein ermatteter Nachzügler flog so tief, dass seine herabhängenden Beine schon zarte Zeichen auf das Wasser malten. Zola blickte dem verspäteten Vogel hinterher, bis seine Kalligrafie flussabwärts verwischte und er selbst im Röhricht der Auen mit ihren verborgenen Teichen verschwand. Dann watete sie ans Ufer, setzte sich auf einen Stein, spreizte die Zehen und sah ihnen beim Trocknen zu. Manchmal fühlte Zola sich noch älter, als ihre geschundenen Füße aussahen. So alt, wie sie sich schon in jüngeren Jahren geschminkt hatte, um im flackernden Zwielicht der Öllampen in ihrem Zelt darzustellen, was sie heute war. Madame Vovoni, die Wahrsagerin.
Es hatte erst der Tanz auf dem Seil für Nándor Eötvös in Budapest und später die Wanderung durch Europa ihre Füße ermüden lassen – sie wusch sie täglich in kaltem Wasser. Es hatte das Lesen der Karten und Handflächen im Halbdunkel ihr Augenlicht getrübt – sie verlegte ständig ihre Lesebrille. Es hatte der Mistral in den Cevennen ihr Haar in Stroh verwandelt – sie färbte es mit einem Sud aus Kastanienblättern und Zwiebelschalen. Es hatten die Sonnen über Südfrankreich ihr die Haut verbrannt – sie bestrich die Leberflecken mit Süßholzextrakt. Es war die Kälte der Extremadura ihr in die Knochen gefahren – sie linderte das Rheuma mit einer Salbe aus Weihrauch und Brennnesseln. Es hatte schließlich der Landregen von Lothringen ihr ins Gemüt geregnet – und dagegen gab es kein Mittel.
•
Mit einem leisen »Pah!« entzündete sich das Gas. Schneller, als Merle ihre Hand zurückziehen konnte vor der blau aufblühenden Flammenkugel. Sei’s drum. Dann ging diese Runde eben an den Herd. Merle schüttelte das Streichholz aus und schnupperte an ihren Fingerknöcheln, bis sich der eigentümlich würzige Geruch versengter Härchen auf der Haut verflüchtigt hatte. Mit der anderen Hand stellte sie den Milchtopf auf das siegreiche Feuer und drehte es auf die niedrigste Stufe.
»Lolo? Raus aus den Federn! Lo! Lo!«
So rief sie ihren Lothar seit jeher, aber seit einer Weile machte es sie seltsam melancholisch. Lolo, wie kindisch das klingen konnte. Kein Wunder, dass er nicht mehr so genannt werden wollte. Sie musste es sich wohl abgewöhnen.
Durch das Fenster über dem Spülstein konnte sie unten auf dem Rasen den alten Smolka sehen. Wie er die aufgehängte Wäsche abschritt, entlang der Leine wie ein Offizier die vorderste Linie seiner Soldaten. Neuerdings bewegte der Nachbar bei seinen rätselhaften Beschäftigungen die Lippen. Lange dauert’s nicht mehr, dachte Merle, und er redet laut mit sich selbst. Oder seinen frisch gewaschenen Gespenstern. Und hoffentlich redet er dabei nichts Falsches. Sie hatte ihn gern, den Kauz. Mit der Kelle hob sie das Ei, von beiden Seiten angebraten, und ließ es auf den Teller gleiten. Vom Brotlaib schnitt sie eine Scheibe, genau wie Lolo es mochte. Nicht zu dick, nicht zu dünn.
»Lothar! Stunde schlägt!«
Aus dem Korb nahm sie einen Apfel und legte ihn gleich wieder zurück, zu schrumpelig. Griff nach seinem Nachbarapfel, prüfte auch den und zerteilte ihn auf der Anrichte. Schnitt das Gehäuse heraus und nahm mit dem Messer die Schale ab. Fürs Mittagessen würde sie bei Frau Schiller noch Gemüse besorgen müssen. Unter der Hitze im Töpfchen auf dem Gasherd stöhnte schon die Milch.
»Hallo? Braucht’s eine Vorladung für den Herrn?«
Mit streifenden Bewegungen trocknete Merle ihre Hände an der Schürze, Vorderseite, Rückseite. Warf einen strengen Blick auf die Uhr über der Tür, schwarze Zeiger, weiße Emaille. Im Rahmen darunter kam er dann endlich zum Vorschein, zum Frühstück.
»Keine Minute zu früh!«, sagte Merle.
»Morgen, Mama!«, sagte Lothar und schob sich auf einen der Küchenstühle, die Robert damals viel zu hoch gezimmert hatte. Erst seit ein paar Wochen, mit dreizehn Jahren und nach einem ersten Schuss in die Höhe, kam der Junge überhaupt mit den Füßen auf den Boden. Immerhin hatte er schon seine Schuhe angezogen.
»Die Milch läuft über, Mama!«
Mit einem »Huch!« nahm sie den Topf vom Herd und schenkte ihm ein.
»Honig?«
Er schüttelte den Kopf, sie fuhr ihm durchs schwarze Haar. Ihm hatte die Natur einen Scheitel gezogen, ganz gegen ihre Art, ungewöhnlich akkurat. Seine Muskeln an den Schläfen beim Kauen. Immer dieses Schlingen und das Schnaufen beim Runterschlucken. Dazu ein nachdenkliches Gesicht.
»Eben wollte ich dir noch etwas Wichtiges sagen, Mama. Aber jetzt habe ich es vergessen …«
»Dann kann es so wichtig nicht gewesen sein!«
»Es war ganz ungeheuer wichtig!«, protestierte er.
»Du wolltest die Reifen am Fahrrad noch aufpumpen, oder? Du kennst doch Frau Kruse, wie ungemütlich die werden kann«, sagte Merle mit sanftem Tadel. »Wehe, wenn jemand sich verspätet, dann …«, und Lothar vollendete den Satz mit gespitzten Lippen: »Dann können wür keinen Kriech führen, wönn die Truppe nicht vollständig angetröten ist!«
Merle kicherte, weil die Frau des Pfarrers tatsächlich genau so redete. Lothar kicherte mit, weil er stolz auf seine gelungene Parodie war. Er aß schnell, wippte mit den Beinen. Wischte mit dem Brot das restliche Eigelb vom Teller und trank sein Glas aus. Über der Oberlippe ein milchweißer Bogen.
»Hast du mir den Apfel geschnitten?«
»Schon eingepackt. Jetzt aber los, oder?«
Lothar schob den Teller von sich fort, blieb aber sitzen: »Isst du nichts?«
»Hab’ schon«, sagte Merle und wollte ihm mit dem Daumen die Milch abwischen. Er sah es kommen, drehte den Kopf weg und wischte sich selbst mit dem Handrücken über den Mund.
»Weg?«
»Weg«, bestätigte Merle und reichte ihm den kleinen Rucksack mit der Teekanne und dem Apfel in der Blechdose. Lothar rutschte vom Stuhl, schulterte den Tornister und schlug sich plötzlich vor die Stirn.
»Jetzt fällt mir wieder ein, was ich dir erzählen wollte! Der Zirkus ist in der Stadt, Mama! Gehen wir hin?«
Merle winkte ab: »Es ist gar kein richtiger Zirkus. Nur ein Jahrmarkt.«
»Aber sie haben einen Tiger! Und ein Motorrad!«
»Ein Motorrad haben die Gebrüder Lejeune auch«, sagte Merle müde.
Lothars Wangen waren jetzt rot vor Begeisterung: »Aber die Gebrüder Lejeune können damit nicht die Wand entlangfahren!«
»Die Wand entlang?«
»Die Wand entlang!«
»Sagt wer?«
»Gesine! Und eine Wahrsagerin gibt es auch!«
Merle gähnte. »Ich kann auch wahrsagen!«
»Kannst du nicht!«, schimpfte Lothar, und fast hätte er dazu mit den Beinen aufgestampft.
»Und ob!«, sagte Merle und setzte einen entrückten Blick auf. »Ich sehe … ich sehe … ich sehe … jetzt zum Beispiel voraus, dass die Frau Kruse fuchsteufelswild wird, wenn du wieder zu spät kommst!«
Lothar verdrehte die Augen und ächzte. Auf den Arm genommen zu werden, das bereitete ihm neuerdings auch körperliche Schmerzen.
»Natürlich gehen wir zum Zirkus, Dummerchen«, sagte Merle.
»Wirklich?«
»Ein Tiger auf dem Motorrad? Das will ich nicht verpassen!«
Lothar machte »pfff«, aber Merle sah ihm die Erleichterung an. Sie küsste ihn auf die Stirn.
In der Wohnungstür lauschte sie noch dem Trommeln seiner Schuhe auf den Stufen im Treppenhaus. Dann kehrte sie in die Küche zurück, beugte sich über die Anrichte und öffnete das Fenster. Unten klemmte Lothar sich ihr altes Damenrad zwischen die Beine und schwang sich auf die Pedale. Schlingernd umfuhr er den alten Smolka, der scherzhaft mit dem Stock drohte. Das Fahrrad, dachte Merle, jetzt hat er’s doch vergessen! Sie lehnte sich noch ein Stückchen weiter aus dem Fenster.
»Die Reifen, Lolo! Sind die Reifen aufgepumpt? Lothar?«
Aber er hob nur die Hand zu einer Geste, die alles Mögliche bedeuten konnte, und radelte, ohne sich noch einmal umzudrehen, den Buchenweg hinunter. Kopfschüttelnd sah Merle ihm nach, bis er in die Kaiserstraße einbog. Dort bimmelte gerade die Elektrische stadteinwärts. Lächelnd schloss Merle das Fenster.
•
Als sie ihn gerade wieder anziehen wollte, entglitt Zola Vovoni einer ihrer Pantoffel, landete im Wasser und ließ sich sofort von der Strömung mitnehmen. Als hätte er nur auf diese Gelegenheit gewartet, sich endlich von diesem Fuß zu lösen und in eine winzige Barke zu verwandeln, papageienbunt und mit echten Perlen bestickt. Zola schickte dem Verräter einen vernichtenden Fluch hinterher, beschimpfte sich selbst für ihre Tollpatschigkeit. Wo hatte sie diesen Pantoffel gekauft? In Sevilla? In Toulouse? Es wollte und wollte ihr nicht einfallen, und so setzte sie sich zum Nachdenken wieder hin.
Jahr für Jahr zickzackte der Zirkus über den Kontinent, winters im Süden, sommers im Norden. Wo er einmal seine Zelte aufgeschlagen hatte, dahin kehrte er selten zurück. Dennoch war es Zola manchmal, als stünde in Wahrheit der Zirkus still. Als hätte sich jedes Mal, wenn sie den Vorhang ihres Wagens beiseite schob, eine neue Stadt vor ihrem Fensterchen eingefunden. So war es auch diesmal. Da konnte Jean sagen, was er wollte. Regelrecht verrannt hatte er sich in die Behauptung, dass der Zirkus schon einmal ein Gastspiel hier gegeben habe. Wann genau, daran konnte er sich nicht erinnern. Aber den Namen des Städtchens, da war er sich ganz sicher: Ginsterbourg? Mais oui, bien sûr!
Was Zola vom Ufer aus sehen konnte, machte den Eindruck verschlafener Freundlichkeit. Verschachtelte Altstadt am Berg, der sie mit seiner bewaldeten Gipfelkuppe überragte. Oben keine Burg, wo eine Burg sein müsste. Dächer über Dächer, gedeckt mit schwarzem Schiefer und noch feucht vom Tau des Morgens. Ein sehr hoher Kirchturm, um den die Krähen kreisten, aufgeschreckt vom Klang der Glocken. Eng gestaffelte Giebel und Türmchen und Fassaden. Unten Reste einer Stadtmauer, Quader und Efeu. Hier Nistplatz für Schwalben, dort Fundament für Fachwerkhäuser, die sich verträumt im Wasser spiegelten. Trutzig und idyllisch zugleich, wirkte sogar das steinerne Viadukt hinüber zur Neustadt wie eine Zugbrücke. Nichts davon kam Zola bekannt vor, nicht einmal der stolze Zwillingsturm über dem Stadttor. Ginsterbourg? Einer von uns beiden, dachte Zola, verliert allmählich den Überblick. Vielleicht lag es daran, dass die ganze Stadt mit Blumen geschmückt war. Wie überhaupt alle Städte und Dörfer, die sie bisher auf ihrem Weg durch das Reich gesehen hatten. Als hätte das Land auf einmal Rouge aufgetragen und Parfüm. Zur Feier von was?
Sie kniff die Augen zusammen. Tatsächlich, das war Jean dort auf der Brücke! Und er hatte die Schubkarre dabei. Sie erkannte ihn an seinem Dreispitz. Natürlich. Wer sonst würde mit einer so albernen Antiquität auf dem Kopf durch die Gegend spazieren, als wäre er Bonaparte persönlich? Noch dazu mit der leeren Schubkarre?
Zola schüttelte den Kopf und murmelte: »Cela va faire mal …«
Sie mochte sich gar nicht ausmalen, welche Wirkung diese bizarre Erscheinung am frühen Morgen auf einen braven Bürger haben musste. Oder auf weniger brave Bürger. In einem jener Landstriche von Europa, wo eine weit weniger wohlwollende Erinnerung an den Kaiser gepflegt wurde, als Jean sie mit seinem Mummenschanz so unbeirrt zu Markte trug. Er hielt seinen Napoleon in Ehren, als wäre stündlich mit seiner Rückkehr von St. Helena zu rechnen.
Wie oft hatte Zola ihm geraten, es nicht zu weit zu treiben mit dieser Folklore! Jean zuckte dann nur mit den breiten Schultern und sagte, was er immer sagte: »Cela va faire mal«, weil diese Formel seine Einstellung zum Leben auf den Punkt brachte. Es wird wehtun. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht morgen. Aber eines Tages ganz bestimmt.
Was Zola sich am Allerwenigsten ausmalen wollte. Dazu mochte sie den Alten viel zu sehr. Wenn er nicht getrunken hatte, war er so etwas wie die gute Seele ihrer kleinen Truppe. Wenn er getrunken hatte, war er noch immer so etwas wie ihr Urgestein. In einem früheren Leben, vor dem Großen Krieg, soll er Landarzt oder Tierarzt gewesen sein in der Picardie. Das war es jedenfalls, was ihnen die Leute in der Picardie erzählt hatten. Als Landarzt oder Tierarzt sei er in den Krieg gezogen – und nie mehr heimgekehrt. In der Picardie gingen seinerzeit Gerüchte, er sei mal in Bordeaux, mal in Paris gesichtet worden. Als Clochard, der sich mit Kunststückchen über Wasser hielt. Vermutlich war er damals schon, als was Zola ihn später kennengelernt hatte – ein Houdini der Seifenblasen.
Als Meister seines Fachs und Mönch seiner Religion machte Jean um die Rezeptur seiner Laugen ein großes Geheimnis, aus dem Anrühren der Zutaten ein heiliges Gewese. Die Würde dieser Rituale war zu respektieren. Und nahm nicht auch Zola ihr eigenes Handwerk ernster, als es im Dienst der Illusion nötig gewesen wäre? Es gab mal eine Zeit, da hatte sie viel über solche Dinge nachgedacht. Aber bis zum heutigen Tag wollte ihr nichts einfallen, das flüchtiger und zweckloser und schöner wäre als eine Seifenblase. Der gute Jean, dachte sie zärtlich, während er dort oben die Schubkarre über die Brücke schob. Schickt unermüdlich Schillerndes in eine feindliche Welt, wo es platzen muss, wie nur Seifenblasen platzen. Oder Träume.
»Cela va faire mal« werden seine letzten Worte sein, bevor er am 20. Juni 1944 an einer Ziegelsteinmauer in Coussay-les-Bois mit verbundenen Augen als Partisan erschossen wird, der er nie war.
•
Reifen aufpumpen? So ein lästiger Quatsch! Deutscher Erfindergeist, dachte Lothar und trat fester in die Pedale, deutscher Erfindergeist würde bald Schläuche entwickeln, die überhaupt nicht mehr aufgepumpt werden müssten. Besser noch fliegende Fahrräder, jawohl, mit schlagenden Flügeln rechts und links, rechts und links, rechts und links, rechts überholte ihn die gelbe Straßenbahn. An einem solchen Morgen gehörte der Gehweg neben der Kaiserstraße ihm ganz alleine. Lothar lehnte sich tief über die Lenkstange. Umklammerte die Griffe, dass seine Knöchel weiß hervortraten, Daumen an der Klingel. Vorbei am Gemüseladen von Frau Schiller und an der Frisierstube von Herrn Benedini, klingeling, vorbei an der Einfahrt zum Getränkelager der Gebrüder Lejeune. Beim Lichtspielhaus, dem Tivoli, hatte er die Trambahn wieder eingeholt. Nur noch ein paar Haltestellen bis hinunter zum Fluss, klingeling. Omnibusfahrräder, das wär’s! Im Rhythmus seiner Tritte murmelte er die Verse vor sich hin, das machte er immer so.
Es führt über den Main.
Eine Brücke von Stein.
Linker Hand flogen jetzt die Schaufenster nur so vorbei. Seinen Vorsprung würde die Elektrische bis zur Brücke nicht mehr einholen! Schuhladen, Wäscherei, Kurzwaren. Die Konditorei Hirschbiegel mit ihren mehrstöckigen Torten in der Kühlung, als wären es ebenso kostbare Exponate wie die Nähmaschinen von Pfaff und Singer im Geschäft nebenan.
Rechts und links, rechts und links, so konnte er sich die Zeilen gut merken.
Wer darüber will geh’n.
Muss im Tanze sich dreh’n.
Fußpflege, Instrumente, Spielwaren. Zylberstayn mit seinen Juwelen hinter extradickem Glas, Zylberstayn, warum nicht einfach Silberstein? Gleich daneben die M. Sieber’sche Buchhandlung, das kleine Geschäft seiner Mutter, Schreibwaren und Bücher. Bei der Werkstatt bremste er ab, um einen Blick auf die zerlegten Fords und aufgebockten Opel im Hof werfen zu können, und vor dem Eiscafé standen bereits Tische und Stühle auf dem Gehweg.
Beim GINSTERBURGER ANZEIGER wurde gerade eine neue Ausgabe verladen. Das war jetzt Pech, das bremste seine Fahrt. Geschäftiges Gewusel, durch das sich Lothar nur zu Fuß einen Weg bahnen konnte. Zwischen den Männern auf der Rampe und den Boten mit ihren Droschken und Lastkraftwagen flogen die Scherze, Flüche und verschnürten Zeitungspakete nur so hin und her. Fehlte nur noch, dass er hier jetzt dem Vater von Gesine über den Weg lief. Erst beim Eingang zum Redaktionsgebäude, über dem ein marmorner Muskelprotz eine grünstichige Weltkugel in die Höhe stemmte, konnte Lothar das Rennen gegen die Straßenbahn wieder aufnehmen – und am Ende knapp für sich entscheiden.
Fallalala la, falla la, la
Wie ging’s weiter? Er überquerte die steinerne Brücke und radelte durch das Stadttor, dann über das alte Kokokopfsteinpflaster der Kronengasse. Dort blieb Lothar stehen und spähte unschlüssig in die Winkelgasse. Es war seine Gewohnheit, einen Abstecher in das verwunschene Gewirr aus Fachwerkhäusern zu machen, zu einem kleinen Platz mit Springbrunnen, ins Herz der wirklich alten Altstadt. Uraltstadt mit Gassen so eng, dass ihre märchenhafte Verschlafenheit auch tagsüber kaum von Sonnenlicht erhellt wurde. Hier hatten vor langer Zeit die Menschen gewohnt, die über Jahrhunderte am Münster bauten. Das hatte ihm seine Mutter im Frühjahr bei einem Spaziergang erzählt: »Und bald wird das alles plattgemacht«, dann käme dort »etwas Neues« hin. Und der Gedanke, diese ganze Welt könnte bald verschwunden sein, hatte Lothar so erschreckt, dass er sich seitdem auf dem Weg zum Chor gerne Zeit für einen Abstecher nahm. Schweren Herzens entschied er sich heute dagegen. Er war zu spät dran.
Kommt ein Fuhrmann daher,
hat geladen gar schwer.
Alle Fenster der Kreisleitung waren wie zum Frühjahrsputz geöffnet, das sah freundlich aus. Die Hakenkreuzfahnen hingen fast bis auf die Straße herunter. Wo die Kronengasse sich zum Marktplatz öffnete, hatte die Metzgerei Schlesinger schon geöffnet. Wenn er seine Mutter dort zum Einkauf begleitete, steckte ihm die Frau Schlesinger mit ihren fleckig roten Wangen gerne ein Scheibchen Fleischwurst zu, »damit er groß und stark wird, unser kleiner Kamerad«, aber Lothar warf die Wurst immer weg, aus Angst, davon eines Tages ebenso rote Wangen zu bekommen wie Frau Schlesinger. Jetzt stand sie mit blutiger Schürze vor dem Geschäft, zwinkerte ihm zu und spritzte mit einem Schlauch das Blut vom Pflaster. Im Uhrzeigersinn radelte Lothar um den Neptunbrunnen herum.
Seiner Rösser sind drei
und sie tanzen vorbei.
Vorbei am Hotel Krone mit seiner goldenen Drehtür und dem Wimpel mit dem Wappen der Stadt, Mühlrad mit Lanze auf grünem Grund. Vorbei am Roten Storch mit seinem hölzernen Storch über dem Eingang, vor dem die rothaarige Roswitha gerade erste Stühle in die Sonne stellte. Vorbei am Theater, wo Lothar auch diesmal einen Blick auf die Fotografien im Schaukasten riskierte. Männer in Rüstungen, Männer mit Speeren. Frauen in weiten Gewändern, Frauen in kurzen Röcken.
Fallalala la, falla la, la
»Pass auf, Kleiner, dass dir nicht die Augen aus dem Kopf fallen!«, rief Roswitha mit breitem Grinsen, beide Arme in die breiten Hüften gestemmt. Mit glühenden Ohren wandte er sich ab und schwang sich wieder aufs Rad. Jetzt galt es, Anlauf zu nehmen die steile Glockengasse hinauf, wo er es an der Synagoge vorbei bis zum Museum schaffen könnte, bevor er absteigen und das Fahrrad den restlichen Anstieg zum Gemeindehaus an der Erlöserkirche würde schieben müssen. Aber auf den Stufen vor dem Münster stand ein seltsamer Mann, der erregte seine Aufmerksamkeit. Er trug einen sehr kuriosen Hut.
•
Zola hatte gewartet, bis Jean mit seiner Schubkarre und dem albernen Dreispitz durch das Stadttor mit seinem Zwillingsturm verschwunden war. Ihre Füße waren inzwischen auch getrocknet. Pfeifend stand sie auf, drehte sich um – und hielt vor Schreck die Luft an.
Auf der Böschung ein sprungbereiter Höllenhund. Mit erhobener Pfote mitten in der Bewegung erstarrt, als er Zola entdeckt hatte. Bluthund, der das Wild fixiert. Kein Knurren, aber das mochte nichts bedeuten.
Ins Wasser, dachte sie. Geht er auf mich los, dann springe ich ins Wasser.
Er rührte sich nicht, sie rührte sich nicht.
Bald hätte Zola nicht mehr sagen können, wie lange sie schon stand und starrte, Auge in Auge mit diesem Monstrum.
Plötzlich ein scharfer Zuruf: »Boelcke! Sitz, verdammt nochmal!« Folgsam setzte sich der Zerberus, ohne Zola aus den Augen zu lassen.
Auf dem Pfad tauchten zwei Männer auf. Ein dicker Mann mit dicker Brille und breiten Hosenträgern, der dem Hund den Kopf tätschelte und »Brav, Boelcke, brav« sagte. Und ein dicker Mann mit Vollbart und Soutane, katholischer Priester also und über ihre Begegnung ähnlich überrascht wie Zola Vovoni, die mit klimpernden Armreifen ein hektisches Kreuz schlug. Worauf der Pastor eine segnende Geste andeutete und einen kurzen Blick mit seinem Begleiter wechselte.
Dunkle Haut, weite Kleider, offenes Haar, ein einzelner Pantoffel in der Hand. Zola wusste, dass sie einen ungewohnten Anblick bot, und ahnte, dass diese Leute sich die üblichen Gedanken machten. Gleich würden sie die üblichen Fragen stellen. Also nahm Zola all ihren Hochmut zusammen, stieg langsam die Böschung hinauf, jetzt bloß nicht ausrutschen, und schritt erhobenen Hauptes an den beiden Männern vorbei. Ihre Blicke konnte sie noch im Rücken spüren, weil sie solche Blicke ebenso gewohnt war wie ihre Unverhohlenheit, die sich zuverlässig entlud in eine wüste Beschimpfung, einen unflätigen Spruch, einen schlüpfrigen Scherz.
»… Splitter!«, hörte sie es leise hinter sich.
Zola blieb stehen.
»Glas!«
Zola drehte sich um. Der Hund widmete sich der Pflege seines Geschlechts. Sein Herrchen hob abwehrend die Hände: »Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, ich meine ja nur …«
»Es empfiehlt sich nicht«, sprang der Priester ein, »am Fluss auf festes Schuhwerk zu verzichten. Hier unten wird oft gefeiert, die Jugend, und deshalb hat’s überall Glasscherben!«
Später, schon auf dem Trampelpfad zwischen den blühenden Weißdornhecken, konnte Zola wieder freier atmen. Sie war nicht gebissen, beschimpft oder verspottet worden. Sie war auf eine drohende Gefahr hingewiesen worden und hatte sich mit einem Lächeln bedankt. Gewöhnlich waren die Leute, wie sie es seit jeher waren, wenn fahrendes Volk ihre gefügten Gewohnheiten in Unordnung bringt – überrascht am ersten Tag, fröhlich am zweiten, ausgelassen am dritten. Am vierten oder fünften Tag war ihnen der Anblick der Buden und Wagen vertraut geworden. Am sechsten oder siebten Tag hatte sich ihre Gastfreundschaft gesättigt. Spätestens am achten oder neunten Tag legte ihnen ein örtlicher Ordnungshüter den Abgang nahe. Vertraulich, leutselig, noch. Auf eine weitere Woche ließen sie es nur selten ankommen. Möglich, dass sie hier ihre Zelte noch früher abbrechen mussten. In Ginsterburg war ihnen das Sportfeld abseits der Stadt als Standort zugewiesen worden. Das war nicht sehr gastfreundlich, dachte Zola. Besser als nichts, aber nicht gut fürs Geschäft.
Ohnehin lief es seit einer ganzen Weile nicht gut für ihre kleine Truppe. Ganz egal, wo und unter welchem Namen sie auftraten. Ob als »Extravagancia del Profesor Magirus Hipódromo y Circo« in Spanien, ob als »Professore Magirus Ippodromo & Circo Stravaganza« in Italien, ob als »Professeur Magirus Hippodrome & Spectacle de Cirque« in Frankreich. Auch in Deutschland waren sie als »Professor Magirus’ Pferdeschau & extravaganter Zirkus« nicht viel mehr als ein fahrender Tingeltangel mit genau zwei Attraktiönchen.
Raj, der indische Tiger.
Und Gino mit dem Todeskessel.
•
Lothar hätte schwer erklären können, warum ihm das Münster so unheimlich war. Lag es an den dämonischen Wasserspeiern, die ihm mit ihren steinernen Augen zu folgen schienen? Oder an der zerklüfteten Fassade, die wie eine düstere Klippe über dem Marktplatz aufragte? An seinem wolkenhohen Turm, dessen Zwilling nie vollendet worden war? Oder an den schwarzen Rabenvögeln, die ihn unablässig umkreisten? Auf Lothar jedenfalls wirkte das Gebäude so bedrohlich wie eine Gewitterwolke.
Umso neugieriger machte ihn, was dieser Mann dort auf den Stufen zum Portal im Schilde führte. Abseits stand, von einem Tuch bedeckt, eine Schubkarre. Der Mann hatte die Kirche im Rücken und einen lustigen Hut auf dem Kopf. Mit ausladenden Bewegungen, die zum Zuschauen einladen sollten, rührte er in einer Zinkwanne. Lothar fasste sich ein Herz und trat näher heran. In der Wanne schwappte seifige Flüssigkeit. Gerührt wurde sie mit einer Reuse aus Draht. Das eigenartige Werkzeug glich einem Schmetterlingsfänger, nur ohne Netz. Gebannt folgte Lothar jeder einzelnen Bewegung, gewiss, gleich Zeuge eines erstaunlichen Kunststücks zu werden …
»Was wird denn das, wenn’s fertig ist?«
»Saubere Unterhosen, ist doch klar!«
Lothar spürte, wie sein Herz ins Stolpern geriet. Die Zwillinge. Ihr Gelächter, ganz nah. Irgendwie hörte er ihren Stimmen an, dass sie die neuen Uniformen trugen. Er wusste es einfach, ohne sich umzudrehen. Lothar kannte Knut und Bruno vom Sehen, aus der Oberschule für Knaben, da waren ihm die Söhne vom Gürckel zwei Jahrgänge voraus. Er kannte sie gut genug, um zu wissen, dass ihnen besser aus dem Weg zu gehen war.
Erwachsenen bereitete die Ähnlichkeit der Zwillinge manchmal Schwierigkeiten. Kein Muttermal, keine Narbe und auch sonst kein Merkmal, das eine Unterscheidung erleichtert hätte. Schon immer hatten sie die gleichen Kleider getragen. Neuerdings zeigten sie sich nur noch in erdnussbraunem Drillich, die Sommermütze schief auf dem Kopf, das schwarze Halstuch locker gebunden. Armbinde mit Hakenkreuz. Besonders »fesch« fanden das die Erwachsenen. Und sprachen munter Knut als Bruno und Bruno als Knut an, als sei es einerlei. Lothar konnte die Verwirrung nicht verstehen. Er wusste immer, instinktiv und zweifelsfrei, mit wem er es zu tun hatte. Prügelfreudig waren alle beide, aber Knut war der mit der kürzeren Lunte, den gehässigeren Sprüchen, den härteren Ohrfeigen.
Und so spürte er auch jetzt den Reflex, sofort die Flucht zu ergreifen. Wieso hatte er die Gefahr nicht kommen sehen?
»So’n Quatsch«, hörte er auf einmal Roswitha sagen: »Sieht doch ein Blinder mit Krückstock, dass der Reklame für den Jahrmarkt macht …«, und das erleichterte Lothar ein wenig. Solange die Wirtin vom Roten Storch in der Nähe war, würden ihn die Zwillinge in Frieden lassen.
»Wenn das so ist, wüssten wir schon gerne«, beharrte Bruno, »was es ist, das hier so bestialisch stinkt?«, vollendete Knut.
»Ich würde es eher verdächtig finden, wenn man unsere Schlachtabfälle nicht riechen könnte«, warf Frau Schlesinger ein, Lothar erkannte auch sie an ihrer »Noch ein Stückchen Fleischwurst für unseren kleinen Kameraden?«-Stimme. Die Schubkarre dort sei randvoll mit Knochen und Pansen und Gedärmen und Gekröse für den Tiger. Lothar guckte ehrfürchtig rüber und sah Schmeißfliegen auf dem Tuch. Und aus dem kleinen Pulk, der sich inzwischen versammelt hatte, rief jemand zur allgemeinen Erheiterung: »Vorlautes Jungvolk wäre dem Tiger bestimmt lieber!«
Der Mann mit dem Dreispitz hatte in der Zwischenzeit in aller Seelenruhe weiter in der Wanne gerührt. Jetzt erst blickte er auf, vergewisserte sich seines Publikums – und malte mit einer schnellen Bewegung einen Bogen in die Luft, einen Schwarm mikroskopischen Geglitzers. Freundlicher Applaus, dezente Verbeugung.
Lothar vom Donner gerührt.
Zauberei, dachte er, das ist Zauberei.
Erneut zog der Zauberer seine Reuse durch die Lauge. Diesmal zeichnete er auf Brusthöhe ein zitterndes Muster, aus dem sechs Blasen wie Billardkugeln hervortanzten, die er von Hand zu Hand wandern ließ – erst mit erstauntem, bald mit gelangweiltem Gesicht. Zuletzt tat er, als müsste er ein Gähnen unterdrücken, zog eine Stricknadel aus dem Jackett und brachte die Blasen nacheinander zum Platzen. Verblüffter Applaus, elegante Verbeugung.
Lothar mit offenem Mund.
Beiläufig steckte sich der Zauberer eine Zigarette an und tauchte erneut seinen Blasenstab in den Bottich. Aus schillernden Farben ein zitternder Schlauch, den er an seine Lippen führte und mit Rauch aus seinen Lungen füllte. Eine knappe Bewegung aus dem Handgelenk verschloss das Gebilde zu einem Globus von beachtlicher Größe. Und über den Stufen zur Kathedrale war ein milchiger Mond aufgegangen. Stürmischer Applaus, »Bravo!« und »Allerhand!«, tiefe Verbeugung zum Ende der Vorstellung.
Plaudernd zerstreute sich das kleine Publikum. Nur Lothar blieb stehen und beobachtete, wie der Zauberer die Lauge in den Gulli kippte, Zinkwanne und Schmetterlingsfänger auf die Schubkarre lud. Unterdessen hatte ein Hauch von irgendwoher die Rauchseifenblase erfasst. Gemächlich segelte sie über den Marktplatz bis über den Neptunbrunnen, hielt inne, kehrte um, dem Münster entgegen. Mit glasigen Augen folgte Lothar ihrem Flug im Aufwind die düstere Fassade hinauf. Ein winziges Gestirn aus Flüchtigkeit und Oberflächenspannung, das einfach nicht platzen wollte.
•
Über der Tür tickte die Uhr. Der Wasserhahn tropfte. Merle drehte ihn fester zu. Er tropfte weiter. Unablässig rauschte durch die Rohre das Abwasser. Spielte wohl wieder der Fritz Grasberger von oben mit der Klospülung. Hatte große Freude daran, der Kleine, anders als seine Mutter. Wie sich die Nachbarin ihrer späten Schwangerschaft geschämt hatte. »Mit bald vierzig Jahren«, hatte die Frau Grasberger bei wirklich jeder Begegnung im Treppenhaus geklagt, sei sie als Mutter eigentlich viel zu alt. Merle war es unangenehm, von dieser sauertöpfischen Person ins Vertrauen gezogen zu werden. Zugleich fühlte sie sich aber zu aufmunternden Floskeln verpflichtet, von Frau zu Frau. Kopf hoch, Frau Grasberger! Das wird schon! Als der Bub dann zur Welt kam, körperlich kerngesund, war von einem seltenen Syndrom mit kompliziertem Namen die Rede. Geistig würde der Fritz immer Kleinkind bleiben. Inzwischen hatte der Knabe die Pubertät erreicht und seine Leidenschaft für Schalter, Hebel und Knöpfe entdeckt. Er griff einfach nach allem, womit er möglicherweise etwas in Gang setzen konnte.
Über dem Mülleimer eine Wolke aus Fruchtfliegen. Merle schlug die skelettierten Apfelgehäuse, welken Salatblätter und verschimmelten Zitronen in eine Ausgabe des GINSTERBURGER ANZEIGERs ein. Dann legte sie das feuchte Papierbündel neben die Wohnungstür, damit sie später das Runtertragen nicht vergessen würde.
Sie ging in Lothars Zimmer und zog die Vorhänge auf. An den Wänden ein blassbuntes Mosaik aus Banknoten. Scheine über Zehntausend, Millionen, Milliarden oder Billionen von Reichsmark. Bunter Papiermüll, mit dem Robert nach der Großen Inflation das künftige Kinderzimmer tapeziert hatte. Da war ihr Sohn schon unterwegs und ihre Ehe schon gescheitert gewesen.
Als Merle die Bettwäsche ausschüttelte, polterte etwas auf den Boden. Sie ging auf die Knie, tastete unter dem Bett. Natürlich die Dynamotaschenlampe. Hatte ihm der Smolka geschenkt. Über diese Leserei bis in die Puppen würde sie mit Lolo mal ein ernstes Wörtchen reden müssen. Sie klopfte das Kissen aus, strich die Tagesdecke glatt und setzte sich gedankenverloren aufs Bett. Die Ära kämpfender Strichmännchen und Buntstiftpiraten am Kopfende war wohl wirklich vorbei. Inzwischen hing dort ein Luftschiff an der Spitze des höchsten Wolkenkratzers von Neuyork und eine nachkolorierte Montgolfière über dem Schlachtfeld von Solferino. Darunter weitere Fotos, die Lothar aus Illustrierten geschnitten hatte. Luftritter wie Manfred von Richthofen, Max Immelmann oder Ernst Udet. Rennfahrer wie Bernd Rosemeyer, Hermann Lang oder Ewald Kluge. Junge Männer mit Heldenblick in die Ferne.
Ach, dachte sie dann, mein Lolo macht sich. Aber so still ist er noch. So folgsam, so verträumt. Keine Freundschaften, wie Dreizehnjährige in seinem Alter sie längst schon geschlossen haben müssten. Keine für einen Sommer, keine fürs Leben. Nicht in seiner Schule, nicht in der Nachbarschaft, nicht beim Schlagballspielen unten auf dem Sportfeld vom TuS Ginsterburg. Für die Paddlergilde war er noch zu jung. Die Hitlerjugend kam sowieso nicht in Frage. Schon aus Rücksicht auf Robert. Beiden wäre ihnen nicht im Traum eingefallen, ihr gemeinsames Kind den Faschisten zu überlassen.
Kennengelernt hatte sie Robert, als er bei ihr im Laden ein Buch über die russische Revolution bestellte. Wie der junge Trotzki sah er damals noch aus, Vorarbeiter und Gewerkschaftler bei der Jungheinrich GmbH & Co. KG. Die Beziehung war kurz und stürmisch. Sie lasen sich gegenseitig Bakunin vor und träumten von einer Reise nach Moskau. Er verhöhnte sie als Sozialdemokratin, sie verspottete ihn als Stalinisten.
Harmlose Neckereien waren das, wie Merle dachte – bis zu dem Tag, an dem sie bei ihrem Lieblingsschriftsteller über eine lustige Geschichte gestolpert war. Bei einer Reise in die Sowjetunion war Panait Istrati zum Zeugen des Elends und der Schauprozesse geworden. Auf seine Frage wurde ihm erklärt, man könne eben kein Omelett zubereiten, ohne ein paar Eier zu zerschlagen. Worauf Istrati geantwortet hatte: »Ich sehe die zerschlagenen Eier, aber wo ist das Omelett?«
Vielleicht hatte sie zu laut gelacht, als sie Robert diese Anekdote erzählte. Vielleicht hatte er auch einfach nur einen sehr schlechten Tag gehabt. Jedenfalls war ihm da zum ersten Mal die Hand ausgerutscht – und Merle hatte noch am selben Tag den Entschluss gefasst, ihn zu verlassen. Sein Krebs aber war schneller. Er kam ihr in die Quere. Und so blieb Merle die drei Jahre, die ihm noch bleiben sollten, an seiner Seite. Mit Kopf und Herz auf Abstand zwar, aber an seiner Seite. Diese »schlechten Zeiten«, dachte sie manchmal, waren nicht die schlechtesten gewesen. Es waren geschenkte und gestundete. Und manchmal hatten sie sogar so etwas wie eine Familie gehabt.
Auf dem Nachttisch stapelten sich die Abenteuer zu einem schiefen Büchertürmchen.
Ein Sturz in den Mahlstrom (dünne Staubschicht)
Ein Kampf um Rom
Reise zum Mittelpunkt der Erde (zerfleddert)
Fünf Wochen im Ballon
Sagen des Altertums (klassisch)
Der Schatz im Silbersee (unberührt)
Jeden Monat brachte sie Lolo ein neues Abenteuer mit nach Hause. Jeden Monat nahm sie ein zugeschlagenes oder ausgeschlagenes Abenteuer wieder mit zurück in ihren Buchladen. Merle pustete die dünne Staubschicht von Edgar Allan Poe und warf einen kurzen Blick auf Lothars aktuelle Favoriten. »Luftherrschaft« von einem gewissen Giulio Douhet. Sie blätterte auf und las einen beliebigen Satz: »In diesem Kampf müssen wir den Luftkrieg zu seinem logischen Ende führen.« Mit einem Frösteln schlug sie das Büchlein wieder zu und griff nach dem »Reiseführer durchs Reich der Insekten«, der sich zwischen Gurkengläsern mit Essigäther und Stecknadeln, Klebstoff und Pinzetten einen Ehrenplatz auf dem Schreibtisch erobert hatte. Das sah Lolo viel ähnlicher. Aufgeschlagen war das entomologische Lexikon bei L wie »Lucanus Cervus«. Aha, der Hirschkäfer. Ein ganz erstaunliches Tier. Glücklicherweise konzentrierte Lolo sich auf kleinere Insekten. Katalogisierte gepresste Falter, wie andere Leute Briefmarken sammelten. Fügte eigene Zeichnungen hinzu.
Merle freute sich über sein Steckenpferd. Auch wenn sie der Gedanke traurig machte, dass Lothar alle diese Geschöpfe eigenhändig und einzeln töten musste. Zwar ließ sie sich gerne zeigen, wie umsichtig er dabei vorging. Äther auf die Watte, danach erst die Nadel durchs Herz. Es blieb aber bei ihrem Wunsch, sein einsames und eisiges Steckenpferd durch Gesellschaft und Wärme auszugleichen. Ob er nicht im Chor von Frau Kruse? All die anderen Jungs? Limonade und Kuchen!
Auf ihren Vorschlag hatte Lothar zunächst nur mit seinem typischen Schulterzucken geantwortet. Und trotzdem radelte er nun schon seit einem halben Jahr jeden Freitag ins Gemeindehaus der Erlöserkirche. Worte der Begeisterung hatte Merle in der ganzen Zeit noch nicht gehört. Klagen aber auch nicht. Ganz gleich, wohin man ihren Sohn auch stellte – er tat gewissenhaft, was von ihm verlangt wurde. Manches sogar, wenn man Frau Kruse glauben durfte, mit einigem Talent.
Wie alles schon immer eingefaltet ist in unseren Kindern, dachte sie und nahm die Brille ab. Wie es sich Jahr um Jahr entblättert, wie mehr und mehr zum Vorschein kommt, was eingefaltet war von Anfang an. Persönlichkeit. Sie rieb sich die Nasenwurzel. Doch, er macht sich. Er kommt nicht nach seinem Vater. Er kommt nach mir. Bei dieser Erkenntnis empfand sie weder Schmerz noch Stolz. Nur eine zärtliche Form von Ratlosigkeit.
Sie setzte die Brille wieder auf und schlenderte zurück in die Küche. Räumte das Geschirr beiseite, hielt es mechanisch unter den Wasserhahn, trocknete es ab, hängte das Tuch vor den Herd. Dann nahm sie den schrumpeligen Apfel aus dem Korb, betrachtete ihn eine Weile und biss hinein.
•
Zola Vovoni kreuzte die Aschenbahn und überquerte das Fußballfeld, sein Gras kitzelte zwischen ihren Zehen. Die Weitsprunggrube war eine kleine Sandwüste. Gleich dahinter erhob sich, wie der Tempel einer obskuren Religion, am Rande ihrer kleinen Wagenburg der Todeskessel. Im Prinzip war die Steilwandtonne nur ein gigantisches Weinfass, gefügt aus hölzernen Halbschalen. Neben einem würfelförmigen Käfig, verhängt mit blauen Tüchern, schraubte Gino an seinem Motorrad. Am Oberkörper klebte ihm das Unterhemd, im Mundwinkel die Zigarette. Kaum bemerkte er Zola, warf er den Schraubenschlüssel beiseite und sprang auf.
»Die Bestie hat Hunger, Zola! Wo bleibt das Fleisch?«
Zola lächelte: »Du solltest wirklich mehr auf eine ausgewogene Ernährung achten, junger Freund. Gerade am Morgen!«
Verständnislos starrte er sie an, sofort lenkte Zola ein: »Jean ist schon in der Stadt. Er kommt bestimmt bald zurück.«
Mit zwei Fingern nahm Gino die Kippe aus dem Mund, betrachtete sie kurz und schnippte sie weg. »Hoffentlich lässt er sich nicht zu viel Zeit, maledetto«, sagte er und blickte hinüber zum Käfig. »Niemand weiß, wozu ein hungriger Menschenfresser fähig ist!«
»Wir sollten es besser nicht darauf ankommen lassen!«, sagte Zola mit gespieltem Schaudern.
Und so lachten beide, worüber sie ebenso gut hätten weinen können. Es war ein jämmerliches Schauspiel, zu dem ihre ehemals glanzvollste Nummer verkümmert war: »Die Enthüllung des indischen Menschenfressers«, wenn das Publikum schon den ganzen Tag ehrfurchtsvoll um die verhängten Gitter herumgeschlichen war und den Tiger gerochen hatte. Denn stinken, bei allen Göttern, das konnte die Katze noch. Früher hätte der Tiger zum Zeitpunkt der Enthüllung – in der kinderfreundlichen Frühvorstellung um acht, in der bengalisch beleuchteten Spätvorstellung um elf Uhr am Abend – bereits gebrüllt und getobt wie der Leibhaftige. Heute konnte, wer gerade abkömmlich war, ein Jongleur oder eine Seiltänzerin, zu Trommelwirbel und Tusch das blaue Tuch vom Käfig ziehen. Mit ein wenig Glück erwachte Raj dann aus seinem ewigen Nickerchen und schaute sich verwirrt um. An sehr guten Tagen wuchtete er sich sogar blinzelnd auf die Beine und fauchte heiser in die Stäbe. Der schwierigste Teil der Nummer war, das Tuch rechtzeitig wieder über dem Käfig zu drapieren. Der Greis neigte dazu, sich binnen kürzester Frist erneut aufs Ohr zu legen.
Wirkung erzielte der Tiger nur noch auf Plakatwänden und an Litfaßsäulen. In Wahrheit gab es ihn längst nicht mehr, ebenso wenig wie einen »Professor Magirus«. Oder auch nur ein Hippodrom, seit ihnen vor drei Jahren der letzte Klepper an Altersschwäche verendet war. Für Ersatz war einfach kein Geld da. Schon der Appetit der alten Katze brachte sie regelmäßig an den Rand des Ruins. Als Glanzlicht blieb nur Gino, der sein Motorrad allerdings nach jeder Steilwandfahrt von Grund auf überholen musste.
»Was ist denn mit der Maschine?«, erkundigte sich Zola. »Können wir uns heute Abend auf sie verlassen?«
Gino spuckte aus: »Fanculo tutto!«
Zola lächelte. Wie eifrig der Junge sich bemühte, seine Zugehörigkeit zu ihrem fahrenden Volk zu verleugnen, wie unbedingt er stattdessen Italiener sein wollte. Er war kein Rom, Römer wollte er sein. Fanculo tutto? So ein Unfug.
»Ist es schlimm?«, fragte sie.
»Ich flicke sie schon seit Monaten«, sagte er und hob den Schraubenschlüssel wieder auf. »Ich flicke und flicke, bis ich endlich das Ersatzteil finde. Und wenn ich das Ersatzteil finde, dann kann ich es mir nicht leisten. Also flicke ich weiter.«
Zola gefiel es nicht, Gino so zerknirscht zu sehen. Der Zirkus brauchte einen unzerknirschten Gino. Seinen Wagemut, wenn er an der senkrechten Wand des Todeskessels förmlich zu kleben schien. Seine Schönheit, wenn er mit ausgebreiteten Armen in den Fußrasten stand wie ein horizontaler Jesus. Mit weißem Seidenschal um den Hals, lederner Fliegermütze auf dem Kopf und dem Lächeln eines jungen Rudolph Valentino im Gesicht, wenn er auf den ratternden Planken seine Kreise zog in einer Wolke aus Lärm und Benzin, dem Parfüm der Moderne. Zola stellte sich vor, wie Gino beim flüchtigen Blick aus seinem Kessel hinauf ins Rund der Ränge keine einzelnen Gesichter mehr erkennen konnte. Nur ein wirbelndes Band der Verzückung. Geöffnete Münder, gerötete Wangen, geballte Fäuste. Sie mussten ihm erscheinen wie ein Mund, eine Wange, eine Faust. Eine Verzückung.
Er wird am 27. September 1942 auf seiner dienstlichen Gilera sterben, wenn ihm in Ägypten an der einzigen Kreuzung von Sidi Barrani ein italienischer Schützenwagen die Vorfahrt nimmt.
•
Lothar schob die letzten Meter, lehnte das Fahrrad gegen die Hauswand und stemmte sich gegen die Eichenholztür zum Gemeindesaal der Erlöserkirche. Drinnen empfing ihn das leere Foyer und sein schlechtes Gewissen. Fast eine Viertelstunde in Verzug, so spät wie noch nie. Da konnte er sich auf etwas gefasst machen. Ein Donnerwetter, das sich gewaschen hatte. Vielleicht auch ein paar Schläge mit dem Taktstock. Er eilte den Gang hinunter bis zur Tür zum Proberaum.
Und ein Bursch ohne Schuh
und in Lumpen dazu.
Als die Brücke er sah,
ei, wie tanzte er da!
Er nahm sich ein Herz und trat ein. Frau Kruse streifte Lothar nur mit eisigem Blick, ohne den Tanz ihres Taktstocks zu unterbrechen. Unschlüssig blieb er neben der Tür stehen, den schadenfrohen Blicken der anderen Jungen ausgesetzt. Mit Namen kannte er nur wenige, befreundet war er mit keinem. Chorknaben kamen gemeinhin auch nicht aus der Vorstadt mit ihren Mietskasernen, wo Lothar wohnte. Sie kamen aus Herzogental mit seinen Herrenhäusern in weitläufigen Parkanlagen, aus Elternhäusern mit Ölgemälden an den Wänden und Flügel im Salon. Mit lächelnden Müttern, die andere lächelnde Mütter mit Tee bewirteten, und Vätern, deren Geschäfte sie nach London oder Frankfurt oder Danzig führten. Und wenn diese Väter mal zu Hause waren, lauschten sie den Geschichten ihrer Söhne, sagten »Hört, hört!« und blickten mit Wohlgefallen auf ihre Sprösslinge. So stellte Lothar sich das zumindest vor.
Fallalala la, falla la, la. Lothar starrte weiter auf den Boden, summte leise mit. Die Fülle, der Wohlklang. Wie beim Ausatmen alles in Melodie zerfloss. Die reine Schönheit eines getroffenen Tons … Wo blieb denn das Donnerwetter? Frau Kruse schien ihn nicht weiter beachten zu wollen. Unwirsch dirigierte sie jetzt gegen einen Missklang an, der sich auf einmal in den Gesang gemogelt hatte. Lothar sah grinsende Gesichter, verstohlene Rempeleien mit den Ellbogen. Fiebrige Seitenblicke, verhaltenes Prusten. Und endlich diese eine Stelle … Kommt ein Mädchen allein auf die Brücke von Stein. Fasst ihr Röckchen geschwind, und sie tanzt wie der Wind … an der sich alle Disziplin in Gekicher auflöste. Frau Kruse, verärgert, prügelte mit dem Taktaktaktstock gegen die Tischkante.
»Höher! Ist das denn so schwör? Röckchen!«, sang sie und kam hinter ihrem Pult hervor: »Röck! Chen!«, worauf die allgemeine Unruhe in gackernden Tumult umschlug.
Gelangweilt blickte Lothar aus dem Fenster. Am Himmel keine rauchgefüllte Seifenblase. Die blühende Kastanie im Hof ganz still, wie gemalt. Kein Wind.
Und jetzt erst entdeckte er den Schmetterling, staubbraun auf dem staubbraunen Fensterrahmen. Ist das denn die Möglichkeit? So früh im Jahr, noch vor den Zitronenfaltern? Könnte das vielleicht sogar ein Nierenfleck sein? Und so nah, dass Lothar nur noch hätte zugreifen müssen! Er konnte sogar die Fühler zittern sehen. Aber wohin damit?
Er dachte nach. In der Hosentasche, das kannte er schon, würde ihm das Insekt zu einem unpräparierbaren Klümpchen zerfallen. Jetzt bräuchte er sein Sammelkästchen, aber das lag zu Hause auf dem Schreibtisch. Nichts zu machen. So ein Ärger! Künftig, nahm er sich vor, würde er seine Ausrüstung immer mit sich tragen. Sammelkästchen, Käscher, Äther. Allzeit bereit!
Fallalala la, falla la, la.
»Bis nöchsten Sonntag!«, rief die Frau Kruse jetzt. »Lernt mir den Text, Hörrschaften! Und lernt, eure Albernheiten ein wönig zu zügeln!«
Vom allgemeinen Aufbruch aufgescheucht, flog der Zipfelfalter gegen die Fensterscheibe, floh auf Hüfthöhe die Wand entlang. Lothar griff mechanisch nach seiner Ledertasche, ohne das Tier aus den Augen zu lassen.
»Lothar Sieber! Bleibst du noch einen Momänt?«
Er nickte, blieb mit gesenktem Kopf stehen. Das Donnerwetter, ganz vergessen. Die Kruse wartete, bis der Raum sich geleert hatte. Legte ihren Taktstock beiseite. Der Zipfelfalter hatte sich aus dem Staub gemacht.
»Das ist schon ein wülder Haufen, oder?«
»Ja, Frau Pfarrer.«
»Aber du fühlst dich wohl hier?«
»Ja, Frau Pfarrer.«
»Und bei der Mörle, stöht da auch alles zum Bösten?«
»Ja, Frau Pfarrer.«
»Ich frage nur, weil wir sie so lange nicht mehr im Gottesdienst gesehen haben. Mein Mann macht sich schon Sorgen.«
Lothar schwieg. Seitlich geisterte der Falter wieder in sein Blickfeld.
»Richte deiner Mutter doch aus, dass wir sie würklich gerne wieder in der Kürche begrüßen würden. Und dich natürlich auch! Magst du das tun?«
Der Falter hatte sich beruhigt und auf dem Pult niedergelassen. Es war wirklich ein Nierenfleck. Lothar nickte.
»Gut, dann geh jetzt heim.«
•
Irgendwann waren alle Feuerschluckerinnen bestaunt, alle Seiltänzer beklatscht und alle Süßigkeiten gekostet. Dann setzte Gewöhnung ein. An einem fünften Tag lockte nur noch Gino neues Publikum in seinen Todeskessel. Was dieser Italiener für ein Teufelskerl war, das sprach sich bis auf die Höfe und Dörfer im Umland herum – die enttäuschende Harmlosigkeit des »Menschenfressers« leider auch. So glich sich das wieder aus.
Und Zola? Konnte sich weder gratulieren noch beschweren, was die Bilanz des Abends betraf. Wieder waren alle dabei. Die Leutseligen und die Gläubigen, die Spieler und die Spielverderber, die Verrückten und die Gefährlichen. Wobei man es den wenigen Gefährlichen am wenigsten ansah, dass sie gefährlich waren. Was sie erst recht gefährlich machte.
Beispielsweise die dralle Rothaarige am frühen Nachmittag. Hatte sehr konkrete Fragen zu einem amourösen Abenteuer mit einem Getränkehändler namens Lejeune und sich zuvor schon ordentlich weichgetrunken. Alkohol spielte Zola in die Karten, und das Tarot verfehlte nur selten seine Wirkung. Menschenkenntnis, mehr brauchte sie nicht. Der Rest war, was sie daraus machte. Eine Geschichte. Die Kundin war in Plauderlaune, was Zola ebenfalls in die Karten spielte. Aus denen Zola ihr dann las, dass es mit dem Getränkehändler nichts würde, vielleicht aber mit seinem Bruder. Hatte er denn einen Bruder? Er hatte, und der schien ebenfalls attraktiv zu sein. Die Kundin war zufrieden. Sie stellte sich als Wirtin vor, betreibe ein Gasthaus am Marktplatz und habe dort schon am Morgen »diesen Seifenblasenkünstler«. Perlenbestickte Geldbörse: »Was schulde ich?«, dazu üppiges Trinkgeld.
Beispielsweise der katholische Priester, dem sie am Morgen in den Büschen über den Weg gelaufen war. Gestatten, Pater Waibel. Ob er der »werten Kollegin« einfach mal einen Besuch abstatten dürfe? Ohne ihre Dienste in Anspruch zu nehmen? Er durfte, und Zola durfte ihn im Gegenzug »Bruder Julius« nennen. Schnell lenkte der Bruder ihr Gespräch auf Unterschiede und Parallelen ihrer beider Professionen, Kreuz und Pentagramm, Séance und Epiphanie, und Zolas Unbehagen wuchs mit jedem seiner Worte. Sie spielte trotzdem mit, bis er laut über eine mögliche »Ökumene mit dem Okkulten« nachzudenken begann und die in Wahrheit doch gewiss »gottgefällige Reinheit« einer Liebe zwischen Männern. Da dämmerte Zola, wie besoffen ihr Besucher schon die ganze Zeit gewesen sein musste. Sanft setzte sie Bruder Julius vor die Tür.
Beispielsweise die drei Schwestern. Gekleidet in dunkle Tracht und diese verhärmte Alterslosigkeit, wie sie mit dem Landleben kommt. Trauten sich kaum, überhaupt das Zelt zu betreten. Denen war das nicht geheuer. Am Anfang hielten sie sich an den Händen, bekreuzigten sich verstohlen, hatten »eigentlich gar keine Fragen«. Am Ende lauschten sie gebannt, was Zola der Glaskugel über die Fruchtbarkeit ihrer Äcker, ihrer Schöße sowie der Lenden ihrer Ehemänner entlocken konnte. Sie lebten noch in einem dunklen Aberglauben, wie er selten geworden war auf einem mit Glühbirnen ausgeleuchteten Kontinent. Damit konnte Zola arbeiten. Lederbeutel, die Münzen einzeln abgezählt.
Beispielsweise die Frau mit schwarzem Bubikopf und schwarzer Brille, an der Hand einen vielleicht dreizehnjährigen Jungen: »Darf man eintreten?« Der geweitete Blick des Sohnes, versteinert in Ehrfurcht. Dazu das spöttische Lächeln der Mutter, nur ein feiner Zug um den Mund. Zola wusste sofort, dass das nichts werden würde. Der moderne Mensch betrat ihr Zelt, wie er einen Blick auf das Horoskop in der Zeitung warf, versuchsweise, als ob – höchstens insgeheim hoffend, es könnte vielleicht doch etwas dran sein. Und manchmal nicht einmal das. Manchmal sollte eine Wahrsagerin nur zum Gespött gemacht werden.
Als Zola aus den Karten las, spähte ihr die Frau über die Schulter und rief: »Schau mal, Lolo, ein neuer Mann wird in unser Leben treten!« Als Zola tief in die Glaskugel blickte, reichte die Mutter ihr ein Taschentuch: »Vielleicht wollen wir sie zuerst polieren? Damit wir klarer sehen?« Als Zola zuletzt den tropfenförmigen Amethyst kreisen lassen wollte, schloss auch die Dame ihre Augen und raunte: »Ich sehe … ich sehe … ich sehe, dass uns dieser Hokuspokus gleich eine ganze Reichsmark kosten wird!«
Zola legte das Pendel beiseite. Die Mutter funkelte sie fröhlich an. Der Junge tat ihr leid. Seine Ehrfurcht war nackter Angst gewichen. Sie kannte diesen Blick. Das Kind fürchtete, die Mutter könnte den Zorn einer echten Hexe auf sich gezogen haben. Zeit, die Vorstellung zu beenden.
Zola schenkte dem Jungen ein Lächeln und erhob sich. »Es wäre nicht recht«, sagte sie milde und streckte die Hand aus, »wenn ich für diese Sitzung etwas berechnen würde …« Die Hand galt der Mutter. Es war der Sohn, der sie ergriff.
Und da geschah es.
Ein Gefühl, als streifte der Flügel eines Vogels ihre Stirn.
Plötzliche Gewissheit, heftig wie ein Schlangenbiss.
Instinktiv zuckte Zola zurück, noch bevor sie wirklich etwas hatte sehen können. Für die Dauer der Berührung aber hatte sie etwas hören müssen. Betäubendes Brüllen, nicht länger als ein Wimpernschlag. Dann war es wieder vorbei und Zola wie vom Donner gerührt.
War es wirklich wieder geschehen?
»Geht’s Ihnen gut?«, hörte sie jetzt die Mutter fragen.
Ja, es war wirklich wieder geschehen.
»Ein Glas Wasser vielleicht?«
Sie blickte auf. Die Frau wirkte wirklich besorgt. Einen Arm hatte sie um die Schulter ihres Sohnes gelegt, den anderen spürte Zola auf ihrer Schulter.
»Es ist nichts«, sagte Zola.
»Hören Sie, das tut mir wirklich leid, wenn …«
»Sehr freundlich, aber es geht schon«, unterbrach Zola und hob abwehrend die Hand. Sie meinte es auch so. Es war nichts. Es ging schon wieder.
»Wirklich?«
Ihre Hand zitterte. Zola klemmte die Hände unter die Achseln. Langsam sank sie auf den Hocker zurück. Spürte, wie ihr Herzschlag sich wieder beruhigte.
»Wirklich«, murmelte sie und sah zu Boden. »Ganz gewiss. Sehr freundlich. Ich habe mich nur erschrocken. Machen Sie sich wegen mir keine Sorgen. Ich brauche nur einen Moment der Ruhe.«
Und wirklich, was war schon geschehen? Es ist wieder passiert, dachte sie. Dabei hast du gedacht, es wäre vorbei. Vielleicht war es knapp. Ganz bestimmt aber nicht so schlimm wie damals. Und jetzt wird es nicht wieder passieren. Das wäre vollkommen verrückt. Ganz ruhig. Wo sind die Streichhölzer? Ich brauche jetzt eine Nelkenzigarette. Sofort.
Als sie wieder aufblickte, war sie endlich allein. Auf dem Tisch eine Münze. Zwei Reichsmark.
»Zu freundlich«, sagte Zola.
•
Ursel sah es nicht gerne, dass er neuerdings so oft Spätschichten übernahm.
»Mein Mann ist doch kein Malocher in der Papierfabrik!«, sagte sie dann, oder: »Deine Tochter weiß gar nicht mehr, wie du aussiehst!«
Eugen aber seufzte sich regelmäßig aus der Affäre, sprach von Verantwortung und dem Vertrauen, das der Chef in ihn setzte. Bei den vielen Kündigungen in den letzten Monaten, da konnte er den Landauer doch unmöglich im Stich lassen. Gelogen war das nicht. Vor wenigen Jahren hatte er sich noch Hoffnungen gemacht, bald in der FACKEL veröffentlichen oder seinen Namen in der WELTBÜHNE lesen zu können. Inzwischen hockten die Redakteure, mit denen er damals in Kontakt stand, allesamt im Exil oder im Knast. Weshalb Eugen es vorzog, seine Perlen beim GINSTERBURGER ANZEIGER vor die Säue zu werfen. Und weil er als Edelfeder für Leichtes und Lokales keine Karriere machen konnte, machte er sich eben nützlich.
Solche Erwägungen taktischer Natur konnte Ursel gut nachvollziehen. Sie waren aber nicht die ganze Wahrheit. Eugen hatte schlicht angefangen, die besondere Atmosphäre der Spätschichten zu genießen, wenn alle Schreibtische verwaist und die Schlachten des Tages geschlagen waren. Dunkelheit, wo tagsüber alles ausgeleuchtet war. Stille, wo sonst unablässig geredet wurde. Weite, wo sonst eiliges Gedränge herrschte. Letzte Korrekturen des Setzers, bevor die Zeitung endgültig in Druck gehen konnte. Das heroische Gefühl, als letzter Mann an Deck das Schiff in den Hafen steuern zu dürfen. Die seltenen Audienzen bei Landauer, der als Verleger und Chefredakteur jede fertige Ausgabe mit einem nächtlichen Cognac zu begießen pflegte. Was am Schreiben nicht Kunst, sondern Handwerk war – daran hatte er mittlerweile auch Gefallen gefunden.
Und so studierte er, die Hände auf den Umbruchtisch gestützt, kurz vor Mitternacht ein letztes Mal die Überschriften des kommenden Tages. Jüdischer Brandstifter in Frankfurt begeht Selbstmord. Räuberpistole, das lasen die Leute gerne. Mercedes-Benz gewinnt in Monte Carlo. Weil er schon Karten hatte für den »Großen Preis« am Nürburgring, interessierte ihn sogar diese Meldung. Germanen und Kelten in Ginsterburg. Ein Artikel, den er selbst hatte stark redigieren müssen, damit der Unsinn aus dem örtlichen Museum nicht auch noch seinen Weg in die Zeitung fand. Ehrentag der Luftwaffe in Berlin. Mehr Verlautbarung als Reportage, die allein von den Bildern lebte. Neue Negerunruhen in einem Vorort von Neuyork. Ein sehr lebhaft verfasster Korrespondentenbericht, der Ursel gewiss wieder einen wohligen Grusel bereiten würde. Kindesentführung in Frankreich
![Seemann vom Siebener [Ungekürzt] - Arno Frank - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a9b3ebbe2f517096544f7695637eb431/w200_u90.jpg)




























