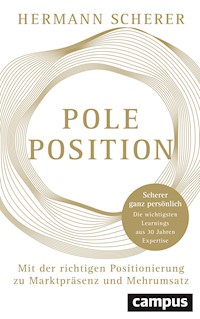Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Der Fisch springt nicht an den Haken und das Reh läuft nicht vor die Flinte. Genauso will auch die Chance gejagt sein. Glückskinder wissen das. Statt darauf zu warten, dass ihnen alles Gute einfach in den Schoß fällt, setzen sie ihre Chancenintelligenz ein: die Fähigkeit, Chancen zu erkennen und zu nutzen – und zwar die richtigen! Klingt banal? Warum sind wir dann nicht längst alle Glückskinder? Hermann Scherer erzählt viele Geschichten von Menschen, die Chancen in scheinbar unbedeutenden oder gar ausweglosen Situationen gesehen und ergriffen haben. Zum Beispiel von Stefan Raab, der es vom Metzgerei-Lehrling zum medialen Multitalent gebracht hat. Oder von Cliff Young, der im Alter von 61 Jahren den 875 km langen Ultra-Marathon in Overall und Gummistiefeln lief und gewann. Und Scherer macht klar, was man über Chancen wissen muss: Sie liegen nie in der Zukunft, sie pfeifen auf Regeln und sie sind so alltäglich wie das Leben! "Die Sorte Glück, die ich meine, wenn ich von Glückskindern spreche, ist der Zustand des Glücklichseins, der nicht durch einen zufälligen Glückstreffer hervorgerufen wird, sondern durch eine Art zu leben, die einem ermöglicht, dauerhaft Chancen zu entdecken und zu nutzen. Um diese Glückskinder und ihren besonderen Chancenblick geht es in diesem Buch." Hermann Scherer
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:1 Std. 48 min
Veröffentlichungsjahr: 2011
Sprecher:Sonngard DresslerHelmut WinkelmannOliver PreuscheAndreas LiebethalIsaak Dentler
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Hermann Scherer
Glückskinder
Warum manche lebenslang Chancen suchen – und andere sie täglich nutzen
Campus VerlagFrankfurt/New York
Über das Buch
»Die Sorte Glück, die ich meine, wenn ich von Glückskindern spreche, ist der Zustand des Glücklichseins, der nicht durch einen zufälligen Glückstreffer hervorgerufen wird, sondern durch eine Art zu leben, die einem ermöglicht, dauerhaft Chancen zu entdecken und zu nutzen. Um diese Glückskinder und ihren besonderen Chancenblick geht es in diesem Buch.«
Hermann Scherer
Über den Autor
Über 2000 Vorträge vor rund 400000 Menschen, 30 Bücher in 12 Sprachen, erfolgreiche Firmengründungen, Vorlesungen, eine anhaltende Beratertätigkeit und immer neue Ziele – das ist Hermann Scherer. Er lebt in Zürich und ist in der Welt zu Hause, wo er mit seinen mitreißenden Auftritten Säle füllt. Der Business-Experte »zählt zu den Besten seines Faches«. Süddeutsche Zeitung
Inhalt
SUCHMODUS – Warum kaum jemand den Expresslift im Empire State Building benutzt
ZWECKOPTIMISMUS – Warum die Menschen nicht loslassen
FIRST LIFE – Warum das Leben keine Generalprobe ist
TRUGSCHLUSS – Warum die Sonderangebote des Lebens zu billig sind
UNTERLASSER – Warum im Wartezimmer der Perfektion die Kassenpatienten der Veränderung sitzen
VERGEIGT – Warum wir unglücklich sterben
ZUTEILUNGSSTAU – Wie viele Chancen jeder im Leben bekommt
DURCHBRÜCHE – Warum Verwirrung unser bester Zustand ist
FILTER – Was Wald, Bäume und Lichtungen mit Komplexitätskompetenz zu tun haben
DURCHBLICK – Wie Glückskinder am Anfang das Ende denken
CQ – Wie Chancenintelligenz Glückskinder zu Entscheidungen führt
WIN-WIN-WIN – Eine Anleitung zum sozialen Individualismus
Register
SUCHMODUS
Warum kaum jemand den Expresslift im Empire State Building benutzt
Ich halte mich für ziemlich erfolglos. Das soll gar keine Koketterie sein; natürlich weiß ich, dass ich gemessen an allgemeinen Maßstäben durchaus erfolgreich bin, und damit meine ich nicht nur das Materielle, sondern auch Aspekte wie: wunderschöne Dinge erleben, zu den aufregendsten Orten der Welt reisen, spannende Menschen kennen lernen, mit wunderschönen Frauen zusammen gewesen sein.
Eine dieser wunderschönen Frauen in meinem Leben hat einmal zu mir gesagt: »Mein Gott, Hermann, jetzt sei halt endlich zufrieden!«
Und als sie dann in mein unzufriedenes Gesicht geschaut hat, versuchte sie mir zu erklären, wie das geht, das Zufriedensein: »Schau, vergleich dich doch mal mit den Menschen um uns herum. Für die meisten von denen bist du in vielerlei Hinsicht bereits dort, wo sie erst noch hinwollen. Kannst du das nicht sehen? Kannst du dann nicht zufrieden sein mit dir und deinem Leben?«
Nein. Kann ich nicht. Ich sehe das nicht, was die meisten Menschen wollen, sondern schaue nur auf die paar wenigen, die dort sind, wo ich noch hin will. Ich suche Chancen, um das zu schaffen, denn ich will so schnell und so weit wie möglich weg vom Status quo. Und das macht mich zu einem unausstehlichen Menschen. Ich weiß das. Ich kann mich ja oft selbst nicht leiden.
Eine Sache, die ich mir selbst fast nicht verzeihen kann, ist, wie dumm ich manchmal bin. Dann habe ich Sorgen und verschwende meine Kreativität, um mir die schlimmsten Szenarien auszumalen, die mich ereilen könnten, anstatt meine Kreativität einzusetzen, um nützlichere Dinge zu kreieren als schlechte Gefühle. Eine Hauptsorge, die mich dann umtreibt, ist, ich geb’s zu: es nicht zu schaffen.
Ich habe dann auch Angst, dass ich mein Leben bislang vergeigt habe und dass ich mich in meinen Selbsttäuschungsmechanismen bequem eingerichtet habe und der Tod täglich näher kommt, während ich nicht weiß, wie weit er noch entfernt ist. Ich hadere dann bitterlich mit den Problemen, mit denen ich mich herumschlage, anstatt sie als das zu erkennen, was sie sind: Chancen in Verkleidung.
In diesen Momenten weiß ich auch nicht mehr, was ich von Herzen gerne will, ich zweifle, ob meine Entscheidungen falsch gewesen sind, dabei weiß ich doch, dass es eigentlich gar kein Richtig oder Falsch gibt, sondern nur echte Chancen oder scheinbare Chancen. Nur kann ich dann den Unterschied zwischen den beiden Kategorien nicht mehr erkennen, weil meine Visionen verschwommen sind und ich das Zielbild meines Lebenspuzzles nicht mehr sehen kann.
Skeptisch bin ich dann auch noch! Ich begegne den Menschen mit meinem Zweifeln, und damit lernen diese Menschen mehr über mich als ich von ihnen. Sie spüren mein unausgesprochenes Nein zu ihnen, das einzig und allein die Funktion hat, mir selbst zu ersparen, mich zu verändern, dazuzulernen, mich aufzuraffen, etwas Neues zu erkennen. Skeptisch bin ich dann auch mir selbst gegenüber, denn ich misstraue mir, ob ich noch lange genug lebe, um beispielsweise ein guter Redner oder ein ernstzunehmender Autor zu werden. Nicht einmal der Zeit traue ich dann mehr, obwohl ich weiß, wie viel sie bewirken kann. Und ich scheue dann die Investitionen, die nötig sind, um voranzukommen, zweifle, ob es sich lohnen wird, so viel Zeit und Geld in meine Ziele zu stecken. Ob das jemals wieder herausguckt?
Kommt es überhaupt darauf an, was ich einzelner kleiner Trottel im Leben will?
Außerdem komme ich mir dann auf alberne Weise egozentrisch vor und frage mich: Kommt es überhaupt darauf an, was ich einzelner kleiner Trottel im Leben will? Sollte ich nicht viel mehr geben und helfen und mich um andere Menschen sorgen? Bin ich am Ende gar kein sozialer Mensch, sondern ein egoistischer Idiot, das Feindbild der halben Gesellschaft? Dabei weiß ich doch eigentlich genau, wie viel ich gebe und dass ich das nur kann, weil ich zuvor meinen Beitrag zum wirtschaftlichen Wachstum geleistet habe, indem ich selbst wirtschaftlich gewachsen bin. Ich weiß eigentlich, dass nur lebt, was wächst, und habe trotzdem das Gefühl, nicht gründlich genug nachgedacht zu haben bei allem, was ich angefangen habe.
Ja, ich weiß, langes Nachdenken führt nicht zu besseren Ergebnissen, sondern nur zu späteren Ergebnissen, aber in diesen dummen Momenten verliere ich die Sicherheit. Ich halte dann meine Visionen für Luftschlösser, finde die Luft, die ich atme, zu dünn und bin zu aller chronischen Unzufriedenheit auch noch unglücklich.
Oder auf den Punkt gebracht: Ich bin dann möglicherweise so wie Sie und jeder andere die meiste Zeit über ist. Und das kann ich weder mir noch Ihnen vorwerfen. Es ist nun mal so, Glück verspüren wir nur in ausgewählten Momenten. Trotzdem: Diese Phasen der Gewöhnlichkeit, der Durchschnittlichkeit, der Mittelmäßigkeit sind für mich so schrecklich, dass ich sie immer fluchtartig verlassen will. Denn ich weiß: Immer dann tickt die Uhr, während ich die Chancen verpasse, die mich meinen Zielen und Visionen näher bringen würden.
Aber ebenso kenne ich – so wie vermutlich auch Sie – Momente, in denen es anders ist. Momente, in denen ich das Gefühl habe, einigermaßen intelligent zu sein, insbesondere: chancenintelligent zu sein. Ich löse mich dann aus all den fruchtlosen Vergleichen mit anderen Menschen und fühle mich wie ein Glückskind. Ich bin dann ein Glückskind. Drei Sorten von Situationen sind das, bei denen es spürbar vorangeht in mir: in den Momenten zwischen Wachen und Schlafen, wenn ich in der Liebe bin und wenn ich spiele.
Sind wir nicht alle ein bisschen alpha?
Die Kraft, etwas zu bewirken, die Macht, etwas zu bewirken und die Fähigkeit, etwas zu bewirken, vereinigen sich in dem lateinischen Wort »Potenzial«. Das Wort ist derzeit sehr en vogue, wenn es um Motivation und Persönlichkeitsentwicklung geht: »Unleash the Power within!« – »Entfesseln Sie Ihr Potenzial!«
Eine andere Sorte Potenzial ist beispielsweise die potenzielle Energie, die im Unterschied zwischen der Größe zweier elektrischer Ladungen gespeichert ist. Stellen Sie sich das wie zwei Seen vor, die in unterschiedlichen Höhenlagen liegen. Die Energie, die im Höhenunterschied »gespeichert« ist, wird zur Wirksamkeit gebracht, wenn die beiden Seen durch einen Bach oder ein Rohr miteinander verbunden sind. Dann strömt das Wasser herunter, und die Bewegungsenergie des Wassers lässt sich durch ein Wasserrad, das mit einem Generator verbunden ist, in elektrischen Strom umwandeln, mit dem Sie zu Hause ein Schnitzel in der Pfanne braten können.
Solche Gefälle existieren überall. Wenn beispielsweise der Potenzialunterschied zwischen Himmel und Erde zu groß ist, dann zucken Blitze zwischen beiden und gleichen den Unterschied mit einer massiven Elektronenlieferung wieder aus. Genau das passiert ständig, in jeder Sekunde, in minimalster Ausprägung in Ihrem Kopf. In den bis zu 1000 Milliarden Neuronen in Ihrem Gehirn werden ständig Potenziale erzeugt, die sich mit kleinen Blitzen elektrisch durch die Nervenfasern, die Axone, entladen. Mit jeder Entladung wird eine Information transportiert, die am Ende der Axone, an den Synapsen, an die nächste Nervenzelle übertragen wird. Jedes Neuron bildet bis zu 10000 Synapsen-Schaltstellen mit anderen Neuronen. Insgesamt werden in einem Gehirn bis zu einer Billiarde, also eine Million Milliarden winzig kleine elektrische Schaltungen gebildet, die zusammen das neuronale Netzwerk Gehirn bilden. All diese kleinen Potenzialänderungen addieren sich auf und ergeben das, was wir Gehirnströme nennen. Mit einem Elektroenzephalographen, der über mehrere Elektroden, die am Kopf angebracht werden, die Abweichungen der elektrischen Felder misst, können wir unsere Gehirnströme messen. Sie schwanken stark – sowohl zeitlich als auch von Ort zu Ort im Gehirn. Diese Schwankungen werden auf einem Bildschirm als Kurvenverläufe angezeigt. Typisch sind dabei rhythmisch auf- und niederschwingende Kurven. Versierte Neurologen können darin Muster erkennen.
Weil die Informationen so zahlreich sind, teilen sie die Neurologen traditionell in so genannte Frequenzbänder ein. Da gibt es die Delta-Wellen mit einer niedrigen Frequenz von ein bis vier Schwingungen pro Sekunde. Messen kann man sie sowohl bei Säuglingen im Wachzustand als auch bei Erwachsenen im Tiefschlaf. Sollten Sie als Erwachsener einmal Delta-Wellen im Wachzustand haben, sind Sie kurz vor dem Ableben, denn dann haben Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eine schwere Hirnverletzung mit einer Hirnblutung oder Sie haben einen Schlaganfall oder einen epileptischen Anfall.
Theta-Wellen zwischen vier und acht Schwingungen pro Sekunde kommen vermehrt vor, wenn Sie sehr müde oder gerade eingeschlafen sind. Bei Kleinkindern sind sie auch tagsüber ganz normal.
Es gibt auch noch höherfrequente Beta- und Gamma-Wellen, aber besonders interessant sind die im Frequenzbereich oberhalb der Theta-Wellen, nämlich zwischen acht und 13 Schwingungen pro Sekunde, da heißen die Signale Alpha-Wellen. Sie werden vor allem gemessen, wenn ein Mensch sehr entspannt ist. Es ist ein merkwürdiger Zustand, nicht wach und aufnahmebereit nach außen, aber auch nicht schlafend, entrückt oder abgeschaltet. Dieser Alphazustand ist keine dumpfe, weggedämmerte Verfassung, sondern trotz allem In-sich-gekehrt-sein ein merkwürdig intelligentes Stadium, in dem man zum Beispiel sehr fantasievoll sein oder schwierige Probleme lösen kann. Einerseits sehr entspannt und ausgeglichen. Andererseits hellwach und beweglich, aber irgendwie nach innen gerichtet.
Ich kenne dieses Alpha-Gefühl auch vom Autofahren über lange Strecken. Sie kennen das vielleicht auch. Ich komme plötzlich irgendwo zwischen Adelzhausen und Odelzhausen schlagartig zu der Erkenntnis, dass ich von den letzten 100 Kilometern A8 nichts mehr weiß, das Bewusstsein war wie weggeknipst, aber trotzdem war ich wach, habe funktioniert. Immerhin sitze ich noch angeschnallt im fahrenden Auto und habe keine anderen Autos, Leitplanken oder Bäume touchiert. Und irgendwie habe ich außerdem klar vor Augen, dass ich das teure Angebot, das im Büro auf dem Schreibtisch liegt, annehmen sollte, obwohl es doppelt so teuer ist wie das Vergleichsangebot des Konkurrenten. Es ist sonnenklar: Teurer aber gleichzeitig preiswerter. Schlagartig ist das Angebot kein Problem mehr, sondern eine Lösung.
Mit Meditation können Geübte sich schnell jederzeit in einen solchen Zustand versetzen, den jeder von uns auch kurz vor dem Einschlafen automatisch durchläuft. In diesem Zustand können wir Menschen und Situationen besonders trennscharf einschätzen. Wenn sich gerade Chancen im Leben bieten, dann erkennen wir sie in diesen Momenten. Es tut sich ein kleines Fenster zwischen unserem mächtigen Unterbewussten auf und wir können die Erkenntnis ans Tageslicht in unser Bewusstsein holen, dass wir eine Chance erkannt haben. Denn wir alle erkennen permanent Chancen, wir sind uns dessen nur nicht bewusst. Dumm nur, wenn wir dann nach so einem hellsichtigen Moment einschlafen und alles wieder vergessen. Oder wenn wir tagsüber aus einem Alphazustand auftauchen und uns mit hektischer Betriebsamkeit die erkannte Chance wieder aus dem Bewusstsein drücken.
Die meisten Menschen nehmen die täglichen Alpha-Zustände nicht wahr. Ich auch oft nicht. Aber manchmal kapiere ich, dass ich gerade »alpha« war, und dann gelingt es mir bisweilen, eine Chance am Schwanz zu packen, bevor sie wieder in irgendeinen Spalt davongewuselt ist. Das sind visionäre Momente des Glücks.
Spielerischer Alpha-Amor
Um visionär denken zu können, darf uns die »realistische Realität« oder was wir dafür halten, nicht im Weg stehen, wir brauchen vielmehr ein hohes Maß an Realitätsanzweifelung oder Realitätsignoranz. Um Wege zum Ziel zu erkennen, die außerhalb des üblichen Alltagstrotts liegen, eben Chancen zu erkennen, müssen wir die Signale, die wir über die Realität empfangen, mit unseren nichtrealen Vorstellungen verbinden. Deshalb können Sie ein Brainstorming sofort verlassen, wenn jemand sagt: »Jetzt aber mal realistisch!«
Es gibt eine ganz bestimmte Verfassung, da spielt die Realität in der Tat keine Rolle. Das ist der Zustand, wenn ich in der Liebe bin. In der tiefen Liebe zu mir, den Mitmenschen, der Umgebung, der Welt. Dieser Zustand ist zumindest bei mir sehr selten. Das sind die Momente, in denen man mit sich und allem drumherum im Reinen ist, den Flow spürt, ja, die Energie des Lebens mit jedem einzelnen Atemzug geradezu inhalieren kann. Wenn Sie die tiefe Dankbarkeit spüren, das Leben zu leben, wenn Sie Gänsehaut haben.
Nicht so tiefgreifend, dafür sehr kreativ ist der ausgeprägte Spieltrieb. Wenn ich mich gehen lassen würde, wäre ich – da bin ich ziemlich sicher – ein notorischer, spielsüchtiger Casinobesucher. Ich kenne mich gut genug, um mich in dieser Hinsicht unter Kontrolle zu behalten. Aber mein Spieltrieb ist ja Gott sei Dank auch nicht auf das Glücksspiel um Geld am Roulette-Tisch begrenzt. Ich probiere insbesondere in meinen Unternehmungen manchmal planfrei und spontan herum, alleine aus Freude über das Spielen, nicht an einen bestimmten Zweck gebunden. Natürlich will ich dabei gewinnen, also ein gutes Geschäft machen, das meine Spielräume weiter vergrößert, das mich auf meinem Weg zu meinen Zielen voranbringt. Das ist Teil des Spiels.
Die Herangehensweise des Spielers ist im Leben deshalb so interessant, weil ein Spieler agiert. Er reagiert nicht auf Reize, sondern er setzt sie. Er ist offensiv, tut Dinge freiwillig und unvorhersehbar. Ein Spieler begründet nicht, er macht einfach. Es geht dann beispielsweise auch nicht mehr ums Geld. Es ist doch egal, wie viel es kostet, der Erfolg ist wichtiger als der Gewinn. Das ist der Moment, in dem die Realität mit unseren bewussten, also eingebildeten Zwängen und Beschränkungen keine Rolle mehr spielt. Genauso wie beim Alpha-Zustand oder in der Liebe sind wir beim Spielen frei. Und innere, geistige Freiheit ist die Voraussetzung für den Chancenblick.
Interessanterweise habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass die Geringschätzung des finanziellen Einsatzes zu Beginn dann am Ende zu einem umso größeren Rückfluss an finanziellen Mitteln geführt hat, denn wenn die Kosten im Spiel nicht wichtig sind, trauen wir uns, groß zu denken. Und wer groß denkt, vergrößert seine Chancen auf den Erfolg erheblich.
Alpha-Entspannung, Liebe und Spiellaune. Diese Zustände sind in ihren Extremen eher selten. Aber ich glaube, dass es auch einen Dauerzustand gibt, der vielleicht so etwas wie eine Mischung aus diesen drei Zuständen ist, ein spielerischer Alpha-Amor sozusagen, den einige wenige Menschen ständig und dauerhaft besitzen. Das sind Menschen, vor deren Lebenswerk wir in Ehrfurcht in die Knie gehen, die wir bewundern, weil sie scheinbar immer alles richtig machen, immer allen eine Nasenlänge voraus sind, zum Teil extreme Lebenswege hinter sich haben, vom Kleinkriminellen zum Milliardär, vom steinewerfenden Taxifahrer zum Außenminister, vom Bedürftigenstipendiaten zum amerikanischen Präsidenten. Diese Glückskinder sehen und nutzen täglich Chancen, die die anderen ein Leben lang suchen.
Und das hat nichts mit König Zufall zu tun. Die Sorte Glück, die ich meine, wenn ich von Glückskindern spreche, ist vielmehr der Zustand des Glücklichseins, der nicht durch einen zufälligen Glückstreffer hervorgerufen wird, sondern durch eine Art zu leben, die einem ermöglicht, dauerhaft Chancen zu entdecken und zu nutzen. Neuerdings sagt man auch Erfüllung dazu. Um diese Glückskinder und ihren besonderen Chancenblick geht es in diesem Buch. Irgendwie machen diese Menschen das ja, irgendwie zwingen sie das Glück, erarbeiten sich ihre Chancen. Machen wir uns nichts vor, keinem fällt der Erfolg dauerhaft in den Schoß. Aber wie genau machen die das?
Planung ersetzt lediglich Zufall durch Irrtum
Eines ist sicher: Planen lässt sich im Leben nichts. Planung ersetzt lediglich Zufall durch Irrtum, denn im Leben kommt es immer anders, als man dachte. Glückskinder haben nicht die bessere Methode oder den besseren Plan. Ich glaube vielmehr daran, dass glücklich werden kann, wer die Fähigkeit herausbildet, seine Chancen im Leben zu erkennen und zu nutzen.
Der beste Deal
Der Magen rutschte mir in die Kniekehlen, wir stiegen auf, 10., 20., 50., 86. Stock. Als ich ausstieg und ins Freie trat, sah ich über mir nur noch die mächtige Antenne, deren Spitze bei schlechtem Wetter in 449 Meter Höhe durch die Wolken sticht.
Ich genoss den Ausblick über die schönste Stadt, die ich kenne, nicht zum ersten Mal, aber wie jedes Mal war ich überwältigt. Beim Anblick von Downtown Manhattan, im Hintergrund die Freiheitsstatue, dahinter Staten Island und dann das Meer, hatte ich wie schon so oft einen Kloß im Hals. Ich liebe diese Stadt.
Als ich vorhin, an diesem brütend heißen Julitag, die Lobby des Empire State Building betreten hatte, da hatte es sich angefühlt, wie in den Glanz und Reichtum des großen amerikanischen Jahrhunderts einzutauchen. Art-Déco-Reliefs, Marmor, ein goldener Schimmer lag über der Halle. Dann hatte ich die mehreren hundert Touristen gesehen, die zum Takt der Wanduhr in den Lift träufelten wie Kochsalzlösung in die Vene eines Infarktpatienten. Ich hatte auch nach oben gewollt.
In gewisser Weise ist all das hier das Werk von George McAneny, 5. Bürgermeister des jungen Bezirks Manhattan. Als sein Amtsfüller am 25. Juli 1916 majestätisch über die »New York Zoning Resolution« glitt, zeichnete er mit einem Federstrich das Gesicht der Stadt, die wir heute kennen. Die Bauvorschrift, in die die Tinte sickerte, verordnete Manhattans Skyline unter anderem ihre charakteristischen Setbacks, die terrassenförmige Verjüngung der Wolkenkratzer gen Himmel.
Eine dieser Terrassen, kaum breiter als eine Tischtennisplatte, ist heute ein Touristenmagnet, der sich nur mit der Chinesischen Mauer und den Pyramiden von Gizeh messen lassen muss: das 86th Floor Observation Deck, die Aussichtsplattform hoch über dem Betondschungel am Hudson auf dem Dach des Empire State Building. Dieses Bauwerk ist eine Legende. Genauso legendär sind die Schlangen an seinen Aufzügen.
Das Ticket in den 86sten kostete 15 Dollar. Zu diesem Preis durfte man sich hinten anstellen. 30 Dollar kostete der Express Pass. Wie schön, ich hatte die Wahl! Ich hatte keinen Augenblick gezögert. Am Schalter hatte ich meine Kreditkarte durch den Schlitz zwischen Marmor und Panzerglas geschoben, und sie war prompt zusammen mit meinem Express Pass wieder zurückgekommen – inklusive Lächeln der Kassiererin. Ein Ordner hatte die dicke rote Absperrkordel ausgehakt, war zur Seite getreten und hatte mich durchgewunken. Ich war an der Schlange vorbeigegangen und in den Aufzug gestiegen.
Auf dem Rückweg nach unten und hinaus auf die 5th Avenue kam ich jetzt wieder an dieser langen Menschenschlange vorbei, wo dieselben Gesichter wie vorhin darauf warteten, endlich nach oben fahren zu dürfen. An der Tür nach draußen kam mir ein junges Pärchen entgegen, Deutsche. Sie sagte zum ihm: »Oh, schau mal, die stehen alle an, das geben wir uns nicht.«
Er sagte: »So ein Mist!«
Ich sagte wie ein hilfsbereiter New Yorker: »Nehmt doch den Express Pass. Kostet das Doppelte, aber dann dürft ihr sofort nach oben, an der Schlange vorbei.«
Aber an ihren Gesichtern konnte ich ablesen, dass diese Option wohl nicht in die engere Wahl kam. Er sah so aus, als ob er die Investition scheute, sie sah so aus, als könnte sie es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, wie ein VIP an all den Wartenden vorbeizugehen.
»Oder geht rüber zum Rockefeller Center, 50. Straße, das ist fast noch schöner. Und die Schlangen sind nicht so lang.«
Ich ging weiter und konnte noch sehen, dass die Laune und die Tatkraft der beiden im Keller waren. Warum eigentlich? Was an dieser Situation machte sie denn so verdrießlich? Sie hatten doch alle Möglichkeiten: Kleines Ticket mit Anstehen oder großes Ticket und schnell hinauf oder den eigentlich noch schöneren Blick vom Top of the Rock auf dem Rockefeller Center, wo man sowohl den Central Park viel besser sehen kann als auch obendrein das schönste Gebäude der Stadt bewundern kann, weil man nämlich nicht gerade selber draufsteht: das Empire State Building. Oder sie könnten ganz darauf verzichten und einen der unzähligen anderen tollen Plätze aufsuchen, die es in dieser Stadt der wahrlich unbegrenzten Möglichkeiten gibt. Aber miese Laune bekommen? Wohl die schlechteste Option. Warum sehen sie die Chancen nicht? Warum sind sie so fixiert auf das Eine, das sie geplant hatten, und das sich jetzt als ein wenig problematisch herausstellt?
Als ich draußen nach einem Taxi winkte, drehte ich den Gedanken im Kopf anders herum: Warum habe ich als Einziger von allen Besuchern weit und breit diesen Express Pass gekauft? Was genau war es, was mich ohne mit der Wimper zu zucken, ja, ohne es groß zu bemerken, den Sonderweg gehen ließ, der für mich aussah wie der einzig vernünftige Weg? Und was genau war es, was denen da unten den Weg nach oben versperrt hatte? 15 Dollar Aufpreis? Geschenkt! Bei geschätzten 1500 Dollar Invest in einen Wochenend-Trip nach New York kosten drei Stunden Warten zehnmal so viel wie ein Express-Ticket. Es kann nicht das Geld sein, jedenfalls stünden die gesparten 15 Dollar in keinem vernünftigen Verhältnis zum Preis, der dafür stattdessen zu berappen wäre: drei Stunden Erleben einer grandiosen Stadt verloren und diese wertvolle Zeit in einer Warteschlange verplempert! Oder so gesehen: Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Beam-Apparat, der Sie mit einer Raumschiff-Enterprise-Technologie völlig ungefährlich und innerhalb eines Sekundenbruchteils von Ihrem Wohnzimmer nach New York befördern könnte. Drei Stunden Aufenthalt in Manhattan würden 10,40 Euro vierzig Cent kosten, nach dem aktuellen Kurs 15 Dollar. Guter Deal? Was für eine Frage! Der Preis eines Kinotickets. Der beste Deal, den ich mir vorstellen kann, ich würde wahrscheinlich versuchen, ein Abo auszuhandeln, um jeden Tag rüberzubeamen. Das Expressticket ist eines der besten Geschäfte, die ich kenne. Aber so sehen das die Leute nicht. Nur: Wie sehen sie es denn?
Ist es Zugehörigkeit? – Die da oben, wir da unten. Unsereins stellt sich eben in die Reihe. Hm. Ist es Angst? – Der Weg nach vorn, vorbei an allen andern. Allein. Wer will sich derart exponieren? Warum ausscheren? Nach dem Gesetz der Herde ist immer der Ausreißer Schuld. »Fürchte den Zorn der Menge!«, sagt der Mann im Ohr. »Sie packt dich und zertrampelt dich. Also lass es!« Naja. Oder ist es schlicht Mittelmäßigkeit der Gedanken? Unflexibilität im Geiste? Ungewohntheit der Optionen? Das will ich alles kaum glauben. Also will ich der Sache auf den Grund gehen.
Chance oder nicht?
Chancen sehen zweitens oft nicht wie Chancen aus, drittens haben sie nichts mit Visionen zu tun, viertens fallen sie einem nicht in den Schoß, fünftens liegen sie nie in der Zukunft, sechstens gehorchen sie keinen Regeln. Und erstens sind Adventskalender todlangweilig.
Man muss nur den Glaubenssatz streichen, dass an jedem Tag Schokolade drin sein muss.
Jeden morgen im Dezember die Frage: Was mich heute wohl erwartet? Uuuiii, Schokolade. Das ist zwar einerseits fantastisch verlässlich, andererseits aber auch sehr gewöhnlich, alltäglich, banal. Und genau da liegen sie, die Chancen: im Alltäglichen nämlich. Das Prinzip des Adventskalenders ist nämlich eine wunderbare, zeitlose Idee. Man muss nur den Glaubenssatz streichen, dass an jedem Tag Schokolade drin sein muss. Deshalb bastele ich meine seit Jahren selbst, mit großem Vergnügen. Ich fülle Stoffsäckchen, Filzhütchen und Flanellläppchen je nach Vorliebe meiner Lieben. Letztes Jahr habe ich mir was ganz Raffiniertes einfallen lassen. Da mein (damaliger) Schatz Häagen-Dazs-Eis fast noch mehr liebte als mich, bin ich in die nächste Filiale gegangen und habe mir 24 leere Dosen inklusive Deckel zugelegt. (Nach kurzem Diskurs über Markenhygiene zum Preis einer Eisportion. Die Leute dort sind nicht auf den Kopf gefallen.)
Die Becher habe ich mit allerlei Schnickschnack gefüllt, von der Mozartkugel über den Massagegutschein bis fast zum Zwölfkaräter an Nikolaus. Die Überraschung zu Heiligabend verrate ich natürlich nicht. Meine Adventskalender erfreuen sich von Jahr zu Jahr wachsender Beliebtheit und das nicht nur bei meiner Partnerin, sondern vor allem auch bei meinen Freunden. Denn die wollen (es werden Jahr für Jahr mehr Bestellungen) genau so einen Kalender für ihre Frauen. So bekomme ich schon im Oktober die ersten Anrufe: »Hermann. Hör mal. Du machst das doch eh. Ist doch egal, ob ein-, zwei- oder dreimal!?«
So und dann kommt es, ich kann nicht anders: Ich bin angesichts dieser Erfahrungen der festen Überzeugung, dass mit einem kleinen feinen Premium-Adventskalender-Shop im Internet und der nötigen Pressearbeit in den Society-Titeln unter dem Motto »Make your own Adventskalender« ein gutes Geschäft zu machen wäre. Das ist keine rocket science.
Sie sind so hundsgewöhnlich wie ein Teebeutel, ein Schmetterling, ein Fliegenpilz.
Im Gegenteil, es ist sogar ziemlich banal. So banal, dass mittlerweile Porsche Design damit begonnen hat, Adventskalender zu vertreiben, momentan limitiert auf fünf Stück weltweit zum Einzelpreis von 1000000 Euro. Inklusive Motorboot und übrigens ohne Porsche. Den hat man ja schon. Das ist die gleiche, schlichte, alltägliche Idee, nur sehr konsequent umgesetzt. Chancen sind so alltäglich wie das Leben. Sie sind weder zahlreich noch selten. Sie sind so hundsgewöhnlich wie ein Teebeutel, ein Schmetterling, ein Fliegenpilz. Das ist der erste Punkt.
Jede Chance ist nur eine Betrachtungsweise des Alltags. Wir halten sie für selten, weil Menschen mit der Fähigkeit zur ganz speziellen Betrachtungsweise so selten sind. Menschen, die die Frequenz des Tarnschildes kennen, mit denen sich die Chancen überall im Leben verbergen. Sie sehen auf den ersten Blick nicht aus wie Chancen, das ist Punkt zwei.
An Irrtümer und Gefahren trauen sich erst recht die wenigsten heran. Dort lauern die echten, fetten Chancen, gut verborgen. Und oft sehen sie sogar wie Niederlagen aus.
So wie am 12. April 1961, als ein Mann mit rot-weiß gestreifter Krawatte und Seitenscheitel in ein Mikro spricht, das aussieht wie eine Kreuzung aus Toaster und Rasierapparat. Seine Rede klingt wie eine Predigt. Aber das erwarten die 200 Millionen Zuhörer an den Radio- und Fernsehgeräten von einer »Special Message to the Congress on Urgent National Needs«. Juri Gagarin hat vor wenigen Stunden als erster Mensch im All die Erde umrundet. Die Sowjets triumphieren. Sie haben den Amerikanern zum dritten Mal in Folge einen empfindlichen Schlag versetzt. Und das in nur fünf Jahren. 1957 der Sputnikschock. 1961 das Desaster in der Schweinebucht. Und jetzt das. Kein Punktsieg, sondern ein Knock-out. Voll auf die Bretter geschickt, vor den Augen der ganzen Welt, von einem System, dem man sich wirtschaftlich und moralisch um Lichtjahre überlegen wähnt. Nur einer fliegt zum ersten Mal ins All. Der erste Amerikaner hätte erst in drei Wochen abheben sollen. Das konnte man sich jetzt sparen. MISS – »Man in Space soonest«, das amerikanische Programm ist gescheitert.
Der Herr mit der Fönwelle, auf dessen Lippen sich nun die Augen der Welt heften, heißt John Fitzgerald Kennedy. Aufrecht steht er im Kongress vor dem Sternenbanner. Vor allem aber steht er mit dem Rücken zur Wand. Er hat eine Überraschung mitgebracht für die geschundene amerikanische Volksseele. »Die Zeit ist gekommen, einen Sprung voran zu machen. Zeit für ein großes, neues amerikanisches Unternehmen. Unsere Nation sollte sich das Ziel setzen, noch vor dem Ende dieses Jahrzehnts einen Menschen auf dem Mond zu landen.« Der Trick kommt zum Schluss: »Es wird nicht nur ein Mann zum Mond fahren. Sondern eine ganze Nation. Denn wir alle müssen mithelfen, ihn da hoch zu bringen.«
Mit diesem Geniestreich sichert Kennedy sich alle Systemvorteile. Er vereint Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hinter sich. Das bleibt nicht ohne Folgen. Das Wirtschaftswachstum steigt, die Stundenlöhne auch. Die Arbeitslosigkeit sinkt, die Scheidungsrate und die Selbstmordrate auch. Sogar die Zahl der Alkoholiker geht in den folgenden Jahren messbar zurück. Die Nation hat ein leuchtendes Ziel. Jeder Amerikaner kann es sehen. Beim Aufstehen, beim Zubettgehen, im Autokino, beim verliebten Spaziergang durch die Nacht. Der Mond. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Ziel aus kaltem politischem Kalkül. Denn fünf Stunden vor seiner Rede war der Mond für Kennedy noch aus grünem Käse.
Ein handfestes Problem ist immer ein guter Anfang.
Chancen sind eben keine Visionen. Das ist der dritte Punkt. Politiker, Sportler, Banken, Joghurts, Baumärkte – alle haben heute Visionen. Aber was sollen das für Visionen sein? Da liegt eine Verwechslung der Begriffe vor. Lieber mal Probleme haben, finde ich! Ein handfestes Problem ist immer ein guter Anfang. Kennedy war ein abgekochter Hund. Er hatte Marilyn Monroe in einem Hinterzimmer des Weißen Hauses. Aber hatte er eine Vision? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er ein großes Problem hatte: Die Russen hatten drei Jahre Vorsprung. Doch weil JFK ein ziemlicher Hasardeur war, witterte er dahinter die Chance.
Wer zentrale Probleme sichtbar besser löst als andere, der regt einen kybernetischen Kreislauf an, mit dem er seinen Erfolg am Ende nicht verhindern kann!
Das ist nichts weiter, als ein Differenzierungsfenster im Wettstreit der Ideen zu öffnen. Wer ein Problem löst, erwirbt für einen bestimmten Zeitraum eine Alleinstellung. Einen Selektionsvorteil. Das ist ein Prinzip der Wirtschaft, weil es ein Prinzip der Welt ist: Wer zentrale Probleme sichtbar besser löst als andere, der regt einen kybernetischen Kreislauf an, mit dem er seinen Erfolg am Ende nicht verhindern kann! Mit ein wenig Glück währt dieser Vorteil ein Leben lang. Doch vielleicht kopieren ihn auch morgen schon die Chinesen. Und so wie der Fisch nicht an den Haken springt und das Reh nicht vor die Flinte läuft, will auch die Chance gejagt sein, Punkt vier.
»Der Zivilisation ist es gelungen, das Raubtier im Menschen auszuschalten. Nicht aber den Esel«, wusste Churchill. Raubtiere müssten eigentlich Chancentiere heißen. Sie sind Fleisch gewordene Initiative. Mit jeder Faser ihres Körpers erzwingen sie die Entscheidung. Würden wir mit dem Blick des Jägers auf Gewohntes, Gewöhnliches, auf das Tagesgeschäft schauen, wären überall Chancen sichtbar. Gerd Müller, wahrscheinlich das größte Chancentier in der Geschichte des Fußballs, hat das so formuliert: »Wenn’st denkst, is’ eh zu spät«
Und wie das immer ist: Hinterher sieht alles ganz einfach aus. So zwingend, so logisch.
Denn Punkt fünf: Chancen liegen nie in der Zukunft. Sondern immer vor der Nase. Alle warten auf den einen Job, das eine große Ding. Dabei ist es die Hingabe an das Jetzt und Hier, die aus nichts die Chance schafft. Der Schlüssel ist Initiative. Erst in der Rückbetrachtung reihen sich die Gelegenheiten wie Perlen auf der Schnur. Denn Chancen bilden Ketten, Cluster. Und wie das immer ist: Hinterher sieht alles ganz einfach aus. So zwingend, so logisch.
Einer, der das meisterhaft beherrscht, fing als Witzfigur an und wird die ganz Großen im deutschen TV beerben: Stefan Raab. Als Metzger fehlt ihm schon von Berufs wegen jeder Skrupel. Er hatte schon früh ein Problem entdeckt. Ralf Siegels Würgegriff hatte eines der größten TV-Events der Welt, den »Grand Prix de la Chanson d’Eurovision«, in Deutschland zu einer Lachnummer verkommen lassen. Nur noch für Omakränzchen und die Gay-Community konsumierbar, die sich mit einem Augenzwinkern an der Paradiesvogelei erfreute. Dann kam der Fernsehmetzger. Mit »Wadde hadde dudde da« veralberte er die Veranstaltung auf ihrem Hochaltar. Und viele Entertainer hätten eine Grand-Prix-Teilnahme schon als Höhepunkt ihrer Karriere gefeiert. Doch Raab hatte Blut geleckt. Das war erst seine Lehrlingsarbeit.
Mit so einer großen, alten Marke wie dem Grand Prix musste mehr machbar sein in Deutschland. Er baute eigene Kandidaten auf und schickte sie in den Wettbewerb. Mit überraschenden Ergebnissen. Sein Gesellenstück war der »Bundesvision Song Contest«. Hier spielte er mit den Möglichkeiten seiner hauseigenen Produktionsfirma die Veranstaltung auf nationaler Ebene nach. Und machte so die Granden des öffentlich-rechtlichen Rundfunks neugierig. Gemeinsam richteten sie den nationalen Vorentscheid aus. Das Ergebnis ging hoch wie ein Satellit, setzte sich in Oslo die Krone auf und singt sich seitdem durch die Charts: Lena – Raabs Meisterstück.
Chancen pfeifen nämlich auf Regeln.
Chance ist Reframing. Ein Prozess wird in einen völlig neuen Kontext gestellt. Das gelingt nur wenigen. Weil nur wenige anarchisch genug denken. Die Regeln, denen die Mehrheit ihre Gehirne oft bestürzend vollständig überantwortet hat, löschen jeden Zündfunken. Chancen pfeifen nämlich auf Regeln. Punkt sechs.
So sind also Chancen. Und wie sind die potenziellen Chancenverwerter? Vor allem eines: voller Hoffnung!
Gehofft, geplant und abgehakt
Als das Lebensmittelgeschäft meines Vaters vor dem Aus stand, hatte er in seiner höchsten Not einen Brief an Otto Wiesheu geschrieben, damals Bayrischer Wirtschaftsminister. Als rechtschaffener Bürger, Steuerzahler, Respektsperson mit tadellosem Leumund, als verantwortungsvoller Brötchengeber und Stütze des öffentlichen Lebens in Gemeinde und Partei bat Vater um Hilfe und hoffte, der Wiesheu würde ihn da raushauen. Er hätte auch an Superman oder das Sandmännchen schreiben können. Das war mir von Anfang an klar. Und ich konnte Vaters kindlichen Versuch innerlich nur mühsam mit seiner Verzweiflung rechtfertigen, den Totengräbern seines Lebenswerkes ins Auge blicken zu müssen. Monatelang kam gar nichts. Ich sehe ihn noch heute mit leerem Blick am Briefkasten stehen. Irgendwann kam ein Brief mit lauwarmen Worten und den besten Wünschen für die Zukunft.
Die Hoffnung, dass andere etwas bewegen, ist Selbstaufgabe.
Die Hoffnung, dass andere etwas bewegen, ist Selbstaufgabe. Medien, Parteien, manche antiquierten Verbände – sie schläfern die Menschen ein. Sie betäuben uns mit Hoffnung. Damit alles so bleibt, wie es war, vor allem ihnen ihr Posten erhalten bleibt. So wie der Fortschritt der Medizin mit einer stetigen Verschlechterung der Volksgesundheit einhergeht, so erhöht die Politik mit stetig steigenden Steuern und Abgaben die Unfähigkeit zur Selbstverantwortung. Das ist aus Sicht der Mediziner und Politiker und aller von ihnen Abhängigen ein durchaus logisches und sinnvolles Konzept, das ganz offensichtlich dauerhaft funktioniert, denn es erhält sich selbst am Leben. Es ist nur für die Behandelten und Regierten nicht ganz so sinnvoll wie für die Behandler und Regierenden.
Warum sollte jemand anderes meinen Interessen nachgehen? Was mich betrifft, nehme ich lieber selbst in die Hand. So einfach. Das kann man mit Egoismus verwechseln, mit Härte oder gar sozialer Kälte. Ich nenne es Selbstdisziplin und Verantwortung. Und ich weiß, dass meine Art, mit Verantwortung umzugehen, mich in einer komplexen Welt handlungsfähig hält. Mir ist aber auch klar, dass es für viele Menschen, je nach Wertesystem, ein Rätsel ist, wie man so leben kann wie ich: ganz ohne Netz und doppelten Boden. Ganz ohne Hoffnung.
Als ich das Geschäft meines Vaters übernommen hatte, arbeiteten wir hart an Sanierungsplänen. Die Banken waren dabei gelinde gesagt keine große Hilfe, ich war aber sowieso zu beschäftigt, um die Situation hoffnungslos zu finden, und zwar beschäftigt mit einer zu treffenden Entscheidung. Es ging um zwei Alternativen, ich war nicht sicher… und fragte meinen Coach und Mentor. Ausführlich erklärte ich ihm alle Details. Ich weiß noch, mit welcher Ruhe er sich den Schwall meiner Pros und Contras anhörte. Ohne eine einzige Nachfrage. Danach blieb er erst mal stumm. Ich wartete auf seine Antwort, ungeduldig und gereizt.
»Mach das Zweite da… Mit dem Dings…«, sagte er nach einer gefühlten Ewigkeit.
»Wie? Das Zweite da? Mit dem Dings!?« Mir platzte der Kragen. »Hast du mir überhaupt zugehört?«
»Nö«, sagte er, »ich höre dir nie zu, wenn du so rumsabbelst. Aber ich habe gesehen, wie bei Alternative Nummer zwei deine Augen angefangen haben zu leuchten…«
Er hatte, wie immer, völlig recht.
Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit eintretender Kosten höher als die Wahrscheinlichkeit eintretender Umsätze.
Auf Vernunft kommt es meistens nicht so sehr an, wie wir glauben. Ich glaube an Business-Pläne genauso wenig wie an die Hoffnung, weil ich abertausende gesehen und gehört habe. Alle sind irgendwie falsch und richtig zugleich. Wichtig ist am Ende nur das Augenfunkeln. Die Vernunft plant. Und plant sich damit von der Wirklichkeit weg. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit eintretender Kosten höher als die Wahrscheinlichkeit eintretender Umsätze. Also trifft der Planer im entscheidenden Moment die vernünftigste, nämlich die mutloseste Wahl. Der Bauch dagegen weiß nichts, er will einfach. Und er gewinnt völlig ungeplant.
Geld tötet Kreativität.
Ich kenne mich. Ich bin kein Außerirdischer. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Und ich weiß, es geht immer was. Um so unverständlicher ist mir, warum andere Menschen glauben, dass so oft nichts geht. Wie sie so trotzig und unbelehrbar darauf hoffen, dass von irgendwo Hilfe kommt, oder wie sie die Wunschergebnisse planen und vor lauter Zukunftsplanung vergessen, so schnell wie möglich das Beste aus der Gegenwart herauszuholen. Ich habe lange Zeit fast jedes Jahr eine neue Firma gegründet – keine mit mehr als 2500 Euro. Mehr ist meistens auch nicht nötig, manchmal sogar schädlich, denn Geld tötet Kreativität.
Was ich gemacht habe, hätte jeder gekonnt. Ich komme nicht aus behütetem Elternhaus mit Sondervorteilen. Im Gegenteil. Ich habe einen riesigen Berg von Schulden übernommen. Ich habe nie gewartet oder gebeten oder Pläne geschmiedet. Sondern immer gehandelt. Und die Schulden restlos abgetragen. Es ist die Hoffnung auf die helfende Hand, genauso wie die Planung der kommenden Gelegenheit, die die Menschen lähmt. Hoffnung und Planung sind Mauern und Gitter.
Ich habe mich nie auf meine Talente verlassen, das Risiko war mir zu groß.
Die Entscheidung mit dem Funkeln in meinen Augen betraf die Chance, dass ich als Vortragsveranstalter mich selbst für Vorträge engagieren könnte, und als Vortragsredner nicht nur meinem Mitteilungsbedürfnis Rechnung tragen könnte. Nicht dass ich als Redner von vornherein mit großem Talent gesegnet war, aber darauf kommt es letztlich ja auch nicht an. Übung ist effektiver als Talent. Ich habe mich nie auf meine Talente verlassen, das Risiko war mir zu groß.
Also habe ich meine Firma »Unternehmen Erfolg« gegründet, die als Vortragsveranstalter schnell Marktführer im ganzen Bundesgebiet wurde.
Ich fand weiter neue Chancen. Zum Beispiel die Intransparenz: Welche Redner sind gut und welche nicht? Ein echtes Problem für jeden Veranstalter. Daraus wurde das Deutsche Rednerlexikon. Und die Redneragentur vortragsimpulse.de. Eine Chance zieht die nächste nach sich. Trainerlexikon, Beraterlexikon, Coachlexikon. Redner brauchen Räume, sprich Hotels oder Veranstaltungsorte: Hotellexikon. Aber ich will Sie nicht langweilen. Sie wissen, worauf ich hinaus will.
Das ist nicht normal, ich weiß das wohl. Normal ist dagegen mein Freund aus Grundschultagen: 47, Elektrikerlehre, zweiter Bildungsweg, Fachinformatiker. Hat 20 Jahre Computer zusammengelötet, bis der Wettbewerb seinen Arbeitgeber nach fünf Jahren Todeskampf erlegt hatte. Ein paar Monate lang hat er noch Bewerbungen geschrieben. Heute sitzt er zu Hause, bemalt Zinnsoldaten und geht früh zu Bett.
Doch statt seine Armeen in Marsch zu setzen, stellt er sie in den Schrank.
Jetzt aber wird es spannend. Zinnsoldaten – er ist wirklich gut darin! Seit eh und je haben ihn alle um seine Sammlung beneidet. Inzwischen ist die Qualität seiner Figuren einmalig. Er ist sozusagen der Zinnsoldatexperte. Ständig wird er von Bekannten um Stücke gebeten. In Zeiten des Onlinehandels könnte er mit dieser Handarbeit ein kleines Vermögen machen. Und das mit purem Vergnügen. eBay, Facebook, Xing – innerhalb eines Tages stünde ihm die Welt offen, eine Riesenchance, nach einiger Zeit mit Freude mehr zu verdienen als jemals zuvor in seinem Leben. Doch statt seine Armeen in Marsch zu setzen, stellt er sie in den Schrank. Und kassiert Hartz IV.
Ich habe ihn nach dem Grund gefragt. »Warum nicht?«, war seine Antwort. »Das ist mein gutes Recht. Schließlich hab ich 25 Jahre lang eingezahlt.«
Menschen entscheiden sich konsequent und trotzig gegen die Chance. Sie sehen sie nicht, weil sie nicht danach suchen. Sie hoffen lieber, sie planen lieber. Oder sie entscheiden sich dafür, den ganzen Stress mit den Chancen ein für allemal abzuhaken.
Das geht doch nicht!
Kyle McDonald hatte keine Hoffnungen. Er hatte auch keinen Geschäftsplan, ja er hatte nicht einmal eine Geschäftsidee, als er in seiner Einzimmerbude saß und langsam eine rote Büroklammer zwischen Daumen und Zeigefinder drehte. Außer einem speckigen Laptop besaß er nicht viel, was deutlich mehr wert gewesen wäre als das gebogenes Stück Kupferdraht mit Weichplastik-Überzug. Was Kyle aber hatte, war ein Gedanke: Ein Tausch von zwei unterschiedlichen Gegenständen kann für beide Seiten ein lohnendes Geschäft sein. Tauscht man den eingetauschten Gegenstand wiederum mit einem guten Geschäft ein, erhöht sich der erzielte Wert ein weiteres Mal. Und wenn man dann weitertauscht? Und weiter und weiter und weiter? Wie oft muss man diese schlichte rote Büroklammer »hochtauschen«, bis daraus ein Haus geworden ist? Hm. Ausprobieren!
»Tausche Büroklammer gegen Haus.« Diese Idee bloggte er kurzerhand auf oneredpaperclip.blogspot.com. Der Gedanke war in der Welt. Dann ging alles überraschend schnell.
Die Büroklammer tauschte er gegen einen fischförmigen Stift. Den gegen einen Türknauf aus Keramik. Bald besaß er eine Instant-Party – ein leeres Fass Bier, Gutschein für eine Füllung und Budweiser-Leuchtreklame. »One red paperclip« wurde so rasend schnell so berühmt, dass sich Prominente darum schlugen, mit Kyle zu tauschen. Radiomoderator Michel Barrette tauschte das Fass Bier gegen seinen Motorschlitten. Schockrocker Alice Cooper einen Nachmittag mit sich selbst. Der US-Schauspieler Corbin Bernsen vermittelte eine Filmrolle. Und die Stadt Kipling veranstaltete im September ein Casting für eben diesen Film.
Diese Werbung war der Stadt ein Haus wert. Nach genau einem Jahr seit dem Start der Tauschaktion war der Handel perfekt: Am 12. Juli 2006 fand die Schlüsselübergabe statt. In Kipling Saskatchewan, Hauptstraße 3 – gut 3200 Kilometer westlich von Montreal, wo Kyle bis jetzt gewohnt hatte. Als erstes wurde das Haus nun rot gestrichen. So rot wie die Büroklammer, mit der alles angefangen hatte. Kyle: »Fragt mich bitte nicht, warum. Das muss wohl einfach sein.« Und auch auf die Frage der BBC, wie er so viel internationale Aufmerksamkeit für seine Aktion erreichen konnte, antwortete Kyle mit der reinen Wahrheit: »Ich habe absolut keine Ahnung.«
Dieser Mann hat zweifellos eine Chance genutzt. Hatte er das geplant? Nein, er war einfach nur herzerfrischend naiv. Und die reine Schönheit seiner Idee war so selten und außergewöhnlich, dass sie von der ganzen Welt belohnt wurde. Aber die meisten Menschen, zumindest die, die ich kenne, haben so gut wie nie schöne Ideen, denn sie haben irgendwann in ihrem Leben ihre Naivität verloren, sie wurde stillgelegt, aufgegeben, eingemottet und ersetzt durch: Wissen. Brav gelernt in Kindergarten, Schule und im Elternhaus, an der Uni und im ersten Job. Statt herzerfrischenden Ideen haben sie die beruhigende Gewissheit, aus welchem Grund etwas nicht funktionieren kann.
Wir sind Studenten des Misserfolgs geworden.
Wir sind Studenten des Misserfolgs geworden. Wir studieren, warum etwas nicht geht, sehen die Möglichkeiten nie ohne unsere Meinung darüber – und die ist meistens nicht positiv. Mein Ex-Steuerberater war so einer. Immer, wenn ich ihn bezüglicher neuer Projekte fragte, ob diese funktionieren würden, meinte er: Das geht nicht! Ich fragte ihn dann mal, warum seiner Meinung nach alles nicht geht. Er meinte, er hätte das studiert. Nun habe ich einen neuen Steuerberater, und es geht. Glücklicherweise habe ich das nie studiert, das, warum es nicht geht. Komisches Studienfach.
Eine Wissensgesellschaft ist eben noch lange keine Innovationsgesellschaft. Neue Ideen entstehen nicht aus gesichertem Wissen, sondern aus der Rekombination von vorhandenem Wissen. Ihre potenzielle Zahl wächst exponentiell mit der Zahl der Erfahrungen. Das ist simple Stochastik. Also braucht es möglichst viele verschiedene Erfahrungen. Und neue Erfahrungen macht man nicht durch die Anwendung dessen, was man ohnehin schon weiß. Warum jeden Tag den gleichen Weg zur Arbeit nehmen? Warum die Maus immer mit rechts bedienen? Wer wirklich Chancen im Leben erkennen will, muss Chancen jagen: beispielsweise, indem er am laufenden Band neue Erfahrungen macht.
Warum kriegen 99,9 Prozent der Menschheit nur 0,01 Prozent des Planeten zu sehen? »Australien? Unendlich weit weg. Ja, muss man mal gesehen haben im Leben. Aber wenn ich schon hinfahre, dann richtig.« Diesen Satz habe ich schon von 20-, 30-, 40-, 50-, 60- und 70-Jährigen gehört. Nach 70 bewegt sich aber nicht mehr allzu viel, das werden Sie zugeben, weshalb es meist bis zum Schluss beim Vorsatz bleibt. Ich bin da einfach mal hingeflogen. Es war überraschenderweise weder besonders teuer noch besonders kompliziert – noch besonders aufregend. Das weiß ich aber nur, weil ich dort war. Und ich war dort, weil ich reise, seit ich denken kann. Wer mit 14 schon dreimal New York gesehen hat, hat es im Leben leichter als Heiner, den Muttern mit 28 zum ersten Mal ins Sauerland mitnimmt. Nur wer die Welt bereist, sieht sie differenziert. Die einzige gefährliche Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die sich die Welt nicht angeschaut haben.
Die einzige gefährliche Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die sich die Welt nicht angeschaut haben.
Entscheidend ist dabei nicht das nackte Wissen über ferne Länder und andersartige Lebensentwürfe, sondern die dazu passenden Erfahrungen, die man nur selbst machen kann. Je reicher die Erfahrungen, umso reicher das Selbstverständnis und umso detaillierter der Blick auf den Alltag. Wer Chancen sucht, muss immer wieder neue Sichtweisen finden, insbesondere auf die Details. Auch bei sich selbst. Dazu muss man neugierig sein. Doch das wurde den meisten von uns schon als Kind abtrainiert. Denn wir wollen verständlicherweise, dass unsere Kinder auf der sicheren Seite bleiben.
Ein zwölfjähriger Junge aus Louisville war so neugierig. Vor allem aber hatte er eine Stinkwut im Bauch, weil ihm jemand das Rad geklaut hatte. Er wusste genau, wer. Doch die Kentucky State Police scherte sich nicht um das Rad eines kleinen schwarzen Jungen. Deshalb stand er 1954 mit Schaum vorm Mund in einem Box-Gym und bat um Unterricht. Er wollte die sichere Seite verlassen. Irgendwann kurz darauf, da bin ich sicher, hatte Clay zu seinem ersten großen Fight den Fahrraddieb gestellt. Und ich wette, er hatte ihn gewonnen. Zehn Jahre später stand er in seinem ersten Weltmeisterschaftskampf gegen Sonny Liston. Die New York Times schrieb vor diesem Kampf um den Thron im Olymp der Boxwelt: »Der auf lästige Weise selbstbewusste Clay bestreitet diesen Titelkampf mit nur einem unbedeutenden Nachteil. Er kann nicht so gut kämpfen, wie er reden kann.«
Weil sie sich konservieren wollen, statt sich immer wieder neu zu erfinden.
Clay antwortete im Ring und schlug Liston 7:1. So weit so gut. Doch dann legte er eine überraschende Volte hin: Statt sich im Erfolg von der amerikanischen Historie vereinnahmen zu lassen, brach er in spielerischem Alpha-Furor mit Kultur und Namen. Er erfand sich neu. Er bekannte sich zur Nation of Islam und wurde als Muhammad Ali der, den wir heute kennen – einer der größten Sportler des 20. Jahrhunderts. Es spielt keine Rolle, ob es nun der Islam oder der Buddhismus oder sonst eine religiöse Spielart war, es ist egal, ob er sich Ali, Isaac, Tenzin oder Franziskus nannte. Entscheidend ist die Einstellung zum Leben, die sich daraus erschließt. Warum bei den meisten anderen der erste Erfolg auch der letzte ist? Weil sie sich konservieren wollen, statt sich immer wieder neu zu erfinden.