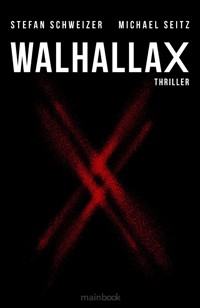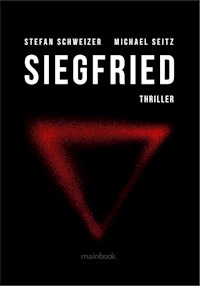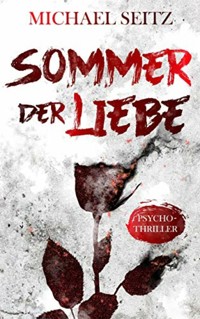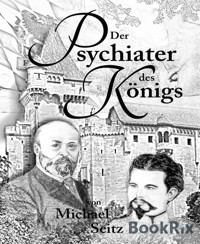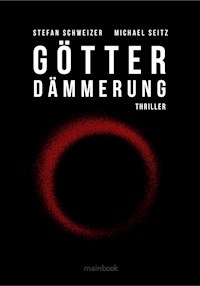
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mainbook Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Wagner-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Band 2 der Wagner-Trilogie mit dem Titel "Siegfried" wird am 1.9.2022 erscheinen. Ein feiges Nagelbombenattentat in einer belebten Kölner Einkaufsstraße. Unter den Schwerverletzten befindet sich die Exfrau von Tscharly Huber, seines Zeichens Extremismus-Experte und investigativer Journalist. Zunächst sieht alles nach einem Bandenkrieg im Bereich der Organisierten Kriminalität aus. Doch Tscharly stößt bei seinen Nachforschungen schnell auf die Existenz rechter Seilschaften innerhalb des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV). Als Neonazis einen Anschlag auf eine Moschee planen, spielen erneut V-Mann-Führer des BfVs eine unrühmliche Rolle: Unter dem Deckmantel der Geheimdienste erhalten V-Leute aus dem Umfeld des Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) bei ihren Taten aktive Unterstützung bei Planung, Organisation und Durchführung des Bombenattentats. Tscharly bleibt wenig Zeit, um ein weiteres Blutbad zu verhindern und seine Familie zu retten … Götterdämmerung ist ein atemberaubender Polit-Thriller sowie ein historisches Zeitdokument über die Hintergründe der NSU-Affäre. Zehn Jahre nach der spektakulären Entdeckung des NSU bringt Götterdämmerung vielleicht Licht ins Dunkel eines der verborgensten Kapitel der neueren deutschen Geschichte. Ein Buch für Fans von brisanter Unterhaltung, gelungener Spannungsliteratur und historisch-politischen Pulverfässern!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 514
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Seitz
Stefan Schweizer
Götterdämmerung
Thriller
eISBN 978-3-948987-30-5
Copyright © 2021 mainbook Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Gerd Fischer
Covergestaltung und Bildrechte: Lukas Hüttner
Auf der Verlagshomepage finden Sie weitere spannende Bücher: www.mainbook.de
Inhalt
Autor Michael Seitz
Autor Stefan Schweizer
Vorwort
Prolog
Erster Teil: München, zwei Tage zuvor – 8. Juni
Mittwoch, 9. Juni: 12.02 Uhr – 13.15 Uhr, über den Wolken
Köln, 14.45 Uhr, linkes Rheinufer, Keupstraße
Zur selben Zeit
Keupstraße, 15.15 Uhr
15.30 Uhr
15.40 Uhr, Keupstraße 29, Kreuzung Schanzstraße
15.45 Uhr, Internationale Filmschule Köln, Schanzenstraße
Keupstraße 15.58 Uhr
Sunlight Camping-Mobil, 16.20 Uhr, A 1, Richtung Dortmund
Berlin, Charlottenburg, 17.05 Uhr
Keupstraße, Ziviler VW-Polizeitransporter Rücksitz, 19.38 Uhr
Intensivstation Krankenhaus Köln, 20 Uhr
Kölner Altstadt, Kneipe, 21 Uhr
22.38 Uhr, Tscharlys Pensionszimmer
Donnerstag, 10. Juni - 0.05 Uhr
8.35 Uhr
Vormittags
13 Uhr
14 Uhr
15 Uhr
15.50 Uhr, Keupstraße
16.53 Uhr
Zweiter Teil: Frankfurter Nachrichten, 10. Juni 2004
Montag, 14. Juni: 4 Uhr
12 Uhr
16.30 Uhr
18 Uhr
19.30 Uhr
22 Uhr
Dienstag, 15. Juni: 3.10 Uhr
18.05 Uhr
Mittwoch, 16. Juni, 10 Uhr
11 Uhr
12.05 Uhr
München, 16 Uhr
19 Uhr, Köln, DITIB-Moschee (Türkisch Islamische Union der Anstalt für Religion e. V.)
21 Uhr
23.00 Uhr
23.05 Uhr
23.53 Uhr, München
Donnerstag, 17. Juni
0.05 Uhr
1 Uhr, München
1.05 Uhr, Köln
1.16 Uhr, München
1.21 Uhr Köln
1.25 Uhr
1.32 Uhr
1.45 Uhr München
2.03 Uhr Köln
4.27 Uhr
5.17 Uhr
5.27 Uhr
5.51 Uhr
5.59 Uhr
6.00 Uhr
6.01 Uhr
6.02 Uhr
6.04 Uhr
6.06 Uhr
6.09 Uhr
6 Uhr 09 Min 55 Sek
6 Uhr 09 Min 55 Sek
6.10 Uhr
6.11 Uhr
Epilog: Drei Tage später
Mittwoch, 30. Juni 2004
München, am gleichen Tag
Nachwort
Danksagung
Danksagung
Autor Michael Seitz
Michael Seitz, Jahrgang 1976, hat seine Kindheit und Jugend in München und im ländlichen Niederbayern verbracht und lebt seit 2005 in Wien. Er schreibt vorwiegend historische Romane und Gegenwartskrimis. Seitz genießt es, mit seiner Frau und seinen beiden Kindern durch Wien zu flanieren und in Buchgeschäften zu schmökern.
Veröffentlichungen (Auswahl): „Die verlorenen Kinder“ (Droe-mer Knaur, 2017), „Der Falter“ (Droemer Knaur, 2018), „Kinderspiel – Die Fesseln der Vergangenheit“ (Droemer Knaur, 2019), „Sechs“ (Droemer Knaur, 2019)
Autor Stefan Schweizer
Stefan Schweizer studierte, promovierte und lehrte an der Uni-versität Stuttgart. Er lebt im Speckgürtel der Bundeshauptstadt, bewegt sich gerne in fremden Kulturen, in exotischen subkul-turellen Milieus und ist Grenzgänger zwischen den Scenes.
Veröffentlichungen (Auswahl): „Mörderklima“ (Klimawandel-Krimi, mainbook, 2020), „Die Akte Baader“ (Gmeiner, 2018), „Roter Herbst 77 – RAF 2.0“ (Südwestbuch, 2017), „Roter Frühling 72, RAF 1.0“ (Südwestbuch, 2017), „BERLIN GANGSTAS“ (Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2016), „Goldener Schuss“ (Gmeiner, 2015).
Allen Opfern, der dem „Nationalsozialistischen Untergrund“ zugeschriebenen Bombenattentate und Morde
Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit.
(Sprichwort)
Solange der Schriftsteller sich nicht stationär behandeln lassen muss, dürfte er keine Gelegenheit haben, um festzustellen, dass seine Leiden sich von denen der anderen Leute nun doch nicht sonderlich unterscheiden. Bei denen fließen nur keine Bücher raus, sondern ganz gewöhnliches Blut.
(Jörg Fauser, Die Messer der Leiden)
Vorwort
Im März 2020 trat der Sachbuchautor und Extremismus-Experte Stefan Schweizer an mich heran. Er fragte mich, ob ich nicht Lust und Interesse hätte, gemeinsam mit ihm einen Thriller über die NSU-Morde zu schreiben. Ich erinnerte mich, dass ich ein paar Jahre zuvor in Köln auf der Keupstraße unterwegs war, wo das im Buch beschriebene Nagelbombenattentat stattfand. Plötzlich hatte ich die Bilder von damals wieder vor Augen. Stefan hatte zu den Morden der NSU für ein Sachbuch recherchiert und war dabei auf die unsäglichen Verquickungen von Geheimdiensten und V-Männern gestoßen. Auffällig ist, dass ein Akteur einer der vielen bundesdeutschen Dienste sich bei einigen Tatzeitpunkten ganz in der Nähe des jeweiligen Tatortes befand; bei anderen Attentaten wurden V-Männer der Dienste identifiziert. Zahlreiche Zeugen-aussagen bestätigen deren Existenz. Hier, in diesem Buch, haben wir ihm den Namen „Roland Wagner“ gegeben, der als Pars pro Toto dieser einer Demokratie unwürdigen Vermischung von Ge-heimdienst- und V-Mann-Wesen steht. Eine Reihe von Zeugen wurden im Zuge des NSU-Prozesses nicht zugelassen, da der Bundesverfassungsschutz diese Informanten als V-Männer in der rechten Szene beschäftigt. Die Existenz dieses Buches dürfte daher für einige Beteiligte ebenso explosiv sein wie die Anschläge selbst, die sich zwischen den Jahren 1999 bis 2009 ereigneten. Bedanken möchte ich mich daher auch bei Verleger Gerd Fischer, der sich traute, uns trotzdem einen Vertrag für diesen heiklen Politthriller der besonderen Art anzubieten. Es war mir eine Freude, gemein-sam mit Dir, Stefan, dieses Werk – fifty-fifty – zu verfassen. Ich erinnere an das Zitat der Autorin Ingeborg Bachmann:
„Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar.“
Michael Seitz, Wien, im Dezember 2020
Prolog
Donnerstag, 10. Juni, 2004 Ortszeit: 16.53 Uhr Köln, Mühlheim, nahe Keupstraße
Er schmeckte das Blut auf seinen Lippen wie flüssigen Stahl. Das Blut jenes Mannes, mit dem er sich zehn Minuten zuvor getroffen hatte. Ein Typ mit einem militärisch aussehenden Bürstenhaarschnitt, der vorgegeben hatte, ihm Informationen über die Täter zu liefern. Ein Informant, in dem er sich getäuscht hatte. Tscharly Huber hörte die Vespa hinter sich. Knatternd – nah am Kolbenfresser. Seine Verfolger waren ihm bereits dicht auf den Fersen. Ließen sich zwischen all den Altbauhäusern und Siebzigerjahre Klötzen einfach nicht abschütteln. Sein flaues Bauchgefühl hatte doch recht gehabt! Ihr konspiratives Treffen war verraten worden. Drei Schüsse in die Stirn – aus zehn Metern Entfernung – hatten dem Leben seines Informanten auf offener Straße ein Ende gesetzt. Ganze Arbeit. Vollprofis, die eiskalt eine Exekution durchführten. Zuletzt hatte Tscharly sich im Irak in einer vergleichbaren Situation befunden. Im Krieg zwischen amerikanischen Drohnen und irakischen Heckenschützen war er als Journalist zwischen die feindlichen Linien geraten. Fünfzehn Kilometer entfernt von Tikrit hatte er gemeinsam mit kanadischen Kollegen in einer Höhle Zuflucht gefunden. Dafür hatte Tscharly als einer der ersten Europäer die Ehre gehabt, live und vor Ort von der Festnahme Saddam Husseins zu berichten. Der Erfolg wog wieder einmal die Gefahr auf. Kaum zu Hause hatte seine aktuelle Lebensabschnittsgefährtin sich von ihm getrennt. Tscharly Huber hatte in seinem Leben gelernt mit menschlichen Verlusten umzugehen.
Er sprang über eine Straße. Quietschende Reifen. Ein Hupkonzert. Wankte die Gleise einer Straßenbahnlinie entlang. Die Luft roch nach Asche und Benzin. Der Anschlag hatte vor vierundzwanzig Stunden stattgefunden. Zweiundzwanzig Menschen mit meist türkischer und kurdischer Herkunft befanden sich seither auf Intensivstationen in ganz Köln verteilt. Seine Exfrau Sara lag ebenfalls im Koma. Sara hatte recht behalten. Kaum dass Tscharly wieder einmal in ihr Leben trat, verursachte er ihr nichts als Probleme, hatte sie ihm fünfzehn Minuten vorher noch vorgeworfen. Als sie ihm diesen Vorwurf entgegengeschmetterte, hatte sie nicht einmal ahnen können, wie sehr sie dieses Mal recht behalten sollte! Die Attentäter hatten eine Nagelbombe gezündet. Dass sich Sara ausgerechnet zum Zeitpunkt der Explosion am Ort des Tatgeschehens befand, auch daran gab Tscharly sich die Schuld. Immerhin ist sie mir nachgelaufen!
Er rannte querfeldein über eine Grünfläche für Hundebesitzer und ihre vierbeinigen Lieblinge. Das Rattern der Vespa verstummte. Ein Nieselregen ging über dem rechten Rheinufer nieder. Die hohe Luftfeuchtigkeit drückte in Tscharlys Lungenflügeln. Seine Muskeln an Armen und Beinen brannten, verbrauchten mehr Sauerstoff als die feinen Lungenbläschen jemals imstande sein würden, aufzunehmen und in Energie zu verwandeln. Keupstraße, vor vierundzwanzig Stunden noch eine Lebensader mit türkischen Geschäften und Lokalen, die Tscharly wegen ihres orientalischen Flairs fasziniert hatte. Der ewige Duft von Fladenbrot und Knoblauch in der Luft, salziger Geschmack von Oliven auf der Zunge – zwei Halbwüchsige, die sich auf der Straße mit Fäusten duellierten, während die Alten herumstanden und Geld auf den Sieger wetteten … Ein Kosmos, ein Universum für sich. Liebevoll Klein-Istanbul genannt, war die Straße, in der Sara seit ihrer Scheidung vor fünfzehn Jahren wohnte, zu einem Ort des Terrors geworden. Und mittendrin Karl Huber – genannt Tscharly, 44 Jahre, Ex-Raucher, Ex-Ehemann, Ex-Schwiegersohn, ExFreund … ein Mann sowas von Ex, dass sein bevorstehender Exitus nur noch eine Frage von Minuten oder Sekunden sein konnte …
Schüsse zerrissen wie brutale Peitschenhiebe die Stille hinter ihm!
Hundebesitzer mit ihren Tieren – Pudeln, Schnauzern, Promenadenmischungen – liefen um ihr Leben. Polizeisirenen ertönten.
Tscharly rannte, stapfte in Hundehaufen – und erreichte die Straße gegenüber dem Parkhaus. Dort, wo er in der Pension vis-á-vis übernachtet hatte. Vielleicht gelang es ihm, sich in dem Gebäude zu verschanzen. Im Hintergrund erhob sich eine Moschee. Täuschte er sich, oder handelte es sich tatsächlich um Klagelaute, die seinen Gehörgang erreichten?
Tscharlys Herz raste. Völlige Stille. Nichts als der Gesang des Imams hallte auf einmal durch die Straßen. Kein Zweifel, wem die Gebete der gläubigen Muslime galten. Tscharly fühlte sich zurückversetzt. Vernahm tief in sich die Gesänge, die aus den Minaretten über den Bergdörfern in der Nähe von Tikrit niedergegangen waren. Selbst die Mutter aller Schlachten hatte die Menschen nicht davon abgehalten zu beten. Und es schien Tscharly, als befände er sich nun in der gleichen Situation, nur die Kulisse hatte sich radikal verändert. Er erkannte das Fahrzeug, das aus dem Schlund der Parkgarage emporschoss, viel zu spät. Ein Mini-Cooper, eines dieser typischen Frauenautos, das in der Regel farblich zur Handtasche und den Ohrringen der Fahrerin passten. Er begriff den Fehler, den er durch sein Zögern begangen hatte. Es war von Anfang an ihr Plan gewesen, ihn bis vor die Tür seiner Pension zu verfolgen. Und jetzt – während dieses Fahrzeug Anlauf nahm, um ihn in mörderischem Tempo zu überrollen – versagte jeglicher Fluchtinstinkt in ihm. Der Lack, schwarzmetallic, spiegelte die dunklen Wolken über Köln.
Der Gesang des Imams war nichts weiter als das Lied vom Tod, das eigens für ihn – Tscharly Huber – gesungen wurde. Er wünschte sich, er könnte noch einmal von vorne beginnen und die Zeit um achtundvierzig Stunden zurückdrehen …
Erster Teil
München, zwei Tage zuvor – 8. Juni
„Papa, ich warte schon eine Woche länger als ausgemacht auf deine läppischen dreihundertfünfzig Euro! Mein Vermieter hier in Berlin hält schon nach einer Brücke für mich Ausschau“, meldete sich seine Tochter über ihr Handy.
„Ich bin gestern eh auf der Bank gewesen“, log Tscharly beinahe mechanisch. Er kämpfte aber auch gegen sein schlechtes Gewissen wegen der Un-Wahrheit an und nahm sich vor, dafür bei Gelegenheit wieder einmal eine gute Tat zu vollbringen. Vielleicht sollte er einem Obdachlosen ein paar Brezen mit Weißwürsten und ein Bier in einem der schicken Lokale in der Münchner Innenstadt spendieren. Am besten vor der Diskothek P1, damit auch die Reichen und Schönen Zeuge seines Samaritertums wurden.
„Das sagst du immer“, durchschaute Milla ihn. „Ich weiß genau, dass du es wieder vergessen hast. Du wirst schusslig und alt.“
„Na gut, ich habe es wirklich vergessen. Du kennst mich ja lange genug. Aber wenn ich an einer Sache dran bin, dann vergesse ich alles andere. Du kriegst spätestens morgen dein Geld. Damit dein Vermieter dich nicht auf die Straße setzen muss, der arme Kerl! Mir kommen gleich die Tränen.“
Tscharly betrachtete die Zahnbürste in seiner linken Hand. Er hatte gerade die Zahncreme aufgetragen, als das Läuten des Handys ihn in seiner Morgentoilette unterbrach. Auf seine Zähne muss man immer aufpassen! Eine Weisheit, die bereits Julia Roberts als Prostituierte in Pretty Woman gepredigt hatte. In der Szene hatte sie auf unterhaltsame Weise Werbung für Zahnseide gemacht. Tscharly hatte den Film ein halbes Dutzend Mal gesehen, 1990. Was auch immer ihn dazu bewogen hatte, eine Liebesromanze im Kino anzuschauen, hätte er sich selbst nicht erklären können. Damals war er längst von Sara geschieden gewesen. Und ihre Ehe schien ihm wie eine Erinnerung an eine Erinnerung …
Milla holte ihn eiskalt in die Realität zurück.
„Am Ende muss ich noch bei Mama einziehen, damit ich mir das Wohnen während des Studiums leisten kann.“
Er lachte. „Köln soll ja auch sehr schön sein. Und die Kölner Philharmonie ist viel besser als ihr Ruf. Für eine Musikstudentin ist Köln zweifellos auch nicht gerade eine schlechte Stadt.“
„Das sagst gerade du.“
„Was?“
„Du hast es ja selbst gerade mal fünf Jahre mit Mama ausgehalten, bevor du mich mit ihr alleine gelassen hast. Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn man die eigene Mutter nach der Schule völlig betrunken in ihrem Bett vorfindet und du keine Ahnung hast, wie du deine Hausaufgaben machen sollst?!“
Da war er wieder! Der alte Konflikt!
„Milla, es tut mir heute noch leid.“
„Davon kann ich leider meine Miete nicht bezahlen.“
„Deine Mutter und ich haben uns nur noch angeschrien. Es gibt viele, die trotz Ehedrama zusammenbleiben, weil sie glauben, dass sie damit ihren Kindern was Gutes tun. Und vielleicht wäre gerade das der richtige Weg gewesen. Ich wünschte, dass es anders gekommen wäre …“
„Du könntest dein schlechtes Gewissen ja mal wieder mit einer guten Tat ruhigstellen“, überrumpelte sie ihn.
„Ich …“
„Ich versuche seit Tagen mit Mama zu telefonieren. Aber sie geht einfach nicht an ihr Telefon. Mit ihrer Wohnungsnachbarin habe ich schon telefoniert. Mama ist zu Hause und sie verlässt auch manchmal ihre Wohnung. Aber sie geht mal wieder nicht an ihr Handy. Vielleicht will sie mich wieder einmal dafür bestrafen, dass ich mit sechzehn von daheim ausgezogen bin. Wäre ja nicht das erste Mal. Nur hab ich diesmal ein flaues Gefühl. Vielleicht hebt sie ja ab, wenn sie deine Nummer sieht.“
„Vielleicht“, murmelte er. „Vielleicht will sie ausgerechnet mich sprechen.“ Was ich stark bezweifle, fügte er in Gedanken hinzu.
„Danke, du bist der beste Papa der Welt.“
Seine Freude über ihr Kompliment hielt sich in Grenzen. „Na sag schon, was du dir diesmal wünschst, meine geliebte Tochter und Prinzessin.“
„Ich hab dir doch neulich von dem Israel-Trip erzählt“, begann Milla. „Für achthundert Euro. Eine ganze Woche Sightseeing im Heiligen Land. Für mich und für Thorsten. Wäre das nicht ein schönes Geburtstagsgeschenk?“
„Mmh, ich verstehe ja, dass junge Liebe am liebsten gemeinsam auf Reisen geht. Aber könnten zur Abwechslung nicht auch einmal seine Eltern für seine Reisekosten aufkommen?“
„Ach komm, Papa, sei kein Spielverderber.“
Irgendwie gefiel ihm ihre Idee, Jerusalem und die heiligen Stätten anzusehen – und dazu die Golanhöhen und das Nachtleben in einem der angesagten Clubs in Haifa. Die Israelis besaßen eine Art zu feiern, als gäbe es kein Morgen. Während seiner Zeit im Nahen Osten hatte Tscharly mit einigen jungen Frauen Sex gehabt, die gerade eine Auszeit von ihrem Militärdienst genossen hatten. Tscharly schwelgte in der Erinnerung. Milla sandte ihm einen Kuss via Handy.
„Okay. Meinetwegen. Habe ich denn eine Wahl?“, entgegnete er. Und vor seinem inneren Auge blickte sie ihn auf dieselbe Art und Weise wie früher an, als sie noch ein Kind gewesen war. Wer konnte schon dem Augenaufschlag einer Fünfjährigen widerstehen, die dazu eine Miene aufsetzte, als ginge es um Leben und Tod?
„Manchmal frage ich mich, ob bei manchen Frauen diese Gabe angeboren ist“, überlegte er laut. „Ob sie zu einem natürlichen oder göttlichen Bauplan gehört?“
„Welcher Bauplan, Paps?“
„Männer um den Finger zu wickeln.“
„Papa, ich hab dich lieeeeb“, säuselte sie.
„Ich dich auch mein Schatz.“
„Papa, ich muss jetzt auflegen. Ich muss zur Vorlesung.“
„Dann lern was Schönes. Pass auf dich auf, ja?“
„Versprochen.“
„Bis bald. Servus.“
„Ciaooooh.“
Milla legte auf. Tscharly betrachtete sein Gesicht im Spiegel des Aliberts. Ich wünschte, uns wäre mehr Zeit miteinander vergönnt geblieben, kleine Maus, dachte er. Er wohnte allein und er brauchte sich vor niemandem zu schämen über die Tränen, die einen seltsamen Glanz in seine großen dunklen Mandelaugen zauberten. Sie konnten friedlich miteinander reden, ohne in Streit zu verfallen. Dafür empfand er Dankbarkeit. In Millas Pubertät hatte sie ihn im besten Fall angeschrien. Am schlimmsten waren die zwei Jahre zwischen ihrem vierzehnten und sechzehnten Geburtstag gewesen, während derer sie kein Wort miteinander gesprochen hatten. Ein Zustand, der abrupt endete, als Milla zum Studium nach Berlin drängte. Sara hatte sich quer gegen den Wunsch ihrer Tochter gestellt. Tscharly hatte mit Engelszungen auf seine Ex-Frau eingeredet und schließlich sogar für die Finanzierung dieses ehrgeizigen Plans gesorgt. Am Ende merkte Sara, dass sie ihre Tochter verlor, wenn sie sie zu Hause einsperrte. Milla fand einen Platz in einer Studenten-WG in Charlottenburg und zeigte sich von ihrer erwachsenen Seite, indem sie Tscharly plötzlich wieder in ihr Leben integrierte. Was zehn Jahre Psychotherapie nicht vermocht hatten, fügte sich auf einmal von selbst. Wenn ich das gewusst hätte, kleine Maus, dann hätten wir uns das viele Geld für die Psychotante sparen können.
Tscharly putzte seine Zähne. Anschließend benutzte er Zahnseide und musste wieder an Julia Roberts denken. Wenn ich in L.A. leben würde und Julia Roberts als Nachbarin hätte, dann wäre ich sicher ein guter Freund von ihr. Pretty Woman würde seine dunklen Augen, das markante Kinn mit Dreitagebart und sein früh ergrautes Haar ganz sicher attraktiv finden, stellte er sich vor. Nur Sex würden Julia und ich auf alle Fälle vermeiden. Sex zerstört Freundschaften. Deswegen wäre ich ihr ältester und bester Freund …
Er blickte auf die Küchenuhr.
Halb zehn.
In einer halben Stunde erwartete ihn der alte Methusalem in der Redaktion der Münchner Neuesten Nachrichten. Verdammt, das schaffe ich nie im Leben. Nach seinem letzten Fernostabenteuer hatte Tscharly große Lust gehabt, das zu tun, was er die längste Zeit seiner Journalistenkarriere getan hatte, nämlich in den Nahen Osten zurückzukehren, um von diesem ewigen Krisenherd aus Bericht zu erstatten. Die Tatsache, dass seine Tochter plötzlich mit ihm freundschaftlich verkehrte, hatte ihn jedoch dazu bewogen, zu seinen Münchener Wurzeln zurückzukehren. Er wollte sich und Milla eine Chance geben, wenn auch die Distanz zwischen München und Berlin zwischen ihnen lag. Er hatte die Hoffnung gehegt, vielleicht doch irgendwann eine väterliche Instanz sein zu können. Eine Hoffnung, die sich erfüllt hatte. Milla sprach Tacheles, war ehrlich mit ihm. Sie sagte ihm, wo er versagt hatte. Und sie teilte ihm mit, in welcher Hinsicht sie ihn brauchte. Mit der Zeit hatte er sich sogar mit ihrer Studienwahl anfreunden können. Natürlich hatte er davon geträumt, seine Tochter irgendwann in der Rolle der Strafverteidigerin vor Gericht zu sehen. Auch mit einem Betriebswirtschaftslehrestudium ließe sich im Leben so einiges anfangen. Jedoch mied Milla ihre Mutter, weil sie ihr zu Hause zu wenig Entscheidungsfreiheit gelassen hatte – das hatte Tscharly kapiert. Tscharly hatte beschlossen, seiner Tochter die lange Leine zu geben, schließlich war er ihr Mäzen. Mit diesem Schritt hatte er ihrer Vater-Tochter-Beziehung unerwartet ein erstaunlich festes Fundament verliehen, eine Entwicklung, mit der er kaum mehr gerechnet hatte.
Tscharly schmierte sich nach dem Zähneputzen eine Scheibe Knäckebrot dick mit Nutella und machte gerade Anstalten, hineinzubeißen, als das Handy ihn neuerlich aus seiner Morgenroutine riss.
„Wo bleibst du?“, meldete sich der alte Methusalem.
„Wir haben gesagt um zehn“, erwiderte Tscharly.
„Halb zehn. Alle sind schon in der Redaktion und warten auf dich!“
Tscharly schaute auf den Kalender. „Tatsächlich. Ich komme gleich … Fangt schon mal ohne mich an!“
Der alte Methusalem verfiel in einen nörglerischen Tonfall. „Tscharly, mein Freund, wenn du nicht mein Ex-Schwiegersohn wärst, dann hätte ich dich längst rausgeworfen. Sieh zu, dass du das Herz eines alten Mannes nicht überstrapazierst, schwing dich in deinen Alfa und fahr ohne Umwege direkt in die Redaktion und ziehe keine viertausend Euro ein und gehe auch nicht über Los, verstanden?“
„Eigentlich wollte ich vorher noch zur Bank.“
„Bankgeschäfte haben Zeit. Große Politik kann niemals warten. Redaktionspolitik erst recht nicht. Wir sehen uns, du kennst die Spielregeln!“
Damit beendete Peter Smuss das Telefonat. Peter Smuss, geboren 1924 in Danzig, gehörte zu jenen Zeitzeugen, die insgesamt acht Arbeits- und Todeslager der Nazis überlebt hatten. Sein Vater war ein jüdischer Fleischer gewesen. Alles andere als ein vermögender Mann, aber es hatte gereicht, die Familie über Wasser zu halten. Eigentlich hatte Smuss einst in die Fußstapfen seines Vaters treten wollen. Nachdem er die zwölf Jahre Tausendjähriges Reich – wie er selbst sagte – für immer hinter sich gelassen hatte, hatte er Vater, Mutter und vier Schwestern weniger – sieben minus sechs ist gleich eins, so lautete seine nüchterne Bilanz. Die Nazis waren gründlich bei der Vernichtung von sechs Millionen Juden vorgegangen. Peter Smuss war gerade einundzwanzig geworden und sah aus wie ein sechzigjähriger, verhungerter Greis. Was er am meisten brauchte, war Fleisch auf seinen Rippen. Smuss fand eine Anstellung in einer Druckerei, die für eine Zeitung arbeitete. Die Münchner Neuesten Nachrichten erschienen ab 1948. Während in den Redaktionen sämtlicher Zeitungen der Republik überwiegend Journalisten, die für die Reichspropaganda eines Josef Goebbels geschrieben hatten, arbeiteten, bestand die Mannschaft in den Räumen der Münchner Neuesten Nachrichten fortan aus Menschen, die im Widerstand tätig gewesen waren oder Vernichtungs- und Arbeitslager mit knapper Not überlebt hatten. Die Zeitung genoss heute nicht nur im Süden Deutschlands ein hohes Ansehen. Der alte Methusalem war der Letzte aus dem Kreis der Gründergeneration, die aktiv in der Redaktion ihren Dienst versahen.
Tscharly hatte als junger Mann sein Volontariat bei den Münchner Neuesten Nachrichten absolviert. Ein Jahr später hatte er beim alten Methusalem um die Hand von dessen Tochter angehalten. Der alte Methusalem war auch über die Scheidung hinaus einer von Tscharlys größten Fans und Freunden geblieben. Tscharlys Stolz über diese persönliche Verbindung hätte niemals größer sein können.
Tscharly würgte das Knäckebrot mit Nutella in drei Bissen hinunter und rannte vor die Haustür. Der rote Alfa Romeo Spider besaß ein schwarzes Verdeck, das Tscharly über Nacht offen zu lassen pflegte.
Hier am Stadtrand von München – in Zamdorf – war Tscharly aufgewachsen. Er fühlte sich geborgen zwischen Reihenhäusern und Familienidyll. Tscharly wischte sich die Schokoladenfinger zwischen den weißen Ledersitzen ab. Der Motor der 1,8-Liter-Maschine brauste auf, ein wahrer Ohrenschmaus für die Liebhaber italienischer Sportwagen. Tscharly raste bei Dunkelgelb über die Kreuzung Friedrich-Eckhart-Straße/Rohlfsstraße. Als er ein Junge gewesen war, hatte er sich an der Tankstelle an dieser Kreuzung oftmals heimlich ein Eis oder andere Süßigkeiten gekauft. Der Freund, der ihn bei diesen Streifzügen begleitet hatte, war mit ihm in dieselbe Klasse gegangen. Florian hatte er geheißen. Florian starb im Schulunterricht an einem Asthma-Anfall. Florian hatte sein Asthma-Spray zu Hause vergessen. Sie hatten gerade den Wechsel von der Grundschule in der Ostpreußenstraße aufs Gymnasium geschafft. Tscharly hatte Florian hilflos in den Armen gehalten. Die Lehrerin war danebengestanden und hatte vor Panik geschrien. Dadurch wurde Florian zum ersten Menschen, dessen Tod eine Wunde in Tscharly gerissen hatte. Vielleicht war Florians Tod der Grund, warum er als Journalist immer wieder das Spiel mit dem Feuer gesucht hatte. Eine innere Angst – ein Schuldgefühl, die innere Wunde könnte eines Tages heilen und die Erinnerung an Florian damit verblassen. Eine Art Überlebens-Schuld!, analysierte er sich manchmal selbst. Die Tankstelle war im letzten Jahr abgerissen worden. Nach einer Bodensanierung würden wohl auch an dieser Stelle schon bald Einfamilienhäuser aus dem Boden sprießen.
Tscharly gab Gas und erreichte das Gelände der Münchner Neuesten Nachrichten nach wenigen Minuten Fahrt. Er bog nach links auf den Parkplatz ab und stand vor einem achtstöckigen Halb-Glas-Halb-Beton-Bau. Tscharly trug ein T-Shirt, das seine Schultern und Arme betonte. Er schlüpfte in ein dunkelblaues Jackett und winkte von außen dem Portier in der Loge zu. Das Geld für Milla würde er heute Nachmittag überweisen. Und das mit Sara hatte Zeit! Erst einmal stand das Treffen mit Saras altem Vater bevor.
Tscharly atmete dreimal tief durch, bevor er das quaderförmige Gebäude betrat. Das hier war seine geistige Heimat, sein Hafen. Es gab keinen Grund nervös zu sein und doch wünschte er sich nichts sehnlicher als eine Zigarette. Blöde Angewohnheit und eines der Gifte mit dem größten Suchtpotenzial. Nervös fummelte er an seinen Hosentaschen herum. Natürlich weder Zigaretten noch Feuerzeug, da er die Sargnägel seit er nach München zurückgekehrt war – abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen – nicht mehr angerührt hatte. Entgegen seiner Gewohnheiten kontrollierte er mit der Fernbedienung ein zweites Mal, ob sein Romeo abgeschlossen war. Was war bloß mit ihm los? Ob der Alte ihn an die Al-Qaida-Story ranließ? Oder wollte er ihm vor versammelter Mannschaft die Leviten lesen? Bei aller Freundschaft und gegenseitiger Wertschätzung konnte man bei einem Peter Smuss nie so genau wissen, was er beabsichtigte. In der spanischen Hauptstadt Madrid waren vor drei Monaten bei einer Serie von Bombenanschlägen auf Nahverkehrszüge einhunderteinundneunzig Menschen gestorben und tausendfünfhundert verletzt worden – zum Teil schwer! An der Urheberschaft von Al-Qaida bestanden keine Zweifel.
Tscharlys Projekt hatte es wahrlich in sich. Zugegeben, es war nicht leicht vermittelbar. Aber bei seinen Vorrecherchen hatte er Anzeichen dafür gefunden, dass bundesdeutsche Sicherheitsdienste mit den Islamisten zusammenarbeiteten. Sie infiltrierten verdächtige Kreise mit V-Leuten, um über deren Pläne auf dem Laufenden zu bleiben. Und nicht nur das! Nein, sie fütterten sie bei Bedarf sogar mit Ressourcen, Logistik und Informationen, damit diese Islamisten unter Kontrolle der deutschen Dienste blieben. Das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz machte in dieser Hinsicht beim Hauptattentäter von 9/11, Mohamed Atta, eine fragwürdige Figur, was Tscharly in Sachen Demokratie und bürgerliche Freiheitsrechte als einen Skandal empfand. Das gehörte aufgeklärt, in die Zeitung und sein Name darunter. Daraus bezog Tscharly einen wesentlichen Teil seines Selbstverständnisses. Den Reichen und Mächtigen ihre scheinheiligen Masken vom Gesicht zu reißen und die Bevölkerung zu warnen. Sein anonymer Tippgeber hatte Tscharly eine Information zugespielt, die darauf hinwies, dass auch einer der Madrider Attentäter ein V-Mann der deutschen Dienste war. Oder zumindest eines weiteren europäischen Geheimdienstes. Diese Information musste Tscharly noch verifizieren oder als gezielte Desinformation identifizieren. Solange das nicht passiert war, würde er unmöglich Ruhe finden. War Tscharly einmal auf ein Thema angesprungen, dann gab es für ihn keine Alternative, bis seine Artikel den Weg in die Öffentlichkeit fanden.
Ein Blick auf seine Rado verhieß nichts Gutes. Tscharly zog seine erste Vormittagsbilanz: Erstens, die Uhr hatte schon bessere Zeiten gesehen, aber trotz der Kratzer stand sie ihm immer noch gut. Zweitens, die Redaktionssitzung war sicherlich schon vorbei und drittens: Auf der Bank war er auch nicht gewesen! Milla würde ihm demnächst die Hölle heiß machen. Darin war sie gut und hatte viel von ihrer Mutter gelernt. Da blieb nur zu hoffen, dass wenigstens der alte Methusalem ein klein wenig von seiner guten Stimmung für ihn reserviert hatte.
Da Tscharly die Treppen hochgerannt war, schnappte er jetzt gehörig nach Luft. Die Atmosphäre im Großraumbüro fühlte sich wie immer elektrisierend an. Überall knisterte es. Ungeheure Mengen an Energien luden das Gebäude auf. Es herrschte mehr als nur geschäftige Betriebsamkeit. Tscharly erblickte als erstes die neue Volontärin, die in der Teeküche stand und ein großes Kaffeetablett vorbereitete. Verflixt, wenn die bereits hier herumhantierte, hatte er die Sitzung definitiv verpasst. Kira wurde nämlich immer die fragwürdige Ehre zuteil, die Sitzungsprotokolle zu verfassen.
Sie war siebenundzwanzig Jahre jung, wie er heimlich ihrer P-Akte entnommen hatte, hatte langes, blondes Haar und besaß einen ein klein wenig zu hageren Körper. Eine Art Heroin-Chic, ohne direkt ein Fall für eine stationäre Behandlung zu sein. Tscharly bevorzugte etwas mehr weibliche Rundungen, aber er konnte auch verstehen, dass es Männer gab, die auf diesen androgynen Typ Frau standen. Kira stammte aus einer alteingesessenen Münchener Familie und hatte ein katholisches Privatgymnasium besucht, was unter den Kollegen der Münchner Neuesten Nachrichten schon für manch derben Witz gesorgt hatte.
„Wir sehen uns nachher?“, fragte er sie.
Sie nickte und schenkte ihm einen Augenaufschlag, den er bis in die Zehenspitzen spürte.
„Ich komme sofort nach dem Mittagessen bei dir vorbei“, zirpte sie mit einer honigsüßen Stimme, die ihn für eine Sekunde die Makel ihres Körpers vergessen ließ. „Die Sitzung war übrigens sehr interessant. Da wurden zahlreiche Ressorts neu zugeschnitten.“
Die Neuigkeit gab Tscharly den Rest, aber er setzte sein Pokerface auf. Dass Kira zum Mittagessen verabredet war, wunderte ihn nicht. Wahrscheinlich mit dem Chef vom Dienst höchstpersönlich, diesem alten Lustmolch, der aber seine Frau zu Hause vertrocknen ließ wie eine Primel.
„Ah geh, der Huber.“
Mayer vom Kulturressort steckte seinen unförmigen Kopf mit Deckelglatze und rotgekräuseltem Haarkranz zu ihnen herein. Auch das noch!, dachte Tscharly. Dieser Besserwisser mit dem Anspruch „Ich-habe-die-Kultur-schon-mit-der-Muttermilch-aufgesogen“ hatte ihm gerade noch gefehlt.
„Stell dich gefälligst hinten an, wenn du was von Kira möchtest.“
Wie erwartet räusperte sich Mayer und Kiras Gesicht lief rot an.
„Passt“, wandte Tscharly sich wieder an die junge Frau. „Wir gehen dann durch, wie eine Story aufgebaut werden könnte, die sich mit dem Leid der Opfer-Angehörigen von Madrid beschäftigt. Vielleicht kriegen wir von Smuss das Okay für den Artikel. Dann setzen wir beide unseren Namen darunter.“
Kira knickste leicht und ihr Blick wanderte besorgt zu Mayer.
„Ich würde meinen Namen nicht gleich mit solch fragwürdigen Projekten kontaminieren“, wandte Mayer erwartungsgemäß ein.
Armes Ding, diese Kira, dachte Tscharly. Muss sich jedem an den Hals werfen. „Stimmt“, sprach er zu Mayer, „bei deinem Kulturzeug musst du dir höchstens Sorgen machen, ob eine Schauspielerin aufgrund deiner Kritik einen hysterischen Zusammenbruch kriegt oder nicht. Oder ob sie vielleicht bei der nächsten Gala besonders freundlich zu dir sein soll, damit du lobende Worte für sie findest.“
Mayer senkte verschämt den Blick.
Touché, jubilierte Tscharly innerlich – die Dauerfehde mit Mayer gehörte seit er wieder in München arbeitete zu seiner Redaktionsroutine.
„Nicht zu viel Mut antrinken in der Mittagspause!“, rief Mayer ihm hinterher. „Du musst in letzter Zeit ja auf deinen Blutdruck aufpassen, wie ich gehört habe. In München hat noch jeder seine Weißwurst-und-Leberkäs’-Kilos zugelegt! Nix mehr Couscous der Herr!“
Tscharly ließ den Kollegen grußlos zurück. Als er Kira und Mayer den Rücken zugewandt hatte, hörte er, wie sich Mayer wegen der Buchmesse und den neurechten Verlagen gegenüber der Volontärin aufplusterte. Auch eine Art, sich wichtig zu machen! Tscharly wäre beinahe über einen Eimer und einen quergestellten Wischmopp, die den schmalen Gang versperrten, gestolpert. Er hielt inne. Blickte auf.
„Dddder Chef wwwwartet auf ddddich!“, hieß ihn Robert willkommen.
Robert, die gute Seele des Verlags. Smuss hatte ihn eingestellt, um seiner sozialen Verantwortung als Unternehmer nachzukommen. Robert litt seit seiner Geburt an einer kognitiven Behinderung und hätte auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance gehabt. Hier war er das Mädchen für alles: Akten, Kaffeekochen, Putzdienste. Durch Roberts Beschäftigung sparte sich Smuss so ganz nebenbei auch noch die Behindertenumlage, die er sonst an den Staat hätte zahlen müssen.
„Danke, Robert, ich freue mich, dich zu sehen.“
„Es issssst eeeeeilig, Herrr Huuuber, der Herrr Smuss wartet schooon …“
Tscharly spürte einen Kloß in seinem Hals. Verdammt, ich habe es wieder einmal verbockt. Warum schaffe ich es einfach nicht, wichtige Termine einzuhalten? Sara hatte Tscharly einmal als einen Zeit-Chaoten bezeichnet. Irgendwann später hatte ein Psychologe ihn darüber aufgeklärt, dass dieser Begriff tatsächlich zum medizinischen Terminus gehörte und eine Form von Messie-Syndrom bezeichnete. Tscharly nickte Robert zu und machte sich daran, das Großraumbüro weiter zügig zu durchqueren. Aggressives Klappern der Tastaturen, gehetzt geführte Telefonate. Dennoch, so hatte Tscharly aus anderen Redaktionen gehört, hatten sie es hier noch vergleichsweise gut. Viele Verlage waren in der permanenten Zeitungskrise in eine finanzielle Schieflage geraten. Da wollte keiner der erste sein, der aus Rationalisierungsgründen vor die Türe gesetzt würde. Der Knaller war eine bekannte Zeitung aus dem Stuttgarter Raum gewesen. Dort hatte die Geschäftsführung im letzten Winter die Heizung kälter stellen müssen, da ein Grad gesenkte Raumtemperatur im Jahr eine nicht unbeachtliche Summe an Euros einsparte. Die Aktionäre wollten auf diesen Betrag bei der jährlichen Dividendenausschüttung auf keinen Fall verzichten. Tscharly erkannte die Perfidie dahinter: Sollten doch die Schreiberlinge selbstgestrickte Socken, Pullis und Schals mit in die Redaktion nehmen – deren Problem, oder?
Die neue Sekretärin Roswitha Groß war eine Wucht – im eigentlichen Sinne. Manchmal hatte Tscharly den Verdacht, dass Smuss’ zweite, knapp vierzig Jahre jüngere Ehefrau bei der Auswahl der neuen Sekretärin mitgeholfen hatte. Roswitha wog mindestens 150 Kilogramm, hatte ein aufgedunsenes Gesicht und trotz der Körperfülle eine sehr überschaubare Oberweite. Auch nicht sein Ideal, aber die Arbeit war ja nicht Parship, wo sich alle paar Sekunden ein Single verliebte, beschwor Tscharly sich. Er hätte sich in Smuss’ Vorzimmer aber einen optischen Hingucker gewünscht, als Mut-Macher sozusagen, bevor er die Höhle des Löwen betrat. So war aber die erste Euphorie vor dem Betreten des Chefbüros schon beim Anblick der Vorzimmerdame zerstoben. Mit klobigen Fingern stopfte sie die Reste eines Osterhasen in den Mund, den sie wohl im Dutzend auf einer Angebotspalette im Discounter für einen Spottpreis ergattert hatte. Aber eins musste man Roswitha lassen: Sie war zuverlässig, erledigte ihren Job und war kein TratschWeib. Im Prinzip genau das, was der Alte benötigte. Tscharly hatte sie sich anvertraut, dass sie seit ihrer Pubertät wegen Depressionen in Behandlung war. Roswitha hatte in ihrem Leben sehr viel Kummer in sich hineingefressen.
„Hallo, Tscharly“, begrüßte sie ihn verschämt.
„Hallo, Roswitha, wie geht’s?“
„Wie immer gut.“
Warum nur fiel es ihm schwer, ihr auch nur ein Wort davon zu glauben?
Wenn Tscharly an die Sexpuppen anderer großer Verlagshäuser dachte, prallten zwei Universen aufeinander, denn das dort waren eigentlich keine Frauen mehr, sondern Fleisch gewordene Klischees. Meistens sahen diese Damen auch mit dreißig noch aus wie Anfang zwanzig. Dazu wasserstoffblond, und an Wangen, Brüsten und Gesäß war nicht selten auch chirurgisch nachgeholfen worden. Die Fingernägel waren bunt angemalt, als könne die Welt dadurch ihre graue Tristesse abschütteln, und in den meisten Fällen waren sie so lang, dass Tscharly bezweifelte, dass diese Damen überhaupt tippen konnten, ohne einen schwerwiegenden Arbeitsunfall zu riskieren. Vermutlich taten derlei Barbies sich schon beim Drücken eines Aufzugknopfs schwer.
„Herr Smuss wartet auf mich.“
Regel Nummer eins, die ihm der alte Methusalem auf den Weg gegeben hatte: Familie ist Familie und Geschäft ist Geschäft. Deshalb siezten sie sich vor der Belegschaft und duzten sich unter vier Augen.
„Ich frage kurz an“, sagte Roswitha, während sie die Schokoladenmasse sichtbar im Mund hin und herschob. Sie wirkte nicht, als würde sie die Schokolade genießen.
Während Roswitha schwer schnaufend in den Hörer lauschte, weiteten sich ihre Augen.
Verdammt!, dachte Tscharly, der es gelernt hatte, die Körpersprache anderer zu studieren.
„Sofort eintreten“, wurde er von Roswitha in eine ungewisse Zukunft verabschiedet.
Tscharly gehorchte.
Peter Smuss thronte hinter dem größten Eichenholzschreibtisch, den Tscharly je zu Gesicht bekommen hatte. Beinahe jeder Quadratzentimeter darauf war mit Akten, Büchern und Zeitungsexemplaren belegt. In der Mitte des Schreibtisches thronten Bilderrahmen. Nur Auserwählte hatten die Ehre besessen, die Bilder von Familienmitgliedern jemals betrachten zu dürfen.
„Setz dich“, brummte sein Ex-Schwiegervater, während er mit gewitterumwölktem Gesicht ein Dokument studierte. „Kannst du mir auch nur einen vernünftigen Grund nennen, warum ich dich nicht sofort auf die Straße setzen soll? Wir haben fünfzehn Minuten auf dich gewartet, bevor wir anfingen. Wie du weißt, ist Zeit Geld, gerade in unserem Business!“
Die Enge in seinem Hals reizte Tscharly zu einem Räuspern. Regel Nummer zwei: Familie ist Familie und Geschäft ist Geschäft, also bist du beruflich draußen, wenn du Scheiße baust. Was unweigerlich zu Regel Nummer drei führte: Familie ist Familie und Geschäft ist Geschäft, also musst du noch besser als die anderen sein, damit ich mit dir zufrieden bin.
„Sorry, ich hab gestern noch eine Schlaftablette genommen. Und der Wecker heute Morgen war dann wohl auch noch kaputt.“
Unwirsch winkte der Alte ab – spar dir den Scheiß, keine Ausflüchte. Und verkniff sich ein Grinsen.
„Soll nicht wieder vorkommen“, sagte Tscharly.
Smuss blickte von den Unterlagen auf und fixierte seinen Ex-Schwiegersohn mit einem durchdringenden Blick. Die Augenklappe über dem linken Auge ließ ihn bedrohlich wirken. Andererseits weckte sie in Tscharly Assoziationen an Pippi in Takatuka-Land. Mit einer routinierten Bewegung legte Smuss die Blätter mit der Linken auf die Papierwüste und griff mit seiner Rechten nach einer Pfeife, die in einem antiken Rothändle-Aschenbecher steckte. Genussvoll entzündete er sie mit einem Zippo-Feuerzeug. Das strikte Rauchverbot im Gebäude wurde penibel durchgesetzt, aber der Chef hätte wohl lieber auch noch sein rechtes Augenlicht hergegeben, als auf seine geliebte Pfeife zu verzichten – so erzählten es sich zumindest seine Angestellten!
„Seit du zurück in München bist, ist wieder der alte Chaot aus dir geworden, Tscharly. Manchmal kann ich meine Tochter doch verstehen, warum sie dich sitzengelassen hat.“
Tscharly wollte widersprechen, hielt es aber für besser, den Mund zu halten.
„Ich weiß, dass es zwischen euch beiden nicht mehr ging, da musst du mir nichts erzählen. Zudem habe ich nie behauptet, dass meine Tochter einfach sei. Ich habe dir von Anfang an prophezeit, dass du das keine sieben Jahre durchhältst. Immerhin hast du fünf geschafft. Respekt. Damit warst du in deiner ersten Ehe länger verheiratet als ich.“
Tscharly schwieg eisern.
„Aber während deiner Ehe warst du trotzdem irgendwie zuverlässiger, Tscharly.“
Der alte Methusalem stieß kunstvolle Rauchwolken aus. „Die Afrikaner sagen, ein Mensch gilt dann als erwachsen, wenn er die Schuld an seinen Fehlern nicht mehr der Erziehung durch seine Eltern gibt. Das habe ich meiner Tochter oft genug gepredigt.“
Bam – da lag es auf dem Tisch, und es kostete Tscharly einiges an Mühe, sich jetzt auf keine Diskussion über Sara einzulassen. Blitzschnell durchforstete er sein Gehirn nach Antworten, doch der Alte kam ihm zuvor: „Spar dir dein taktisches Gesülze, Tscharly, ich hoffe, dass du meinen freundschaftlichen Rat verstanden hast. Du bist klug, ich muss das jetzt nicht weiter ausbuchstabieren. Und wahrscheinlich ist es das Beste, wenn du dich weiterhin von meiner Tochter fernhältst. Aber aus meiner Sicht brauchst du dringend eine Frau. Du wirkst auf mich wie Peter Pan, der Junge, der nicht erwachsen werden wollte. In deinem Alter wirkt das langsam lächerlich.“
So war er immer schon gewesen. Offen, direkt und schonungslos. Peter Smuss machte keine Kompromisse, wenn es darum ging, anderen Leuten ohne Umwege seine Meinung mitzuteilen. Der alte Methusalem hatte sein Auge wegen seiner schonungslosen Ehrlichkeit verloren. Im KZ Monowitz war er als junger Mann relativ sicher gewesen, da die IG Farben ein kapitales Interesse an der Ausbeutung seiner Arbeitskraft gehabt hatte. Allein wegen seiner körperlichen Kräfte hatten die Nazis den Metzgersohn nicht sofort in Richtung Gaskammer und anschließendem Krematorium geschickt. „Ich kann von Glück sagen, dass ich nicht durch den Rost gefallen bin“, hatte Smuss diesen Umstand kommentiert. Der Ausspruch entstammte – was viele nicht wussten – dem Jargon der Nazis, die damit die Asche jener im KZ verbrannten Ermordeten meinten. Als ein Vertreter der IG-Farben-Geschäftsführung im Herbst 1944 das Lager aufgrund des immer prekärer werdenden Kriegsgeschehens samt Gattin inspizierte, konnte Peter nicht an sich halten. Solch eine umwerfend schöne Frau hatte er Jahre nicht zu Gesicht bekommen und die besonderen Umstände im Lager trugen das Übrige dazu bei. Obwohl er sich der damit verbundenen Gefahr bewusst war, gelang es Smuss einfach nicht, die Augen von dem blonden, arischen Prachtweib zu lösen. Was den SS-Schergen nicht verborgen geblieben war. Smuss war zwanzig gewesen. Und bevor er die Gelegenheit gehabt hätte, seine Unschuld zu verlieren, hatten die Nazis ihn 1938 verhaftet.
„Du bist hier, um zu arbeiten, du kleiner, dreckiger Jude!“, hatte ihn einer der Oberaufseher vor versammelter Mannschaft angebrüllt, während die Großkopferten bereits im Büro verschwunden waren. „Was erdreistest du dich, eine anständige arische Frau durch deine jüdischen Blicke zu schänden, du elendiger Mistkerl?“
Peter zuckte mit den Schultern und trug innerlich das Bild der Schönen wie eine Monstranz vor sich her – da änderte auch der geifernde SS-Mann nichts dran. Smuss ließ die weiteren wüsten Beschimpfungen über sich ergehen, ohne zuzuhören, was die Wut seines Gegenübers nur noch steigerte.
„Du wagst es, gegenüber deinen Herren aufzubegehren?“, brüllte der SS-Mann. „Ich werde dir Manieren beibringen. Ihr Juden seid das Unglück dieser Erde!“
„Ich wusste nicht, dass es im Tausendjährigen Reich verboten ist, ein Auge auf eine schöne Frau zu werfen“, erwiderte Peter. „Gemäß den Nürnberger Rassegesetzen darf ich sie nicht ehelichen oder mit ihr intim werden – anschauen ist aber erlaubt. Oder gibt es da einen neuen Paragrafen?“
Der deutsche Elitesoldat lief rot an. Sein Körperstamm bebte. Dann zückte er den berüchtigten SS-Dolch und hielt ihn drei Zentimeter vor Peters Gesicht.
„Was steht da, du Saujude?“
Peter Smuss, der Metzgerssohn aus Danzig, riss sich zusammen und blickte dem arischen Elitekrieger des Schwarzen Ordens furchtlos ins Gesicht.
„Meine Lehre heißt Reue, Herr Obersturmbannführer.“
Einige der umstehenden Leidensgenossen kicherten verhalten trotz Todesgefahr. Der Leitspruch „Meine Ehre heißt Treue“ gehörte zum Evangelium dieser atheistischen Weltanschauungskrieger. Was Smuss gesagt hatte, bedeutete eine Gotteslästerung. Was dann im Detail passierte, darüber konnte Smuss bis heute nicht erzählen. Er hatte Tscharly lediglich anvertraut, dass sich der Lagerarzt Horst Fischer in einem stundenlangen Prozedere um ihn gekümmert hatte. Einige der gebrochenen Finger konnte man bei genauer Betrachtung auch heute noch erkennen. Aber die linke Sehkraft blieb für immer verloren.
Einen Tag nach dem Vorfall hatte der Obersturmbannführer Smuss an seinem Krankenlager besucht. „Wenn du noch einmal ein Auge auf eine deutsche Frau wirfst, wirst du blind wie ein Fisch sein und nur noch das Gas und die verzweifelten Schreie deiner Leidensgenossen hören, bevor du zur Hölle fährst, Saujude.“
Tags darauf hatte der Metzgerssohn im KZ seine Arbeit wieder aufnehmen müssen.
Tscharly war der einzige Mensch, dem Smuss diese Geschichte jemals anvertraut hatte. Nicht einmal Sara gegenüber hatte er davon auch nur ein Sterbenswörtchen erwähnt. Sara hatte unter dem Schweigen ihres Vaters entsetzlich gelitten.
Smuss klopfte die Pfeife aus, um Tscharly aus seiner Gedankenwelt zurückzuholen.
„Also, was hast du rausgefunden?“
Endlich – Tscharly gewann seine Sicherheit zurück. Nichts Privates mehr, sondern seine Arbeit im Hier und Jetzt. Das, was er am besten beherrschte.
„Wie bekannt, haben sich die Explosionen in Madrid am 11. März früh am Morgen innerhalb von drei Minuten ereignet. Es war allmorgendliche Pendlerzeit. Hätten die Vorortzüge nicht jeweils wenige Sekunden oder ein paar Minuten Verspätung gehabt, dann wären sie alle gleichzeitig im Bahnhof explodiert. Dann wäre das gesamte Glasdach vom Bahnhof auf die Passagiere herabgeregnet und es hätte noch deutlich mehr Tote und Verletzte gegeben.“
Tscharly legte das Ergebnis seiner Recherchen, das aus einem Sammelsurium von Artikeln, Gesprächen mit Kollegen und Sicherheitsbeamten sowie Hinweisen von weiteren Informanten bestand, dar: „Zehn Spreng-sätze explodierten beinahe zur exakt selben Zeit in den Vorortzügen, drei weitere sollten mit Verzögerung in die Luft gehen. Das ist eine niederträchtige Taktik, um die Rettungskräfte und die Polizei bei ihrem anschließenden Rettungseinsatz zu treffen. Nach den Explosionen eilen Rettungskräfte aller Art an den Unglücksort. Wenn es dann zu weiteren Detonationen kommt, erfordert das eine hohe Anzahl an Opfern unter Sanitätern, Polizisten und so weiter. Dies besitzt negative Auswirkungen auf die Wahrnehmung eines Attentats. Wenn Polizei und Sanitäter nicht mehr sicher sind, wer ist es denn dann noch? Dass die drei Bomben nicht detonierten, war neben der Verspätung der Züge ein weiteres Glück im Unglück.“
„Das Attentat fand am 11. März statt“, brummte Smuss. „Hast du Hinweise dafür gefunden, dass das Anschlagsdatum bewusst in Anlehnung an den 11. September 2001 gewählt wurde?“
Zahlensymbolik zählte zu den Lieblingshobbys sämtlicher Terroristen dieser Welt – ganz gleich welcher politischen Couleur. „Abstrakt gesprochen“, erwiderte Tscharly, „arbeiten die Terroristen mit Bezügen zwischen Attentaten, Gruppierungen und Personen. Jedes RAF-Attentat wurde nach einem ihrer gefallenen Kämpfer benannt, wie du weißt. Das palästinensische Kommando, das die Olympischen Spiele 1972 in ein Massaker verwandelt hat, hieß Schwarzer September, was sich wiederum auf ein Massaker der jordanischen Armee an ihren Landsleuten im September 1970 bezogen hat. Also ja, der Verdacht einer bewussten Kontextualisierung des Anschlags liegt laut einer meiner Quellen durchaus nahe, würde ich sagen. Anscheinend war es den Strippenziehern wichtig, dass ihr Attentat exakt dreieinhalb Jahre nach den Angriffen Al-Qaidas auf das World Trade Center in New York stattgefunden hat. War New York das Symbol der kapitalistischen Welt oder aus Terroristensicht des internationalen Finanzkapitals, so steht Madrid als Chiffre für den Kampf zwischen dem Christentum und Islam seit dem Mittelalter.“
„Weiter?“, forderte ihn der alte Methusalem auf und Tscharly fuhr fort: „In Spanien tobten jahrhundertelang erbitterte Kämpfe zwischen Christen und Muslimen um die Vorherrschaft über die iberische Halbinsel. Erst die Reconquista, die im 15. Jahrhundert triumphierte, stellte die christliche Herrschaft in Europa sicher und vertrieb die meisten Muslime zurück nach Nordafrika und auf die Arabische Halbinsel. Die Anschläge von Madrid besitzen deswegen in der geschichtlichen Dimension eine enorme Symbolkraft: Die muslimischen Attentäter wollten damit wohl verdeutlichen, dass der religiöse Kampf um Europa wieder aufgeflammt und für die Muslime noch lange nicht verloren ist. Sie befinden sich auf einem Kreuzzug. Sie sind im Heiligen Krieg!“
Der Alte winkte ab – das klang für seinen Geschmack wohl zu pathetisch. Tscharly beschloss, sich auf die gegenwärtigen Fakten des Attentats in Madrid zu konzentrieren: „Was laut einem hohen spanischen Sicherheitsbeamten auffällt, ist, dass am 11. März 2004 die Sicherheitsmaßnahmen in Spanien aufgrund der anstehenden Parlamentswahlen bereits extrem hochgefahren worden sind. Mein Informant hat sogar die vage Vermutung geäußert, dass es ein Leck im spanischen Sicherheitsapparat gegeben hat, das die Attentäter mit Informationen über Sicherheitslücken in der Hauptstadt versorgt hat.“
„Das wäre ja ein echter Hammer! Wenn es denn so wäre. Aber mit Vermutungen kommen wir nicht weiter, Tscharly. Indizien, Beweise, zwei unabhängige Quellen, aber bitte keine Vermutungen oder Bauchgefühle“, betete der alte Methusalem ihm das kleine Einmaleins des Journalismus vor. „Was hast du für belastbare Indizien, auf die wir uns als Quellen für unsere Leser beziehen können? Am 1. Januar 2050 habe ich eine Verabredung zum Mittagessen. Bis dahin sollten wir fertig sein.“
„Seltsam ist“, ließ sich Tscharly nicht beirren und fasste jetzt zusammen, was er von einem spanischen Kollegen der berühmten Zeitung El Pais erfahren hatte, „dass sofort nach den ersten Meldungen über das Attentat Spekulationen über die Attentäter aufgetaucht sind. Normalerweise hält sich die Politik bei Attentaten dieser Kragenweite eine Weile lang bedeckt, bis sie sich aufgrund von Informationen ihrer Geheimdienste zu einer Äußerung hinreißen lässt. Aber die Wahlen im Genick hat sich die spanische Regierung nicht entblödet, stehenden Fußes die baskische Separatistenbewegung ETA für die Anschläge verantwortlich zu machen.“
„Die ETA?“ Smuss grinste ungläubig. „Die wollten doch tatsächlich der ETA die Schuld für das Massaker in die Schuhe schieben? Du weißt, wie viel mir am Baskenland, seiner Kultur und seiner hervorragenden Kulinarik liegt, auch wenn ich den Sinn des ETA-Terrors nie verstanden habe. Spanien war nie Nazideutschland. Aber gut, die ETA hat immer nur um ihre nationale Unabhängigkeit und die Loslösung von Spanien gekämpft. Das ist so, als ob es eine Bajuwarische Volksbefreiungsfront geben würde, die mit Waffengewalt für die Loslösung von Deutschland kämpfte. Das passiert wahrscheinlich tausendfach jedes Jahr auf der Wies’n in den Köpfen der bayerischen Stur-Schädel. Aber wie kamen die Regierenden in Madrid ausgerechnet dazu, die ETA ohne Beweise zu beschuldigen? Die einzige Heldentat der ETA, die mir bekannt ist, war, dass sie 1973 Francos Stellvertreter Blanco in die Luft gejagt haben. Dadurch ersparten sie Spanien weitere Jahrzehnte faschistischer Herrschaft. Ich wünschte, die Deutschen hätten ebensolche Cojones und militärische Präzision besessen, um Hitler loszuwerden!“
Tscharly seufzte und Erinnerungen an exzellente Tapas, dunkelroten Wein und feurige Baskinnen mit lodernden Augen stiegen in ihm auf. Ja, das Baskenland war ein Paradies auf Erden und dennoch hatte die separatistische Befreiungsorganisation ETA dort durch Anschläge lange Zeit Terror verbreitet, der von der spanischen Nationalregierung mit Gegenterror beantwortet worden war.
„Die These, dass die ETA den Anschlag begangen hat, wurde am selben Tag Allgemeingut“, fuhr Tscharly fort, „da es politisch perfekt ins Konzept passte. Die Täterschaft der ETA lag im Bereich des Denkbaren. Immerhin ist vier Monate zuvor ein ETA-Kommando, das mit einer halben Tonne Sprengstoff zum Bahnhof Chamartin unterwegs gewesen ist, von den Sicherheitsbehörden einkassiert worden. Die herrschende konservative Partei hat einen großen Teil ihrer Wählerstimmen ihrem harten Kampf gegen die ETA zu verdanken. Deshalb wollte sie sich nach dem Attentat als HardlinerPartei profilieren, um nach Stimmen für die anstehende Wahl zu fischen. Aber die ETA hat nie Attentate in dieser Dimension gegen die Zivilbevölkerung begangen, ohne vorher eine telefonische Warnung auszusprechen. Die Warnungen ließen den Sicherheitsbehörden jedes Mal Zeit zur Evakuierung der Bevölkerung. Ein solcher Anruf hat am 11. März definitiv nicht stattgefunden. Die ETA hätte den Anschlag von Madrid ohne Anruf nie durchgeführt. Das hätte sie die Sympathien ihrer treuesten Unterstützer gekostet.“
„Weiter“, forderte Smuss. „Wenn es nicht die ETA war, wer war es und wie kamen die spanischen Ermittlungsbehörden dann auf die tatsächlichen Attentäter?“
„Es haben sich einige Spuren, die in Richtung Al-Qaida führten, dann doch verdichtet. So wurde ein gestohlener Lieferwagen mit Sprengkapseln und Tonbändern mit arabischen Koranversen in der Nähe von Madrid gefunden. Am 13. März wurde auch noch die Verhaftung von drei Marokkanern und zwei Indern publik gemacht. Die Männer standen im Zusammenhang mit einem Mobiltelefon, das bei einem der nicht detonierten Sprengsätze gefunden worden ist. Die Mobiltelefone als Zünder waren die heiße Spur, welche die ETA schließlich entlastet hat – und die damit in Richtung Al-Qaida geführt haben! Einen Tag später tauchte ein Videoband auf, auf dem Al-Qaidas Militärsprecher behauptet, dass seine Organisation die Verantwortung für die Anschläge übernimmt.“
Smuss brummte für Tscharlys Geschmack unzufrieden. „Das war wohl jetzt die Bildzeitungsversion, Tscharly. Für unser Blatt und für mein unverwüstliches Gedächtnis hätte ich das Ganze gerne ausführlicher. Mehr Informationen, mehr Tiefe, zentrale Akteurs-Interaktionen und so weiter.“
Tscharly fuhr beflissen fort: „Die Masche der spanischen Regierung, vorschnell alle Schuld auf die ETARRAS zu schieben, erwies sich im Nachhinein als Bumerang. Teile der spanischen Bevölkerung zweifelten plötzlich an der Regierungsversion und so kam es zu Demonstrationen gegen die Regierungspartei namens Partido Popular. Die ETA hat dann auch noch das Ihre zum Kippen der Situation beigetragen, wie mir meine französische ETA-Quelle verraten hat. Sie hat sich gegen die Verleumdungen der spanischen Regierung durch Gegenpropaganda zur Wehr gesetzt. Die ETA bestritt jegliche Beteiligung am Attentat. Dabei ist es aber dann nicht geblieben. Eine straff organisierte Terrororganisation wie die ETA besitzt einen Geheimdienst, und der hat in diesem Fall bessere Arbeit geleistet als sämtliche spanische Sicherheitsdienste zusammen. Deshalb beschuldigte ein ETA-Sprecher islamistische Gruppen, den Anschlag begangen zu haben. Und wie zur Bestätigung des ETA-Dementis tauchte am Abend des 11. März ein Bekennerschreiben der Abu-Hafs-El-Masri-Brigaden auf. Das ist eine Untersektion von Al-Qaida!“
„Und?“
„Die Begründung in dem angeblichen Bekennerschreiben lautete, dass Spanien eines der wichtigsten Mitglieder in der Allianz im Krieg gegen den Islam sei. Das bezog sich natürlich auf die Präsenz spanischer Truppen als Teil der internationalen Schutzmacht im Irak. Die Aussage war einem Strategieschreiben von Osama Bin Laden entnommen. Aber es gab Zweifel, dass die Gruppe den Anschlag begangen hatte, da sie sich schon zuvor zu anderen Taten bekannt hatte, die sie allerdings gar nicht begangen haben konnte!“
„Mmh, irgendwelche Trittbrettfahrer also, aber: Al-Qaida bekennt sich, war es aber dann doch nicht, obwohl Al-Qaida den Anschlag begangen hat?“
Tscharly nickte. So wie der alte Methusalem es formulierte, klang es in der Tat absurd. Das hörte sich an wie eine Gleichung mit unzähligen Minuszeichen in den Klammern und Variablen, die scheinbar ohne jede Logik nach Belieben ihren Platz wechselten und ihren Wert änderten.
Tscharly machte sich daran, den Rechenweg der Formel zu erklären: „Es entspann sich ein Verwirrspiel von Beschuldigungen, Dementi und neuen Beschuldigungen zwischen der Regierung, den Oppositionsparteien, der ETA und islamistischen Gruppen. Wahnsinn, was das für ein Chaos war! Überall mischten Geheimdienste mit. Leider gehen Geheimdienste unheilvolle Allianzen mit Terroristen ein – wie wir wissen. Das ist eine der Ursünden sämtlicher Demokratien, denn ein freiheitlicher Staat darf sich nie mit Terroristen in irgendeiner Form verbrüdern.“
Tscharly holte ein zusammengefaltetes Blatt aus seiner Hosentasche. „Das stammt aus einer Strategieschrift von Osama Bin Laden, die wenige Monate vor den Attentaten von Madrid publiziert worden ist. Im Prinzip hat der Scheich bereits alles im `Zweiten Brief an die Muslime im Irak´ vorweggenommen, indem er die Auswirkungen der Anschläge auf das World Trade Center gelobt hat. `Ihre Verluste haben durch diesen Schlag und seine Auswirkungen über eine Billion Dollar erreicht und zum dritten Mal hintereinander hat ihr Haushaltsdefizit eine Rekordzahl erreicht, denn es wird auf über 450.000 Millionen Dollar geschätzt, Gott sei gepriesen dafür.´ Danach hat er die muslimischen Kämpfer zur Elite verklärt: `Ihr seid die Soldaten Gottes, die Speerspitze des Islam und heute die erste Verteidigungslinie der internationalen muslimischen Gemeinschaft. Die Christen haben sich unter dem Banner des Kreuzes versammelt, um die Gemeinschaft des geliebten Mohammed zu bekämpfen. Gebt euch mit eurem Heiligen Krieg zufrieden. Kein Muslim ist würdig euch voranzugehen, denn Gott selbst ist das, worauf ihr vertraut, und die gewaltigen Hoffnungen, die nach Gott in euch gesetzt werden, machen den Muslimen heute keine Schande.´ Dadurch hat Bin Laden allen autonom kämpfenden Zellen einen Freibrief für Attentate erteilt. Die Madrider Zelle hat die Botschaft wortwörtlich genommen und in die Tat umgesetzt.“
Überraschend lange blickte Smuss auf seine Rolex. Vielleicht war er es, der mit der Volontärin zum Lunch verabredet war, überlegte Tscharly. Nein, ausgeschlossen – Smuss war menschlich integer und hätte sich nicht auf eine Frau, die seine Enkelin sein könnte, eingelassen.
„Was für einen verquasten Scheiß Bin Laden von sich gibt!“, fluchte er. „Wenn ich mich mit weltanschaulich-pseudoreligiösem Schwachsinn beschäftigen möchte, lese ich den `Mythus des 20. Jahrhunderts´ von Rosenberg“, setzte er eins oben drauf. „Dazu benötige ich keine Briefe, Strategiepapiere oder Bekennerschreiben eines Rauschebarts, der sich zuerst von der CIA alimentieren ließ und danach die Amerikaner als Dankeschön kräftig in den Arsch gefickt hat!“
Tscharly ließ sich von den herben Worten nicht irritieren. Eine seiner Stärken bestand darin, sich mit Terroristen und ihren Botschaften auseinanderzusetzen. Das bedeutete, deren Schriften zu lesen, zu analysieren und deren Perspektive einzunehmen. Auch wenn das manchmal ziemlich schmerzte! Der Alte hatte schon recht, die ideologische Fundierung der Madrider Anschläge durch einen selbsternannten Propheten wie Bin Laden, interessierten an dieser Sache nur am Rande. Zurück zu den Fakten!
„Ja“, stimmte er Smuss deshalb zu. „Die Islamisten sind vielseitig. Im Afghanistan-Krieg galt die Devise `Der Feind meines Feindes ist mein Freund!´ Deswegen hat die westlich-kapitalistische Welt die Muslime unterstützt, um die kommunistisch-atheistische Besatzungsmacht der Sowjetunion in Afghanistan zu besiegen. Einer der marokkanischen Verdächtigen des Terroranschlags von Madrid wies laut meiner Quelle aus dem Innenministerium Verbindungen zu den Anschlägen auf das World Trade Center in New York auf. Die spanische Fahndung wurde auf zwanzig Marokkaner ausgeweitet – allesamt Veteranen des Afghanistan-Krieges und jetzt Al-Qaida!“
„Sie haben die Hurensöhne also doch geschnappt? Und hoffentlich an ihren Eiern aufgehängt.“
Tscharly nickte. „Die meisten geschnappt, aber das mit den Eiern wird dein Wunschtraum bleiben. Am 3. April schlugen spanische Anti-Terroreinheiten im Madrider Vorort Leganés zu. Es gab einen heftigen Schusswechsel. Gegen einundzwanzig Uhr stürmten Spezialkräfte die verdächtige Wohnung. Die Aktion war allerdings ein Fehlschlag. Als die Polizisten in das Haus eindrangen, sprengte sich der Rädelsführer in die Luft und tötete dabei sechs seiner islamischen Brüder und einen Polizisten. Fünfzehn Polizisten wurden insgesamt verletzt. Es wird vermutet, dass einigen Komplizen die Flucht gelang. In unterschiedlichen Zusammenhängen kamen mir Hinweise zu Ohren, dass einer der Geflüchteten ein V-Mann eines europäischen Geheimdienstes gewesen sein könnte. Vielleicht sogar eines deutschen …“
„Hinweise, gewesen sein könnte …“, äffte der alte Methusalem ihn nach. „Wenn du schon meine Tochter nicht in den Griff gekriegt hast, so hegte ich doch die Hoffnung, dass du dein Handwerk bei mir wenigstens anständig gelernt hast, Tscharly. Aber auch hier scheine ich mich getäuscht zu haben.“
Tscharly überhörte die Spitze geflissentlich. „Das Ende ist bekannt“, steuerte er nun direkt auf das Ergebnis seiner Gleichung zu: „Der Anschlag hat die politische Landschaft in Spanien verändert. Die bis dato herrschende Partido Popular unter Premierminister Rayo wurde abgewählt! Das hat sie sich wegen der Verschleierungstaktik in Sachen Attentat selbst zuzuschreiben. Die Sozialisten unter der Führung von Zapatero gewannen mit über zweiundvierzig Prozent der Stimmen. Al-Qaida hat so gesehen einen triumphalen Sieg errungen. Die neue, sozialistische spanische Regierung hat nämlich umgesetzt, dass alle ihre Truppen aus dem Irak abgezogen worden sind. Schon allein um weitere islamistische Attentate auf spanischem Boden zu verhindern!“
„Waschlappen!“, kommentierte Smuss. „Ohne Rückgrat und Verstand. Solche Schmocks! Haben sich von den Halsabschneidern den Schneid abkaufen lassen.“
„Einer der festgenommenen Marokkaner hat übrigens etliche Jahre in Deutschland gelebt. Aus unerfindlichen Gründen wurde er von den Spaniern schon nach kurzer Zeit freigelassen. Und damit wären wir wieder beim Casus knacksus! Wenn nämlich Sicherheitsbehörden und Justiz schwerkriminelle Angehörige von Terrororganisationen ohne erkennbare Gründe schnell aus der Haft entlassen, liegt der Verdacht nahe, dass es sich um den V-Mann eines Geheimdienstes handelt. Das gilt nicht nur für autokratische Systeme, sondern leider auch für Demokratien. Insofern liegt es auf der Hand, dass dieser Marokkaner mir Aufschluss über Al-Qaida und deren Verbindungen mit europäischen und deutschen Geheimdiensten geben kann. Es liegt im Interesse unserer Demokratie, solche Machenschaften aufzudecken. Wir haben die Pflicht, die Bevölkerung über solche Schweinereien aufzuklären, Peter.“
Tscharly war damit am Ende seiner Ausführungen angekommen. Sein ExSchwiegervater nuckelte in sich gekehrt an der Pfeife. Tscharly kramte aus seinem Portemonnaie einen zusammengefalteten Din-A4-Zettel, entfaltete ihn, stand auf, beugte sich soweit es ging über den Schreibtisch und platzierte ihn vor Smuss’ Nase. Der ließ sich von seinem Ex-Schwiegersohn nicht drängen und wandte sich mit dosierten Bewegungen dem Papier zu.
„DITIB-Moschee?“, fragte er schließlich völlig ungläubig. „Ausgerechnet in Köln!“
Tscharly nickte.
„Wenn dein auf diesem Fresszettel stehender Gewährsmann nicht ein alter Bekannter von mir wäre, könntest du dir mit dem Fetzen den Arsch abwischen, Tscharly.“
Erregte Rauchzeichen stiegen empor. Ein erneuter Blick auf die Rolex, gefolgt von heftigem Stirnrunzeln, was das Muster auf Smuss’ Stirn wie einen mehrfach gefurchten Acker aussehen ließ. „Mir machst du nichts vor, Kleiner, aber wenn ich von Sara auch nur ein einziges Wort der Beschwerde höre, schmeiße ich dich in hohem Bogen raus.“
Tscharly atmete auf. Freundlicher konnte der alte Methusalem seine Erlaubnis, auf Kosten der Zeitung in Köln Nachforschungen anzustellen, wohl kaum formulieren.
„Danke, lieber Ex-Schwiegerpapa.“
„Aber wenn du dich am Ende noch mit ihr versöhnst, ist das auch dein Problem, Tscharly. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Jedenfalls unterlässt du alles, was Sara“, jetzt machte er mit dem rechten Zeigefinger eine langsame Drehbewegung auf Höhe der Schläfe, „in irgendeiner Form schaden könnte, solange du dich in dieser Stadt am Rhein aufhältst. Hast du mich verstanden?“
„Ich habe Sara immer geliebt.“
„Spar dir deine Beteuerungen. Mich interessieren nur Resultate. Also, ich will die ganz große Geschichte. Klage sie alle an – die Herrschenden, das System, die Geheimdienste. Ich weiß, du bist ein fähiger investigativer Journalist. Du kannst, wenn du willst sogar pünktlich sein! Aber was du meiner Meinung nach am allerdringendsten brauchst, ist eine Frau, Tscharly, die endlich Ordnung in dein chaotisches Leben bringt.“
Mittwoch, 9. Juni12.02 Uhr – 13.15 Uhr, über den Wolken
„Wir begrüßen unsere Fluggäste an Bord der Lufthansa-Maschine 212 auf dem Flug 303/12 von München nach Köln und bitten Sie nun, sich anzuschnallen und die Gurte erst zu lösen, wenn wir Sie darauf hinweisen. Wir wünschen Ihnen während unseres Fluges einen angenehmen Aufenthalt an Bord.“
Tscharly lehnte sich zurück. Wurde Zeit, dass auch in der Economy-Class die Sitze endlich für breitere Schultern gebaut wurden.
Gestern, nach seinem Gespräch mit dem alten Methusalem, hatte er die Zeit mit Internetrecherche verbracht und in Köln einige Anwälte kontaktiert, mit denen er seit zwanzig Jahren zusammenarbeitete. Einer von ihnen zählte zum früheren Bekanntenkreis des deutschen Außenministers Joschka Fischer. Fischer, der selbst in den Siebzigerjahren zur RAF-Sympathisanten-Szene gehört hatte, zählte ja heutzutage längst zum politischen Establishment. Der Anwalt-Freund wiederum hielt über drei Ecken Kontakt zu einem ehemaligen RAF-Anwalt, der in den Siebzigerjahren regelmäßig Haschisch in die Hochsicherheitszelle der Stuttgarter Gefangenen geliefert hatte. Dadurch hatte er der jungen Bundesrepublik einen Gefallen erwiesen, indem er verhindert hatte, dass Andreas Baader und die Genossinnen der ersten RAF-Generationen völlig durchgedreht waren. Der alte Methusalem besaß einen persönlichen Draht zu Fischer, was sich schon des Öfteren als nützlich erwiesen hatte. Mal sehen, wie lange die rot-grüne Regierung in Berlin noch hielt! Die Umfragewerte kündigten eine politische Zeitenwende an. Viele einstige Wähler verübelten den Grünen die Teilnahme an einem Kriegseinsatz – dem ersten in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Tscharly erhoffte sich über den Anwalt an den Namen des V-Manns heranzukommen, der von dem Anschlag in der Madrider U-Bahn gewusst hatte. Wenn es ihm gelang, hier einen Beweis zu liefern und ein Gesicht zu präsentieren, dann … dann …
Die Stewardessen gaben ihre obligatorische Vorstellung, wie Schutzmasken und Jacken zu verwenden seien. Eine Brünette mit schwarzen, glutvollen Augen erregte Tscharlys Aufmerksamkeit. Hatte er dieselbe Frau gestern am Nachmittag im Fitnessstudio gesehen? Tscharly hatte wie üblich seine Hanteln gestemmt und anschließend ein Ausdauertraining absolviert, als ihm diese Frau ins Auge gestochen war. Das Fitnessstudio eignete sich nach wie vor am besten, um ein wenig Zerstreuung zu finden. Außerdem – hatte sein ExSchwiegervater ihm nicht angeraten, sich dringend eine Frau zu suchen?
Ehe Tscharly eine Antwort auf seine Frage fand, glitten seine Gedanken wieder zu seinem Verdacht zurück: Wenn er es schaffte, dem alten Methusalem und der deutschen Öffentlichkeit einen Beweis für seine These zu präsentieren, dann würden die Menschen in diesem Land vielleicht endlich aus ihrer Naivität erwachen. Ein Geheimdienst, der nach Belieben agierte und V-Männer mit dubiosen Vergangenheiten aller Art anheuerte … In Gedanken versuchte er seine Überlegungen der attraktiven Stewardess zu erklären, die gerade ihre Vorstellung beendete: „Das ist, als würde man einen Bankräuber als Bankdirektor einstellen! Das Risiko ist unkalkulierbar!“