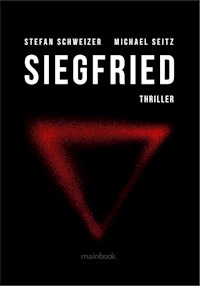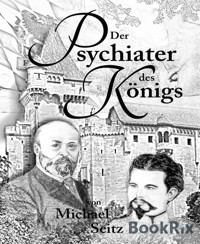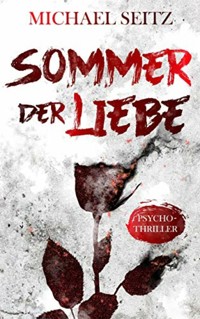
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einer Hippie-Kommune verschwindet eine junge Frau spurlos.
Vierzig Jahre später wird die Leiche eines Mädchens, das in einer betreuten Wohngemeinschaft für Teenager gelebt hat, grausam ermordet aufgefunden.
Seine Ermittlungen führen Profiler Tobi Miller von der Gegenwart in die schillernden Siebzigerjahre. Im Fokus der Ermittlungen steht die Kommune des Kunstmalers Heinrich Maier – eine Enklave der `68er-Bewegung. Als der Profiler einen weiteren Mord an einem jungen Menschen verhindern will, führt sein Weg ihn von Wien bis an die Küste Siziliens, wo einige Akteure aus den alten Zeiten ein zutiefst menschenverachtendes Geschäftsmodell aus ihren einstigen Idealen und Ideologien gemacht haben.
Tobi muss schließlich auch um das eigene Leben fürchten, denn seine Gegner kennen weder Skrupel noch Gewissen und töten konsequent jeden, der sich ihrem absoluten Machtanspruch in den Weg stellt …
Ein packender Psychothriller über Illusionen, enttäuschte Hoffnungen und Lebenslügen vor dem Hintergrund von Sex, Drugs & Rock`n Roll
Nach einer wahren Begebenheit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sommer der Liebe - Psychothriller
Den IrrendenBookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenImpressum
Sommer der Liebe - Psychothriller
Michael Seitz
Copyright © 2021 Michael Seitz
Redaktion & Lektorat: Elke Seitz
Covergestaltung Sarah Schemske bücherschmiede.net
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN: 9798718368932
Inhaltsangabe
Ein Psychothriller vor dem Hintergrund von Sex, Drugs & Rock`n Roll
In einer Hippie-Kommune verschwindet eine junge Frau spurlos.
Vierzig Jahre später wird die Leiche eines Mädchens, das in einer betreuten Wohngemeinschaft für Teenager gelebt hat, grausam ermordet aufgefunden. Seine Ermittlungen führen Profiler Tobi Miller von der Gegenwart in die schillernden Siebzigerjahre. Im Fokus der Ermittlungen steht die Kommune des Kunstmalers Heinrich Maier – eine Enklave der `68er-Bewegung. Als der Profiler einen weiteren Mord an einem jungen Menschen verhindern will, führt sein Weg ihn von Wien bis an die Küste Siziliens, wo einige Akteure aus den alten Zeiten ein zutiefst menschenverachtendes Geschäftsmodell aus ihren einstigen Idealen und Ideologien gemacht haben.
Tobi muss schließlich auch um das eigene Leben fürchten, denn seine Gegner kennen weder Skrupel noch Gewissen und töten konsequent jeden, der sich ihrem absoluten Machtanspruch in den Weg stellt …
Hinweis
Ein Personenverzeichnis mit den in der Kommune lebenden Personen samt Auflösung mit den bürgerlichen Realnamen findet sich im Anhang dieses Buches. Wer die Spannung jedoch aufrecht erhalten und lieber mitraten möchte bis zum Schluss über das Who is Who, sollte erst gegen Ende dort nachschlagen.
Prolog
Dazu ist es zu spät; ich kann nicht mehr umkehren. Jetzt, nach jenem Vorfall, der sich in der U-Bahn-Station ereignete, von dem die Welt keinerlei Notizen nahm. Ich sehe ihre Gesichter verschwommen im Neonlichtschatten der Rolltreppe, an der ich zum Täter und Opfer geworden bin; meine Monster tragen keine Masken. Blut aus der Wunde an deinem Hals, aus deinem Mund, mit Speichel vermischt. Sie haben dir einen Eckzahn ausgeschlagen – mindestens. Wenn nicht sogar zwei! Ich versuche mit einem Taschentuch die Wunde abzudrücken, um das Schlimmste zu verhindern. Hätte ich dich liegengelassen, was hätte es für eine Konsequenz gehabt? Wer konnte schon wissen, dass das Virus in dir und deinem Blut einen Wirt gefunden hatte, eine Fehlkonstruktion der Schöpfung? Welches dämliche Virus kann nur so destruktiv sein, den Ast, auf dem es sitzt, selbst abzusägen! Aber von Selbstzerstörung brauchst du mir ja nichts erzählen; darin habe ich jede Menge Übung, was wohl auch der Grund ist, warum ich dein Flehen „Nicht Polizei rufen! Bitte!“, erfüllt habe. Du bist mir in die Wohnung gefolgt, ich habe dir meine Dusche zur Verfügung gestellt, frische Kleidung. Ich habe mir deine Geschichte angehört, und dann war es um mich geschehen. Ich wurde zu deinem Wirt; jetzt bist du mein Virus. Und die Krankheit, die ich in mir trage, ist ein Gastgeschenk, eine Erinnerung an dich. Sag mir, was sind dagegen schon die Monster, die schamlos ihre nackten Gesichter zeigen, wenn es keinen Weg zurück gibt, wo man noch die Möglichkeit hätte, eine andere Wahl zu treffen? Einfach weiterzugehen, um damit wenigstens ein Leben zu retten, wenn man schon nicht beide retten kann?
August 1977
Heinrich hatte sich neben sie gesetzt, und es war ihr wie ein kleines Wunder erschienen. Damals. In der Bar im Ersten Bezirk, in der Jimmy Hendrix ein Gitarrensoli darbot und Janis Joplin in weinerlichem Singsang stündlich intonierte, dass allein der Wind die Antwort auf sämtliche Fragen des Lebens wusste. Andrea stellte sich auf Zehenspitzen, um Heinrichs Worten zu lauschen. Man konnte ja sein eigenes Wort kaum verstehen. Heinrich war mit Abstand der Älteste in diesem Lokal. Heinrich hätte ihr Vater sein können. Er hatte im Krieg, über den ihre Eltern niemals vor ihr sprachen, gekämpft. Manchmal, wenn Papa mit seinen alten Kameraden zusammenkam, hatte Andrea die Männer belauscht. Die Kameraden aus vergangenen Tagen schütteten Schnaps in ihren Kaffee, und die Erzählungen über Russland hörten sich an wie von einem missglückten Urlaub. Die Männer wussten, wovon sie sprachen. Verstanden einander, wie man sich nur versteht, wenn man den Kessel von Stalingrad überlebt hat. Ihre Frauen dagegen mussten nicht alles wissen! Und die Kinder sollten froh sein, dass ihnen ein Krieg gegen den Iwan – wie sie den Feind nannten –, erspart blieb.
Heinrich legte einen Arm um Andreas Hüfte. „Was hast du heute noch vor, Mädchen?“
Andrea war eben gerade siebzehn geworden; die Reifeprüfung hatte sie im Mai bestanden. Heinrichs lange graue Haare, die er zu einem Pferdeschwanz gebändigt hatte, seine dunklen, geheimnisvollen Augen, seine von der Sonne gegerbte Haut und seine schlanken Künstlerhände waren ihr sofort aufgefallen. Das war vor acht Wochen gewesen. Als sie das Lokal mit ihrer Freundin Brigitta zum ersten Mal betreten hatte. Mit Brigitta zusammen traute sie sich alles. Mit Brigitta konnte sie offen reden; ein Leben ohne die Freundin schien ihr schier unvorstellbar. Allein hätte Andrea sich niemals in diese heilige Stätte vorgewagt. Die Mutter hatte Andrea wie eine biblische Prophetin verboten, diesen babylonischen Ort der Sünde jemals zu betreten. Nur daran zu denken. Allein die Auserwählten verkehrten in diesem Lokal. Und Heinrich, mit dem Aussehen eines Seeräuberkapitäns, galt als Verführer in persona. Andrea hätte es von sich aus niemals gewagt, Heinrich auch nur in die Augen zu sehen; zu groß wog die Angst, er könnte sie anhand eines einzigen Blickes als Klosterschülerin erkennen.
Heinrich Maier, Maier mit a-i, nahm ihr Kinn in seine Hand und fügte zu seiner Frage hinzu: „Ich wüsste da eine Möglichkeit für ein Menscherl wie dich. Du bist was Besseres als – die.“ Er vollführte aus dem Handgelenk eine Geste, die alle anderen jungen Menschen umfasste. Das Odeur mit süßlichen Substanzen durchdrungenem Tabaks hing in der Luft. Bierflaschen lagen auf dem Boden. Aschenbecher standen kopf. Die jungen Leute grölten jetzt zu einem Lied von The Doors. Heinrich nahm Andrea in seine Arme. Selbst Wochen später konnte sie ihr Glück kaum fassen: Er hatte sie auserwählt. Ausgerechnet! Wo sie doch auf dem Gymnasium der Dominikanerinnen von Anfang an das Dasein eines Mauerblümchens gefristet hatte. Die Mädchen, die auf dem Internat lebten, hatten alle einen Freund. Es gehörte zum guten Ton, einander vom Verlust der Jungfräulichkeit zu berichten. Andrea, die zu den Auswärtsschülerinnen zählte, hätte in ihrer Freizeit jede Möglichkeit verstreichen lassen, einen Jungen kennenzulernen. Das Mädchen, das mit gesenktem Blick durch die Straßen schlich. Angst davor hatte, gesehen zu werden. Am Ende hätte tatsächlich jemand es gewagt, sie anzusprechen. Andrea wünschte es sich tief in ihrem Innern und doch fürchtete sie den Moment. Sie wusste nicht, was sie getan hätte, wenn ein Junge an ihr Interesse gezeigt hätte. Und außerdem überwog da auch die Angst vor der Reaktion ihrer Eltern.
„Du musst um zehn zu Hause sein!“, hatte die Mutter ihr aufgetragen.
Der Vater spielte mit seinen Freunden Karten. Papa kam für gewöhnlich erst im Morgengrauen von solchen Kameradschaftsabenden nach Hause. Er war derjenige, der seiner Tochter mehr erlaubte als seine Frau es für gehörig erachtete. Andreas Mutter würde ihre Tochter mit Ohrfeigen empfangen und ein Ausgehverbot verhängen, wenn sie sich nicht an die vereinbarte Zeit hielt. Vor allem die Kärntner Straße, an der zu dieser Zeit die Prostituierten ihrem Geschäft nachgingen, war der Mutter ein Dorn im Auge. Am Ende hielten die Männer ihre Tochter für ein „gefallenes Mädchen“, wenn Andrea sich der Straße näherte – eine Flitschen, wie die Wiener sagten; die Nachbarn zerrissen sich ohnehin ihr Maul wegen Andreas bunten Hippiekleidern.
Andreas Armbanduhr, die sie zur Firmung bekommen hatte, zeigte neun Uhr. Sie blickte in die Augen dieses Mannes, der ungefragt seinen Arm einfach um sie gelegt hatte. Und spürte ein warmes Gefühl in ihrem Bauch! Gleichzeitig schoss ihr eine peinliche Röte ins Gesicht; sie wollte vor Scham den Blick senken. Heinrich hielt ihr Kinn fest und sagte: „Wie heißt du?“
Andrea schaffte es irgendwie, ihm zu antworten.
„Ein schöner Name“, befand er. „Ein besonderer Name. Die Tapfere“, übersetzte er. „Ich habe ein altgriechisches Gymnasium besucht. Aber das ist lange her. Jetzt sind die Zeiten andere. Und wenn du willst, kann ich dir zeigen, was für Zeiten jetzt angebrochen sind. Mutig in eine neue Zeit! So heißt doch die Devise.“ Er lachte über seine Floskel, mit der die Sozialdemokraten in den Wahlkampf gezogen waren.
Andrea stimmte wie durch Magie in sein Gelächter mit ein. Hatte sie sich eben noch krampfhaft mit beiden Händen an einer Flasche mit Zitronenlimonade festgehalten, lockerten sich ihre Finger jetzt.
„Geh, leg des Kracherl weg“, sagte er und stellte die Bottel achtlos auf den Tisch.
Ehe sie zu einer Erwiderung fähig gewesen wäre, umschloss er mit seinen Lippen die ihren. Instinktiv stellte sie sich auf die Zehenspitzen. Sie war ohne Schuhe von zu Hause losgezogen – barfuß; sie wollte nicht auch noch die Füße einsperren. Andrea erwiderte seinen Kuss. Seine wunderschönen Hände strichen durch ihr Haar. Die Wärme in ihrem Bauch breitete sich in alle Körperregionen aus. In den Liebesromanen, die sie heimlich unter der Bettdecke las, hieß es immer, dass Frauen in den Armen ihrer Verführer dahinschmolzen. Bisher hatte sie keine Ahnung davon gehabt, was die Autorinnen dieser Bücher damit gemeint hatten; in diesem Moment in jenem berüchtigten Lokal in der Kärntner Straße bekam sie eine Ahnung davon, was der Ausdruck „dahinschmelzen“ wohl bedeutete. Dieser reife, erwachsene Mann gab ihr die Sicherheit, die sie bei ihrem Vater vermisste. Papa schaffte es ja nicht einmal, sie vor ihrer strengen Mutter und deren Schlägen zu beschützen. Allein Heinrichs Anwesenheit geriet zu einem Versprechen. Das Versprechen einer Welt, in der es keine Klosterschule, kein Russland und auch keine Regeln mehr gab. Es bedeutete die Flucht aus einer Welt, in der die Erwachsenen ihren Kindern einbläuten, was Moral und Anstand hieß. Und dabei offenbar vergessen hatten, was sie ein paar Jahre zuvor den Juden angetan hatten! Andrea lauschte den Worten dieses Mannes wie unter Hypnose. Sog jeden Laut wie eine durstige Seele das Wasser in sich auf. „Du bist anders als die anderen. Du bist was Besonderes, Andrea! Von jetzt an gehören wir zusammen. Bis in den Tod!“
Und es klang in ihren Ohren wie ein altgriechischer Sirenengesang auf einer wilden Odyssee von Träumen.
Wien, Montag, 15. Oktober 2018, 13. Bezirk, Tag drei ohne das Nasenspray
Die Betreuerin heißt Brigitta Seghers; weißhaarig, verhärmtes Gesicht, und wenn mich jemand nach meiner Meinung fragen würde, würde ich ehrlicherweise antworten: „Ich bin schwul, und das ist gut so!“; diese Frau verströmt eine Wärme wie im Inneren einer Gefriertruhe. Sibirien klingt in ihrer Gegenwart wie ein Versprechen von einem Strandurlaub.
„Wann haben Sie Jennifer zuletzt gesehen?“
Bruno Horvath tippt sich mit dem Zeigefinger ans Kinn, während er diese Frage an die Betreuerin richtet. Finger am Kinn – ein Mann in Denkermanier, Brunos übliche Geste, die er mal mehr mal weniger unbewusst macht. Auf alle Fälle seine Reaktion auf Momente, in denen ihm unbehaglich zumute ist. Ich kenne Bruno jetzt schon zwanzig Jahre. Manchmal sehne ich mich noch nach der Zeit in dem Gefängnis mit den Todeskandidaten zurück. Huntsville. Texas. Zwischen Wien und Huntsville liegen inzwischen dreizehn Monate. Diese Geste mit dem Zeigefinger am Kinn gehörte schon zu Bruno, bevor ich mir auf der anderen Seite des Atlantiks eine Auszeit von Österreich genommen habe; manches ändert sich eben nie.
„Ich habe Ihnen doch schon gesagt, Herr Inspektor, ich weiß es nicht mehr!“, antwortet die Seghers.
„Sie haben vor einer Woche Dienst gehabt und Sie haben auch gestern Dienst gehabt“, erwidert Bruno, „und in beiden Fällen können Sie sich nicht erinnern, wann Sie die Mädchen zuletzt gesehen haben?“ Er schüttelt den Kopf; als Vater einer Tochter, die im Dezember ihren achtzehnten Geburtstag feiert, hat er sich unter einer Betreuungseinrichtung für Teenager eindeutig etwas anderes vorgestellt, verrät mir seine wütende Miene. Ich bin derjenige von uns beiden, der keine Kinder hat. Ich, der Kinderlose, übernehme wohl besser das Ruder; wahrscheinlich verfüge ich über etwas mehr emotionale Distanz zu unserem aktuellen Fall als ein fürsorgender Vater und Beamter.
„Haben sich die beiden jungen Frauen in letzter Zeit anders verhalten?“
Brigitta Seghers’ Falten um Augen und Mundwinkel spiegeln Empörung wider. „Es sind Teenagerinnen! Welcher Teenager in dieser Einrichtung hat keine adoleszenten Probleme? Herr Miller, wir befinden uns hier in einer Wohngemeinschaft für Jugendliche, die aus guten Gründen durch die Fürsorge des Jugendamts von ihren Eltern getrennt worden sind. Die meisten hier haben Elternteile, die entweder alkoholabhängig, suchtgiftabhängig oder gewalttätig sind. Dass eines der Mädchen aus der Einrichtung wegläuft, passiert im Durchschnitt einmal pro Woche. Und meistens kommen die Kinder auch wieder zurück. Ich weiß nicht, warum Sie diesmal einen derartigen Aufstand veranstalten, meine Herren! Das kann doch nicht Ihr Ernst sein.“
Brigitta Seghers gehört eindeutig zu jenen Frauen, die schon weißhaarig zu Welt gekommen sind, nehme ich an. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass sie jemals jung war; dazu leuchtet ihr Gesicht einfach zu blass; blutleer, wie das eines Zombies aus einem Siebzigerjahre-Vampirfilm mit Klaus Kinski-du-dumme-Sau! Sie fächert sich mit einem Exemplar einer Tageszeitung genervt Luft zu und seufzt auch noch gequält.
Bruno legt ein Blatt Papier auf den Schreibtisch. „Sie wissen genau, warum wir hier sind, Frau Seghers!“
Seghers ignoriert den Erpresserbrief.
„Kennen Sie diese Handschrift?“
Seghers wirft einen Blick auf das Schreiben, ohne es auch nur mit der Fingerspitze zu berühren. „Nein, Herr Inspektor! Und das habe ich Ihnen bereits gesagt. Alles was ich weiß, habe ich Ihnen bereits am Telefon mitgeteilt! Sie hätten nicht extra auch noch herkommen müssen.“
Ich spüre den altbekannten Impuls, nach meinem Nasenspray zu greifen. Seit drei Tagen halte ich es jetzt ohne mein geliebtes Nasenspray aus. Ein echter Held! Immerhin bin ich süchtig nach dem verdammten Nasenspray, weil es meine Nerven beruhigt. Ich versuche, mir nichts von meiner Nervosität anmerken zu lassen; wenn man als Kriminalpsychologe arbeitet, hegen die Menschen insgeheim sehr hohe Erwartungen, die mit meiner Rolle einhergehen. Ich versuche es deshalb mit Fachjargon; vielleicht schinde ich damit Eindruck auf dieses verhärmte Exemplar einer hochaltrigen Pädagogin.
„Wir wissen, die Kinder lernen am meisten am Vorbild und aus ihren Erfahrungen“, erkläre ich ihr.
„Wem sagen Sie das, Herr Miller?“ Seghers zündet sich mit einem Gasfeuerzeug eine Zigarette an. „Dessen sind wir uns hier alle in der WG ja auch bewusst.“
„Und in diesem Alter suchen sie ihre Vorbilder bei den Gleichaltrigen – in der Peer-Group.“
Seghers bläst mir kalten Rauch ins Gesicht. Ich atme durch den Mund. Ich wiege über hundert Kilo – um genau zu sein: deutlich über hundert Kilo! Seit einem Jahr stelle ich mich deswegen auf keine Waage mehr. Wer braucht schon Zahlen, um an ihnen sein Wohlfühlgewicht zu definieren? Aber übergewichtige Menschen passivem Rauch auszusetzen, erfüllt eindeutig den Tatbestand der Körperverletzung; am liebsten würde ich dieser Frau mit meinem Hintern ins Gesicht springen; ich halte meinen Reizhusten zurück.
Ich konfrontiere Seghers mit den Fakten: „Anastasia ist zuerst verschwunden. Gestern Jennifer! Und heute lag zufällig dieses Erpresserschreiben im Briefkasten der Zentrale Ihres Vereins!“
Ihr Pokerface lässt keinen Rückschluss über irgendwelche Emotionen zu.
„Wir müssen ausschließen, dass es sich hier um einen Streich handelt“, sagt Bruno, den Finger inzwischen wieder am Kinn.
Seghers lehnt sich zurück und bläst genüsslich Rauch in die Luft. Neben ihr steht ein Computer; eine Staubschicht überzieht den schwarzen Bildschirm.
„Bitte, meine Herren, wenn Sie meinen, dann ermitteln Sie. Die Mädchen werden aber von selbst wieder auftauchen! So ist das bisher jedes Mal gewesen.“
„Wir würden uns trotzdem gerne die Zimmer der beiden ansehen“, beharrt Bruno.
„Wie können Sie das nur von mir verlangen, Herr Inspektor?“, plustert sich Brigitta Seghers unerwartet auf. Ihre Empörung gleicht der einer Suffragette bei einem vatikanischen Konklave. Bruno senkt demütig seinen Kopf. Er ähnelt einem kleinen Jungen, und die Seghers liest ihm jetzt ordentlich die Leviten: „So leicht werden wir die Intimsphäre unserer Jugendlichen nicht preisgeben! Es geht hier schließlich um Vertrauen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das Urvertrauen dieser jungen Mädchen und Frauen wurde in der Vergangenheit schon genug enttäuscht. Es geht hier um Professionalität und Beziehungsaufbau. Wir setzen wegen irgendwelcher fragwürdigen Ermittlungen nicht die Integrität dieser Einrichtung aufs Spiel, meine Herren!“
„Dann besorge ich eben einen Durchsuchungsbefehl!“, antwortet Bruno trotzig.
Seghers widerspricht: „Den Sie im Leben nicht bekommen werden, Herr Inspektor. Oder gibt es etwa den Verdacht, dass die Mädchen ein Verbrechen begangen haben?“
Ich versuche nochmal das fachliche Gespräch unter Insidern. „Wenn es sich um eine Adoleszenzkrise handelt, weil beide durch einen Zwischenfall in ihrem Vertrauen zu Ihrer Einrichtung eine sogenannte Re-Traumatisierung erfahren haben, könnte es sich im schlimmsten Fall ja auch um Selbsttötung handeln. Nehmen wir an, Anastasia hat in irgendeiner Form Gewalt erlebt. Vielleicht in der Schule oder an ihrer Lehrstelle. Anastasia läuft davon und tut sich was an. Suizid – wird auch definiert als die extremste Form der gegen sich selbst gerichteten Aggression, wie Sie wissen.“
„Mir müssen Sie nicht erklären, was Autoaggressionen sind, Herr Miller.“ Seghers zieht an ihrer Zigarette, als handele es sich bei dem Glimmstängel um den weltweit letzten seiner Art. „Wir haben hier ständig mit Selbstverletzungen zu tun. Es vergeht kein Tag, an dem nicht eines der Mädchen sich ritzt oder sich auf irgendeine andere Art und Weise schädigt. Ich kenne meinen Job! Den müssen Sie mir nicht erst erklären.“
Ich atme tief in den Bauch und erkläre ihr meine Hypothese: „Eine Woche später läuft dann auch noch Jennifer weg und tut sich ebenfalls was an“, komme ich auf den Ausgangspunkt meines Referats zurück. Ein Referat, das ich allein deshalb halte, um diese Frau milde und zugänglich zu stimmen.
Seghers lacht eiskalt. „Und von mir wollen Sie jetzt wissen, wer diesen Erpresserbrief an unsere Leitung geschrieben haben könnte, meine Herren. Und zu allem Überfluss wollen Sie auch noch die Mädchen hier als Zeugen befragen. Und herumschnüffeln. Was glauben Sie, was hier los ist, wenn hier zwei Kriminalbeamte auftauchen und den Mädchen unbequeme Fragen stellen?“ Seghers legte ihre Zigarette in den Aschenbecher. „Nein, meine Herren, unsere Zentrale hat Ihnen bereits Bilder und Daten über die beiden Mädchen gegeben. Sie haben alles, was Sie für Ihre Fahndung brauchen. Was wir uns hier nicht leisten können, ist ein Aufruhr in jeder nur erdenklichen Art. Wenn Sie weitere Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an die Geschäftsführung. Dieses Gespräch ist hiermit beendet!“
Seghers drückt die Zigarette aus, als könnte sie damit auch gleichzeitig alle Probleme und Widersacher auslöschen. Ihre angeknabberten Fingernägel weisen nikotingelbe Ränder auf.
Bruno presst die Lippen aufeinander. Ermittler, die selbst Kinder haben, sind in einem Fall wie diesem zweifellos im Nachteil. Die Abgrenzung fällt ihm sichtlich schwerer.
„Wir werden wiederkommen!“, höre ich meine Stimme – die Stimme des Kinderlosen. Die Stimme des Schwulen. Desjenigen, der selbst niemals Kinder haben wird. Ich frage mich, ob die Seghers zu Hause eigene Ableger von sich hat. Und ob sie mir meine Homosexualität ansieht. Mag sie etwa keine schwulen Männer? Verhält sie sich deshalb so abweisend mir gegenüber? Gott, ich sehne mich nach dem Spray und einer Riesentafel Schokolade! Seghers linker Mundwinkel zuckt; ein Lächeln zwischen Mitleid und Zynismus, das an die Störung eines Gesichtsnervs erinnert.
„Wie Sie meinen“, sagt Bruno.
Seghers weicht meinem Blick aus. „Sie finden die Tür schon von selbst, meine Herren.“
Wienerbergbrücke, 12. Bezirk
Eine Viertelstunde später sitzen wir in Brunos Büro an der Wienerbergbrücke, und ich rieche noch immer den Zigarettenrauch an meinen Kleidern. Ich rekapituliere innerlich unsere Zeugenbefragung: Eine Wohngemeinschaft für Mädchen mit Borderline-Syndrom, geleitet von einer gewissen Brigitta Seghers, Pädagogin und Psychoanalytikerin. Die Einrichtung scheint in einem Verzeichnis für gemeinnützige Vereine unter dem Namen „Wiener Kinderliebe“ auf.
„Was für eine Krankheit ist ein Borderline-Syndrom eigentlich?“, fragt Brunos Kollege Matthias Schweiger.
Der einunddreißigjährige Inspektor teilt sich mit Bruno das Büro. Früher saß an seinem Platz Brunos bester Freund und Kollege, der vor drei Jahren aus der Abteilung ausgeschieden ist. Matthias Schweiger weiß um seine Lückenbüßerfunktion, nicht umsonst ringt er um die Aufmerksamkeit seines Vorgesetzten wie ein Musterschüler.
Bruno antwortet kühl: „Haben Sie in den letzten zwei Stunden nicht genügend Zeit gehabt, um Wikipedia zu bemühen, Herr Schweiger?“
Der Kollege bleibt gelassen; einziges Anzeichen seiner Nervosität scheint der Griff nach seiner Nerdbrille, die er zurechtrückt – eine Übergangsbewegung. „Ich habe mir die Facebook-Profile der Mädchen angesehen, Chef.“
Schweigers ultrablonde Haare und sein hautenges T-Shirt, das seine Brust und Armmuskeln betont, werfen in mir immer wieder die Frage auf, wie es um sein Privatleben bestellt sein mag; ist er einer von diesen Männern, die sich ihre Homosexualität nicht eingestehen können? Ich eise meinen Blick wieder von ihm los. Never fuck in a Company! Amerikanische Scheinmoral gilt erst recht hier in meiner alten Heimatstadt. Ich habe es bisher vermieden, einen Kalender mit kalifornischen Feuerwehrmännern in meinem Büro aufzuhängen; würde nur für unnötig Geschwätz sorgen.
„Was haben Sie über die Mädchen herausgefunden?“, bohrt Bruno nach.
Ich bediene die Kaffeemaschine, ein Relikt aus der Zeit, als Bruno hier noch mit Schweigers Vorgänger gearbeitet hat; die beiden haben für das Ding sogar zusammengelegt, hat Bruno einmal so ganz nebenbei erwähnt. Die Maschine rotzt George Clooneys feinsten Espresso in eine Tasse, die für meine Verhältnisse viel zu sehr an Puppengeschirr erinnert. Ich sehne mich nach einem großen Becher Kaffee Americano von Starbucks.
„Das Borderline-Syndrom“, erkläre ich Matthias Schweiger, „gehört zu den sogenannten Persönlichkeitsstörungen. Es handelt sich dabei um keine Krankheit. Die betroffenen Menschen haben wegen ihrem Verhalten zumeist Schwierigkeiten in der Beziehung zu sich selbst. Und in den Beziehungen zu anderen Menschen. Das Wort Persönlichkeitsstörung ist meiner Meinung nach auch völlig unpassend. Beziehungs-Störungen wäre der treffendere Begriff. Schließlich scheitern diese Menschen regelmäßig in ihren Beziehungen zu ihren Mitmenschen, und sind deswegen sehr einsam.“
„Haben wir denn nicht alle manchmal irgendwie Beziehungsstörungen?“, fragt Schweiger.
„Solange niemand darunter leidet, ist es auch nicht krankheitswertig“, erkläre ich ihm, „ich frage mich viel mehr, warum die Abteilung für Leib und Leben in diesen Fall eingeschaltet worden ist. Und dann werde ausgerechnet auch noch ich als Profiler hinzugezogen!“
Bruno hebt die Schultern. „Ich habe dir schon erklärt, momentan ist ungewöhnlich noch das harmloseste Wort für den Zustand dieser ganzen Abteilung. Der alte Chef ist in Pension gegangen. Seine Nachfolgerin hat sich hier nicht lange gehalten, wie du weißt. Um momentan ist die Leitungsstelle ausgeschrieben, und es findet sich anscheinend kein Bewerber. Es herrscht Chaos.“
„Bewirb du dich doch!“
Bruno schüttelt den Kopf. „Hältst du mich für so verrückt, dass ich mir das antue? Ich habe eine Exfrau, eine fast erwachsene Tochter und eine Patchwork-Familie mit zwei schulpflichtigen Kindern. Das kann ich Christina nicht antun. Sonst sieht sie mich gar nicht mehr. Das wiederum könnte in meinem Privatleben wiederum sehr schnell zu Beziehungsstörungen führen.“
„Was wissen wir über die beiden Vermissten?“, frage ich Schweiger.
Bruno setzt sich ebenfalls zu uns an den Besprechungstisch; auf zwei überdimensionalen Bildschirmen erscheinen die Gesichter zweier weiblicher Teenager.
„Das hier ist Anastasia Prudnikov. Blonde Haare, dunkelbraune Augen. Piercings in der Nase, der Lippe und an den Augenbrauen – das ist ihr besonderes Zeichen.“ Schweiger fährt fort: „Sie lebt seit ihrem zwölften Lebensjahr in der WG der Wiener Kinderliebe. Sie ist im Juli siebzehn geworden.“
„Ihr Handy? Konnte es schon geortet werden?“, hakt Bruno nach.
„Das Handy ist seit einer Woche tot. Zuletzt hat sie sich damit im Schlosspark von Schönbrunn aufgehalten. Von da ab gibt es kein Lebenszeichen mehr.“
„Ungewöhnlich für eine Frau in dem Alter“, findet Bruno, „bei meiner Tochter Sara ist das Handy praktisch an ihrem Kopf festgewachsen.“
„Und was ist mit Jennifer Mozart?“
Schweiger vergrößert das Bild der anderen Vermissten. Man kann auf dem Profilfoto erkennen, dass Jennifer Mozart unter Übergewicht leidet; Hals und Gesicht gehen übergangslos ineinander über. Cola und Fastfood oder eine ungünstige Genetik haben deutliche Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen; die Haut ist blass. Auf dem Profilbild, das Schweiger ausgesucht hat, streckt sie die Zunge raus und offenbart ihren Facebook-Freunden ebenfalls ein Piercing, genau wie Anastasia.
„Sie lebt seit ihrem zehnten Lebensjahr in der WG“, erklärt Schweiger, „ist in diesem Jahr schon viermal als vermisst gemeldet worden und ist jedes Mal nach drei bis fünf Tagen wieder aufgetaucht.“
Bruno seufzt. „Kein Wunder.“
Ich blicke in seine dunklen Augen. Kann mir denken, was er denkt. „Was?“, frage ich ihn trotzdem.
„Mit der Seghers in einer WG, da würde ich auch lieber davonrennen, wenn ich ein Teenager wäre.“
Bingo! Ich kenne ihn wirklich lange genug. Schweiger, beide Hände über der Tastatur, wartet auf weitere Anweisungen seines Vorgesetzten.
„Was ist mit Jennifer Mozarts Handy?“, lässt Bruno nicht lange auf sich warten.
„Ebenfalls tot. Zuletzt geortet am Praterstern bei der U-Bahn-Station.“
„Was kann eine Siebzehnjährige dort nur gemacht haben?“, fragt Bruno mich, obwohl auch er die Antwort zweifellos kennt. Ich bin vor kurzem in eine Mietwohnung in der Nähe eingezogen. Bruno hat mir geholfen, Schachteln und Möbel zu schleppen. Die Gegend um den Praterstern ist bei Drogenfahndern verschrien; das weiß jedes Kind in dieser Stadt.
Ich habe Brunos dezenten Hinweis verstanden. „Was wissen wir über Drogen oder Prostitution bezüglich der beiden Mädchen?“, frage ich Schweiger.
Bruno fällt mir ins Wort, ehe sein Kollege antworten kann: „Glaubst du vielleicht, Oberinspektor Schweiger kann zaubern? Woher soll er das wissen? Und von der Seghers werden wir diesbezüglich so schnell nichts erfahren. Und die Zentrale der Wiener Kinderliebe in Hietzing wird uns wohl kaum die Akten der Mädchen so einfach herausrücken. Datenschutz!“, fügt er gequält hinzu.
„Dafür, dass sie es so genau nehmen, macht der Leiter der Kinderliebe aber einen ganz schönen Druck, Herr Chefinspektor!“, wirft Schweiger ein. „Hat in der letzten Stunde dreimal hier angerufen, dieser Herr Seidel.“
„Angst vor Bloßstellung in der Öffentlichkeit“, fällt mir dazu nur ein, „der Verein kann sich negative Schlagzeilen nicht leisten. Könnte sich verheerend auf die Spendengelder auswirken. So ein Verein lebt ja schließlich von seinem Image und von Spenden. Was sonst?“
Bruno knurrt: „Wenn man bedenkt, dass die Seghers uns nicht einmal sagen konnte, was die Mädchen bei ihrem Verschwinden für Klamotten getragen haben! Und dann von Vertrauen und Beziehung daherredet! Ich frage mich, wer hier von allen die größten Beziehungsprobleme hat? Vielleicht gibt es ja auch Beziehungsprobleme zwischen der Zentrale und der Außenstelle, weil die Kommunikation versagt hat.“
Ich kann mir ein Lächeln nicht verkneifen. „Waren wenigstens die beiden Mädchen auf Facebook miteinander befreundet, wenn sie schon zusammen gewohnt haben?“
Schweiger antwortet: „Natürlich! Aber wer ist das nicht heutzutage?“
„Was?“, fragt Bruno.
„Mit allem und jedem auf Facebook befreundet!“
Bruno hat sich erst im August seiner Tochter Sara wegen auf Facebook angemeldet. Er hofft, dadurch ein wenig mehr Kontrolle über sie haben; behauptet er zumindest! Brunos verächtlicher Blick verrät mir die Abneigung eines Mannes, der soziale Netzwerke mit der Erfindung eines rechteckigen Rades gleichsetzt; zu nichts nutze!
„Haben die beiden hin und hergeschrieben, Herr Schweiger?“
„Nein. Sie waren beide mit allen Mädchen in der WG befreundet. Beide haben sich aber gegenseitig keine Nachrichten auf dem Messenger zukommen lassen. Die Auswertungen habe ich bereits hier.“
„Vielleicht Mobbing unter Teenagern“, vermutet Bruno.
Schweiger schüttelt den Kopf. „Nichts was darauf schließen ließe.“
Ich betrachte die Bilder, bis mir schließlich ein Licht aufgeht: Beide Mädchen leiden an einer Form von Essstörung! Anastasia Prudnikov besitzt das Gesicht einer Magersüchtigen, und Jennifer Mozart leidet unter dem glatten Gegenteil. Und doch haben beide ein und dasselbe Problem. Entweder man frisst seinen Kummer in sich hinein oder: „Man kann nicht so viel essen, wie man kotzen möchte.“, um einmal mehr den Schriftsteller Kurt Tucholsky zu zitieren. Auf der einen Seite die Bulimikerin, auf der anderen die Adipöse; alle beide leiden an Depressionen und spielen Russisch Roulette mit ihrer Gesundheit.
Ich frage Schweiger: „Was wissen wir über die Eltern der Mädchen?“
„Anastasia Prudnikovs Eltern sind ebenfalls auf Facebook angemeldet. Sie leben aber irgendwo in Russland. Sind nicht mit ihrer Tochter befreundet. Man hat ihnen das Sorgerecht entzogen, als ihre Tochter drei Jahre alt war. Später sind sie in ihre Heimat zurückgekehrt! Und die Mutter von Jennifer Mozart ist tot. Ihr Vater lebt in einem Pflegeheim für Menschen mit Wachkoma hier in Wien; der wird uns nicht viel erzählen können.“
Bruno seufzt schwer. „Kein Wunder, dass die Mädchen unter Beziehungsstörungen leiden, wenn sie von allen verlassen worden sind. Das muss sich ja schrecklich für ein Kind anfühlen!“
Ich appelliere an den Kriminalbeamten in ihm: „Was machen wir jetzt, Herr Chefinspektor?“
„Ich schlage vor, wir statten diesem Herrn Seidel in der Zentrale einen persönlichen Besuch ab. Einen Mann, der dermaßen auf Kohlen sitzt, sollte man nicht warten lassen.“ Bruno zwinkert mir zu. „Scheiß auf den Datenschutz, Herr Profiler!“ Und dann zitiert er Goethe, den bekanntlich größten aller Dichter und Denker: „Die Seghers und ihre Freunde können uns alle mal am Arsch lecken.“
2. Bezirk, Praterstern
Der Energiedrink breitet sich mit einem Prickeln in ihrem Magen aus. Die obligatorische Mischung aus Übelkeit und Glücksgefühl, verursacht durch Zucker, setzt wie gewohnt beim ersten Schluck ein. Jennifer Mozart schleppt sich von der U2 zur Rolltreppe. Das Gefühl gleicht einem Schweben, das sie für Sekunden das leichte Stechen in ihrem Bauch vergessen lässt. Für Sekunden fühlt sie sich sogar wie das schlanke Mädchen, das sie bis zu ihrem zehnten Lebensjahr gewesen ist. Damals, als sie noch eine Familie gewesen waren, hatte in der Villa in Döbling immer Dunkelheit geherrscht. Der Vater hatte der Mutter, Jennifer und ihrer fünfjährigen Schwester Amelie verboten, nach draußen zu gehen. Die Jalousien waren Tag und Nacht geschlossen gewesen. Der Vater warnte sie eindringlich: „Wenn ihr nach draußen geht, können sie eure Gedanken lesen. Hütet euch vor ihnen!“
Die beiden Mädchen verstanden nicht, wen er mit sie und mit ihnen meinte. In ihrer kindlichen Art fantasierten sie von bösen Feen, die auf der Straße und auf Spielplätzen lauerten und mit Laserblicken in die Köpfe der Menschen Löcher bohrten, nach dem Vorbild der Figuren aus den Manga-Comics. Der Begriff Gedanken war Jennifer und ihrer Schwester zu abstrakt erschienen; sie stellten sich darunter Murmeln in ihren Köpfen vor. Die Feen ernährten sich von diesen Murmeln, indem sie sich aus den Gehirnen von Kindern bedienten.
Jennifer befiel jeden Tag panische Angst, wenn sie zur Schule gehen musste. Überall lauerten die Kinder dieser Feen. Und die Lehrerinnen gehörten zu ihnen und schauten in ihre Köpfe, hungrig nach Nahrung lechzend. Jennifer fürchtete sich vor der Schule; aber sie musste dennoch dorthin! Der Vater bestand sogar darauf, dass sie die Villa, die er von seinen Eltern geerbt hatte, zum täglichen Schulgang verließ. Um nicht unnötig Aufsehen zu erregen, wie er betonte. „Dass du mir ja kein Wort davon gegenüber den anderen verlierst! Dass das klar ist!“, trichterte er ihr jeden Morgen ein. Jennifer sollte sich unauffällig verhalten – am besten, sie sagte gar nichts!
„Wenn du plauderst, dann kommen die bösen Männer. Sie werden mich einsperren. Und du und deine Schwester und deine Mutter seid dann ihnen hilflos ausgeliefert, weil ich euch dann nicht mehr beschützen kann!“
Die Familie hatte sich ausschließlich von Haferflocken ernährt; in warmem Wasser vermengt. Die Verbündeten der Feen und der bösen Männer mischten allen anderen Lebensmitteln Gift bei. Der Vater brachte Tage damit zu, die Flocken nach elektronischen Chips zu durchsuchen, die dazu dienten, von der Blutbahn aus Informationen über sie preiszugeben. Manchmal gelang es ihrer Mutter, eine Tafel Schokolade ins Haus zu schmuggeln. Jennifer und ihre Schwester hatten Angst davor, von der Schokolade zu essen. Und doch gaben sie der Versuchung nach, schmeckte die süße Leckerei auf ihren Zungen doch wie ein kleines Paradies auf Erden. Jennifer sehnte sich dann danach, auch eines von diesen Feenkindern zu sein. Die Feenkinder hatten in der Schule manchmal Schokolade dabei. Gleichzeitig verursachte der Genuss Jennifer Alpträume von U-Booten, die sich durch ihren Körper manövrierten und Funksignale an feindliche Dämonen ausstrahlten.
Anfang Juni, gegen Ende der dritten Klasse, kam Jennifer wie an jedem Wochentag von der Schule. Sie erstarrte bei dem Anblick, der sich ihr bot. Jemand hatte doch tatsächlich die Jalousien nach oben gekurbelt! Das Haus wirkte in diesem Zustand fremd, die Fensterscheiben schienen ihr nackt, erweckten einen geradezu obszönen Eindruck auf das Mädchen. Noch nie hatte es die Fenster ohne die Jalousien davor gesehen.
Erst auf den zweiten Blick wurde Jennifer der Polizeiautos in der Garageneinfahrt und auf dem Bürgersteig gewahr. War es jetzt endlich doch so weit? Hatten sie herausgefunden, was in ihren Köpfen vorging?
Für Sekunden stand sie wie angewurzelt, betrachtete aus der Ferne die Männer in ihren Uniformen und das weiß-rote Absperrband am Gartenzaun.
„Mama! Amelie …“ Die Namen der Menschen, die sie am meisten liebte, kamen ihr als Erstes über die Lippen. Papa, der Wächter, nahm seine Töchter niemals in die Arme; vielleicht misstraute er im Grunde auch seiner eigenen Familie, hatte Jennifer schon oft vermutet. Und allein dieser Gedanke hatte sie dermaßen verletzt, dass sie ihn niemals hätte in Worte fassen können. Hatte Papa etwa die Polizei angerufen, weil er ihr – Jennifer –, seiner eigenen Tochter, misstraute? Weil er sich von einem Mitglied seiner Familie bedroht fühlte? Sie erinnerte sich daran, wie er gestern abend ihre Schultasche durchforstet hatte. Stift für Stift, Heft für Heft; die Taschen ihrer Jacke und sämtliche Kleidungsstücke hatte er ebenfalls sorgfältig kontrolliert. Dabei hatte er ein Stück Schokolade gefunden; von Kerstin, ihrer Banknachbarin, die ihr die Leckerei geschenkt hatte. Der Vater hatte die Schokorippe lange und eingehend betrachtet.
Papa hatte sie angeschrien: „Bist du verrückt geworden, Mädchen! Glaubst du, du bist als einzige sicher vor ihnen?!“
Eine Viertelstunde hatte er getobt. War in Weißglut geraten. Jennifer hatte sich vor ihm gefürchtet. Die Mutter hatte sich schützend vor sie gestellt. Die kleine Amelie floh in ihr Zimmer. Jennifer eilte ihr nach. Anschließend hatte Jennifer die lautstarke Diskussion zwischen ihren Eltern durch die Tür belauscht.
Die Mutter hatte zum Vater gesagt: „Manchmal ist die Wahrheit eine andere, als du denkst, Liebling.“
Und der Vater hatte geantwortet: „Verschon mich und die Kinder mit deinem Wahnsinn! In einer Welt, in der die Menschen gläsern geworden sind, herrscht der nackte Wahnsinn. Sie wissen alles über uns!“
Die Mutter sagte: „Vielleicht solltest du doch einmal zum Arzt gehen, Liebling.“
„Zum Arzt? Was soll ich da?“
„Dir helfen lassen.“
„Wozu? Weil ich sie alle durchschaut habe? Gehörst du am Ende auch zu ihnen? Willst du mich für verrückt erklären lassen?“
„Aber nein, natürlich nicht, Liebling!“
„In dieser Gesellschaft wird man mundtot gemacht, wenn man dieses Spiel nicht mitspielen will. Sie beobachten uns alle!“ Der Vater hatte von einer geheimen Weltregierung gesprochen, die sich durch Medien und Geheimdienste Wissen über die Menschen verschaffte. Jennifer hatte diesem Vortrag nicht folgen können. Jahre später wurde ihr bewusst, dass die Mutter nicht einmal geahnt hatte, wie krank der Vater bereits gewesen war, als sie ihn geheiratet hatte. Ein Eigenbrötler, ein Sonderling, der den Menschen und den Partys aus dem Wege ging, war er gewesen; der sich in sein Elternhaus einsperrte. Auf der Uni galt er als exzellenter Student, angehender Atomphysiker, der trotz aller Brillanz sein Studium von einem Tag auf den anderen beendet hatte. Seine beiden Eltern waren acht Wochen zuvor kurz hintereinander an Krebs verstorben. Vielleicht lag in einem Trauerprozess, den der junge Mann ohne seelische Unterstützung nicht hatte bewältigen können, der Auslöser jener Tragödie, die Jennifer an jenem Tag im Juni, drei Tage vor ihrem zehnten Geburtstag, widerfuhr. So versuchte sie es sich Jahre später mit Hilfe einer Therapeutin zu erklären.
„Halt!“, hörte die neun Jahre und dreihundertzweiundsechzig Tage alte Jennifer eine Männerstimme. Die Fahrzeuge und das Absperrband erschienen ihr wie Relikte aus einem Film. Manchmal hatte Mama spätabends Kriminalfilme angesehen. Jennifer hatte durch einen Türspalt das Geschehen auf dem Bildschirm beobachtet. Genauso wie in diesen Filmen gestaltete sich an diesem Tag die Realität um sie herum. Das Kind sah auf und erblickte einen Mann in einer Lederjacke vor sich.
„Kriminaloberinspektor Brunner“, stellte der Mann sich vor, „du musst keine Angst vor mir haben.“ Und dann sagte er einen Satz, der alle Alarmglocken in ihr zum Läuten brachte: „Wir sind von der Polizei. Wir sind gekommen um dir zu helfen. Wir gehören zu den Guten!“, versuchte der Inspektor das verschreckte Mädchen instinktiv zu beruhigen.
Der Beamte mit der Lederjacke streckte Jennifer die Hand entgegen. Jennifer betrachtete den Arm wie einen verwunschenen Gegenstand. Allein die Berührung genügte, sich zu infizieren. Mit Viren zu infizieren, vor denen der Papa sie gewarnt hatte. Dieser Mann behauptete, zu den Guten zu gehören! Woher wusste dieser fremde Mann denn, dass es die Bösen gab? Diejenigen, die sie Tag und Nacht durch das Fenster beobachteten. Die in den Autos saßen und ihre Wohnung mit Wärmebildkameras unter die Lupe nahmen; Männer, Frauen und Kinder, die täglich an ihrem Haus vorbeigingen und sich unauffällig verhielten, aber in Wahrheit nur darauf lauerten, einen schwachen Moment zu nutzen, um die Macht über sie zu erlangen.
Dieser Mann in der Lederjacke versuchte ihr ein Theater vorzuspielen; er gehörte eindeutig zu ihnen. Daran hegte Jennifer keinen Zweifel!
Ein zweiter Beamter mit grauen Haaren, der wie ein Großvater mit buschigen weißen Augenbrauen aussah, trat auf sie zu. Und eine Frau, die sich als Psychologin vorstellte. Mama hatte Papa immer wieder mal vorgeschlagen, sich einer Psychologin anzuvertrauen; Papa war daraufhin jedes Mal explodiert. Kein Zweifel, diese Leute waren gekommen, um sie zu holen! Und vorher hatten sie bereits ihre Familie geholt! Jennifer befiel Todesangst und ein eiserner Überlebenswille zugleich. Nein, sie würde diesen Leuten nicht in die Falle gehen! Sie brauchte nur in das Haus zu laufen und in ihr Zimmer zu fliehen. Den Schlüssel umdrehen, die Jalousien wieder herunterlassen. Und sie wäre für alle Zeit sicher vor ihnen!
Die Frau sagte: „Ich möchte mich mit dir unterhalten, Jenny.“
Jennifer schrie.
Der Inspektor mit der Lederjacke griff blitzschnell nach ihrer Hand. Jennifer entriss sie ihm. Die Schultasche auf dem Rücken entwischte sie den beiden Beamten; stürmte unter der Absperrung hindurch. Stieß gegen einen Mann, der eine weiße Kiste schleppte. Ein zweiter Mann trug die Kiste am hinteren Teil; die Kiste war klein, sodass ein Kind wie Amelie mühelos hineingepasst hätte. Jennifer begriff plötzlich: Sie hatten ihre Schwester umgebracht!
„Festhalten! Lasst die Kleine nicht in das Wohnzimmer!“, brüllte der Mann mit der Lederjacke. Er stürmte mit schweren Schritten hinter ihr. Er schrie: „Bruno! Bruno, wo bist du, verdammt?“ Augenblicklich lief ihr durch den Hausflur ein weiterer Mann entgegen.
Jennifer täuschte einen Haken nach links, in Richtung Badezimmer, vor. Im Fangenspielen gehörte sie zu denen, die regelmäßig als Letzte übrig blieben. Dieser Umstand verschaffte ihr an diesem Tag jenen Sekundenbruchteil an Vorsprung, um den beiden Kriminalbeamten zu entwischen. Sie flitzte nach rechts und stand in einem Wohnzimmer, in dem Männer in weißen Ganzkörperanzügen wie Astronauten die Umgebung untersuchten. Eine Schicht aus Mehl überzog den Boden, auf dem die Gestalten gerade dabei waren, ihre Mutter zu fotografieren. Ihre Mutter lag auf dem Boden; ihre Brust war mit Blut überströmt. Und dann verschwammen die Bilder vor Jennifers Augen. Die beiden Beamten, („Inspektor Brunner“ und sein Kollege „Bruno“, wie dieser ihn genannt hatte), ergriffen sie unter den Armen. Jennifer hatte sich aus Leibeskräften gegen die Männer gewehrt. Die nette Frau und ein weiterer Mann in Notarztuniform hielten sie fest und stachen sie mit einer Nadel in den Handrücken; ein kurzer Schmerz. Jennifer leistete Widerstand. Befand sich in einem Rettungsauto. Ihr wurde schummrig, als wäre sie zu viel und zu lange auf dem Spielplatz mit dem Karussell gefahren. Nur folgte an Stelle einer Übelkeit ein tiefes, schwarzes Etwas, das sich über ihr Denken legte. Es fühlte sich wie Einschlafen an. Sie – die bösen Feen – hatten die absolute Macht über sie erlangt. Und Papa war diesmal nicht zur Stelle, um seine Tochter zu retten.
Jennifer verlor das Bewusstsein.
Papa kam auch in späteren Jahren nicht, um sie zu befreien. Wie auch? Er lag auf einer Intensiv-Station, an die künstliche Lunge und jede Menge Monitore angeschlossen. Die Kugel, die er sich – nachdem er ihre Mutter und Amelie getötet hatte – selbst in den Kopf gejagt hatte, hatte ihr Ziel haarscharf verfehlt. Er lag im Koma. Jennifer konnte sich jetzt nicht erinnern, wann sie ihn zuletzt besucht hatte. Ihn zu sehen, verursachte ihr jedes Mal einen Schmerz, der die alten Wunden aufs Neue aufriss, als wäre alles erst gestern gewesen. Wann immer sich ihr die Gelegenheit bot, blieb Jennifer auch der Wohngemeinschaft, in der sie seither lebte, fern. Die Angst, einen neuen Verlust erleben zu müssen, stand zwischen ihr und den anderen Menschen. In ihren Träumen sah Jennifer manchmal die kleine Schwester vor sich. Jennifer hatte eine fast leere Packung mit Erdnüssen unter der Matratze in ihrem Zimmer versteckt. An ihrem letzten Morgen hatte Jennifer ihr fünf davon fein säuberlich abgezählt auf dem Handteller präsentiert. „Hier. Für dich.“
Amelies Miene verriet Ekel. „Nein, danke“, lehnte sie ab – und dann sprach sie jenen Satz, der für Jennifer von nun an zum magischen Spruch, der das Sesam zu ihrer Vergangenheit öffnete, avancierte: „Erdnüsse schmecken wie Orangensaft, wenn man sich vorher die Zähne geputzt hat.“
Das waren ihre Erinnerungen.
Jennifer schleppt sich an den Menschen, Bussen und Straßenbahnen vorbei. Erdnüsse schmecken wie Orangensaft, wenn man sich vorher die Zähne geputzt hat. Was für eine extraordinäre Geschmacksrichtung, wie sie nur einer Fünfjährigen einfallen konnte und zugleich die letzten Worte aus ihrem alten Leben – das Leben vor Kinderpsychiatrie, Krisenzentrum und Wohngemeinschaft, jenen Stationen, die sie seither durchlaufen war.
Brigitta Seghers spielte sich in ihren Augen auf, als wäre sie ihre Mutter. Dabei war die Seghers nicht einmal eine Tante oder wenigstens ein Haustier! Die WG-Leiterin hatte kein Recht, ihr Vorschriften zu machen! Über ihr Leben zu bestimmen. Erdnüsse …, sinniert sie vor sich hin – und: Sesam öffne dich! Wie sehr sehnt sie sich zurück in vergangene Zeiten …
Die Seghers hatte mit Besorgnis schon in den ersten beiden Jahren die Gewichtszunahme des einst schlanken Mädchens beobachtet. Jennifer hatte dies zum Anlass genommen, jede Möglichkeit zu nutzen, ihren Körper mit Süßigkeiten und später mit Alkohol und Energiedrinks zu schädigen, nur um dieser autoritären Gans, die sie immer wieder zu erziehen versuchte, eins auszuwischen. Als die Seghers dann Süßigkeiten in der Wohngemeinschaft verbot und eine Kochgruppe mit den Mädchen gründete, die darauf abzielte, sich gesund zu ernähren, hatte Jennifer sich der Aktion als Einzige verweigert. In dieser Gemeinschaft gab es kaum ein Mädchen, das sich nicht von Zeit zu Zeit Schnittwunden an den Unterarmen zufügte; Jennifer ahmte bereits als Elfjährige das Verhalten der anderen nach – lernte am Vorbild der anderen. Der körperliche Schmerz verschaffte ihr Befreiung von aller seelischen Pein. Endlich konnten die bösen Feen und dunklen Zauberer keine Macht mehr über sie ausüben. Die Selbstverletzungen wurden ihr zu einem Ventil, um die Jahre in der Wohngemeinschaft auch psychisch zu überstehen.
Erdnüsse ... Zähneputzen ... Orangensaft ...
Jennifer bleibt stehen; mitten auf dem Praterstern weht ihr eine Brise aus Dönerkebap, Pizza und Bratwurst, durchwirkt von Autoabgasen, Urin, Hundekot und Zigarettendunst entgegen. Jennifer späht über den Platz. Jugendliche mit orientalischem Aussehen haben sich zusammengerottet und trinken Bier aus Dosen; Polizisten stören sie bei ihrem Vergnügen. Obdachlose Frauen und Männer raunen einander zu und streiten um Zigaretten und Tetrapacks mit Fusel. Dazwischen Passantinnen und Passanten, die sich bemühen, den Ort möglichst schnell hinter sich zu lassen. Busse und Straßenbahnen passieren die Haltestellen im Minutentakt; sie verschwinden darin und harren nervös der Weiterfahrt.
„Jennifer!“
Sie erschrickt. Dreht sich um. Friedrich lächelt sie an.
„Friedrich? Da bist du ja!“
Jennifer spürt Tränen der Freude in ihren Augen. Die Dose mit dem halbleeren Energiedrink entgleitet ihren Händen. Im Licht der Straßenlaternen wirken seine grauen Schläfen wie Silber; seine hellen Augen strahlen sie voller Wärme an.
„Wo ist Anastasia?“, fragt Jennifer ihn.
Friedrich lässt ihre Umarmung über sich ergehen – zumindest beschleicht Jennifer der Verdacht, dass die Wiedersehensfreude sich auf seiner Seite in Grenzen hält.
Jennifer hat vor drei Tagen Anastasias Handy gefunden, was sie verwundert hat. Für gewöhnlich hütet Anastasia es wie einen Schatz; die Seghers darf von der Existenz dieses zweiten Gerätes absolut nichts wissen. Es enthält die Liste der Freier, mit denen Anastasia sich gelegentlich trifft, um mit ihnen gegen Bezahlung zu schlafen. Von dem Geld leistet sie sich dann die Zutaten für einen Joint und gelegentlich greift sie auch auf chemische Verlockungen in Pillenform zurück.
„Was willst du von mir?“, fragt Friedrich.
Er streicht sich die Haare aus der Stirn; eine Geste, die ihr seine Nervosität verrät; außerdem würde er sich gleich eine Strähne seiner Rasta-Frisur um den Zeigefinger wickeln. So macht er das immer, wenn er sich unsicher fühlt.
„Wo ist Anastasia?“, wiederholte Jennifer.
Die Antwort folgt wie ein Pfeil: „Woher soll ich das wissen?“ Er wickelt sich tatsächlich eine Strähne um den Zeigefinger.
„Aber …“
„Was aber?“ Er offenbart eine Reihe nikotingelber Zähne.
„Sie hat mit dir telefoniert!“ Sie hält ihm Anastasias inoffizielles Zweithandy vors Gesicht.
„Wie kommst du darauf?“
Wie kommt deine Nummer auf dieses Handy mit den Freiern?
Sie erkennt die Antwort in seinem Gesicht; liest seineGedanken. Er lässt von der Strähne ab und gestikuliert mit den Händen. Jennifer rechnet mit einem Zornesausbruch oder Weinkrampf. Gleich würde er die Fassung verlieren und sie anschreien. Burnout, hatte die Seghers ihnen den Zustand des Erziehers erklärt – Friedrich habe in letzter Zeit immer öfter die Nerven verloren und habe aufgrund seines Burnouts beschlossen, beruflich andere Wege zu gehen. So lautete die offizielle Version.
„Hast du eigentlich schon eine neue Arbeitsstelle gefunden?“, lenkt Jennifer das Gespräch in eine andere Richtung.
Friedrich lässt die Arme sinken.
„Ich habe echt keine Ahnung, wo Anastasia sein könnte“, entgegnet er mit betont ruhiger Stimme.
„Woher weißt du dann, dass sie verschwunden ist?“
Sie beobachtet ihn und fühlt sich wie an jenem Morgen, an dem sie die letzten Erdnüsse in sich hineingestopft hatte; Jennifers Magen verkrampft sich. Ob es allein am Energiedrink liegt, bezweifelt sie.
Friedrich lächelt. Sein Verschwörerlächeln, das sie nur zu gut kannte. Das immer dann zutage trat, wenn er sich mit den Mädchen verbündete. In der Regel handelte es sich um harmlose Sachen wie eine Zigarette, die er einem schenkte. Die Erlaubnis, abends länger fernzuschauen. Oder eine zusätzliche Portion Schokolade, von der die Seghers nichts wissen durfte.
„Soll ich dir ein Geheimnis über deine Freundin Anastasia verraten?“
Er späht angestrengt nach allen Richtungen. Eine Gruppe von mindestens zwanzig Polizistinnen und Polizisten mischt sich gerade unter das Praterstern-Volk.
„Weiß die Seghers, dass du hier bist?“
Jennifer schüttelt den Kopf.
Briefe aus dem Gefängnis, Erster Brief
Aichach, Bayern, Oktober 1992
Als deine Geliebte schreibe ich Dir, meine Süße, und schwöre dir immerwährende Liebe.
Wie musst du dich nur fühlen? So allein!
Für mich, die politische Gefangene in diesem Land, bleibt die Situation erträglich. Wenn man eine politische Gefangene ist, dann hat selbst die Mühsal einer grauen Haftzeit einen Sinn, weil es Teil unseres Kampfes ist. Ein Kampf, den wir einst geführt haben. Ein Kampf für Menschenrechte! Gegen den Kapitalismus. Für Freiheit! Gegen das Gespenst des Imperialismus! Gegen ein politisches Establishment, das aus einem braunen Sumpf heraus die Macht in Deutschland und in Österreich nach dem Krieg übernommen hat, als wäre nichts gewesen, meine Liebe, als hätte es Auschwitz niemals gegeben.
Ich hoffe, du kannst mich verstehen. So wie alle in unserer Kommune, habe ich irgendwann nicht mehr zuschauen können. Bin zu einer Akteurin geworden. Ich hoffe, Heinrich, unser aller Prophet – wo immer er jetzt sein mag – hat mir vergeben, dass ich meinen Weg in den Untergrund gehen musste.
Ich bin genau fünf Jahre vor dir in München geboren. Als Heinrich dich zu uns gebracht hat, 1977 im August, habe ich gewusst, dass die Tage deiner Freundin Andrea – „die Tapfere“, wie Heinrich sie manchmal genannt hat – gezählt waren. Meine weibliche Intuition hat mir das zugeflüstert. Auf meine Intuition habe ich mich immer verlassen können, Geliebte. Auch als ich verhaftet worden bin, vor zwei Jahren, da habe ich schon Tage vorher gewusst, dass die Zivil-Bullen um den Block in Ost-Berlin gestreift sind. Ich habe es in ihren Gesichtern gesehen, dass meine Flucht und mein Leben vorüber sind. Die Jahre in der DDR waren gute Jahre. In dem Moment, in dem diese Imperialisten über den Sozialismus gesiegt haben, habe ich gewusst, dass damit auch meine Zeit der Freiheit vorbei ist. Das Ende eines Weges, der in einer Kommune seinen Anfang genommen hat. Eine Kommune, ein alter Vierkanthof im idyllischen Waldviertel in Niederösterreich – das war unser Paradies. Weißt du noch, es gab keinen einzigen Tag, an dem wir Schuhe getragen haben. Wenn ich an diese Zeit denke, dann fällt mir das Buch von Marlene Haushofer ein, „Die Wand“: eine Frau, die plötzlich mit sich und der Natur und ihren Tieren allein im Wald lebt, weil eine unsichtbare Wand sie von der Außenwelt abschirmt.
Wir haben auch isoliert gelebt – mit dem Unterschied, dass wir ständig mit Radio und Zeitungen über „die Hölle da draußen“, wie Heinrich es ausdrückte, informiert waren.
Wir – das waren eine Gruppe von zehn Leuten, vier Männer und sechs Frauen. Und natürlich Heinrich! Wir haben dort alle unsere bürgerlichen Existenzen aufgegeben. Wir haben uns neue Identitäten zugelegt. Du warst „Mary-Ellen“, die Fernsehserie „Die Waltons“ hat auch dich inspiriert. Andrea war „Miss-Emily“. Und dann gab es da noch „John-Boy“ und „Jim-Bob“ – außerdem „Livie“. Eine Familie, die zusammenhält, die gegen alle schädlichen Einflüsse von außen gewappnet ist. Es gab „Little Joe“ und „Hoss“, unsere beiden Cowboys, die sich ihre Identitäten aus der Western-Serie „Bonanza“ entliehen hatten. Heinrich war „Ben“ – so wie Ben Cartwright, der Vater aller Cowboys und Squaws. Verrückt wie wir waren, haben wir uns aus dem Fundus der Fernsehsendungen der Sechziger- und Siebzigerjahre bedient.
Miss-Emily (Andrea) hat einmal zu mir gesagt: „Du siehst aus wie Dornröschen mit Magersucht.“ Mir ist dabei die Zornesfalte über ihrer Nasenwurzel nicht entgangen.
Du – (Mary-Ellen) – hast mich gefragt: „Und wie heißt du hier?“
„Maja“, habe ich dir geantwortet. „Biene Maja.“ Ich habe mich nach Mario Bonsels Kinderbuchklassiker benannt. Ich kann dem Fernsehen bis heute nichts abgewinnen.
Andrea (Miss-Emily) hat das geflissentlich ignoriert: „Dornröschen!“, hat sie mich genannt.
Und ich habe mich provozieren lassen, dumme Gans, die ich war. „Kleiner Arsch und Tittchen, siehst aus wie Schneewittchen!“
Ich habe Heinrich – „Ben“ (-Cartwright) – von Anfang an einzutrichtern versucht, nicht auch noch dich – als Andreas beste Freundin –, zu uns in die Kommune zu holen. Immerhin haben wir uns alle vorher nicht gekannt! Wir waren alle Fremde, bevor wir hier angekommen sind. „Wenn hier auch noch Miss-Emily ihre Schwester Mary-Ellen anschleppt, dann haben wir am Ende lauter Grüppchenbildungen“, habe ich ihn gewarnt. Ben – unser aller Vaterfigur –, wollte nicht hören, was ich ihm klarzumachen versucht habe.
Am Anfang habe ich noch geglaubt, Miss-Emilys Aufenthalt bei uns würde nur ein vorübergehender sein. Ich habe mich geirrt. Ben Cartwright und den Jungs ist bei ihrem Anblick der Sabber aus dem Mund gelaufen. Sie hatten Mühe, ihre Mäuler zu schließen. Sie hatte blondes Haar, blaue Augen, die Figur der siebzehnjährigen Frau, die noch Ansätze von Babyspeck zeigt, süße, niedliche Füße und überall mit Indianerschmuck behängt, während sie den ganzen Tag über zu den Liedern von Waterloo gesummt hat:
„Das ist meine kleine Welt, sie ist frei und ohne Sorgen, denn in meiner kleinen Welt freu' ich mich auf jeden Morgen …“
Sie hat in den Männern den Beschützerinstinkt geweckt. Und so hat sie Ben dazu überredet, auch noch dich in unsere Kommune zu holen. Wir Frauen haben sie nicht besonders gemocht – aber das weißt du ja. Wir ließen keine Gelegenheit aus, ihr das Leben schwer zu machen. Am Morgen schlug Jim Bob regelmäßig das Holz, damit Hoss unseren Boiler heizen konnte. Die Frauen haben sich um das warme Wasser zum Duschen gestritten. Miss-Emily beschwerte sich bei Little Joe, weil die Frauen ihr nur kaltes Wasser übrig gelassen hatten. Für uns Frauen gehörte es zum guten Ton, täglich bereits vor Miss-Emily auf den Füßen zu sein. Vor allem ich habe mir einen Sport daraus gemacht, so viel heißes Wasser zu verbrauchen, dass für sie kein Tropfen mehr davon vorhanden war. Little Joe hat sich zu ihrem Fürsprecher entwickelt. Little Joe hatte schon immer ein Faible für die Armen und Schwachen. Kein Wunder, wenn man bedenkt, was aus ihm geworden ist. Ich habe vor einiger Zeit ein Bild von ihm gesehen neben einem Bericht über die „Ärzte ohne Grenzen“. Little Joe spielte sich schon damals als unser Gewissen auf.
Er warf mir und den anderen Frauen vor, wir wären Gesindel, weil wir dabei wären, uns zu entsolidarisieren. Was für ein unsinniges Wort!
Wir schlossen Miss-Emily von unseren Geheimnissen aus. Wir tuschelten, wir schmissen uns an die Jungs ran, sobald einer ein Auge auf sie warf. Ich erinnere mich, ich habe eigens mit Hoss geschlafen, weil ich dadurch verhindert habe, dass er mit ihr im Heu landete. Wir haben ja alle zusammen in der Stube genächtigt. Auf Stroh, mit Kissen, auf alten Matratzen. Ich redete mir ein, meine Lustschreie wären die Rache für ihren Regelbruch. Sie durfte Ben – unseren Übervater –, als Einzige berühren. Dafür haben die anderen sie gehasst. Ich weiß nicht, was er nur an ihr fand. Dabei hatte er sie – genau wie uns andere – in dem Lokal im Ersten Bezirk in Wien kennengelernt. Sie war in unseren Augen in Wirklichkeit diejenige, die sich entsolidarisierte, weil sie sich unserem Anführer an den Hals geworfen hat. Natürlich hatte Ben mit uns allen von Zeit zu Zeit das Vergnügen. Es war wichtig für uns. Damit wussten wir, wer in seiner Gunst stand. Lange nicht mit ihm geschlafen zu haben, bedeutete, sich seiner Loyalität nicht mehr sicher zu sein. Also haben wir um ihn geworben. Auch wenn er im Grunde unser Vater hätte sein können! Er war derjenige, der über den Verbleib oder das Ausscheiden eines Mitglieds aus der Kommune das Sagen hatte. Wir wollten alle bleiben! Wir fühlten uns frei. Zum ersten Mal in unserem Leben brauchten wir nicht tun, was unsere Eltern uns vorschrieben. Auch wenn sie uns mit der Polizei holen ließen, was Miss-Emily des Öfteren passiert war, so kamen wir doch spätestens nach drei Tagen zurück.
Wir lebten den Traum der Hippies und Ben alias Heinrich war unser Schlüssel zu allem. Es bedeutete uns eine große Ehre, Heinrich für seine Bilder Modell zu stehen. Von Zeit zu Zeit kam ein Kunsthändler, der früher ebenfalls in der Kommune gelebt hatte, und holte die Bilder ab. Die Werke fanden tatsächlich Käufer und hingen zu dieser Zeit in den Museen und Galerien dieser Welt, weil sie eine neue Ära der Kunst und der Gesellschaft verhießen. Von dem Geld tätigte Ben die Ausgaben, die anfielen für Bier, Toilettenpapier oder Zeitungen. Mit Lebensmitteln versorgten wir uns Großteils selbst. Wir lebten von dem Gemüse, das wir anbauten. Außerdem liefen auf dem Hof zwei Schweine frei herum, die schon viel zu lange darauf warteten, von jemandem geschlachtet zu werden. Bisher hatte sich niemand dafür erwärmen können, „Asterix & Obelix“ ihrer Bestimmung zuzuführen. Am ehesten hatte ich diese Überwindung noch dem guten John-Boy Walton zugetraut, der im Oktober zwei Kaninchen geschlachtet hatte. Wir alle hatten dem Ritual beiwohnen müssen! Aber bei den Kaninchen war es irgendwie was anderes. Die Tiere verhielten sich weitaus weniger intelligent. Die Schweine dagegen waren wie Hunde, die auf ihre Namen hörten und bei schlechtem Wetter mit uns in der Stube schlafen durften.
Auf einem Bild hatte Ben unsere Miss-Emily (Andrea) zwischen beiden Schweinen porträtiert. Das Bild verkaufte sich unter dem Titel „Bourgeoise Sauerei“ bei einer Auktion in Rom zu Bens persönlichen Rekordpreis. Bonanza-Vater Ben Cartwright hatte in der Walton-Tochter offenbar die Muse seines Lebens gefunden. Immerhin malte er wie ein Besessener. Nur noch sie! Ich habe euch beide von Anfang an richtig eingeschätzt – dich und Miss-Emily. Die Art und Weise, wie ihr einander angesehen habt, Berührungen wie zufällig. Wenn eure Hände auf dem Tisch einander berührten – diese Sekunde, die den Hautkontakt unnötig in die Länge zog, verriet mir eure geheime Sehnsucht. Ich musste nicht extra einen Blick unter den Tisch werfen, um zu sehen, welches Spiel eure Füße miteinander spielten.
Du warst in sie verliebt!
Ich habe es in deinem Blick gesehen.
Und er – Heinrich, muss es auch bemerkt haben.
„Wer zweimal mit derselben pennt, gehört auch schon zum Establishment!“
Von wegen.
Der große Ben Cartwright hat von da an seltener mit mir geschlafen, Livie und wie wir uns alle genannt haben. Dabei wollte der alte Mann sich doch beweisen, dass er die bürgerlichen Spießergesetze abgelegt hatte. Oder wollte er uns den Beweis erbringen – und ließ sich deswegen dazu herab, ab und zu mit einer von uns zu schlafen? Miss-Emily ließ sich tagsüber von ihm malen. Nachdem sie mit ihm geschlafen hatte, hatte sie sich zu dir, Mary-Ellen, unter die Decke gekuschelt. Bei dir war sie Kind, bei ihm war sie Frau. Und die Männer in unserer Kommune haben irgendwann den Braten gerochen. John-Boy machte ihr den Hof, ebenso Hoss und Little Joe. Sie gab sich aber nicht mehr mit ihnen ab.
Mitte Dezember berief Ben den „Kommunen-Rat“ ein. Zum Kommunen-Rat gehörten alle Bewohner. Die Sitzungen fanden anlassbezogen statt. Ben hielt wenig von Besprechungen jeder Art, boten sie doch – nach seiner Meinung – „in erster Linie Bedenkenträgern und Bedenkenträgerinnen eine Bühne“.
„Was immer ihr in eurem Bauch spürt, zeigt euch den richtigen Weg!“, pflegte er den Neuankömmlingen zu erklären.
Ich erinnere mich, dass ich damals fasziniert war, solche Worte aus dem Mund eines Erwachsenen zu hören. Ich war völlig baff gewesen. Wir lebten in dem Prinzip von Lust und Un-Lust gefangen.
Als ich ihm keine Antwort gab, setzte er noch eins drauf: „Hör auf deine Hormone, Mädchen“, riet er mir. „Die Natur lügt nie!“