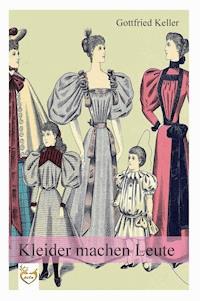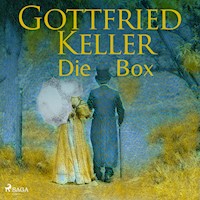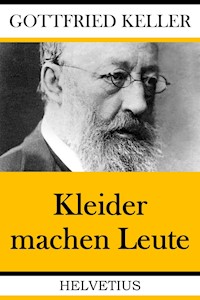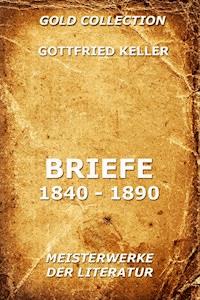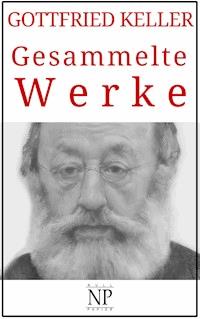
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gesammelte Werke bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Gottfried Keller (19.07.1819–15.07.1890) war ein Schweizer Dichter und Staatsbeamter. Man kann ohne Zweifel sagen, dass Gottfried Keller der wichtigste Autor der Schweiz im 19. Jahrhundert war. Wegen eines Dummejungenstreiches von einer höheren Schulbindung oder gar einem Studium ausgeschlossen, fand der Halbwaise über den Umweg der Lehre zum Landschaftsmaler doch noch zur Literatur. Er hinterlässt ein großes Werk an Gedichten, Dramen, Novellen und Romanen. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2511
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gottfried Keller
Gottfried Keller - Gesammelte Werke
Romane und Geschichten
Gottfried Keller
Gottfried Keller - Gesammelte Werke
Romane und Geschichten
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962812-99-7
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Leben und Werk
Züricher Novellen
Einleitung
Hadlaub
Der Narr auf Manegg
Der Landvogt von Greifensee
Das Fähnlein der sieben Aufrechten
Ursula
Martin Salander
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Sieben Legenden
Vorwort
Eugenia
Die Jungfrau und der Teufel
Die Jungfrau als Ritter
Die Jungfrau und die Nonne
Der schlimm-heilige Vitalis
Dorotheas Blumenkörbchen
Das Tanzlegendchen
Das Sinngedicht
Erstes Kapitel – Ein Naturforscher entdeckt ein Verfahren und reitet über Land, dasselbe zu prüfen
Zweites Kapitel – Worin es zur einen Hälfte gelingt
Drittes Kapitel – Worin es zur anderen Hälfte gelingt
Viertes Kapitel – Worin ein Rückschritt vermieden wird
Fünftes Kapitel – Herr Reinhart beginnt die Tragweite seiner Unternehmung zu ahnen
Sechstes Kapitel – Worin eine Frage gestellt wird
Siebentes Kapitel – Von einer törichten Jungfrau
Achtes Kapitel – Regine
Neuntes Kapitel – Die arme Baronin
Zehntes Kapitel – Die Geisterseher
Elftes Kapitel – Don Correa
Zwölftes Kapitel – Die Berlocken
Dreizehntes Kapitel – In welchem das Sinngedicht sich bewährt
Kleider machen Leute
Pankraz, der Schmoller
Romeo und Julia auf dem Dorfe
Frau Regel Amrain und ihr Jüngster
Frau Regel Amrain und ihr Jüngster
Die drei gerechten Kammmacher
Spiegel, das Kätzchen – Ein Märchen
Der Schmied seines Glückes
Die missbrauchten Liebesbriefe
Dietegen
Das verlorene Lachen
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Index
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Gesammelte Werke bei Null Papier
Edgar Allan Poe - Gesammelte Werke
Franz Kafka - Gesammelte Werke
Stefan Zweig - Gesammelte Werke
E. T. A. Hoffmann - Gesammelte Werke
Georg Büchner - Gesammelte Werke
Joseph Roth - Gesammelte Werke
Mark Twain - Gesammelte Werke
Kurt Tucholsky - Gesammelte Werke
Rudyard Kipling - Gesammelte Werke
Rilke - Gesammelte Werke
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Leben und Werk
Gottfried Keller (19.07.1819–15.07.1890) war ein Schweizer Dichter und Staatsbeamter. Man kann ohne Zweifel sagen, dass Gottfried Keller der wichtigste Autor der Schweiz im 19. Jahrhundert war.
Keller wurde in Zürich geboren. Sein Vater war Drechsler. Nach dem frühen Tod seines Vaters (1824) besuchte er bis 1834 verschiedene Schulen. Wegen eines Dummejungenstreiches von einer höheren Schulbindung oder gar einem Studium ausgeschlossen, fand der Halbwaise über den Umweg der Lehre zum Landschaftsmaler doch noch zur Literatur.
Eigentlich für die Malerei und die bildenden Künste entflammt, waren seine großen Erfolge als Lyriker und (später) auch als Romancier und Dramatiker eher der Mittellosigkeit geschuldet und seinem Wunsch nach Unabhängigkeit von der Mutter, zu der er nach mehreren erfolglosen Versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen, immer wieder zurückkehrte.
Seine erste Gedichtsammlung (1846) verhalf ihm zu einem Stipendium in Zürich. 1848-1850 studierte Keller Geschichte, Philosophie und Literaturwissenschaft in Heidelberg. 1850-1855 lebte er in Berlin und danach wieder in der Schweiz als freier Schriftsteller.
Mehrere Jahre arbeitet er in Zürich als biederer Stadtschreiber und beschäftigte sich beinahe ausschließlich mit der Abschrift und der Korrektur von Protokollen und Gesetzesvorlagen; eine Arbeit, die ihn sichtlich nicht erfüllte und auch nicht ausfüllte.
Nach dem Tode der Mutter scheint ihm das lang ersehnte Glück endlich hold, als er seine spätere Verlobte, die Pianistin Luise Scheidegger kennenlernt. Doch wenige Tage nach der Verlobung nimmt sich Luise das Leben.
Im Alter legt Keller, nun doch von den literarischen Erfolgen profitierend, seine Arbeit als Stadtschreiber nieder und konzentriert sich, zurückgezogen und allein lebend, auf sein Alterswerk. Den zunehmenden Ehrenbezeugungen der Stadt und des Landes entzieht er sich konsequent.
Gottfried Keller stirbt am 15. Juli 1890. Er hinterlässt ein großes Werk an Gedichten, Dramen, Novellen und Romanen.
Wichtige Werke: - Gedichte (1846) - Neuere Gedichte (1851) - Der grüne Heinrich (1. Fassung, 1854/55) - Die Leute von Seldwyla (1856) - Sieben Legenden (1872) - Romeo und Julia auf dem Dorfe (1876) - Züricher Novellen (1878) - Der grüne Heinrich (Neufassung, 1879/80) - Martin Salander (1886)
Züricher Novellen
Einleitung
Gegen das Ende der achtzehnhundertundzwanziger Jahre, als die Stadt Zürich noch mit weitläufigen Festungswerken umgeben war, erhob sich an einem hellen Sommermorgen mitten in derselben ein junger Mensch von seinem Lager, der wegen seines Heranwachsens von den Dienstboten des Hauses bereits Herr Jacques genannt und von den Hausfreunden einstweilen geihrzt wurde, da er für das Du sich als zu groß und für das Sie noch als zu unbeträchtlich darstellte.
Herrn Jacques’ Morgengemüt war nicht so lachend wie der Himmel, denn er hatte eine unruhige Nacht zugebracht, voll schwieriger Gedanken und Zweifel über seine eigene Person, und diese Unruhe war geweckt worden durch den am Abend vorher in irgendeinem vorlauten Buche gelesenen Satz, dass es heutzutage keine ursprünglichen Menschen, keine Originale mehr gebe, sondern nur noch Dutzendleute und gleichmäßig abgedrehte Tausendspersonen. Mit Lesung dieses Satzes hatte er aber gleichzeitig entdeckt, dass die sanft aufregenden Gefühle, die er seit einiger Zeit in Schule und Haus und auf Spaziergängen verspürt, gar nichts anderes gewesen, als der unbewusste Trieb, ein Original zu sein oder eines zu werden, das heißt, sich über die runden Köpfe seiner guten Mitschüler zu erheben. Schon hatte sich in seinen Schulaufsätzen die kurze, dürftige Schreibweise ganz ordentlich zu bewegen und zu färben angefangen; schon brachte er hier und da, wo es angezeigt schien, ein kräftiges sic an und wurde deshalb von den Kameraden der Sikamber geheißen. Schon brauchte er Wendungen wie: »obgleich es scheinen möchte«, oder »nach meiner unmaßgeblichen Meinung«, oder »die Aurora dieser neuen Ära«, oder »gesagt, getan« und dergleichen. Ein historisches Aufsätzchen, in welchem er zwei entschieden einander entgegenwirkende Tatsachen rasch aufgezählt hatte, versah er sogar mit dem pomphaften Schlusse: »Man sieht, die Dinge standen so einfach nicht, wie es den Anschein haben mochte!«
Auch gab es unter seinen Sachen ein Heft immer weiß bleibenden Papiers, überschrieben: »Der neue Ovid«, in welches eine neue Folge von Verwandlungen eingetragen werden sollte, nämlich Verwandlungen von Nymphen und Menschenkindern in Pflanzen der Neuzeit, welche die Säulen des Kolonialhandels waren, dem das elterliche Haus sich widmete. Statt des antiken Lorbeers, der Sonnenblume, der Narzisse und des Schilfes sollte es sich um das Zuckerrohr, die Pfefferstaude, Baumwoll- und Kaffeepflanze, um das Süßholz handeln, dessen schwärzlichen Saft sie in jener Stadt Bärendreck nennen. Namentlich von den verschiedenen Farbhölzern, dann vom Indigo, Krapp usw. versprach er sich die wirkungsreichsten Erfindungen, und alles in allem genommen schien es ihm ein zeitgemäßer und zutreffender Gedanke zu sein.
Freilich boten die Erfindungen selbst nirgends eine Handhabe dar, bei welcher er sie anpacken konnte; sie waren sämtlich wie schwere, große runde Töpfe ohne Henkel, und aus diesem Grunde blieb jenes Heft bis auf die stattliche Überschrift durchaus rein und weiß. Aber das Dasein desselben, sowie noch einige andere Erscheinungen ungewöhnlicher Art, deren Aufzählung hier unterbleiben kann, bildeten eben dasjenige, was er nunmehr als Trieb zur Originalität entdeckte in dem gleichen Augenblicke, da diese Tugend dem damaligen Geschlechte rundweg abgesprochen wurde.
Ängstlich und fast traurig betrachtete Herr Jacques den schönen Tag, fasste dann aber seiner Jugend gemäß einen raschen Entschluss, nahm sein Taschenbuch, das für mannigfache Aufzeichnungen sinnreich eingerichtet war, zu sich und begab sich auf einen Spaziergang für den ganzen Tag, um seine Sache, die er meinte, zu erwägen, zu erproben und in Sicherheit zu bringen.
Erstlich bestieg er eine hohe Bastion, die sogenannte Katze, an welcher jetzt der Botanische Garten liegt, und arbeitete sich so über seine Mitbürger empor, indem er über die Stadt hinblickte.
Alles war in täglicher Arbeit und Tätigkeit begriffen; nur ein kleiner, schulschwänzender Junge schlich um Herrn Jacques herum und schien ebenfalls ein Original werden zu wollen, ja ihn an Begabung bereits zu übertreffen; denn man konnte beobachten, wie der Kleine in ein Kasemattengemäuer schlich, dort einen künstlich angelegten Behälter öffnete, Spielsachen und Esswaren hervorholte und sich mutterseelenallein, aber eifrig zu unterhalten begann.
So war alles betätigt, selbst der blaue See fernhin von den Segeln der Last- und Marktschiffe bedeckt, müßig allein die stille weiße Alpenkette und Herr Jacques.
Da sich nun auf dieser Katze keine erfreuliche Erfahrung oder Auszeichnung darbieten wollte, so stieg er wieder hinunter und ging aus dem nächsten Tore, sich bald an den einsamen Ufern des Sihlflusses verlierend, der wie herkömmlich durch die Gehölze und um die aus dem Gebirge herabgewälzten Steinblöcke schäumend dahineilte. Seit hundert Jahren war diese dicht vor der Stadt liegende romantische Wildnis von den zürcherischen Genies, Philosophen und Dichtern mit Degen und Haarbeutel begangen worden; hier hatten die jungen Grafen Stolberg als Durchreisende genialisch und pudelnackt gebadet und dafür die Steinwürfe der sittsamen Landleute eingeerntet. Die Felstrümmer im Flusse hatten schon hundertmal zu den Robinsonschen Niederlassungen junger Schulschwänzer gedient; sie waren geheimnisvoll von dem Feuer geschwärzt, in welchem geraubte Kartoffeln oder unglückselige Fischchen gebraten worden, die den Robinsons in die Hände gefallen. Herr Jacques selber hatte mehrere dergleichen Projekte hervorgebracht. Allein, ein besserer Kaufmann als Robinson, hatte er dieselben, das heißt die Wahl des Platzes und das Einzelne der Ausführung, jedes Mal für bares Geld an andere Knaben abgetreten, worauf die Käufer dann ebenso regelmäßig infolge dieser Wahl und Ausführung von den Bauern als Holzfrevler und Felddiebe überfallen und geprügelt worden waren.
Dieses erinnerungsreiche Ufer entlang wandelte Herr Jacques, die offene Schreibtafel in der einen, den Stift in der anderen Hand und ganz gewärtig, die Zeugnisse seiner Originalität zu beglaubigen, welche die rauschenden Wasser ihm bringen sollten. Allein der fleißige Strom hatte anderes zu tun, er musste den Bürgern von Zürich das gute Buchenholz zutragen, welches sie aus dem schönen Walde bezogen, den ihnen nach der Überlieferung zur alten Reichszeit die Kinder König Albrechts von Österreich aus dem Gute eines seiner Mörder für loyales Verhalten geschenkt, oder aus jenem Forste, den Ludwig der Deutsche der Abtei Zürich gewidmet. Zu vielen Tausenden kamen, den Fluss bedeckend, die braven Holzscheite aus den mächtigen Wäldern stundenweit hergeschwommen, und der Fluss, von früherem Regenwetter angeschwollen, mit weggeschwemmtem Erdreich gesättigt und schmutzig gefärbt, warf die Last mit wilder Kraft vor sich her, als der ungeschlachte Holzknecht der guten Stadt, dass das Holz gar eilig in deren Bereich sich sputete.
An diesem Anblicke hätte nun Herr Jacques sich zu einem fruchtbringenden Gedanken erheben und, den Lauf der Zeiten verfolgend, das Auge in die graue Vorzeit versenkend, den Bestand der menschlichen Dinge erwägen, oder er hätte das Lob jenes grünen Waldes singen können, der in der Hand ausdauernder Bürgerkraft allein noch lebte von all der Herrlichkeit verschollener Ritter und Abteien, noch so frisch und grün, wie vor einem halben oder bald ganzen Jahrtausend.
Doch konnte er nicht auf solche Abschweifungen geraten, weil er sofort begann, die Holzscheite, so schnell er konnte, innerhalb eines ungefähren quadratischen Bezirkes zu zählen, die mutmaßliche Fläche, welche zu einem Klafter wohlgemessenen Buchenholzes gehören mochte, zu überschlagen, dann solche Flächen abzugrenzen und zu zählen, und endlich den Wert des vorüberschwimmenden Holzes auszurechnen, sodass er, nachdem er, kein Auge verwendend und die Uhr in der Hand, eine halbe Stunde flussaufwärts gegangen war, auf seiner Schreibtafel die ziemlich wahrscheinliche Summe trug, für welche die Stadt während zweier Tage Brennholz einführte. Denn er kannte die gegenwärtigen Holzpreise genau und freute sich, die heutige Mission ganz vergessend, seines Fleißes und seiner Geschicklichkeit.
Plötzlich erwachte er aus seinen Berechnungen, als die Flussgegend sich erweiterte und er eine von Hügeln und Bergen eingeschlossene Ebene betrat, die Wollishofer Allmende genannt, auf welcher sich ihm ein neues Schauspiel darbot.
Auf dieser Allmende sah er nämlich ein Häuflein meistens älterer Herren sich rüstig und doch gemächlich durcheinander bewegen und alle Vorbereitungen zu einem erklecklichen Bombenwerfen ausführen. Es waren die Herren der löblichen alten Gesellschaft der Konstaffleren und Feuerwerker, welche dieses kriegerische Wesen zu ihrem Privatvergnügen sowohl als zu gemeinem Nutzen betrieben und heute ihr jährliches Mörserschießen feierten.
Da waren also mehrere solcher Geschütze, in der Sonne glänzend, aufgepflanzt; daneben stand ein großes offenes Zelt; der Tisch darunter trug Papiere, Instrumente sowie Flaschen und Gläser und eine blanke Zinnschüssel mit Tabak nebst langen irdenen Pfeifen. Eine der letzteren trug beinahe jeder der Herren in der Hand, feine Räuchlein ausblasend in Erwartung des Pulverdampfes. Zwei oder drei von den ältesten trugen noch Haarzöpfchen und mehrere andere gepuderte Haare. Im übrigen gingen sie in blauen oder grünen Fräcken einher, in weißen Westen und Halsbinden.
Sie säuberten aufmerksam die Bettungen der Geschütze und brachten alles wohl in seine Lage; denn wie es schon in dem »einer ehr- und tugendliebenden Jugend« gewidmeten Neujahrsblatte der Gesellschaft vom Jahre 1697 hieß:
Was die Werlet ist und heget, Auf ein Pfimmet ist geleget.
Endlich aber begann
Das schleunige Schießen, Des Feindes Verdrießen!
Bald wälzten sich die Rauchwolken über die Fläche, während die Bomben in hohem Bogen am blauen Himmel nach der Scheibe hinfuhren und die weißen Herren in stiller Fröhlichkeit hantierten wie die baren Teufel. Hier setzte einer die Bombe in den Mörser, dort senkte ein anderer das Geschütz und richtete es kunstgerecht, ein dritter zündete an und
Der vierte den Mörsel schon wieder ausbutzt, Vulkanens Gesinde hier dienet und trutzt!
wie es in einem anderen Neujahrsstücke von 1709 heißt.
Bei aller Furia leuchtete aber doch eine altväterische Frömmigkeit aus den Augen dieser Vulkansdiener, abgesehen davon, dass auch ein Chorherr vom Stift unter ihnen arbeitete, und man konnte sich an jenes andere Fragment ihrer artilleristischen Poesie erinnern, welches lautet:
Wann der Satan mit Haubitzen Seine Plagen auf dich spielt, Dann so wisse dich zu schützen Mit Gebet als einem Schild, Sein Geschütz, gepflanzt zu haglen, Wird dein’ Andacht bald vernaglen!
Herr Jacques, der nichts zu tun hatte, schaute diesem Spiele wehmütig und bescheiden im Schatten eines Baumes zu, bis ihn einer der Bombenschützen, der sein Pate war, erkannte, heranrief und ihm die lange Tonpfeife zu halten gab, während er mit dem Pulversacke zu schaffen hatte. Diese Bequemlichkeit merkten sich die anderen Herren auch, und so stand der junge Originalmensch bis zum Mittag, stets eine oder zwei Pfeifen in der Hand vor sich hinstreckend. Nur der Chorherr, welcher statt der Pfeife eine längliche, mit einem Federkiel versehene Zigarre rauchte, legte diese nicht weg, sondern brannte kühn seinen Mörser mit ihrem Feuer los.
Für seine Mühewaltung wurde Jacques dann aber zu dem Mittagessen gezogen, welches die heutige Tathandlung der Feuerwerker krönte und auf einem nahen Bühel unter den Bäumen bereitet war. Wenn diese wackeren Geister schon durch den Pulvergeruch verjüngt worden, so fühlten sie sich nun durch den blauen Himmel, die grünen Wälder ringsumher und durch den goldenen Wein noch mehr erheitert, und nachdem in vollem Chor ein Kriegslied erschollen, versuchten sie sich in einem Rundgesange, in welchem auch nicht einer seinen Beitrag verweigerte. Da kamen allerlei schnurrenhafte Liedchen zum Vorschein, von deren Dasein Herr Jacques keine Ahnung gehabt. Er lauschte lautlos und sah einen der Singenden nach dem anderen an, und seine weithin ragende bleiche Nase drehte sich dabei langsam in die Runde gleich dem Lafettenschwanz einer Kanone, wie einer der Feuerwerker meinte.
Als nun die Reihe an ihn kam und die Männer darauf hielten, dass er auch seinen Vers singe, wusste er keinen, und es fiel ihm nicht der geringste sangbare Gegenstand ein. Darüber wurde er ganz betreten und niedergeschlagen.
Die Feuermänner aber achteten nicht darauf, sondern begannen den Rundgesang: »Lasset die feurigen Bomben erschallen«, in welchem an jeden die Frage gerichtet wurde:
»Herr Bruder, deine Schöne heißt?«
welche Schöne jeweilig nach ihrer Namhaftmachung hochleben musste. Da riefen nun die einen, mit Schonung der würdigen Hausfrau, den verstellten Namen irgendeiner Jugendfreundin, wie Doris, Phillis oder Chloe. Andere nannten Diana, Minerva, Venus oder Constantia, Abundantia und dergleichen. Das waren aber keine Damen, sondern Lieblingsgeschütze, die ehrbar im Zeughause standen. Diese Geschütznamen wurden jedes Mal wie Kanonenschüsse mit furchtbarer Donnerstimme ausgestoßen, sodass es fast tönte, wie wenn die Rohre einer Zwölfpfünderbatterie eines nach dem anderen abgefeuert würden. Als nun auch hier wieder die Reihe an Herrn Jacques kam, gedachte er sich endlich hervorzutun, und bezeichnete, so laut er konnte, seine Geliebte als »Sapientia!« Da aber seine Stimme zu jener Zeit eben im Brechen war, erdröhnten nur die ersten Silben des Wortes in tiefer Tonlage, während das Ende überschlug und ganz in die Höhe schnappte, was bei seinem tiefen Ernste sich so lustig ausnahm, dass alle Herren in ein fröhliches Gelächter ausbrachen.
Da wurde er noch stiller und blickte lange nicht mehr auf.
Dies bemerkend, klopfte ihm der Herr Pate auf den Rücken und sagte: »Was ist’s mit Euch, Meister Jacques? Warum so mauserig?«
Der kleine Mann schwieg aber noch eine Weile unbeholfen fort, bis ihm einige Schlücke besseren Weines plötzlich die Zunge lösten und er unversehens sein Herz auszuschütten begann. So eröffnete er denn dem alten Herrn seine Klage: Jene hätten gut lachen; er dagegen sei in einer Zeit geboren, in der man unbedingt kein Originalmensch mehr werden könne und am Gewöhnlichen haftenbleiben müsse, was um so schmerzlicher sei, wenn man die letzten Überbleibsel schönerer Tage noch vor sich sehe. Diese alten Bombenwerfer mit ihren gepuderten Köpfen und Tonpfeifen seien ja die originellsten Käuze von der Welt, und ein junger Schüler von heute zerbreche sich ganz vergeblich den Kopf, ausfindig zu machen, was etwas dem Ähnliches darstellen würde. Dieses sei der beseufzenswerte Nachteil des Jahrhunderts, in dem man leben müsse, und kein Kraut sei für solches Übel gewachsen.
Der Alte beschaute den Sprecher von der Seite, ohne etwas zu sagen. Die Nächstsitzenden jedoch sahen sich untereinander an und murrten vernehmlich über ein Zeitalter, in welchem Kinder sich herausnehmen dürften, über die Alten naseweise Bemerkungen zu machen und ihnen Spitznamen zu geben, wie originelle Käuze und dergleichen.
Da wurde der Ärmste ganz eingeschüchtert und beschämt und ließ feuerrot seinen Blick herumirren, nach welcher Seite hin er entwischen könne. Der Herr Pate nahm ihn aber unter den Arm und sprach: »Kommt, Meister Jakobus! Ich will Euch den Überbleibsel dieses heiteren Tages widmen, da wir beide wohl nicht mehr viel zur Arbeit taugen werden! Wir wollen einen Gang auf die Manegg machen und bis dahin des lieblichen Waldes genießen.«
Sie spazierten also über die weite Allmende und über den Sihlfluss, stiegen durch schönes junges Buchengehölz die jenseitigen Höhen empor und gelangten auf einen ebenen Absatz, von zwei mächtigen, breitästigen Buchen beschattet, wo aber schon ein neues Abenteuer auf den jungen Verehrer der Sapientia heranstürmte.
Die Terrasse war bevölkert und belebt von einer Schar junger Schulmädchen, welche zur Begehung des jährlichen sogenannten Lustigmachens aus der engen Stadt ins Freie geführt worden waren und hier unter der Obhut einiger Herren Vorsteher und Lehrerinnen ihren unschuldigen Ringeltänzen und Fangspielen oblagen. Sie waren alle weiß oder rosenrot gekleidet; einige trugen zur Erhöhung der Lust bunte Trachten als Bäuerinnen oder Hirtinnen, wie zu solchem Behufe die geeigneten Gewänder da und dort in den Familien aufbewahrt und im Stande gehalten wurden. Das alles verursachte eine heitere und glänzende Erscheinung in der grünschattigen Umgebung, und gern hielt der Herr Pate einen Augenblick an, um sich an dem lieblichen Anblick zu erfrischen. Er begrüßte die ihm bekannten Vorsteher und scherzte mit den verkleideten kleinen Schönheiten, sie nach Stand und Herkommen befragend, ob sie hier in Dienst zu treten oder weiterzureisen gedächten und so weiter.
Sogleich kam aber die ganze Mädchenschar herbeigelaufen und umringte den alten Herrn samt seinem jungen Schützling, welcher jetzt in noch größere Bedrängnis geriet, als er heute je erlebt. Wo er hinsah, erblickte er in dichter Nähe nichts als blühende und lachende Gesichter, die an der Grenze der Kindheit noch alle frisch und lieblich waren und das ihrer wartende Reich der Unschönheit noch nicht gesehen hatten. Hier das schönäugige Gesichtchen mit den etwas starken, familienmäßigen Vorderzähnchen ahnte nicht, dass es in weniger als zehn Jahren ein sogenannter Totenkopf sein würde; dort das regelmäßige ruhige Engelsantlitz schien unmöglich Raum zu bieten für die Züge anererbter Habsucht und Heuchelei, welche in kurzer Zeit es durchfurchen und verwüsten sollten; wer glaubte von jenem rosigen Stumpfnäschen, dass es zu einem Thron und Sitz unerträglicher Neugierde und Spähsucht bestimmt war und die beiden Sternäugelein links und rechts in falsche Irrlichter verwandeln würde? Wer hätte von dem küßlichen Breitmäulchen da denken können, dass seine jetzo so anmutigen Lippen dereinst, von ewiger Bewegung kleiner Leidenschaften und Müßigkeiten ausgedehnt und formlos geworden, sich bald gegen das rechte, bald gegen das linke Ohr hin verziehen, bald die untere die obere, bald die obere die untere bedecken, dann plötzlich wieder beide vereint sich verlängern und als Entenschnabel schnattern würden? Ei, und dort das angehende Spitznäschen, das die erhabene Beatrix für einen kommenden Dante zu verkünden scheint und sich zu einem Geierschnabel auswachsen wird, der einem ehelichen Dulder täglich die Leber aufhacket, unversehrt von seinem schweigenden Hasse! Und wiederum diese in gleichmütiger Unschuld und zarter Heiterkeit lachende junge Rose, die vor der Zeit entblättert sein wird von tausend Sorgen und ungeahnten Erfahrungen, gebleicht von Kummer und zu schwach auch nur für den Widerstand der Verachtung!
Nichts von alledem war hier zu ahnen; wie eine lebendige Rosenhecke umdrängte das Mädchenvolk den hochragenden Herrn Paten und den etwas kürzeren Herrn Jakobus, welchen die losen Kinder so oft auf dem Schulwege als ernsthaften, pedantischen Großschüler trafen, schwere Bücher unter dem Arm. Neugierig betrachteten sie ihn jetzt nach Herzenslust und so recht in der Nähe, und erforschten unverzagt sein tiefsinniges Gesicht, seine verlegene Haltung, seine etwas langen Hände und Füße, und kicherten dabei fortwährend, sodass es ihm unangenehm zumute wurde. Während der Alte fortfuhr, mit ihnen zu scherzen, und das eine oder andere Köpfchen streichelte, drängten sie sich immer näher und schoben dabei diese oder jene im Hintertreffen Stehende mutwillig in den Vordergrund. Plötzlich stieß auf diese Weise ein langes, stärkeres Mädchen, das allgemein der Holzbock genannt wurde, eine zarte Gestalt so gewaltsam hervor und gegen den Herrn Jacques, dass sie errötend und aufschreiend die Hände wider seine Brust stemmen musste, um nicht an dieselbe hinzufallen, während er überrascht und erschrocken gleicherweise die Ärmste von sich stieß, wie ein unvorhergesehenes großes Übel.
Und doch war es seine von ihm selbst erwählte und festgesetzte erste Liebe, seine Jugendflamme, welche, ohne zu brennen, still auf allen seinen Pfaden leuchtete, ein schmales Jungfräulein mit sieben oder acht langgedrehten, auf den Rücken fallenden blonden Locken, angetan mit einem blendend weißen Kleide und himmelblauen Schuhen mit kreuzweise um die Knöchel gewundenen Bändern.
Diese äußere Erscheinung war der Wille und das Werk der Mutter, welche die vermeintlich verscherzte eigene Bedeutung auf solche Weise an dem Kinde nachholen wollte, ihm mit Sorgfalt alle Tage eigenhändig die Locken wickelte und es so herumlaufen ließ, dass es sich von allen anderen Kindern unterschied, obgleich es ein ganz gewöhnliches Wesen war.
Ebendiese Auszeichnung aber hatte den wählerischen jungen Scholaren bestimmt, bei Gründung der ersten Liebe sein Auge auf das Mädchen zu werfen. Im übrigen begnügte er sich damit, dasselbe von ferne anzusehen und die Wege zu wandeln, auf denen es zur Kirche oder Schule ging, in der Nähe aber immer das Gesicht abzuwenden, sodass ihm die Gesichtszüge der Geliebten eigentlich fast unbekannt waren und er nur ein ungefähres Bild im Kopfe trug, an welchem die Locken und das Kleid die Hauptsache bildeten. Auch war sein Gefühl noch kühl und schwach und mit keinerlei Schlagen des Herzens verbunden. Dieses klopfte ihm jetzt nicht einmal, als er die Jugendgeliebte so unverhofft nahe sah und sie von sich stoßen musste, wobei er einen Augenblick lang zum ersten Mal die Gesichtszüge der Teuren deutlich erkannte, und zwar nicht ohne ein rasches, kurzes Befremden; denn die Züge entsprachen gar nicht der Vorstellung, die er davon hatte. Überdies waren sie etwas entstellt von Scham und Unwillen über den empfangenen Stoß und Gegenstoß. Trotz dieser scheinbar gefährlichen Sachlage kann jetzt schon erzählt werden, dass Herr Jacques pedantisch genug war, an seiner Jugendneigung festzuhalten, dieselbe immer mehr auszubilden und um das Mädchen späterhin zu werben mit der Ruhe und Gemessenheit einer guten Wanduhr, ohne je den Schlaf zu verlieren oder, wenn er schlief, von der Sache zu träumen.
Für jetzt aber nahm der Auftritt eine abermalige plötzliche Wendung; denn von dem nahen Meierhofe her, dessen Pächter eine Wirtschaft betrieb, wurden große Körbe voll eines goldbraunen, duftenden Gebäckes gebracht, welches nur hier verfertigt wurde und den Namen des Hofes trug. Die Halbkinder rauschten wie ein Flug Tauben auf und davon und flogen, ohne zurückzublicken, nach dem lockenden Speiseplatz, alsodass Jacques mit seinem Paten unversehens allein dastand und jetzt mit ihm weiterziehen musste. Und doch drang auch ihm der süße Duft der Kuchen in die Nase; er hatte zudem aus Blödigkeit nicht genug gegessen bei den Vulkansdienern und verspürte starke Esslust. Daher bedrückte es wie eine große Unbilligkeit sein Herz, dass es klopfte, als er vergeblich nach den glückseligen Körben zurückschaute, während der alte Herr ihn entführte. Unmut und Bekümmernis wurden jetzt so stark, dass sie ihm das Wasser in die Augen trieben, die er verstohlen abwischte. Der alte Herr bemerkte es aber wohl und sah ihn kopfschüttelnd wieder von der Seite an; er hielt jedoch dafür, dass nicht die Kuchen, sondern seine jugendlichen Originalitätssorgen ihm noch zu schaffen machten und das Herz bedrängten, und führte den trauernden Heranwüchsling schweigend den steiler werdenden Pfad empor, bis sie auf dem Vorsprung des Berges anlangten, auf welchem noch die letzten Steintrümmer der ehemaligen Burg Manegg zu sehen waren.
Am Fuße des Gemäuers floss ein Brünnlein mit frischem Bergwasser, geziert mit einer Inschrift zum Andenken des ehemaligen Eigners der Burg, des Ritters und Freundes der Minnesinger, Herrn Rüdiger Manesse. Die beiden Wanderer erquickten sich an dem kühlen Wasser, und da überdies von Burgen und Rittern die Rede war, so lebte der Jünglingsknabe wieder auf und erklomm mit dem Alten beruhigter vollends die Burgstätte. Hier setzten sie sich auf eine Bank und betrachteten die reiche Fernsicht; über ihnen ragten schlanke Föhrenbäume, während hundertjährige Stämme gleicher Art aus der Tiefe emporstiegen und ihre schönen Kronen mit gewaltigen, im Abendlichte rötlich glühenden Armen zu ihren Füßen ausbreiteten. Von Süden her leuchtete der wolkenlose Berg Glärnisch über grüne Waldtäler, und im Nordosten über dem See lagerte die alte Stadt im Sonnenglanze.
»Also ein Original möchtet Ihr gerne sein, Meister Jacques?« sagte nunmehr der Pate und strich seinem Schützlinge das Haar aus der erhitzten Stirne. »Ei, das kommt nur darauf an, was für eines! Ein gutes Original ist nur, wer Nachahmung verdient! Nachgeahmt zu werden ist aber nur würdig, wer das, was er unternimmt, recht betreibt und immer an seinem Orte etwas Tüchtiges leistet, und wenn dieses auch nichts Unerhörtes und Erzursprüngliches ist! Jenes ist aber im ganzen so wenig häufig oder recht betrachtet so selten, dass, wer es kann und tut, immer den Habitus eines Selbstständigen und Originalen haben und sich im Gedächtnis der Menschen erhalten wird, ganze Stämme sowohl wie einzelne.
»Da haben wir dieses längst verschwundene Geschlecht der Manesse, die in ihrer Blütezeit alles, was sie unternahmen, ausführten und, ohne sich durch seltsame Manieren bemerklich zu machen, mustergültig ihren Platz ausfüllten, auch wenn es nicht der oberste war. Hier sitzen wir auf einem ihrer Burgställe, dort drüben in der Stadt können wir noch das hohe Dach ihres Ritterturmes erblicken. Lass sehen! Zwischen dem Fraumünster und dem Großmünster muss er stehen! Da sind freilich noch andere solche Spitzdächer von ehemaligen Geschlechtertürmen. Zu äußerst links der Glentnerturm, dicht über ihm der Wellenberg, mehr rechts der Grimmenturm, gleich daneben, scheinbar, der Escherturm, unten, hinter der Wasserkirche, ragt der Turm der Herren von Hottingen; wo ist denn nun der große Erker, der ehemalige Turm der Manessen? Halt, wenn du mit dem Finger dort vom Wettingerhause, das am Wasser steht, über das Gewirre der Dächer aufwärts fährst, so tupfst du auf das sogenannte grüne Schloss, dann ziehst du nur eine gerade Linie nach links bis zu dem ragenden dicken Turmkorpus, dort hausten sie zu einer Zeit und zu einem Teile!«
Der Junge folgte mit Aufmerksamkeit und einiger Mühe dem Finger des Alten; denn innerhalb der Wälle und Tore der Stadt stand noch eine Zahl grauer Türme der früheren Ringmauer und alter Tore, zwischen welchen jene hohen Ritterbedachungen zu suchen waren.
»Jetzt«, fuhr der Alte fort, »hausen die Spinnen und Fledermäuse auf den dunklen Estrichen; der Metzger trocknet seine Felle dort, oder es hämmert ein einsamer Schuster im hohen Gemach! Aber einst war es lustiger; dort und hier, wo wir sitzen, brachte Rüdiger Manesse von Manegg eines der schönsten Bücher der Welt zusammen, die Lieder der Minnesänger, die sogenannte Manessische Handschrift, die jetzt in Paris liegt auf der Bibliothek des Königs. Wenn du hinkommst zu deiner Zeit, so musst du das alte Buch sehen; es ist in rotes Leder gebunden, und der schnöde Name Ludwigs XV. ist ihm auf den Rücken gestempelt. Der Name des Sammlers aber, unseres Rüdiger, ist in aller Welt verbreitet, eben weil er die liebe- und freudenvolle und doch so bescheidene Unternehmung beharrlich durchgeführt hat; sein Name lebt, obgleich ein Schulfuchs neulich den Ton angab, ihm sein Verdienst streitig zu machen, ein Bakel, welchem das Werk selbst doch nach fünfhundert Jahren noch Quelle und Werkzeug seiner Tagesarbeit wurde.
»Die Entstehung der Handschrift aber bewirkte, dass wiederum andere Originale sich zeigten und entwickelten; das ereignete sich alles gar heiter und ergötzlich und hat mich in jüngeren Jahren gereizt, mir die Geschichte etwas zusammenzudenken und auszumalen, alsodass ich dieselbe fast so erzählen kann, als ob ich sie aufgeschrieben hätte, und ich will dir sie jetzt erzählen. Es wird eine schöne Mondnacht werden, und bis wir zu Hause sind, bin ich fertig. Es handelt sich dabei hauptsächlich um den Meister Hadlaub, der das Buch geschrieben, wie ich annehme, die vielen Bilder darin zum Teil gemalt hat und darüber selbst zum Dichter geworden ist durch das Minnewesen und den Scherz, den die Herren mit ihm treiben wollten. Von anständigen Minnesachen aber darfst du allenfalls schon etwas vernehmen.«
Hier schaute der Alte den Herrn Jacques wieder schalkhaft seitwärts an und gedachte, den hölzernen und einbildischen Ernst desselben ein wenig zu verwirren. Er erzählte ihm, indem sie die Heimkehr nach der Stadt antraten, die nachfolgende Geschichte von der Entstehung des Manesseschen Kodex zu Paris.
Hadlaub
Gleich unterhalb des aargauischen Städtchens Kaiserstuhl stehen die beiden Schlösser Schwarz- und Weiß-Wasserstelz, jenes mitten im Rhein, das heißt näher dem linken Ufer und jetzt noch von allerlei Leuten bewohnt, die es kaufen mögen, dieses zerfallen auf dem rechten Ufer. Zu den Zeiten Rudolfs von Habsburg aber saßen zwei Schwestern auf den beiden Burgen als Erbinnen eines mäßigen Landwesens, das nach seiner Teilung keiner großes Gut übrigließ. Darum suchte die ältere derselben, Mechthildis, welche auf Weiß-Wasserstelz hauste und dessenungeachtet eine fast ruhige, finstere und gewalttätige Person war, unablässig ihre jüngere Schwester, Kunigunde auf Schwarz-Wasserstelz, von ihrem Erbe zu verdrängen und mit allen möglichen Ränken in ein Kloster zu treiben. Denn diese Kunigunde war von schöner und lieblicher Gestalt, von der weißesten Hautfarbe und anmutig-heiteren Wesens und besaß viel bessere Aussichten für eine günstige Heirat, als jene bösartige.
Trotzdem war sie den Bewerbungen nicht zugänglich und verwahrte sich gegen solche beinah ebenso sorgfältig, wie gegen die Listen und Überfälle ihrer Schwester, welche diese in Verbindung mit anderen Übeltätern ins Werk zu setzen suchte. Die schöne Kunigunde verschloss sich zuletzt ganz in ihr festes Wasserhaus, das rings von den tiefen grünen Wellen des Rheines umflossen war. Am Ufer besaß sie eine Mühle, betrieben von einem treuen wehrbaren Dienstmann, der Zufahrt und Eingang des Schlosses bewachte mit seinen bestäubten Knechten. Im übrigen war ringsum Stille der Wälder, und man hörte nichts als das Ziehen des Flusses, bis einmal jemand sagte, er habe in der Nacht durch ein offenes Fenster des Schlosses ein kleines Kind schreien hören, und ein anderes Mal ein anderer, er habe es auch gehört, und zwar bei hellem Tage. Bald aber ging das Gerücht im Land, die Dame auf Schwarz-Wasserstelz werde von einem gewaltigen Manne besucht, der niemand anders sei als des Kaisers Kanzler, Heinrich von Klingenberg, mit dem nicht gut Kirschen essen wäre. Ihm sei die schöne Frau in Liebe ergeben, und als starker Nekromant wandle er, wenn er in die Gegend komme, nächtlich über das Rheinwasser trockenen Fußes, um sie ungesehen zu besuchen; er gleite auf einer wie Gold leuchtenden Strickleiter oder, wie andere meinten, von Dämonen getragen an der Turmmauer empor bis zum offenen Fenster der Dame; denn er hielt sich alsdann im nahen Schloss Röteln oder im Städtchen zu Kaiserstuhl auf, das er später als Bischof von Konstanz von einem der letzten Regensberger auch käuflich erwarb.
Tatsache war, dass nach etwa sieben oder acht Jahren die Frau von Schwarz-Wasserstelz ein gar anmutiges Mädchen nach Zürich bringen ließ, dass sie bald darauf selber, und zwar freiwillig, als Klosterfrau in die Abtei Zürich ging und dass sie nach Ablauf einer weiteren Zeit durch den Einfluss eben desselben Bischofs Heinrich zur Fürstäbtissin gewählt wurde.
Ob diese Geistlichwerdung aus Reue geschah und um die Jahre der Leidenschaft abzubüßen oder ob es sich für das vornehme Liebespaar darum handelte, als kirchenfürstliche Personen in freier Gesellschaftlichkeit sich öfter zu sehen und einer beruhigten Zuneigung froh zu werden, ist jetzt nicht mehr zu ermitteln; doch spricht damalige Sitte und das weiter sich Begebende eher für den letzteren Fall.
Denn es gab in unserer Stadt Zürich eine mannigfache und ansehnliche Gesellschaft. Neben den Prälaten und ihren Amtleuten waren da angesessene, schon mehrere hundert Jahre alte Geschlechter, die Nachkommen königlicher Verwalter mit seltsam abgedrehten altdeutschen Namen, die, meistens ein- oder zweisilbig, aus ehemaligen Personen- oder Spitznamen zu rätselhaften Familiennamen geworden, mancher verhallende Naturlaut aus dem Rauschen der Völkerwanderung darunter; kleinere Edelleute der umliegenden Landschaften mit den Namen ihrer Wohnsitze zu Berg und Tal drängten sich herbei, und eine Reihe wichtiger Dynasten der oberdeutschen Lande waren in Zürich verbürgert und gingen ab und zu. Unter allem dem waltete eine nicht unzierliche freie Geselligkeit, und wie einst in solchen Kleingebieten der romanische Baustil noch gepflegt wurde, nachdem er in den offenen Großländern längst dem Gotischen gewichen, so erfreute man sich eines verspäteten Minne- und Liederwesens ritterlicher Art, nachdem dessen Blütezeit schon vorüber war.
Jetzt müssen wir uns aber nach dem Kinde Fides umsehen, welches eben das natürliche Töchterlein der Fürstäbtissin war. Das tun wir am besten, wenn wir auf der anderen Seite der Stadt am Zürichberg hinaufgehen, wo wir das Kind alsbald antreffen werden, und zwar auf einem Spaziergang an der Hand des alten Meister Konrad von Mure, des rühmlichen Vorstehers der Singschule am Großmünsterstift. Der sehr betagte Mann hat das lebhafte Mädchen, das durch den Einfluss des Kanzlers im Hause des Herrn Rüdiger Manesse erzogen wurde, unter die Fittiche seiner besonderen Freundschaft genommen und, da er häufig in der nahen Ritterwohnung verkehrt, aus welcher auch sein Vorsteher, der Probst Heinrich Manesse, stammt, seine kleine Freundin zu dem Gange abgeholt.
Je weiter es aber in die Höhe ging, desto weniger vermochte er das rasche und etwas heftige Kind an der Hand zu behalten wegen überhandnehmender Schwäche und Engbrüstigkeit, wie der treffliche Mann denn auch dazumal nicht manches Jahr mehr lebte. Er ließ also das Mägdlein laufen, wie es mochte, und half sich an seinem Stabe in den schattigen Wegen weiter, die zwischen den vielen zerstreuten Bauernhöfen auf die Höhe des Berges führten.
Als er eine genügende Umsicht erreicht, ruhte er eine Weile auf einem Steine sitzend aus und ließ mit Behagen seinen Blick über die weite Landschaft gehen oder vielmehr über die Versammlung von Landschaften, welche ebenso widerspruchsvoll sich aufreihte, wie unser Zürich, seine Leute und seine Geschichte überhaupt. Das Gebirgsland gegen Süden war urhelvetischen Charakters, in unruhigem und ungefügem Zickzack, eine wilde Welt, die nur durch das Blau der Sommerluft und den Glanz von Schnee und See einigermaßen zusammengehalten war. Wendete der Kantor aber den Blick rechts, gegen Abend, so sah er in das ruhige Tal der Limmat hinaus, durch welches der Fluss, an wenigen Punkten aufleuchtend, hinzog und in den sanft gerundeten und geschmiegten Höhenlinien sich verlor. Von einem massigen Nußbaum und ein paar jungen Eschen eingefasst, glich das Tal, wenn es im Abendgolde schwamm, in seiner maßvollen Einfachheit einem Bilde des Lothringers, der vierhundert Jahre später malte. Nach dieser Richtung hin schaute der alte Herr Konrad am liebsten, wenn er hier oben ausruhte; denn der Frieden dieses Anblickes ergötzte und beruhigte sein trotz der Jahre immer erregtes Gemüt.
Als er sich nun zum Weitergehen wendete und die Höhe vollends gewann, zeigte sich auf dem Rücken des Berges abermals ein neues Landschaftsbild. Jenseits waldiger Gründe und Hänge dehnte sich gegen Norden und Osten flacheres Land, am weiten Horizonte von tiefblauen schmalen Höhenzügen begrenzt. Im vordersten Plane aber standen Gruppen hoher Eichbäume, zwischen deren Kronendunkel die weißen Wolken glänzten. Diese Gegend konnte ebenso gut im Spessart oder im Odenwalde liegen, wenn man das Auge nicht rückwärts wandte.
Da und dort zwischen den Bäumen war die Hofstätte eines der Berggenossen zu erblicken, die bis hier hinauf ihre Wohnungen zerstreut hatten, mehr als einer noch von den ursprünglichen freien Männern der Berggemeinde abstammend und den Hof in alter Freiheit fortführend. Unbezweifelt war ein solcher der Bauer Ruoff oder Rudolf am Hadelaub, dessen Haus am Rande eines diesen Namen tragenden Laubgehölzes stand. Der Name deutet auf einen Streit, der einst in dem Holz oder um das Holz geschehen sein mag; er kommt aber unter den jetzigen Flurnamen nicht mehr vor, weil das ganze Grundstück in einem größeren Besitz aufgegangen und auch der Hof längst verschwunden ist; indessen heißt heutigen Tages noch eine kaum fünfhundert Schritte weiter nördlich gelegene Waldparzelle das Streitholz. Damals aber lag das Haus, aus größeren und kleineren Bach- und Feldsteinen gebaut und mit einem niedrigen Schindeldache versehen, samt dem hölzernen Viehstalle dicht an einer der Schluchten, in welchen der Wolfbach herniederfließt.
Hierher lenkte aber jetzt Herr Konrad, das Mädchen an sich rufend, seinen Schritt und sprach bei dem Hofbesitzer vor. Der lange knochige Mann war eben von einem Gerüste aufgestanden, an welchem er in Mußestunden lange Speerschäfte herzurichten pflegte. Das Holz hierzu gaben ihm die schlanken Eschen, die reichlich am Bache und auf den Höhen wuchsen. Er prüfte den Schaft, an dem er eben schnitzte, nach seiner Länge und Gräde, indem er ihn waagerecht vor das Gesicht hielt und darüber hinblinzelte. Dabei entdeckte er die Ankunft des Kirchenmannes und legte langsam seinen Schaft auf den Haufen der bereits glatt geschnittenen Stangen, um jenen zu begrüßen.
»Ruoff, du verdienst den Namen deines Wohnsitzes!« rief der von Mure ihm entgegen, »wo in aller Welt ist denn schon wieder Streit und Mannschlacht, dass du deine Spießmacherei so eifrig betreibst!«
»Es geht immer etwas«, erwiderte der andere, »bald hie, bald da! Übrigens muss ich die Schäfte machen, wenn ich Zeit habe und das Holz trocken ist, so gibt’s etwa einen Pfennig Geld! Seid willkommen, Herr Konrad, was bringt Ihr Gutes?«
»Du bleibst halt immer ein gewerbsamer Züricher, ihr seid alle gleich und habt nie genug, unten am Wasser und hie oben auf dem Berg!«
»Ja, wir haben’s wie die Wildheuer dort drüben am Hochgebirge, wir müssen trachten, da und dort ein herrenloses Gras zu raffen; statt der hohen Felswände haben wir die Kirchenmauern, drum herumzuklettern! Hofft man ein bequem gelegenes Wieslein oder Äckerlein für sein hart erspartes Geld zu erwerben, so ist schon ein Gotteshaus da, unten, oben, hinten, vorn am Berge, das es nimmt, und man muss es sich noch zur Ehre anrechnen, wenn der bescheidene Mann als Zeuge zugelassen wird!«
»Ruf deine Wirtin herbei«, sagte der Magister lachend, »dass sie dem Kinde hier etwas Milch gibt! Es ist erhitzt und durstig. Oder eher wollen wir einen Augenblick ins Haus gehen, denn ihr Landbebauer kennt ja nicht die höfische Freude, im grünen Klee und unter Blumen zu sitzen, wenn ihr tafelt!«
Der Mann vom Hadelaub schüttelte die Späne von seinem starken Lederschurz, indem er leicht die Stirne runzelte; er liebte nicht, sich gelegentlich, im Gegensatze zu den Herrensitten, gewissermaßen als bäuerisch hingestellt zu sehen. Schon sein sorgfältig rasiertes Gesicht, das nur von einem Kranzbart eingerahmt war, und das halblange Haupthaar bewiesen, dass er als Freier sich zur guten Gesellschaft zählte und nicht mit einem ungeschorenen Hörigen oder Leibeigenen verwechselt werden wollte. Denn die Sitte hatte in diesem Stücke, wie noch in manchem, sich geändert. Geschoren waren jetzt die Herren und langhaarig die Knechte, und nur die Apostel und Könige dachte man sich langbärtig.
»Wenn es höfisch ist, im Freien zu speisen«, sagte er, »so leben wir hier bei Hofe, da wir in Sommertagen hinter dem Hause am Schatten essen. Dort mag auch Euer Mägdlein die Milch trinken, Ihr selbst aber einen Schluck dauerhaften alten Mostes von Holzbirnen, den Ihr kennt.«
»Er ist kühlend und nicht ohne Würze«, erwiderte der Kantor; »kommst du mit deinem Weib nächstens einmal zum Münster, so werde ich euch dafür ein Becherlein welschen Weines vorsetzen, den mir ein sangliebender Herr gebracht hat.«
Sie begaben sich demnach auf die Rückseite des Hofes, wo in der Tat ein uralter Steintisch unter den Bäumen stand, welche vom tiefen Bachtobel heraufstiegen und kühlen Schatten verbreiteten. Nebeneinander gelegte und mit Kies und Rasen bedeckte Baumstämme bildeten eine fahrbare Brücke in den Wald hinüber. An einem laufenden Brunnen wirtschaftete Rudolfs Eheweib, Frau Richenza. Sie war kaum zwei Zoll kürzer als ihr Mann, sodass man erst jetzt, als das Paar beieinander stand, den hohen Wuchs derselben recht gewahrte. Ihr Haar war an Stirne und Schläfen straff zurückgestrichen und hinten in einen starken Zopf gebunden, wie es arbeitende Frauen nötig haben. Auch das Kleid war etwas kürzer, als es bei Leuten freien Standes damals zu sein pflegte, was ihr, mit ihren raschen Bewegungen verbunden, ein rüstiges Ansehen verlieh, das wiederum durch einen gewissen alemannischen Liebreiz des hellen Gesichtes gemildert wurde.
Richenza schüttelte dem Geistlichen und dem Kinde treuherzig die Hand und brachte bald die Milch sowohl als den gelben klaren Most herbei, nebst kräftigem Roggenbrot, während der Mann selbst ebenfalls ins Haus ging und von den geräucherten Vorräten über dem Herde, worüber die Verfügung ihm vorbehalten war, langsam und bedächtig eine Wurst herunterschnitt. Denn ihm stand zu, zu ermessen, wie auf dem Heerzuge des Lebens die köstlichere Speise abzuteilen war, dass der Vorrat langte und niemals Mangel, Schuldbedrängnis und Verpflichtungen eintraten, die von allen Seiten feindlich lauerten.
Nicht lange saß nun die kleine Gesellschaft an dem steinernen Tische, als aus dem Walde drüben heller Gesang eines Kindes schallte und bald eine kleine Herde von Kühen erschien, welche von dem zehnjährigen Knaben des Bauern von der Weide heim und über die Brücke geleitet wurde. Nur mit einem langen blauen Leinenrocke bekleidet, barfuß, von reichem, blondem Goldhaar Gesicht und Schultern umwallt, ein hohes Schilfrohr in Händen tragend, gab das Kind mit den Tieren ein ungewöhnlich anmutiges Bild, welches zudem samt dem Waldesgrün vom Lichte der Abendsonne gestreift war, soweit sie durch die Belaubung dringen mochte. Mit Wohlgefallen folgten Konrads Augen der Erscheinung, bis der unbekümmert weiter singende und sich kaum umsehende Knabe die Kühe in den Stall gebracht hatte und nun zum Tische kam, um sein Abendbrot zu empfangen. Er gab dem alten Herrn ungeheißen die Hand; dann aber legte er erstaunt die Hände auf den Rücken und betrachtete unverwandt das Mägdlein Fides, welches eben sein Milchbecken am Munde hielt und darüber hinweg seine Äuglein gehen ließ. Einen Augenblick setzte es ab und sagte: »Du dummer Bub!« worauf es fertig trank und den Mund wischte.
Er schlug beschämt die Augen nieder und wendete sich seitwärts mit zuckendem Munde; denn eine so unhöfliche Anrede war ihm in seinem kurzen Leben noch nie zuteil geworden. Als nun aber Frau Richenza den Knaben an sich zog und beschwichtigte und der Kantor dem Mädchen seine Unart verwies, fing dieses seinerseits an zu weinen, sodass die Frau auch hier einschreiten und besänftigen musste.
»Sieh, Johannes«, sagte sie zum Knaben, »das Schäppelein des Dämchens ist fast verwelkt, geh mit ihm an den Bach hinunter, wo die vielen Blaublümel stehen, und holet zusammen zu einem frischen Kranze, aber kommt bald wieder, eh’ es zu kühl wird!«
Das Blumenkränzchen, womit das fliegende Haar des Herrenkindes geziert war, befand sich wirklich nicht mehr in bestem Zustande, und es wurde das Vornehmen auch von dem Kantor gebilligt. Die Kinder gingen also, leidlich versöhnt, den schmalen Pfad hinunter, wo der Wolfbach heute noch sich durch Steinblöcke von allen Farben, unterwaschene Baumwurzeln und andere Geheimnisse drängt, kleine Wasserfälle und hundert kleine Theater von Merkwürdigkeiten bildet. Sie gelangten auch bald an eine Stelle, wo das Bord länger von der Sonne beschienen und daher fast immer mit blühenden Pflanzen bedeckt war. Besonders von Vergissmeinnicht erschien alles blau, aber auch weiße Sternchen und rote Glöckchen gab’s darunter, in jenem blumenliebenden Zeitalter eine Augenfreude nicht nur für Kinder.
Die kleine Fides machte sich auch gleich darüber her und band mit Behändigkeit einen Kranz, zu welchem Johannes ihr kaum genug Blumen reichen konnte, je nach Auswahl und Befehl. Ring und Faden hierzu nahm sie vom alten Kranz und ließ die Überreste desselben den Bach hinabschwimmen. Nachdem sie die neue Zierde aufgesetzt, sah sie sich im weiteren um und fing an, auf den Steinen herumzuspringen, welche aus dem rinnenden Wasser hervorragten, bis sie auf einen kam, wo sie nicht mehr fort konnte, ohne durch das Wasser zu gehen. Das war aber wegen der feinen Schuhe und des Kleides untunlich; nach kurzem Besinnen befahl sie dem Knaben, der ihr nachgesprungen war und ratlos bei ihr auf dem Steine stand, sie ans Ufer zu tragen. Er glitt auch sofort ins Wasser und trug das angehende Frauenwesen auf dem Arme und mit schwerer Mühe über die eckigen und runden Bachsteine, indessen sie sich an seinem Halse hielt, aufs Trockene.
Inzwischen rückte Meister Konrad von Mure dem Ziele seines heutigen Ausganges näher. Er hatte, seit längerer Zeit mit den Leuten am Hadlaub in guter Freundschaft lebend, die zarte, aber auch aufgeweckte und gelehrige Beschaffenheit des Knaben Johannes bemerkt und wünschte denselben zu sich zu nehmen, um ihn zunächst zu einem Schreiberlein und Schüler heranzubilden, dessen er zu allerlei Aushilfe ermangelte, dann aber auch einem besseren Lebenslose entgegenzuführen, als er ihm auf dieser Berghöhe beschieden wähnte. Er begann daher von dem Singen des Knaben zu sprechen, wie er allerhand Singspiel in Worten und Weisen richtig aufgefasst und, wenn auch nur stückweise, innehabe, ohne dass man wisse, wie es zugehe. Dann brachte er allmählich sein Anliegen vor, fand aber keine Zustimmung beim Vater. Der unterbrach ihn, als er im besten Zuge war, und sagte: »Lieber Herr! Wir wollen hierin nicht weitergehen! Statt eines ehrlichen Christennamens, wie sie auf diesem Berge und rings im Lande altherkömmlich sind, Heinz, Kunz, Götz, Siz, Frick, Gyr, Ruoff, Ruegg, hat man dem Buben einen von den neumodischen Pfaffennamen verschafft, Johannes, ohne dass ich weiß, wie es eigentlich gekommen ist. Aber weiter soll es nun mit dem Pfaffwerden nicht gehen. Es ist mein einziges Kind. Seit unvordenklicher Zeit haben sich meine Väter auf der hiesigen Hofstatt gehalten; ich will mir nicht vorstellen, dass das durch meine Schuld anders werden soll und keiner der Meinigen mehr seinen Pflug hier führe, sein Vieh hier weide und von hier aus mit Schild und Speer zum Heerbann niedersteige.«
»Ei, was die ehrlichen Christennamen betrifft«, antwortete ihm der Alte lächelnd, »so seid Ihr nicht gut berichtet! Ihr habt als solche lauter wilde alte Heidennamen genannt, Euren und meinen nicht ausgeschlossen. Wisst Ihr, wie Euer Name Rudolf sich ehemals geschrieben hat? Hruodwolf, lupus gloriosus, ein berühmter Wolf, ein Hauptwolf, ein Wolf der Wölfe! Schönes Christentum! Wie heilig klingt dagegen das biblische Johannes, sei es nun der Täufer, oder der Lieblingsjünger des Heilands, oder der Evangelist!«
Soeben kamen nun die beiden Kinder an, und der Kantor zog gleich den Knaben herbei, ergriff dessen Hände und rief: »Seht, Kapitan aller Wölfe, sind diese schmalen Händchen diejenigen eines Pflugführers und Speerträgers? Oder nicht vielmehr diejenigen eines Pfaffen oder Magisters? Eines sanften gelehrten Johannes? Merkt Ihr denn nicht die Weisheit der guten Mutter Natur, die aus so reisigem Volk von Zeit zu Zeit selber ein zarteres Pflänzlein schafft, aus dem ein Lehrer oder Priester werden mag, wo Ihr sonst bei aller Stärke in Unwissenheit und Sünde verderben müsstet? Übrigens ist gar nicht gesagt, dass er durchaus geistlich werden soll; ich bin zufrieden, wenn er nur vorerst etwas lernt und die Zeit nicht verlorengeht!«
»Willst du in die Schule gehen zu den Herren am Münster?« sagte nun die Mutter zu dem Knaben, welcher verwundert alle der Reihe nach ansah.
»Willst du schöne Bücher schreiben und malen lernen mit Gold und bunten Farben, Lieder singen und die Fiedel spielen«, sagte der Singmeister, »schöne Mailieder, kluge Sprüche und das Michaelslied: O heros invincibilis dux – oder wie hast du heut gesungen?«
»O Herr, o Vizibilidux! heißt es«, rief Johannes eifrig, und lachend fragte Konrad, wer ihn das gelehrt habe?
»Der Bruder Radpert im Klösterlein«, versetzte jener selbstzufrieden.
»Das ist ein uralter Mönch bei den Augustinerbrüdern dort hinter den Eichen, der einst als Kriegsmann noch den Heerzug ins Heilige Land mitgemacht hat und dem Kinde zu erzählen pflegt, wie sie das Lied immer gesungen, wenn es in den Streit ging.«
Dies bemerkte die Frau Richenza; Rudolf, ihr Mann, aber sagte jetzt zu dem Knaben: »Nun, was ziehst du nun vor? Willst du bei den Mönchen in der Schule sitzen und eine Glatze tragen, oder willst du hier oben in der freien Luft bleiben und ein wehrhafter Geselle werden?«
Johannes begriff den Sinn der Unterhaltung nur etwa zur Hälfte; er sah sich nochmals um und vermutete zuletzt, dass es sich um eine Schule handle, in welcher solche kleine Dämchen saßen, wie der Chorherr eines zur Probe mitgebracht habe, und da dieses ihm gefiel, so erklärte er, er wolle in die Schule gehen.
»Genug«, rief der Vater in strengerem Tone, »wir wollen mit solcher Sache nicht länger spielen! Geh hinein, Johannes, und hole das Horn, dass wir die Knechte und Dirnen heimrufen!«
Der Chorherr merkte, dass er jetzt nichts weiter ausrichten werde, nahm, da die Sonne sich zum Untergange neigte, Abschied und begab sich auf den Heimweg. Gleichzeitig kamen ein alter und ein junger Knecht mit Ochsen und Eggen in raschem Laufe auf der Hofstatt an, mit lautem Geschrei und Heio, Menschen und Tiere gleich ungeduldig. Während hierdurch die Aufmerksamkeit des Meisters in Anspruch genommen wurde, benutzte Johannes die Gelegenheit, vom Hofe zu entfliehen und dem Kantor und dem Mädchen den Berg hinunter nachzulaufen. Da er barfuß war, so hörten sie ihn nicht. Wenn Herr Konrad einen Augenblick stillstand, um auszuruhen und zu husten, so hielt Johannes in einiger Entfernung ebenfalls an und blieb schüchtern stehen, und wenn sie weitergingen, so lief er wieder hinter ihnen drein. Bei einem solchen Halt entdeckte ihn die zurückschauende Fides; aber sie sah ihn jetzt wieder so stolz und fremd an und schien nicht einmal den alten Herrn von seiner Nachfolge in Kenntnis zu setzen, sodass er verschüchtert zurückblieb und ihnen traurig nachblickte, bis sie in den Abendschatten verschwanden. Dann lief er voll Furcht, teils vor den Folgen seines Ungehorsams, teils vor den Geheimnissen der hereinbrechenden Nacht, eilig zurück, bis ihn die Mutter, die ihn bereits suchte, empfing und unbemerkt ins Haus brachte und auf seinem Lager versorgte, dem Anerbieten des ehrwürdigen Kapitelsmannes mütterlich nachsinnend.
Als sie nach Jahr und Tag ihrem Eheherrn einen zweiten Sohn schenkte, ein Knäblein, das auffallend groß und kräftig war, wurde Rudolf am Hadelaub anderen Sinnes und der Wunsch des Singmeisters der Propstei Zürich erfüllt.
*
Nach ungefähr acht Jahren finden wir den Johannes Hadlaub, wie er jetzt genannt wurde, als blondgelockten feinen Jüngling unermüdlich bei allerhand gelehrter Arbeit. Konrad von Mure hatte ihn unter seine ganz besondere Obhut genommen und zu allererst so schnell schreiben und lesen gelehrt, wie ein Kriegsmann seinen Knaben reiten und fechten. Gleichzeitig mit dieser Übung und durch dieselbe musste er die Sprache deutsch und lateinisch verstehen lernen, denn der Meister gönnte ihm nicht so viel Zeit hierzu, wie den Pfaffen- und Herrenknaben der Stiftsschule. Nach Brauch und Art des Handwerks musste er so bald als möglich Nützliches hervorbringen, was an seiner Stelle in sauberer und genauer Abschrift bestand; den Inhalt aus den vertrauten Worten des Alten gewissermaßen im Fluge verstehen zu lernen, musste er sich still und aufmerksam angewöhnen. Mit der Zeit mochte er dann sehen, was er weiter aus sich machte, wenn er ein wirklicher Gelehrter und Theolog werden wollte. Inzwischen musste er nicht nur Noten und Worte der Kirchenmusik schreiben, sondern auch die Reimwerke Konrads, seine mythologischen, geografischen, naturkundlichen und historischen Traktate fleißig kopieren, bis sein Taufgevatter Johannes Manesse, der Kustos und Scholaster der Propstei Zürich, der Sohn des Herrn Rüdiger, hinter die Sache kam und der flinken und zierlichen Hand des Knaben gewahr wurde. Der zögerte nicht lange, sondern ließ sich von ihm alle die alten und neuen Minnelieder und Rittergedichte abschreiben, deren er habhaft werden konnte in seinem weltlichen Sinne, und Konrad von Mure machte sich eifrig herbei und wachte darüber, dass sie richtig in Ton und Maß geschrieben und vorhandene Fehler ausgemerzt wurden. Hierdurch erlangte der junge Hadlauber, gelehrig und stets munter, eine neue Kenntnis und Übung.
Einige Verzierung der Schrift mit schönfarbigen Tinten gehörte an sich schon zum klösterlichen Schreibewerk; allein hierbei blieb er nicht stehen, sondern suchte bei naiven Bildkünstlern jener Zeit, wie sie etwa in den Bauhütten der beiden Münster zu treffen waren, so viel Erfahrung abzulauschen, als zur Bemalung eines halben oder ganzen Pergamentblattes erforderlich war.
Seit mehreren Jahren war nun der greise Kantor und Stiftsherr von Mure tot, Johannes Hadlaub aber an der Singschule und Bücherei beschäftigt geblieben, ohne sich für den Stand der Geistlichkeit bereit zu machen. Sein Vater schien hiermit zufrieden, obgleich sein zweitgeborener Sohn kräftig heranwuchs und ebenso groß und stark zu werden versprach, wie er selbst. Wenn Johannes ein geschäftskundiger weltlicher Bürgersmann in der Stadt würde, so war ihm das auch recht, und jener begann in der Tat von verschiedenen Herren bei ihren Verhandlungen als Schreiber benutzt zu werden; besonders war es der jüngere Leuthold, Freiherr von Regensberg, der seine Dienste andauernd in Anspruch nahm bei Ordnung seiner schwankenden Verhältnisse.
Noch näher trat er in der Folge dem älteren Manesse, Herrn Rüdiger, als dessen Sohn, der »Küster«, ihn eines Tages aufforderte, schleunig seine Fiedel zu nehmen und mit ihm auf den Hof des Manesse zu kommen.
Johannes ergriff freudig errötend augenblicklich die Geige und schritt mit dem Chorherrn gar stattlich die Kirchgasse, so jetzt Römergasse heißt, hinauf. Freundlich nickte der goldgelockte Jüngling an der Seite des Chorherrn Bekannten zu, welche in den volkreichen Gassen vorübergingen, und er wurde von jedermann ebenso freundlich wieder gegrüßt, weil er eine liebenswürdige Erscheinung war. In einen faltigen Rock gekleidet, der sich in breite, weiße und blaue Querstreifen teilte und fast bis auf die Füße ging, trug er ein purpurrotes Barett, besteckt mit einem weißen Tuche, das Nacken und Schultern deckte.
Bald gelangten sie zu der Behausung der Herren Maneß; erregt blickte Johannes an das steinerne Haus empor, welches damals an dem Turme lehnte und das Wohnhaus war. Im zweiten Stock war die Mauer unterbrochen von einer Rundbogenstellung auf zierlichen Säulen, hinter welchen der Saal sich befand, überragt von den Eichenbalken des Daches. Das Erdgeschoss zeigte ein paar Fenster mit ebenfalls verzierten Rundbogen, daneben aber hauptsächlich ein großes Einfahrtstor, das unter dem Hause durch in den Hof führte zu verschiedenen Aufgängen und Treppen. Unter dem Torbogen waren die Steinstufen angebracht, von welchen die Frauen zu Pferde stiegen, wenn sie ausritten. Eine jener steinernen Schneckenstiegen, deren Tritte uns jetzt, wo sie noch erhalten sind, so hoch und beschwerlich vorkommen, führte zum Saal hinauf.
Als Johannes Hadlaub mit seinem Führer in die Türe desselben trat, verließ ihn plötzlich sein frischer Mut. Er war nicht auf die ansehnliche Gesellschaft gefasst, die da um einen großen Tisch herum in Lehnstühlen oder auf kissenbedeckten Schemeln saß.
Da war vor allem Bischof Heinrich von Konstanz, ein schöner Mann mit dunklen Augen und Haar, mit ernsten, aber geistvollen Gesichtszügen; mit der beringten Hand hielt er die Hand der Fürstäbtissin von Zürich, die in weltlicher Damentracht neben ihm saß, eine still vorübergehende Erscheinung, die nur im Lichte jener Augen aufblühte. Zu seiner anderen Seite saß die Hausfrau des Ritters, von dem ebenfalls alt eingewohnten Stamme der Wolfleipsch, gleich neben ihr eine andere Konventualin der Abtei, Frau Elisabeth von Wetzikon, Muhme des Bischofs, die später die bedeutendste Äbtissin wurde, diese auch in weltlicher Tracht. Neben ihr saß der Toggenburger Graf Friedrich, Nachkomme des Minnesingers Kraft von Toggenburg, dann der Herr von Trostberg, Enkel des Sängers gleichen Namens, dann Herr Jakob von Wart, endlich Herr Rüdiger selbst mit ergrauten Locken, aber blühendem Antlitz, in pelzverbrämtem Rocke. Einige Sitze waren leer, da die junge Fides aufgestanden war und mit zwei anderen Frauen im Hintergrunde des Saales auf und nieder ging.
Auf dem Tische standen Blumen und Früchte, Gebäcke und silberne Schalen mit südlichem Weine, dazwischen aber kleine Pergamentbüchlein, größere Hefte und schmale, lange aufgerollte Streifen von gleichem Stoffe, alles dies mit Reimstrophen beschrieben, gedrängt und endlos wie Heerzüge der Völkerwanderung.
Der Hausherr erhob sich und empfing seinen Sohn samt dessen Begleiter.
»Hast du uns den jungen Spielmann mitgebracht?« fragte er. »Das ist gut, denn wir haben durch die Gunst dieser Herren einige neue Sachen erjagt und möchten dieses und jenes gerne singen hören; aber niemand singt, als der hochwürdigste Fürst Heinrich, und der will nicht mehr, seit er Bischof ist! Da hat uns Graf Friedrich noch einige Lieder seines Großvaters gebracht, die wir nicht besessen; Freund Trostberg nicht weniger als zwei Dutzend Gesänge seines würdigen Vorfahren und hier Baron Jakobus von der Wartburg, rate einmal! sein eigenes Jugendbüchlein, das er uns so lange hinterhalten, achtzehn Lieder, ich hab’s schon gezählt! Aber auch er will nicht mehr singen!«
»Wenn ich nicht mehr singen darf«, nahm jetzt der Bischof das Wort, »so habe ich dafür Buße gebracht, nämlich die Lieder des edlen und ritterlichen Herzogen von Breslau, meines schönen und guten Heinrich! Leider zugleich mit der Nachricht, dass der Treffliche unverhofft und in jungen Jahren Todes verblichen ist, eine Kunde, die mich tief betrübt hat!«
Er zog eine kleine Liederrolle aus seinem Gewande, durchmusterte sie und fuhr fort:
»Hier ist eines der anmutvollsten Lieder, die wir von dem seligen Manne haben, könnte uns der wackere Knabe das wohl vortragen?«
Er winkte Johannes herbei, gab ihm das Lied zu lesen und unterrichtete ihn in halblauten Tönen rasch in der Weise, die jener bald begriff. Johannes legte hierauf die viersaitige Geige flach vor seine Brust und sang das Lied, indem er die Weise eine Terz tiefer dazu spielte und nur jeweilig mit den zwei vorletzten Noten einer Zeile harmonierend ausbog. Es war das Lied:
Dir klag’ ich, Mai, ich klag’ dir’s, Sommerwonne, Dir klag’ ich, leuchtende Heide weit, Ich klage dir’s, o blühender Klee, Ich klag’ dir, Wald, ich klag’ dir, Sonne, Dir klag’ ich, Venus, sehnendes Leid, Dass mir die Liebste tut so weh!
und so weiter, wie von den angerufenen Richtern jeder seine Strafe verheißt, der Ankläger aber schließlich seine Klage zurückzieht und lieber sterben will, als dass solches Ungemach die Schöne treffe.
Der Gesang war aus der frischen Kehle des frohen unschuldigen Jünglings so wohltönend hervorgequollen, dass alle davon ergriffen und gerührt waren, zumal die Nachricht von dem frühen Ende des Dichters die Gemüter schon weicher gestimmt hatte. Der Bischof aber bereinigte sofort mit dem Johannes und Herrn Rüdiger, der eifrig hinzutrat, den Text, in welchem sich durch den gesanglichen Vortrag einige offenbare Unrichtigkeiten in der Silbenzählung bemerklich gemacht hatten.
Jetzt sprang aber der von Wart auf, der sein eigenes Büchlein vom Tisch genommen hatte, und rief: »Nur das erste beste von meinen schwachen Gesätzlein möchte ich nochmals von dem Munde dieses Knaben hören.« Er zeigte ihm eines der Liedchen, und Johannes spielte und sang:
Voll Schönheit wie der Morgenstern Ist meine Fraue, der ich gern Für jetzt und immer dienen will! Wie wenig sie mir Trost gewähre: Ich wünsche, dass sie Glück und Ehre Begleiten an der Freuden Ziel! Ihre Güte und Bescheidenheit Sind leider gegen mich entschlafen; Doch muss ich sie drum tadelnd strafen, Ist eben dies mein schweres Herzeleid!
Indessen hatte der Bischof die Lieder des älteren Trostberg durchgangen, erhob sich unversehens, nahm von dem jungen Spielmann die Fiedel an sich und sang und spielte mit schönen korrekten Tönen:
Rosenblühend ist das Lachen Der viel lieben Frauen mein, Wie konnt’ er solch Wunder machen, Der ihr gab so lichten Schein? Sie ist meines Herzens Osterspiel, Des Herzens, das sie niemals lassen will!