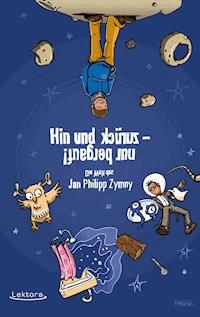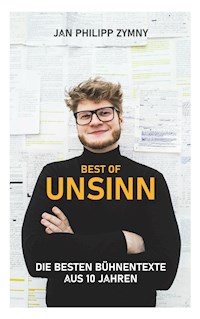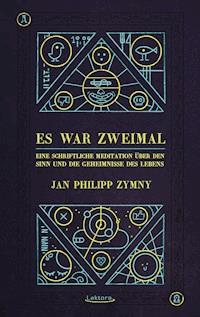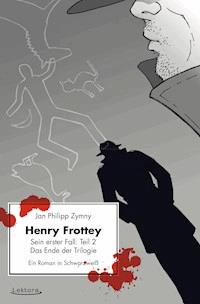Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lektora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Etwas packt mich am Kragen, dann werde ich aus dem Laden geschleift. Ein letztes Aufbäumen, ein Blick in Zugrichtung offenbart ein blaues Huhn. Ich weiß, dass es nicht wirklich existiert. Und außerdem heißt es Milton." Sein neuer Roman "Grüß mir die Sonne!" zeigt Jan Philipp Zymny in Bestform: wortgewaltig wie immer, mit zahlreichen aberwitzigen und überraschenden Wendungen - und dieses Mal zudem literarisch äußerst sensibel. Ein sehr persönliches Buch mit viel Witz und einer tiefen Bedeutungsebene. Die Geschichte um einen von der Realität über alle Maßen irritierten Außenseiter wirft einen ehrlichen Blick auf Wahn und Wirklichkeit, um für sich einen echten Platz zu finde, wo es sich zu bleiben lohnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jan Philipp Zymny
»Grüß mir die Sonne!«
Erste Auflage 2017
Alle Rechte vorbehalten
Copyright 2017 by
Lektora GmbH
Karlstraße 56
33098 Paderborn
Tel.: 05251 6886809
Fax: 05251 6886815
www.lektora.de
Covermotiv: Olivier Kleine, olivierkleine.de
Covermontage: Olivier Kleine, olivierkleine.de
Lektorat: Lektora GmbH
Layout Inhalt: Lektora GmbH
eISBN: 978-3-95461-114-0
Inhalt
Kapitel 1 – Atem
Kapitel 2 – Die zweite Dimension
Kapitel 3 – Milton kommt
Kapitel 4 – Vögel im Kopf
Kapitel 5 – Freiheit
Kapitel 6 – Der Übergang
Kapitel 7 – Eine Aufgabe
Kapitel 8 – Geborgenheit
Kapitel 9 – Kreativität
Kapitel 10 – Ein Gott
Kapitel 11 – Der Fährmann
Kapitel 12 – Sonnenaufgang Reprise
Kapitel 1
Atem
Geburt. Erziehung. Schule. Arbeit. Rente. Schrebergarten, Schrebergarten, Schrebergarten. Tod.
Es muss nicht komplizierter sein. Oft ist es das auch nicht. Zum Glück. Denn wenn ich ehrlich bin, beschleicht mich immer wieder das selbe Gefühl, sobald das Leben über dieses Minimum hinauseskaliert:
Wie bitte? Was wird von mir erwartet? Ich soll regelmäßig Sport treiben, mich gesund ernähren und gleichzeitig ein sechsmonatiges Praktikum im Ausland absolvieren? Aha. Jetzt so ein richtig schöner Autounfall. Und dann geil ein halbes Jahr im Koma intravenöse Kost, nur im Bett liegen.
Da sich jedoch diese ohnehin schon geringwahrscheinliche Möglichkeit speziell in Gebäuden oder allgemein abseits von Straßen als geradezu verschwindend erweist, versuche ich, mir anzugewöhnen, in schwierigen Situationen einfach einzuschlafen. Als Schutzmechanismus. Bevor mir die Festplatte durchschmort, fahre ich sie lieber runter. Ich nenne das Vermeidungsnarkolepsie und es funktioniert nicht sonderlich gut.
Allerdings vermute ich, dass sich hier ein grundlegendes Motiv abzeichnet. Ich reagiere allergisch auf die Wirklichkeit. Sie verursacht mir Kopfschmerzen, lässt meine Augen tränen und schnürt mir die Kehle zu, bis ich kaum noch Luft bekomme.
Vor dem Badezimmerspiegel komme ich zu mir. Falsch. Vor dem Badezimmerspiegel komme ich zu meinem Körper. Ich war anderswo. Meinem war schon hier. Vor dem Badezimmerspiegel sind Körper und Bewusstsein plötzlich wieder kongruent.
Das sich aus dem Netz speisende elektromagnetische Feld, das an den beiden Polen an den Enden der Leuchtstoffröhre anliegt, ionisiert das enthaltene Gas. Unablässig fallen dort angeregte Elektronen auf niedrigere Energielevel zurück, wobei sie die Differenzenergie in Form von Lichtquanten abgeben. In alle Richtungen fortgeschleudert und unfähig, sich zu entscheiden, ob sie Welle oder Teilchen sein möchten, trifft ein Teil dieser Lichtquanten auf die stark fluktuierende Anzahl verschiedenster Atome, die ich meinen Körper nenne. Ein loser Verbund – eher durch die Bezeichnung »mein Körper« als durch sonst irgendwas zusammengehalten.
Einige Wellenlängen des Lichts werden von meiner Haut aus dem sichtbaren Abschnitt des Spektrums absorbiert, einige werden reflektiert. Von Letzteren trifft ein Anteil in einem derart günstigen Winkel auf den Spiegel, dass sie in meine Augen fallen. Durch die Pupille auf die Netzhaut, wo die Photorezeptoren den Reiz in ein bioelektrisches Signal umwandeln (man könnte an dieser Stelle kurz auf die Idee kommen, dass es ökonomischer wäre, sich die Anschlusskabel der Leuchtstoffröhre direkt in die Augen zu stecken – langfristig betrachtet mag das sogar stimmen –, ich rate allerdings trotzdem davon ab), der sich über den Sehnerv ins Gehirn fortpflanzt und einige Areale so stimuliert, dass in meinem Bewusstsein ankommt: »Hallo! Hallo! Hallo! Es gibt was zu gucken.«
Die Konsequenz aus all dem ist Folgendes: Ich schaue meinen Körper im Spiegel an. Die schiere Langweiligkeit dieses Geschehens entwürdigt seine Komplexität.
Und so verhält es sich meistens. Die komplexesten Fragen sind die langweiligsten. Kaum jemand interessiert sich für die Implikationen des Interferenzmusters eines quantenmechanischen Doppelspaltexperiments. Es sind die einfachen Fragen, die wir spannend finden, wie: »Gehen Prominente noch selbst in den Supermarkt?«, »Ob Nathalie aus der Buchhaltung mich wohl auch mag?« oder »Warum bin ich hier?«.
Die meisten Menschen würden jubilierend mit bösartiger, kindlicher Freude die ausgefuchstesten Experimente zertrampeln, wenn man ihnen dafür verriete, wo es gratis Schnitzel gibt.
Ich schaue meinen Körper im Spiegel an, aber das Bild stimmt nicht. Wenn ich es mit dem vergleiche, an das ich mich erinnere, kommen mir allerhand Fragen auf.
Bin das wirklich ich?
War mein Gesicht nicht anders?
Gibt es einen Unterschied zwischen dem, was ich hier sehe und was Dritte sehen, wenn sie mich anschauen?
Hatte ich nicht mehr Arme? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mehr Arme hatte. Wenigstens vier oder fünf. Ich meine, nur zwei? Das ist eindeutig zu wenig. Wie soll ich all meine Aufgaben und Erledigungen besorgen mit so wenig Armen? Vielleicht läuft hier ein Armdieb frei herum. Vielleicht verarbeitet er die Arme zu Schrumpfarmen und verkauft sie als Finger.
Wenn ich lang genug in den Spiegel starre, beginnt eine leichte Dissoziation. In so einem Moment entwickelt sich der bloße Gedanke »Bin das wirklich ich?« in das Gefühl, tatsächlich einer anderen Person in die Augen zu sehen. Wobei, was heißt in die Augen? Es ist physikalisch nicht möglich, sich in einem Spiegel exakt in die Augen zu blicken.
Diesmal ist es anders. Während ich noch über Schrumpfarme nachdenke, sieht der andere mir direkt in die Augen, dann ruckt die Welt abrupt aus ihren Angeln. Von einer Sekunde zur nächsten kommen die Wände näher. Oder verkleinert sich nur mein Blickfeld?
Ich bin gefangen. Mein Herz prügelt gegen meine Rippen, was ich bis in meine Ohren spüren kann. Kalter Schweiß sprießt auf meiner Stirn. Da lässt sich plötzlich ein tonnenschweres, verwesendes Ungeheuer auf meine Brust fallen und schmettert mich zu Boden. Ich kann nicht atmen. Panik sickert in mich hinein und erfüllt meine schwache, winzig kleine Gestalt auf dem Fußboden. Das ist es. Ich werde sterben. Hier und jetzt. Daran besteht absolut kein Zweifel. Mir bleibt nur noch die Wahl, zu ersticken oder dass mein Herz explodiert. Ich bin schon tot, mir wird nur noch die grausame Gnade zuteil, zu beobachten, welches Ende es ist. Das verwesende Ungeheuer starrt mich grinsend zwischen seinen Knien hindurch an.
Nein. Das ist doch Unsinn. Nicht so, nicht hier. Ich muss mich einfach nur wieder zusammenreißen. Ich bin gesund, ich wurde nicht vergiftet und es ist nichts passiert. All das spielt sich nur in meinem Kopf ab. Die Auswirkungen auf meinen Körper sind rein psychosomatisch. Wenn ich aufhöre, mich da reinzusteigern, dann geht das auch weg.
Hör auf, so beschissen zu grinsen! Ich schlag dir in deine dumme Fresse! Es ist so leicht, auszuholen und dein fauliges Gesicht zu zertrümmern, du abartiges Scheißding! Ich schwöre, sobald ich mich wieder bewegen kann, prügle ich solange auf deine stinkende Visage ein, bis ihre blutigen Fetzen zusammen mit den blutigen Fetzen meiner Fäuste und den Fliesen eine einzige verfickte blutige Masse ergeben. Geh runter von mir! Wenn ich mit dir fertig bin und dann immer noch sterbe, dann boxe ich auch noch den Tod kaputt! Ist mir alles egal! Ich lass ihn seine eigene Sense schlucken und hassficke ihn bis zur Besinnungslosigkeit! Lass. Mich. Gehen.
Um mich herum karusseliert der Raum gnadenlos weiter. Nur der flauschige Badezimmerteppich gibt mir Halt. Wenn ich doch nur zwischen seinen Zotteln zerfließen könnte, mich komplett auflösen würde. Auflösen, anstatt zu sterben. Eins werden mit der Welt, anstatt einfach auszuscheiden. Bitte, bitte, bitte! Lass mich jetzt nicht hier verrecken! Bitte! Völlig egal, wer grade zuhört. Mein Körper. Gott. Ich mach alles. Ich fange an, mich tatsächlich gesund zu ernähren oder Sport zu machen oder in die Kirche zu gehen oder zu meditieren. Alles. Nur bitte, bitte, bitte, erlöse mich endlich jemand aus dieser Lage!
Es hat keinen Zweck. Mein Körper gehorcht mir nicht und Gott hat sich noch nie für mich interessiert. Warum kämpfe ich überhaupt dagegen an? Ein sinnloser Tod wie dieser passt gut in den sinnlosen Rest des Universums.
Folge mir in die Leere. In das allumfassende, altbekannte, freundliche Nichts. Ich nehme das Universum an der Hand, gemeinsam rodeln wir in den Abgrund. Hab ich eigentlich gerade wirklich gedacht, dass ich den Tod hassficken möchte …? Was ist denn los mit mir?
Ich sterbe. Gar kein Zweifel. Warum auch nicht? Die Information, dass ich irgendwann sterben muss, ist schließlich kein obskures Geheimwissen. Warum also nicht jetzt und hier auf dem Fußboden? Das »Irgendwann« ist das Irreführende an dieser banalen Erkenntnis. »Irgendwann« wiegt dich in der Sicherheit des Ungewissen. »Irgendwann« bedeutet größtenteils später – meistens sogar viel später, denn »Jetzt« ist nur ein winziger Moment im Verhältnis zu der restlichen Zeit, die mir noch zur Verfügung stehen könnte. Diese Unverhältnismäßigkeit macht »Jetzt« unwahrscheinlich. Die Wahrheit ist: Ich muss sterben und habe keine Ahnung, wann genau. Jetzt ist genauso gut wie jede andere Sekunde. Dabei handelt es sich nicht um Betrug. Der Fehler liegt ja in meinem Denken. Ich bin selber schuld, dass ich mir falsche Hoffnungen mache. Geschieht mir recht.
Und so sieht also mein Ende aus. Auf der Erde liegend erstickt, während mein Herz explodiert. Na gut. Tschüss für immer.
Aber woran eigentlich? Woran sterbe ich? Bis gerade eben hat das doch wunderbar funktioniert, Luft in die Lunge zu pumpen und danach wieder herauszupressen. Dieser Prozess läuft sonst sogar unterbewusst ab. Folglich muss ich atmen. Schlimmstenfalls werde ich kurz ohnmächtig und dann übernimmt mein Stammhirn. Autopilot. Mit normalisierter Atmung reguliert sich auch der Herzschlag, was dann die Panik abnehmen lassen wird. Ich muss meinen Tod nicht akzeptieren, ich muss einfach nur loslassen, meinen Körper wieder die Kontrolle übernehmen lassen, Vertrauen haben, dann stabilisiert sich alles selbst.
Langsam – Muskelstrang für Muskelstrang – erhebt sich das grinsende, verwesende Ungeheuer von meiner Brust, verschwindet im Zwielicht des Flurs und ich bin frei. Ich werde durch mich aufgestanden und zur Arbeit gegangen.
Meine Umwelt lügt mich an. Meine Sinne lügen mich an. Mein Verstand lügt mich an. Dem gegenüber steht ein unsicherer, flackernder Kern Selbst, der aus den binären Erkenntnissen meiner Denkmaschine, welche sich aus den transformierten realen Rohdatensätzen meiner Wahrnehmungsapparate ableiten, Gefühle schöpft. Angst, Freude, Verwirrung, Erstaunen, komplexere Wünsche, höheres Denken, Bewusstsein, sowas gehört mir. Das andere funktioniert auch ohne mich. Mein Leben vibriert unter einer permanenten, sich selbst perfundierenden Dissonanz dieser beiden ineinanderkreischenden Zahnräder. Das erste schleift mitleidlos voran, angetrieben durch den Impuls eines physikalischen Universums, das zweite leidet wabbelnd an seinem Gegenstück herum. Ich passe nicht.
Dabei würde man doch meinen, der Umstand, dass es sich um meine Sinnesorgane, meinen Körper, meinen Geist handelt, diese untrennbare Verknüpfung, die einen Eigentumsgedanken zulässt, bedinge eine gewisse Befehlsgewalt über eben jenen Besitz. Aber nein. Protokolle und Regelschleifen bestimmen den Ablauf. Fütter mich! Geh auf die Toilette! Fütter mich wieder!
Müdigkeit ist die Geschäftsanfrage eines biomechanischen Roboters, die unerbittlich bearbeitet werden muss. Du kannst natürlich versuchen, die Kontrolle an dich zu reißen, indem du beispielsweise aufhörst, zu essen. Dein Körper wird nach geraumer Zeit derart tödlich beleidigt sein, dass er aus Trotz einfach stirbt. Und dich direkt mitreißt.
Wer hat hier also die Hosen an? Das ist keine rhetorische Frage. Dein Körper hat die Hosen an. Schau mal runter. Daher komme ich zu dem Schluss, dass Hosen ein Symbol der Unterdrückung sind, weshalb ich sie ablehne.
Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Egal.
»Teamwork blablabla … Synergie blabliblublabla … Customer experience blibibiblablu … HAHAHA, ihr Räuberbande, ihr blobblobblablob … Ich rede mit Ihnen, Hebers!«
Der Autopilot hakt. Bisher hat das Programm »Ernst gucken und nicken« funktioniert, doch auf derartige Extremsituationen ist es nicht vorbereitet. Abbruch. Abbruch. Starte Programm »Schuldig zu Boden schauen und nicken«. Ich halte die Luft an.
»Hallo! Könnten Sie mich bitte anschauen, wenn ich mit Ihnen spreche?«
Abbruch. Neustart. Ich hebe die Augen bis zu seinem Kinn und versuche, Barthaare zu zählen. Auf die Entfernung gestaltet sich das schwierig. Da sind erstaunlich viele rote Haargruppen drin. Ich schaue schon zu lange auf die selbe Stelle. Ich muss randomisieren. Seine Ohren sind asymmetrisch. Gibt es dafür plastische Chirurgie? Machen Menschen so was? Ich meine, es sind nur Ohren. Niemand achtet wirklich auf Ohren. Ohren sind keine Nase oder Falten. Das muss ich gleich mal nachschauen. Ach was, garantiert machen Menschen … Das brauche ich gar nicht erst zu überprüfen. Schaut der mich immer noch an? Ja. Wenn ich jetzt einfach einschlafe? Nein. Das wird nicht helfen.
»Okay. Okay. Alle zurück an die Arbeit! Hebers, Sie bleiben hier!«
Mit maximaler Geschäftigkeit kriechen die anderen Ameisen zurück auf ihre Pheromonpfade, während die Königin Herr Brinkenberg versucht, ihre Fühler mit meinen zu verknoten, um mich zu supervisen.
Als die anderen fort sind, greift einer seiner buchstäblichen Fühler nach meiner Schulter. Die Berührung stellt unvermittelt eine Intimität her, die brennt. Unaufgeforderter Körperkontakt durchsticht die Schutzhülle um meine Person. Augenkontakt ist fast genauso schlimm. Ich blicke dir in die Augen. Ich will wissen, wer du bist. Ich will dich erforschen. Das hat eine Intimität, mit der ich nicht umgehen kann, die mir unangenehm ist.
Aber Brinkenberg erreicht, was er erreichen will. Die Wellen von »unangenehm«, die er durch mich hindurch sendet, sorgen dafür, dass ich auf ihn fokussiert bleibe.
»Bitte nicht anfassen.«
»Was ist los mit Ihnen? Ich würde ja sagen, Sie sind sonst nicht so, aber Sie sind immer so. Verstehen Sie, was ich meine?«
»Ja, Herr Brinkenberg.«
»Kommen Sie mir nicht mit ›Ja, Herr Brinkenberg‹. Was ist los mit Ihnen?«
»Ich bin geistig abwesend, weil mich das Universum hochgradig verwirrt. Kennen Sie das, wenn Sie die Welt betrachten und permanent das Gefühl haben, dass hier irgendwas nicht stimmt, dass irgendwas Grundlegendes keinen Sinn ergibt? Als würden man ein Bild betrachten, das von weitem symmetrisch und ordentlich wirkt, aber wenn man näher kommt, erkennt man, dass es aus vielen kleinen Asymmetrien zusammengesetzt ist. Jedenfalls versuche ich darum, meinen Blick nach innen zu richten, um nicht permanent darüber nachdenken zu müssen. Das Problem ist, dass auch in mir Prozesse ablaufen, die ich weder verstehen noch steuern kann. Heute morgen hatte ich einen Zusammenbruch, weil ich in den Badezimmerspiegel geschaut habe. Ist Ihnen das schon mal passiert? Dachte ich mir. Sie würden mich vielleicht ein Wrack nennen, was aber kein treffender Vergleich wäre, weil er impliziert, dass ich früher mal seetüchtig war. Das war ich allerdings nie. Ich war schon immer so. Nicht intakt. Gegen die Realität verschoben. Meistens versuche ich einfach nur, über den Tag zu kommen, bis ich mich wieder ins Bett legen kann, um wenigstens über Nacht aus der Wirklichkeit auszuklinken. Und das alles kratzt vermutlich grade mal an der Oberfläche von ›Was ist los mit mir?‹. Um es also kurz zu machen: Bitte fassen Sie mich nicht an, dann kann ich weiter die Aufgaben erledigen, für die ich bezahlt werde. Faktisch gesehen, gehört, so zu tun, als würden mir diese am Herzen liegen, nicht zu denselbigen. Anders zu handeln, wäre also entweder ein Zeichen für einen Lügner oder einen Trottel.«
Plötzlich verschwindet seine Hand. Dann sagt er:
»Scheiße, Hebers … Reißen Sie sich zusammen oder so … Ähm … Ich … Verdammt, so genau wollte ich das doch alles gar nicht wissen … Warum sagen Sie nicht einfach, dass Sie gerade eine harte Zeit durchmachen? Scheiße … Ähm … Na gut, Sie kriegen noch eine Chance, aber wenn Sie hier nicht schnell ordentlich reinklotzen, dann fliegen Sie achtkantig raus. Haben wir uns verstanden? Und besorgen Sie sich Hilfe oder was auch immer.«
Oder: »Arschloch.«
Keine Ahnung. Starte Programm »Ernst gucken und nicken«. Bereite Autopilot bis 19:30 vor. Execute.
»Als Nächstes gehen wir in eine Figur, die heißt: Der Affe trinkt das Mondlicht«, sagt die Yogalehrerin, die Gruppe folgt ihren Anweisungen und ich wackle.
Die Frage, warum ich mich beim Yoga angemeldet habe, verhält sich in vielerlei Hinsicht wie ein Lama in Inlinern auf einem Laufband. Sie bringt mich nicht vorwärts. Mir selbst ist völlig schleierhaft, was dieser Vergleich tiefergehend bedeuten soll, gleichzeitig fühlt er sich treffend an.
Das Studio ist spartanisch, aber rassistisch eingerichtet. In einer Ecke steht ein japanischer Zen-Garten, in der anderen eine chinesische Drachenstatue. Doch was will man von einer Yoga-Schule erwarten, die sich im Hinterzimmer eines koreanischen Schnellimbisses in Bochum befindet?
Unsere Lehrerin heißt Gisela Stibinski. Ich vermute, dass das ein alter indischer Name ist, der bedeutet: »Die, die vorne sitzt und raucht«, denn das ist es, was sie tut.
Niemand wagt es, gegen dieses Missverhältnis zu protestieren, da Gisela permanent einen Blick drauf hat, der seinerseits bedeutet: »Hömma, Freundchen. Wenne frech wirs, mach ich dir n Knoten inne Beine, dasse dein restliches Leben als Brezel verbringen kanns. Dat geht auch ohne Yoga.«
Also yogieren wir und Gisela sitzt und raucht. Sie leitet den Kurs, indem sie mit ihrer Kippe auf einem Yoga-Poster die nächste Figur anzeigt.
Ich finde das unfair, weil ich keine Ahnung habe, wie ich von der aktuellen Position in die neue wechseln soll. Das ist, als würde man einen Blick in die Ikea-Aufbauanleitung werfen, um darin das Bild eines vollendeten Schranks zu finden mit der Anweisung »Bauen Sie den Schrank so zusammen, dass er aussieht wie auf dem Bild«, und man wundert sich total, weil man eigentlich ein Bett gekauft hat. Bedauerlicherweise sind das, was ich finde, und das, was Gisela interessiert, zwei Welten, die sich nur selten begegnen und selbst dann nicht grüßen.
»Und nun: Der hockende Hund kackt«, raspelt Gisela durch den Qualm. Hin und wieder ist es schleierhaft, ob sie den Namen einer Yoga-Figur aufsagt oder nur Dinge beschreibt, die sie durch die Fensterfront beobachtet.
Sie brennt mit ihrer Zigarette ein Loch in das Poster, was auch nur halb so wild ist. War das halt das letzte Mal, dass der Kurs diese Figur gemacht hat. Fertig. Seit meiner dritten Stunde im Yoga-Studio