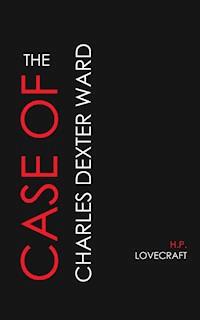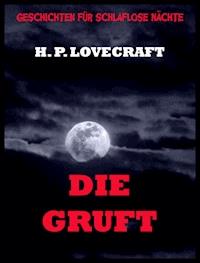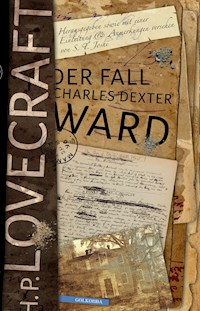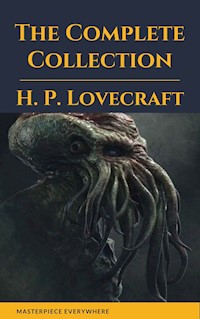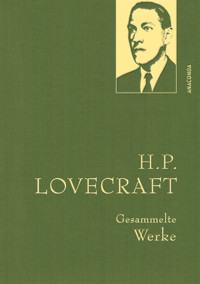
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Anaconda Gesammelte Werke
- Sprache: Deutsch
Das Werk von H. P. Lovecraft ist der blanke Horror. Mit wohligem Grusel hat sich der amerikanische Schriftsteller nicht zufriedengegeben, er stimulierte seine Fantasie zu verstörenden Geschichten der alptraumhaftesten Sorte. Sie sind bevölkert von Dämonen, Außerirdischen und dem wundersamen Kosmos seines selbst ersonnenen Cthulhu-Mythos. Dieser Band versammelt die besten Erzählungen vom ewigen Meister alles Abgründigen und Entsetzlichen, darunter die Klassiker »Die Berge des Wahnsinns«, »Schatten über Innsmouth«, »Das Grauen von Dunwich« und »Cthulhus Ruf«.
»Der größte Horrorautor des 20. Jahrhunderts ist H. P. Lovecraft, daran gibt es keinen Zweifel.« (Stephen King)
- »Der größte Horrorautor des 20. Jahrhunderts ist H. P. Lovecraft, daran gibt es keinen Zweifel.« Stephen King
- Die Keimzelle des Horrors: Lovecrafts wichtigste Werke
- Vom Großmeister des Horrors
- Prägend für den Horrorfilm und die Literatur: Von John Carpenter bis zu Michel Houellebecq
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1207
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
H. P. Lovecraft
Gesammelte Werke
Herausgegeben und neu übersetzt von Florian F. Marzin
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und
enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte
Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung
durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung
oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in
elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und
zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlichgeschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- undData-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jeglicheunbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sindim Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2023 by Anaconda Verlag, einem Unternehmender Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotiv: H. P. Lovecraft, Photo by Lucius B. Truesdell,akg-images / Mondadori Portfolio / Archivio GBB
Umschlaggestaltung: Druckfrei. Dagmar Herrmann, Bad Honnef
Satz und Layout: InterMedia – Lemke e. K., Heiligenhaus
ISBN 978-3-641-31156-8V003
www.anacondaverlag.de
Inhalt
Das Tier in der Höhle
Der Alchimist
Das Grab
Die Aussage des Randolph Carter
Die Ratten im Gemäuer
Das Unbeschreibliche
Gefangen bei den Pharaonen
Die Musik des Erich Zann
In der Gruft
Pickmans Modell
Cthulhus Ruf
Die Farbe aus dem All
Das Grauen von Dunwich
Der Flüsterer im Dunkeln
Die Berge des Wahnsinns
Der Schatten über Innsmouth
Der Schatten aus der Zeit
Das Ding auf der Schwelle
Der Leuchtende Trapezoeder
In den Mauern von Eryx
Quellenverzeichnis
Das Tier in der Höhle
Die schrecklichen Schlussfolgerungen, die sich meinem verwirrten und widerstrebenden Geist nach und nach aufdrängten, waren jetzt zu einer grauenvollen Gewissheit geworden. Ich hatte mich verirrt, hoffnungslos verirrt in der weitläufigen und labyrinthischen Abgeschiedenheit der Mammuthöhle. Wohin ich auch schaute, in keiner Richtung konnte mein angestrengter Blick etwas entdecken, das mir als Wegweiser nach draußen dienen konnte. Dass ich niemals mehr das gesegnete Tageslicht oder die schönen Hügel und Täler der Welt dort draußen erblicken sollte, daran konnte mein Verstand nicht länger zweifeln. Die Hoffnung war dahin. Doch geprägt von meinen lebenslangen philosophischen Studien, gewann ich aus meiner gleichgültigen Haltung eine nicht geringe Befriedigung, denn ich hatte häufig von den wilden Tobsuchtsanfällen gelesen, die Opfer in der gleichen Lage überkamen. Mir selbst widerfuhr nichts Derartiges, sondern ich blieb ruhig stehen, als mir bewusst wurde, dass ich mich verirrt hatte.
Auch die Überlegung, dass ich mich wohl jenseits des Gebietes einer üblichen Suchaktion befand, brachte mich keinen Augenblick aus der Fassung. Wenn ich sterben musste, so überlegte ich, war diese schreckliche, doch majestätische Höhle so willkommen als Grabstätte wie jeder Friedhof, eine Vorstellung, die eher zur Beruhigung beitrug denn zur Verzweiflung.
Letztendlich würde ich verhungern, das war mir klar. Manche waren unter Bedingungen wie diesen wahnsinnig geworden, doch ich spürte, dass dies nicht mein Schicksal wäre. Meine missliche Lage war ganz allein meine Schuld, denn vom Führer unbemerkt hatte ich mich von der Besichtigungsgruppe entfernt und, nachdem ich eine Stunde lang auf den verbotenen Wegen der Höhle gelaufen war, war ich nicht mehr in der Lage gewesen, die verzwickten Biegungen zurückzuverfolgen, denen ich nach Verlassen meiner Gefährten gefolgt war.
Meine Taschenlampe begann zu erlöschen. Schon bald würde ich von der totalen und fast greifbaren Dunkelheit der Eingeweide der Erde umschlossen sein. Als ich da im abnehmenden flackernden Licht stand, stellte ich mir die müßige Frage, wie mein absehbares Ende genau aussehen würde. Ich erinnerte mich an Berichte über eine Kolonie von Schwindsüchtigen, die sich in dieser riesigen Höhle niedergelassen hatte, um in der sauberen Umgebung dieser unterirdischen Welt mit ihrer konstanten Temperatur, der reinen Luft und der friedlichen Stille Heilung zu finden, stattdessen aber auf grausame und merkwürdige Weise tot aufgefunden worden war. Ich hatte die traurigen Überreste ihrer baufälligen Hütten gesehen, als ich mit der Gruppe dort vorbeikam, und hatte mich gefragt, welche Auswirkungen ein längerer Aufenthalt in dieser riesigen stillen Höhle auf jemanden, so kräftig und gesund wie ich, haben könnte. Nun, so sagte ich mir grimmig, war die Gelegenheit da, diesen Punkt zu klären, vorausgesetzt, dass der Nahrungsmangel mich nicht zu schnell hinwegraffen würde.
Als der letzte flackernde Strahl meiner Taschenlampe verblasst war, beschloss ich, nichts unversucht und keine Möglichkeit des Entkommens außer Acht zu lassen. Ich atmete, so tief ich konnte, ein und stieß in der vergeblichen Hoffnung, den Führer auf mich aufmerksam zu machen, eine Folge von lauten Rufen aus. Als ich rief, war ich fest davon überzeugt, dass meine Rufe unnütz waren und meine Stimme, durch die zahllosen Wälle des schwarzen Irrgartens um mich herum verstärkt und gebrochen, keine Ohren außer meinen eigenen erreichen würden.
Ganz plötzlich wurde meine Aufmerksamkeit überraschenderweise von leisen, näher kommenden Schritten in Anspruch genommen, die ich auf dem Felsboden der Höhle zu vernehmen glaubte.
Sollte meine Rettung so schnell erfolgen? Waren all meine schrecklichen Vorstellungen hinfällig, hatte der Führer meine unbotmäßige Abwesenheit von der Gruppe bemerkt, war meinem Weg gefolgt und suchte mich jetzt in diesem Kalksteinlabyrinth? Während diese freudigen Fragen meinen Geist beschäftigten, wollte ich schon erneut rufen, als beim Hinhören meine Freude unvermittelt in Grauen umschlug. Meine immer schon sehr scharfen Ohren, jetzt noch durch die absolute Stille der Höhle besonders geschärft, vermittelten mir in betäubender Klarheit die unerwartete und schreckliche Erkenntnis, dass diese Schritte nicht die irgendeines sterblichen Menschen waren. In der unirdischen Stille dieser unterirdischen Region hätten die Schritte des stiefeltragenden Führers wie eine Serie harter und fester Schläge geklungen. Diese Schritte aber waren weich und gleichmäßig, wie der Gang von Katzen. Außerdem, als ich genau hinhörte, schien es wie das Aufsetzen von vier anstatt von zwei Füßen zu klingen.
Ich war nun davon überzeugt, dass mein Rufen irgendein wildes Tier aufgeschreckt hatte, möglicherweise einen Puma, der zufällig in der Höhle herumgestreift war. Vielleicht, dachte ich, hatte der Allmächtige für mich einen schnelleren und gnädigeren Tod gewählt als zu verhungern, dennoch regte sich in meiner Brust der Selbsterhaltungstrieb, der niemals ganz schläft, und wenn eine Flucht vor der sich nähernden Gefahr mir nur ein härteres und langwierigeres Ende bereiten würde, beschloss ich trotzdem, mein Leben so teuer wie möglich zu verkaufen. Es mag seltsam klingen, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass der Besucher in anderer als böser Absicht kam. Deshalb verhielt ich mich sehr still und hoffte, dass die unbekannte Bestie in Ermangelung von sie leitenden Geräuschen so wie ich die Orientierung verlor und an mir vorbeiliefe. Doch diese Hoffnung wurde enttäuscht, denn die seltsamen Schritte kamen unbeirrt auf mich zu, das Tier hatte offensichtlich meinen Geruch aufgenommen, dem man in einer so reinen Luft wie hier in der Höhle ohne Zweifel auf große Entfernung folgen konnte.
Aus der Notwendigkeit, dass ich mich zur Verteidigung gegen einen unheimlichen und überraschenden Angriff aus der Dunkelheit bewaffnen musste, griff ich mir die beiden größten der Steinbrocken, die überall auf dem Boden der Höhle herumlagen, und hielt in jeder Hand einen zum sofortigen Einsatz bereit und wartete resigniert ab, was geschah. Inzwischen war das grässliche Tapsen der Pfoten näher gekommen. Ohne Zweifel war das Verhalten der Kreatur außergewöhnlich merkwürdig. Die meiste Zeit schien sie auf vier Füßen zu laufen, ohne die Bewegungen der Hinter- und Vorderbeine richtig in Einklang bringen zu können, doch in kurzen unregelmäßigen Abständen hatte ich den Eindruck, dass nur zwei Beine in die Fortbewegung involviert waren. Ich grübelte, mit welcher Art von Tier ich es wohl zu tun hatte, es musste, so überlegte ich mir, eine unglückliche Kreatur sein, die ihre Neugierde, einen der Eingänge der schrecklichen Höhle zu erforschen, mit lebenslanger Gefangenschaft in ihren unermesslichen Weiten bezahlt hatte. Zweifellos ernährte sie sich von den augenlosen Fischen, Fledermäusen und Ratten in der Höhle sowie von einigen gewöhnlichen Fischen, die mit jeder Überschwemmung des Green River hineingelangten, der auf irgendwie seltsame Art mit den Wasserläufen der Höhle verbunden war. Ich verbrachte meine grausige Nachtwache mit absonderlichen Vermutungen, welche Veränderungen das Höhlenleben in der körperlichen Erscheinung des Tieres verursacht hatte, und erinnerte mich an die Berichte der Ortsansässigen über die schrecklichen Veränderungen im Aussehen der Schwindsüchtigen, bevor sie nach ihrem langen Aufenthalt in der Höhle gestorben sind. Dann kam mir plötzlich die Erkenntnis, dass selbst, wenn ich meinen Gegner niederstreckte, ich niemals sein Aussehen erfahren würde, da meine Taschenlampe schon lange verloschen war und ich auch keine Streichhölzer besaß. Meine Anspannung wurde nun unerträglich. Meine aus den Fugen geratene Fantasie ließ in der mich umgebenden Dunkelheit grässliche und fürchterliche Gestalten entstehen, die sich tatsächlich auf mich zu werfen schienen. Die schrecklichen Schritte kamen immer näher. Ich glaubte, dass ich einen gellenden Schrei ausstoßen müsse, doch selbst wenn ich den Versuch unternommen hätte, hätte meine Stimme wahrscheinlich versagt. Ich war versteinert und auf die Stelle gebannt. Ich zweifelte, dass mein rechter Arm in der Lage wäre, wenn es so weit war, den Stein auf das sich nähernde Ding zu werfen. Nun war das beständige Tapp, Tapp der Schritte nah, jetzt sehr nah. Ich konnte das schwere Atmen des Tieres vernehmen und vor Angst gelähmt bemerkte ich, dass es weither gekommen sein musste und deswegen ziemlich erschöpft war. Unvermittelt war der Bann gebrochen. Meine rechte Hand, geführt von meinem verlässlichen Gehör, schleuderte mit aller Kraft das Wurfgeschoss in Richtung eines Punktes in der Dunkelheit, von dem das Tapsen und das Atmen kam, und der Stein, so unwahrscheinlich es klingen mag, erreichte fast sein Ziel, denn ich hörte, wie das Ding zur Seite sprang und dann innehielt.
Nachdem ich mich nach dem neuen Ziel ausgerichtet hatte, schickte ich mein zweites Wurfgeschoss auf den Weg, diesmal höchst erfolgreich, denn mit überschäumender Freude hörte ich, wie die Kreatur scheinbar völlig zusammenbrach und bewegungslos liegen blieb. Die große Erleichterung überwältigte mich fast, und ich lehnte mich an die Wand hinter mir. Ich vernahm weiterhin das tiefe keuchende Atmen und mir wurde klar, dass ich die Kreatur nur verletzt hatte. Jetzt verschwand mein Verlangen, das Wesen zu untersuchen. Zu guter Letzt war ich doch von grundloser abergläubischer Furcht gepackt worden, und ich näherte mich nicht dem Körper und warf auch keine weiteren Steine, um dem Wesen endgültig den Rest zu geben. Stattdessen rannte ich, so schnell ich konnte, in die Richtung – so gut ich es in meinem aufgewühlten Zustand bestimmen konnte –, aus der ich gekommen war. Plötzlich hörte ich ein Geräusch oder eher eine regelmäßige Abfolge von Geräuschen. Einen Moment später hatten sie sich in ein scharfes metallisches Klicken verwandelt. Diesmal gab es keinen Zweifel. Es war der Fremdenführer. Und als ich in den Gewölbegängen das schwache Schimmern eines reflektierten Lichtstrahls einer sich nähernden Taschenlampe erblicke, rief, brüllte, ja schrie ich sogar aus purer Freude. Ich stürmte dem Schimmern entgegen, und bevor ich noch genau wusste, wie mir geschah, lag ich vor dem Führer auf dem Boden, umarmte seine Stiefel und plapperte, entgegen meiner sonstigen Zurückhaltung, meine Geschichte völlig wirr und idiotisch heraus und überschüttete meinen Zuhörer gleichzeitig mit Dankesbezeugungen. Schließlich gewann ich meinen normalen Geisteszustand zurück. Dem Führer war meine Abwesenheit beim Eintreffen am Eingang der Höhle aufgefallen und er hatte sich, vertrauend auf seinen intuitiven Orientierungssinn, zu einer sorgfältigen Durchsuchung der Nebengänge von der Stelle aus, wo er zum letzten Mal mit mir gesprochen hatte, aufgemacht und mich schließlich nach einer Suche von vier Stunden gefunden.
Nachdem er mir dies gesagt hatte, berichtete ich, ermutigt von seiner Gesellschaft und der Taschenlampe, von dem seltsamen Wesen, das ich ein Stück weiter hinten in der Dunkelheit verwundet hatte, und schlug vor, dass wir uns mithilfe der Taschenlampe ansahen, was für eine Art von Kreatur mein Opfer war. Mit einer aus der Gefährtenschaft geborenen Kühnheit folgte ich meinem Weg zurück an den Ort meiner schrecklichen Erfahrung. Schon bald entdeckten wir ein weißes Objekt auf dem Boden, weißer noch als selbst der glänzende Kalkstein. Wir näherten uns vorsichtig und gaben dann gleichzeitig einen Laut des Erstaunens von uns, denn von allen unnatürlichen Missgeburten, die jeder von uns in seinem Leben schon erblickt hatte, war dies bei Weitem die absonderlichste. Es schien ein besonders großer Menschenaffe zu sein, der möglicherweise aus einer herumziehenden Tierschau entkommen war. Sein Haar war schneeweiß, was ohne Zweifel auf die ausbleichende Wirkung seines langen Aufenthalts in der stockdunklen Höhle zurückzuführen war, außerdem war das Haar überraschend dünn, eigentlich bis auf die Kopfbehaarung nicht vorhanden, wo es aber so lang und dicht war, dass es bis auf die Schultern fiel. Das Gesicht war uns abgewandt und fast vollständig nach unten gekehrt. Die Stellung der Gliedmaßen zueinander war sehr eigenartig, erklärte aber die Unregelmäßigkeit bei ihrer Benutzung, die ich zuvor wahrgenommen hatte, als das Tier sich manchmal auf zwei und manchmal auf vier Beinen fortbewegt hatte. Aus seinen Fingern oder Zehen ragten lange, rattengleiche Krallen hervor. Die Hände oder Füße waren nicht zum Greifen geeignet, ein Umstand, den ich dem langen Aufenthalt in der Höhle zuschrieb, der, wie ich schon erwähnt habe, durch das allumfassende und fast unirdische Weiß, das für das ganze Wesen charakteristisch war, bewiesen wurde. Ein Schwanz war nicht zu sehen.
Die Atmung war jetzt sehr flach. Der Führer hatte seine Pistole gezogen und wollte der Kreatur offensichtlich den Gnadenschuss geben, als das Wesen plötzlich einen Laut ausstieß, der ihn die Pistole fallen lassen ließ. Der Laut ist schwer zu beschreiben. Er klang nicht nach irgendeiner bekannten Affenart, und ich fragte mich, ob der unnatürliche Klang nicht eine Folge des langen Aufenthalts in absoluter Stille war, verstärkt durch das unvermittelte Auftreten von Licht, etwas, was das Tier seit seinem Betreten der Höhle nicht mehr erfahren haben konnte. Das Geräusch, das ich einmal als tiefes Raunen beschreiben will, ging leise weiter.
Ganz überraschend schien ein Anflug von Energie durch den Köper des Tieres zu fahren. Die Pranken zuckten, und die Gliedmaßen bewegten sich. Mit einem Ruck drehte sich der weiße Körper, und das Gesicht sah uns an. Einen Moment lang war ich von dem Anblick seiner Augen so erschrocken, dass ich nichts anderes mehr wahrnahm. Die Augen waren schwarz, kohlrabenschwarz im Kontrast zu dem schneeweißen Haar und dem Körper. Wie bei anderen Höhlenbewohnern lagen sie tief eingesunken und hatten kaum eine Iris. Als ich genauer hinsah, stellte ich fest, dass sie zu einem Gesicht gehörten, das ein weniger fliehendes Kinn als bei einem durchschnittlichen Affen aufwies und eindeutig weniger behaart war. Die Nase war ziemlich ausgeprägt. Während wir auf den unheimlichen Anblick starrten, der sich uns bot, öffneten sich die breiten Lippen und heraus kamen verschiedene Laute, worauf das Wesen starb.
Der Führer klammerte sich an meinen Jackenärmel und zitterte so heftig, dass der Lichtstrahl zuckende unheimliche Schatten auf die Wände warf.
Ich bewegte mich nicht, sondern verharrte reglos, und meine erschrockenen Augen waren auf den Boden vor mir geheftet.
Die Furcht verging und Staunen, Scheu, Mitgefühl und Ehrfurcht traten an seine Stelle, denn die Laute, die von der dahingerafften Gestalt, die ausgestreckt auf dem Kalksteinboden lag, ausgestoßen worden waren, hatten uns die grausame Wahrheit enthüllt. Die Kreatur, die ich getötet hatte, das seltsame Tier aus der unermesslichen Höhle, war, oder war einmal, ein Mensch gewesen!!!
21. April 1905
Der Alchimist
Hoch oben auf der grasbewachsenen Kuppe eines Hügels, dessen Flanken am Fuß von den knorrigen Bäumen eines uralten Waldes gesäumt werden, steht das Schloss meiner Vorfahren. Jahrhundertelang haben seine hohen Zinnen düster auf das wilde und zerklüftete Land herabgeblickt. Es war Heimstatt und Bollwerk eines stolzen Geschlechts, dessen Abstammung älter war als selbst die moosbewachsenen Mauern des Schlosses. Diese alten Türme, von Generationen von Stürmen verwittert und unter der langsamen, doch mächtigen Kraft der Zeit zerbröckelnd, bildeten im Zeitalter des Feudalismus eine der gefürchtetsten und herausragendsten Festungen Frankreichs. Von den mit Pechspeiern versehenen Brustwehren und bemannten Zinnen waren Barone, Grafen und sogar Könige in die Flucht geschlagen worden, und in seinen weiten Sälen erklangen nie die Schritte von Eroberern.
Doch seit diesen ruhmreichen Jahren ist alles anders geworden. Eine Armut, die nur knapp über der ärgsten Not lag, in Verbindung mit einem stolzen Namen, der es verbat, durch einen Gelderwerb die Not zu lindern, haben verhindert, dass unser Geschlecht seinen Besitz in vormaliger Pracht aufrechterhielt. Die aus den Mauern fallenden Steine, die wuchernde Vegetation in den Parks, der ausgetrocknete, staubige Burggraben, das aufgebrochene Pflaster in den Höfen und die verfallenen Türme sowie die abgesackten Böden, die wurmstichigen Täfelungen und verblichenen Wandteppiche im Haus erzählten die bedrückende Geschichte verfallenen Glanzes. Im Verstreichen der Jahrhunderte ließ man einem nach dem anderen der vier großen Ecktürme verfallen, bis schließlich der letzte verbleibende Turm die traurig heruntergekommenen Abkömmlinge der einst mächtigen Herren dieses Besitzes beheimatete.
In einem der düsteren und weitläufigen Räume dieses übrig gebliebenen Turms erblickte ich, Antoine, der letzte der unglücklichen und verfluchten Grafen von C., vor neunzig Jahren das Licht der Welt. In diesen Mauern und in den dunklen, schattigen Wäldern, den wilden Schluchten und Höhlen des Hügels unterhalb des Schlosses verbrachte ich die ersten Jahre meines kummervollen Lebens. Meine Eltern kannte ich nicht. Mein Vater wurde im Alter von zweiunddreißig Jahren, einen Monat vor meiner Geburt, durch einen Stein getötet, den jemand von den verfallenen Wehrgängen des Schlosses herunterstieß. Und da meine Mutter bei meiner Geburt starb, oblag meine Pflege und Erziehung ganz dem letzten übrig gebliebenen Diener, einem alten, vertrauenswürdigen Mann von annehmbarem Verstand, dessen Name mir als Pierre in Erinnerung ist. Ich war ein Einzelkind, und das Fehlen von Gesellschaft, das aus diesem Umstand erwuchs, wurde noch durch die seltsame Art, in der mich mein betagter Aufpasser aufzog, verstärkt, denn er hielt mich von den Bauernkindern fern, die am Fuße des Hügels in zwischen den Feldern verstreuten Hütten lebten. Zu jener Zeit erklärte mir Pierre, dass dies so sein müsse, da meine adlige Geburt mich über die Gesellschaft solcher niederen Wesen stellte. Jetzt weiß ich, dass der eigentliche Grund die müßigen Geschichten von dem fürchterlichen Fluch, der auf unserem Geschlecht lastete, war, die sich die einfachen Bauern in ihren Hütten im Schein der Feuerstellen allnächtlich zuflüsterten und die mir nicht zu Ohren kommen sollten.
Auf diese Weise abgeschnitten und auf mich selbst beschränkt verbrachte ich meine Kindheit damit, über uralten Büchern zu brüten, die die von Schatten heimgesuchte Schlossbibliothek füllten, und ziel- und sinnlos durch den ewigen Dunst des gespenstischen Waldes zu streifen, der sich am Fuß des Hügels entlangzieht. Wahrscheinlich waren diese Umstände daran schuld, dass mein Geist schon früh in Melancholie verfiel. Diese Studien und Ausflüge, die das Dunkle und Okkulte in der Natur zum Ziel hatten, beanspruchten meine ganze Aufmerksamkeit.
Über meine eigene Familie erlaubte man mir nur sehr wenig zu erfahren, doch das wenige, das ich mir aneignete, schien mich sehr zu deprimieren. Vielleicht war es anfänglich nur die beständige Weigerung meines alten Erziehers, mit mir über meine Vorfahren väterlicherseits zu sprechen, die in mir das Grauen heraufbeschwor, das ich immer verspürte, wenn mein großer Name erwähnt wurde, doch als ich älter wurde, war ich in der Lage, verstreute Bruchstücke aus Gesprächen, die unfreiwillig über seine senilen Lippen kamen, zusammenzusetzen und die eine Verbindung zu einem bestimmten Umstand hatten, der mir zuerst seltsam vorgekommen war, jetzt aber ein leichtes Schaudern auslöste. Es war der Umstand, dass alle Grafen meines Geschlechts früh ihr Ende gefunden hatten. Hatte ich dies bis zu diesem Zeitpunkt als eine natürliche Angelegenheit in einer Familie von kurzlebigen Männern angesehen, grübelte ich später lange über diese vorzeitigen Todesfälle und begann, sie in Verbindung mit dem Gefasel des alten Mannes zu bringen, der häufig von einem Fluch sprach, der seit Jahrhunderten dafür verantwortlich war, dass die Träger des Titels nicht viel älter wurden als zweiunddreißig Jahre. An meinem einundzwanzigsten Geburtstag übergab mir Pierre ein Familiendokument, das, wie er erklärte, seit Generationen immer vom Vater auf den Sohn übergegangen war und jeder Besitzer dies so fortgesetzt hätte. Der Inhalt überraschte mich ungemein, und nachdem ich es durchgesehen hatte, waren meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Zu jenem Zeitpunkt war mein Glaube an das Übernatürliche fest und tief verwurzelt, ansonsten hätte ich über die unglaubliche Geschichte gelacht, die sich vor mir ausbreitete.
Die Unterlagen führten mich zurück ins dreizehnte Jahrhundert, als das alte Schloss, in dem ich mich befand, eine gefürchtete und uneinnehmbare Festung gewesen war. Sie berichteten von einem bestimmten alten Mann, der einst auf unseren Besitzungen gelebt hatte, eine Person mit nicht geringen Fähigkeiten, doch nur wenig mehr als ein Bauer, und sein Name war Michel, gewöhnlich wegen seiner düsteren Erscheinung mit dem Zusatz Mauvais, der Böse, bedacht. Er war weit über das Maß seiner Mitmenschen gebildet und suchte nach dem Stein der Weisen und dem Elixier des Lebens. Er hatte den Ruf, in den schrecklichen Geheimnissen der Schwarzen Magie und Alchimie bewandert zu sein. Michel Mauvais hatte einen Sohn mit Namen Charles, einen Jungen, der genauso bewandert in den verborgenen Künsten war wie er selbst, den man deshalb Le Sorcier, den Zauberer, nannte. Dieses Paar, von allem ehrlichen Volk gemieden, verdächtigte man abscheulicher Praktiken. Von dem alten Michel sagte man, dass er seine Frau als Opfer für den Teufel verbrannt hätte, und das unerklärliche Verschwinden vieler junger Bauernkinder legte man diesem schrecklichen Paar zur Last. Doch der düstere Charakter von Vater und Sohn wurde von einem menschlichen Lichtstrahl erhellt, der böse alte Mann liebte seinen Sprössling abgöttisch, während der Jüngling für seinen Vater mehr als kindliche Zuneigung empfand.
Eines Nachts geriet das Schloss auf dem Hügel in höchste Aufregung über das Verschwinden des jungen Godfrey, Sohn des Grafen Henri. Ein von dem rasenden Vater angeführter Suchtrupp stürmte in das Dorf der Zauberer und stieß auf den alten Michel Mauvais, der geschäftig über einen riesigen, heftig kochenden Kessel gebeugt war. Ohne wirklichen Beweis, in seinem unbezähmbaren Wahnsinn von Wut und Verzweiflung, legte der Graf seine Hände an den Hals des alten Zauberers, und bevor er sich noch seines mörderischen Griffs bewusst wurde, war sein Opfer schon tot. In der Zwischenzeit war von freudigen Bediensteten die Nachricht eingetroffen, dass man den jungen Godfrey in einem abgelegenen, unbenutzten Zimmer des großen Schlosses gefunden hatte, doch es war zu spät, denn der arme Michel war schon umsonst gestorben. Als der Graf und seine Leute das einfache Haus des Alchimisten verließen, erschien die Gestalt von Charles Le Sorcier zwischen den Bäumen. Aus dem aufgeregten Geschnatter des herumstehenden Gesindes erfuhr er, was geschehen war, doch schien er zuerst vom Schicksal seines Vaters unbeeindruckt. Dann, als er sich langsam auf den Grafen zubewegte, sprach er mit dumpfer, doch schrecklicher Stimme den Fluch, der seitdem über dem Haus der C. liegt.
»Nie soll einer aus eurer MörderbrutLänger leben, als ihr es tut!«,
sprach er, als er, sich plötzlich rückwärts in den dunklen Wald bewegend, aus seinem Gewand eine Phiole mit farbloser Flüssigkeit zog und sie dem Mörder seines Vaters ins Gesicht warf, bevor er hinter dem schwarzen Vorhang der Nacht verschwand. Der Graf starb, ohne ein Wort zu sagen, und wurde am nächsten Tag begraben, nur wenig mehr als zweiunddreißig Jahre nach seiner Geburt. Von dem Mörder fand man keine Spur, obwohl unbarmherzige Gruppen von Bauern die angrenzenden Wälder und die Weiden um den Hügel absuchten.
Die Zeit und das Fehlen eines Mahners ließen die Familie des verstorbenen Grafen den Fluch vergessen, sodass, als Godfrey, der an der ganzen Tragödie unschuldig war und inzwischen den Titel trug, auf der Jagd von einem Pfeil im Alter von zweiunddreißig Jahren getötet wurde, nur die Trauer um sein Ableben die Gedanken bestimmte. Doch als man Jahre danach den nächsten jungen Grafen, Robert, ohne ersichtlichen Grund tot auf einem nahe gelegenen Feld fand, flüsterten die Bauern untereinander, dass ihr Herr vor Kurzem seinen zweiunddreißigsten Geburtstag gefeiert hatte, als ihn der Tod ereilte. Louis, den Sohn Roberts, fand man im gleichen schicksalhaften Alter ertrunken im Burggraben, und so setzte sich die unheilvolle Chronik durch die Jahrhunderte hindurch fort: Henris, Roberts, Antoines und Armands schieden aus ihrem glücklichen und rechtschaffenen Leben, wenn sie knapp vor dem Alter ihres unglücklichen Vorfahren zum Zeitpunkt seiner Ermordung waren.
Dass mir bestenfalls noch elf weitere Jahre hier auf Erden blieben, war mir durch die Worte, die ich gelesen hatte, klar. Mein Leben, zuvor in meinen Augen nicht von besonderem Wert, wurde mir jetzt mit jedem Tag wertvoller, als ich tiefer und tiefer in die Geheimnisse des verborgenen Reichs der Schwarzen Magie eindrang. So abgeschieden, wie ich lebte, hatten die modernen Wissenschaften keinen Einfluss auf mich gehabt, und ich plagte mich wie im Mittelalter, ähnlich vertieft in die Erlangung von dämonischem und alchimistischem Wissen, wie es der alte Michel und der junge Charles gewesen waren. So viel ich auch las, ich konnte keinen Hinweis auf den seltsamen Fluch finden, der auf meinem Geschlecht lag. In seltenen rationalen Momenten ging ich sogar so weit, nach einer natürlichen Erklärung zu suchen, und machte den finsteren Charles Le Sorcier und seine Nachkommen für die frühen Tode meiner Vorfahren verantwortlich, fand aber durch vorsichtige Nachforschungen heraus, dass keine Abkömmlinge des Alchimisten bekannt waren. Ich kehrte zu meinen okkulten Studien zurück und bemühte mich wieder, eine Zauberformel zu finden, die mein Geschlecht von dieser schrecklichen Heimsuchung befreien würde. In einer Sache war ich mir vollkommen sicher. Ich würde niemals heiraten, denn da es keinen anderen Zweig meiner Familie gab, würde ich den Fluch durch mich selbst zum Ende bringen.
Als ich mich dem Alter von dreißig näherte, wurde der alte Pierre in eine andere Welt abberufen. Alleine begrub ich ihn unter den Steinen des Innenhofes, über die er zu Lebzeiten so gerne spaziert war. So blieb ich denn als einziges menschliches Wesen in der großen Festung zurück, um weiter nachzugrübeln, und in meiner Einsamkeit begann ich, mein vergebliches Aufbegehren gegen das drohende Unheil aufzugeben, und versöhnte mich fast mit dem Schicksal, das viele meiner Vorfahren ereilt hatte. Viel Zeit verbrachte ich jetzt mit der Erkundung der verlassenen Säle und Türme des alten Schlosses, wovon mich in meiner Jugend die Angst abgehalten hatte, und von denen einige, wie mir der alte Pierre einmal gesagt hatte, schon seit vier Jahrhunderten von keinem Menschen betreten worden waren. Viele der Objekte, auf die ich stieß, waren seltsam und furchteinflößend. Möbel, bedeckt vom Staub der Jahrhunderte und von der langen Feuchtigkeit verrottet, boten sich meinen Augen dar. Überall gab es ausgedehnte Spinnennetze, und riesige Fledermäuse flappten mit ihren knochigen, unheimlichen Flügeln überall in den sonst unbewohnten Räumen.
Ich führte penibel Buch über mein genaues Alter bis hin zu Tag und Stunde, denn jede Bewegung des Pendels der mächtigen Uhr in der Bibliothek nahm mir ein Stück von meinem dem Untergang geweihten Leben. Schließlich näherte ich mich dem Zeitpunkt, den ich schon so lange befürchtet hatte. Da die meisten meiner Vorfahren, kurz bevor sie das genaue Alter von Henri erreicht hatten, umgekommen waren, war ich jeden Moment auf der Hut vor dem unbekannten Tod. Auf welche seltsame Art ich zu Tode kommen sollte, wusste ich nicht, doch ich war entschlossen, dass er mich nicht als feiges oder handlungsunfähiges Opfer vorfinden sollte. Mit neuer Kraft widmete ich mich meinen Untersuchungen des alten Schlosses und was sich darin befand.
Es war auf einer meiner ausgedehntesten Entdeckungsstreifzüge durch die verlassenen Teile des Schlosses, weniger als eine Woche vor dem Zeitpunkt, der die Stunde meines längstmöglichen Aufenthalts in dieser Welt markierte, über die hinaus nicht die leiseste Hoffnung auf ein Weiterleben bestand, dass mir das entscheidende Ereignis meines Lebens widerfuhr. Den größten Teil des Morgens hatte ich damit verbracht, halb verfallene Treppen in einem der am meisten in Mitleidenschaft gezogenen alten Türme hoch- und runterzusteigen. Im Verlauf des Nachmittags untersuchte ich die tiefer gelegenen Teile und stieg in einen Raum hinab, der entweder ein mittelalterliches Verlies oder ein später angelegtes Pulvermagazin zu sein schien. Als ich langsam durch den salpeterverkrusteten Gang am Fuß der Treppe lief, wurde der Boden sehr feucht, und schon bald sah ich im flackernden Schein meiner Fackel, dass mir eine vor Wasser triefende Mauer den Weg versperrte. Als ich mich umdrehte, um zurückzugehen, fiel mein Blick auf eine Falltür mit einem Ring, die sich direkt neben meinen Füßen befand. Ich hielt inne, und mir gelang es unter Schwierigkeiten, sie anzuheben. Sie enthüllte einen schwarzen Abgrund, aus dem ekelhafte Dämpfe drangen, die meine Fackel flackern ließen, und in dem unsteten Lichtschein sah ich den Anfang einer steinernen Treppenflucht.
Sobald die Fackel, die ich in die abstoßende Tiefe hineinhielt, gleichmäßig und hell brannte, begann ich mit dem Abstieg. Es waren viele Stufen, und sie führten zu einem engen, mit Steinen gefliesten Gang, der, wie mir klar war, tief unter der Erde liegen musste. Der Gang erwies sich als sehr lang und endete vor einer massiven Eichentür, die mit der hier unten allgegenwärtigen Feuchtigkeit überzogen war und meinen Versuchen, sie zu öffnen, widerstand. Nachdem ich meine Bemühungen in dieser Richtung aufgegeben hatte und ein Stück weit Richtung Treppe zurückgegangen war, wurde ich auf einmal mit etwas konfrontiert, das wohl die schauerlichste und beeindruckendste Erfahrung war, die ein menschlicher Geist zu ertragen in der Lage ist. Unvermittelt hörte ich, wie sich die schwere Tür hinter mir quietschend in ihren verrosteten Angeln öffnete. In meiner Aufregung war ich zu keiner vernünftigen Beurteilung der Situation fähig. An einem Ort, der so verlassen wie das alte Schloss ist, plötzlich mit der Anwesenheit eines Menschen oder Geistes konfrontiert zu werden, löste in mir ein unbeschreibliches Grauen aus. Als ich mich schließlich zu der Quelle des Geräuschs umdrehte, sind mir fast die Augen aus dem Kopf gefallen über den Anblick, der sich mir bot.
Dort in dem spitzbogigen Eingang stand eine menschliche Gestalt. Es war die eines Mannes, der eine eng anliegende Kappe und eine lange mittelalterliche Tunika von dunkler Farbe trug. Sein langes Haar und der wallende Bart waren von tiefschwarzer Farbe und unwahrscheinlich dicht. Seine Stirn war überdurchschnittlich hoch, seine Wangen tief eingesunken und faltig, und seine Hände, lang und wie Klauen gebogen, waren von einer tödlichen marmornen Blässe, wie ich sie noch nie an einem Menschen gesehen hatte. Sein Körper war dürr, fast ein Skelett, und auf seltsame Art gebeugt und verlor sich fast in den dicken Falten seines eigenartigen Gewands. Doch das Merkwürdigste waren seine Augen, zwei Höhlen abgrundtiefer Schwärze mit einem allwissenden Ausdruck, doch von unmenschlicher Bosheit geprägt. Sie waren jetzt auf mich gerichtet, durchstachen meine Seele mit ihrem Hass und bannten mich auf die Stelle, an der ich mich befand.
Schließlich sprach die Gestalt mit einer grollenden Stimme, deren dumpfer Grabesklang und unterschwellige Feindseligkeit mir einen Schauder durch den Köper jagte. Die Sprache, die die Gestalt benutzte, war jene heruntergekommene Form des Lateins, die von den etwas gebildeteren Menschen im Mittelalter benutzt wurde und die ich durch meine Nachforschungen in den Werken der alten Alchimisten und Dämonologen kannte. Die Erscheinung sprach von dem Fluch, der auf meinem Geschlecht lag, und von meinem bevorstehenden Ende, redete von dem Unrecht, das mein Vorfahr dem alten Michel Mauvais angetan hatte, und freute sich über die Rache des Charles Le Sorcier. Sie erzählte, wie der junge Charles in die Nacht geflohen war, nach Jahren zurückkam und den Erben Godfrey mit einem Pfeil tötete, kurz bevor er das Alter seines Vater bei dem Mord erreicht hatte, wie er heimlich zu den Besitzungen zurückgekehrt war und sich in dem schon damals zerstörten unterirdischen Raum eingenistet hatte, in dessen Tür jetzt der grässliche Erzähler stand. Er hatte Robert, Sohn des Godfrey, auf einem Feld überwältigt, ihm Gift eingeflößt und dann im Alter von zweiunddreißig dem Tod überlassen und so seinem Rachefluch Genüge getan. An dieser Stelle blieb es mir überlassen, das größte aller Geheimnisse zu lösen, wie nämlich der Fluch weiterhin erfüllt worden war, als Charles Le Sorcier, der Natur gehorchend, hatte sterben müssen, denn der Mann erging sich nun in der Darstellung der intensiven alchimistischen Studien der beiden Zauberer, Vater und Sohn, und berichtete insbesondere über die Forschungen Charles Le Sorciers bezüglich eines Elixiers, das dem, der es einnahm, ewiges Leben und Jugend gewähren sollte.
Seine Begeisterung schien für einen Moment die finstere Feindseligkeit aus seinen schrecklichen Augen zu tilgen, die mir anfänglich solche Furcht eingejagt hatten, doch plötzlich kam der teuflische Glanz wieder, und mit einem schaurigen Laut, dem Zischen einer Schlange ähnlich, hob der Fremde eine Glasphiole, um augenscheinlich meinem Leben genauso ein Ende zu setzen, wie es Charles Le Sorcier vor sechshundert Jahren mit meinem Vorfahren gemacht hatte. Das Erwachen meines Selbsterhaltungswillens löste den Bann, der mich bis jetzt hatte unbeweglich verharren lassen, und ich warf meine verlöschende Fackel auf die Kreatur, die mein Leben bedrohte. Ich vernahm, wie die Phiole harmlos auf den Steinen des Ganges zerbrach, als die Tunika des seltsamen Mannes Feuer fing und die grauenhafte Szenerie in einen schrecklichen Glanz getaucht wurde. Das Entsetzens- und Hassgeschrei, das der verhinderte Meuchelmörder ausstieß, erwies sich als zu viel für meine schon angegriffenen Nerven, und ich brach bewusstlos auf dem glitschigen Boden zusammen.
Als ich endlich wieder zu mir kam, herrschte schreckliche Dunkelheit, und mein Verstand, in Erinnerung an die Geschehnisse, zuckte davor zurück, noch mehr sehen zu müssen, doch seltsamerweise meisterte er dies. Wer, so fragte ich mich, war dieser boshafte Mann und wie war er in das Schloss gekommen? Warum sollte er den Tod des Michel Mauvais rächen, und wie war der Fluch durch all die langen Jahrhunderte seit Charles Le Sorcier aufrechterhalten worden? Die jahrelange Last war von meinen Schultern genommen, denn ich wusste, dass der, den ich niedergestreckt hatte, der Grund für die aus dem Fluch entstehende Gefahr gewesen war, und nun, da ich frei davon war, brannte ich darauf, mehr über die düsteren Umstände zu erfahren, die mein Geschlecht seit Jahrhunderten verfolgt und meine Jugend zu einem einzigen langen Alptraum gemacht hatten. Bereit zu weiteren Nachforschungen, suchte ich in meinen Taschen nach einem Feuerstein und Stahl und entzündete eine neue Fackel, die ich bei mir hatte.
Zuerst enthüllte das neue Licht die entstellte schwarze Gestalt des geheimnisvollen Fremden. Die grässlichen Augen waren jetzt geschlossen. Angeekelt von dem Anblick, drehte ich mich weg und betrat durch die spitzbogige Tür den dahinter liegenden Raum. Was ich vorfand, ähnelte sehr stark einem alchimistischen Labor. In einer Ecke befand sich ein riesiger Stapel gelben Metalls, das im Licht der Fackel beeindruckend glitzerte. Wahrscheinlich war es Gold, aber ich nahm mir nicht die Zeit, es zu untersuchen, denn ich war von dem, was ich durchgemacht hatte, merkwürdig betroffen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes befand sich eine Öffnung, die in eine der vielen wilden Schluchten des dunklen Waldes an der Hügelflanke führte. Erstaunt, doch nun wissend, wie der Mann sich Zugang zum Schloss verschafft hatte, machte ich mich auf den Rückweg. Ich wollte mit abgewandtem Kopf an den Überresten des Fremden vorbei, doch als ich näher kam, glaubte ich einen schwachen Laut von dem Körper zu vernehmen, so als ob noch nicht alles Leben aus ihm gewichen wäre. Bestürzt drehte ich mich um und untersuchte die verkohlte und zusammengeschrumpfte Gestalt auf dem Boden.
Plötzlich öffneten sich die schrecklichen Augen, die noch schwärzer waren als das verkohlte Gesicht, in dem sie saßen, und in ihnen lag ein Ausdruck, den ich nicht zu deuten wusste. Die aufgeplatzten Lippen versuchten Worte zu formen, die ich kaum verstand. Ich hörte den Namen Charles Le Sorcier und glaubte die Worte »Jahre« und »Fluch« aus dem zerstörten Mund zu vernehmen. Aber ich konnte immer noch keinen Sinn in dem unzusammenhängenden Gestammel erkennen. Über meine offensichtliche Unfähigkeit, ihn zu verstehen, blitzten mich seine dunklen Augen erneut voller Feindseligkeit an, bis ich trotz der Hilflosigkeit meines Gegners doch zu zittern begann.
Plötzlich erhob das Wrack mit einer letzten Kraftanstrengung seinen grässlichen Kopf von den feuchten, eingesunkenen Fliesen. Dann, als ich immer noch vor Angst bewegungsunfähig verharrte, schrie er die Worte heraus, die mich seitdem Tag und Nacht verfolgen. »Dummkopf!«, schrie er. »Ahnst du nicht mein Geheimnis? Hast du keinen Verstand, dass du erkennst, welcher Wille durch sechs Jahrhunderte hindurch den schrecklichen Fluch an deinem Geschlecht vollzogen hat? Habe ich dir nicht vom mächtigen Elixier des ewigen Lebens erzählt? Weißt du nicht, wie dieses Geheimnis der Alchimie aufgedeckt wurde? Ich sage dir, ich war es! Ich! Ich habe sechshundert Jahre gelebt, um meine Rache zu vollziehen, denn ich bin Charles Le Sorcier!«
Das Grab
Wenn ich die Umstände in Betracht ziehe, die zu meiner Inhaftierung in diesem Hort für Geisteskranke geführt haben, ist mir bewusst, dass meine momentane Situation einen natürlichen Zweifel an der Wahrheit meines Berichts hervorrufen muss. Es ist eine missliche Tatsache, dass die geistigen Fähigkeiten eines Großteils der Menschheit zu beschränkt sind, um mit Abgeklärtheit und Intelligenz jene vereinzelten Phänomene abzuwägen, die außerhalb der üblichen Erfahrungen liegen und sich nur psychologisch feinfühligen Individuen erschließen. Männer mit einem größeren Intellekt wissen, dass zwischen dem Realen und dem Irrealen keine scharfe Trennung existiert, dass die Erscheinung der Dinge durch die jeweilige individuelle körperliche und geistige Verfassung, in der wir sie wahrnehmen, bestimmt wird. Doch der prosaische Materialismus der Mehrheit bezeichnet als Wahnsinn die Momente höherer Erkenntnis, die den gewöhnlichen Schleier des bekannten Empirismus durchdringen.
Ich heiße Jervas Dudley und von frühester Kindheit an war ich ein Träumer und Visionär. Wohlhabend genug, um nicht arbeiten zu müssen, und vom Temperament her nicht für die eingefahrenen Studien und sozialen Vergnügungen meiner Mitmenschen geeignet, hatte ich meine Wohnstatt immer in den Reichen jenseits der sichtbaren Welt genommen. Meine Kindheit und Jugend verbrachte ich mit alten und wenig bekannten Büchern und mit Streifzügen durch die Felder und Haine unseres Stammsitzes. Ich glaube nicht, dass, was ich in den Bücher las oder in den Feldern und Hainen gesehen habe, genau dem entsprach, was andere Jungen gelesen und gesehen haben, doch davon darf ich nicht viel preisgeben, denn würde ich darüber sprechen, bestätigte dies nur die grausamen Verleumdungen meiner Intelligenz, die ich manchmal dem Flüstern der verborgenen Wächter um mich herum entnehme. Es genügt mir, die Geschehnisse zu berichten, ohne nach ihren Gründen zu fragen.
Ich habe schon gesagt, dass ich jenseits der sichtbaren Welt meine Heimstatt habe, doch nicht, dass ich dort alleine wohnte. Dies sollte kein menschliches Wesen tun, denn die Abwesenheit der Gesellschaft Lebender, zieht unweigerlich die Gesellschaft von Dingen nach sich, die nicht oder nicht mehr leben. Ganz in der Nähe meines Heims befindet sich eine bewaldete Senke, in deren dämmriger Abgeschiedenheit ich die meiste Zeit mit Lesen, Nachdenken und Träumen verbrachte! Dort, die moosbewachsenen Abhänge hinab, unternahm ich die ersten Schritte meiner Kindheit und um die merkwürdig verkrüppelten Eichen herum, wob ich meine ersten kindlichen Fantasievorstellungen. Die Dryaden, die diese Bäume bewachen, lernte ich gut kennen und habe häufig ihre wilden Tänze in den zitternden Strahlen eines abnehmenden Mondes beobachtet – doch davon sollte ich nicht sprechen. Ich will nur von dem einsamen Grab im dunkelsten Gebüsch des Hügels berichten, das verwüstete Grab der Hydes, einer alten, herausragenden Familie, deren letzter direkter Nachfahre schon viele Jahrzehnte vor meiner Geburt in sein dunkles Refugium gebettet worden war.
Das Grabmal, von dem ich hier spreche, ist aus altem Granit, der seit vielen Generationen vom Nebel und der Feuchtigkeit verwittert und blass geworden ist. Es liegt in den Hügel eingebettet, und man erkennt davon nur den Eingang. Die Tür, eine mächtige, hässliche Steinplatte, hängt an rostigen Eisenangeln und ist auf eine abschreckende Art mit schweren Eisenketten und Vorhängeschlössern gesichert, wie es einer grausamen Mode vor einem halben Jahrhundert entsprach. Der Wohnsitz des Geschlechts, dessen Abkömmlinge dort beerdigt sind, hatte einst auf dem Kamm des Hügels gestanden, in dem jetzt das Grab eingelassen ist, doch er war schon vor langer Zeit durch einen Brand zerstört worden, der von einem Blitzschlag ausgelöst worden war. Die älteren Bewohner dieses Landstrichs sprechen manchmal mit leiser und ängstlicher Stimme von dem mitternächtlichen Sturm, der das prachtvolle Herrenhaus zerstört hatte, und murmeln dann etwas von »göttlichem Zorn«, was mit der Zeit mein immer waches Interesse an dem finsteren Grabmal im Wald weiter verstärkte. Nur ein einziger Mann entkam dem Feuer. Als der letzte der Hydes an jenem Platz der schattigen Ruhe beigesetzt wurde, kam die Urne mit seiner Asche aus einem fernen Land, in das sich die Familie zurückgezogen hatte, als ihr Anwesen niedergebrannt war. Niemand war mehr übrig, um Blumen vor den Eingang zu legen, und nur wenige waren mutig genug, um den niederdrückenden Schatten zu begegnen, die merkwürdig um die verwitterten Steine zu tanzen schienen.
Ich werde nie den Nachmittag vergessen, als ich zum ersten Mal über das halb versteckte Haus des Todes gestolpert bin. Es war im Hochsommer, wenn die magischen Kräfte der Natur die Wälder in eine lebende und fast überschäumende grüne Masse verwandeln und die Sinne von dem wogenden grünen Meer und den feinen Gerüchen der Erde und der Vegetation berauscht werden. In dieser Umgebung verliert der Geist seinen Bezugspunkt, Zeit und Raum werden trivial und irreal, und die Echos einer vergessenen, vorzeitlichen Vergangenheit trommeln beständig auf das verzauberte Bewusstsein ein.
Ich war den ganzen Tag durch die geheimnisvollen Haine der Senke gewandert, gab mich Gedanken hin, die ich hier nicht erörtern will, und beschäftigte mich mit Dingen, die ich nicht preisgeben muss. Im Alter von zehn Jahren hatte ich von vielen Wundern gehört und sie gesehen, die der großen Masse unbekannt sind, und war unter bestimmten Gesichtspunkten schon seltsam alt. Als ich mir meinen Weg zwischen zwei verwachsenen Ansammlungen von Dornensträuchern hindurch gebahnt hatte, lag der Eingang der Gruft plötzlich vor mir. Ich hatte keine Ahnung, was ich da entdeckt hatte. Die dunklen Granitblöcke, die merkwürdig verschlossene Tür und die Grabreliefs über dem Eingangsbogen erweckten in mir kein Gefühl der Traurigkeit oder des Schreckens. Ich wusste viel über Gräber und Grüfte und meine Fantasie beschäftigte sich damit, doch man hatte mich in Hinblick auf mein besonderes Temperament von allen Begräbnisstätten und Friedhöfen ferngehalten. Das merkwürdige steinerne Gebäude in dem bewaldeten Hang weckte in mir lediglich mein Interesse und meine Vorstellungskraft und das kalte, feuchte Innere, in das ich vergeblich durch einen quälend offen stehenden Spalt spähte, barg für mich keinen Hinweis auf Tod und Niedergang. Doch dieser Augenblick der Neugierde gebar das verrückte, irrationale Verlangen, das mich in diese Hölle der Inhaftierung gebracht hat. Angespornt durch eine Stimme, die von der abscheulichen Seele des Waldes herstammen musste, beschloss ich, das lockende Dunkel trotz der massiven Ketten, die mir den Zugang versperrten, zu betreten. Im vergehenden Tageslicht rüttelte ich abwechselnd an der rostigen Absperrung, um das Steintor weiter zu öffnen, oder versuchte meine schlanke Gestalt durch den schon entstandenen Spalt zu schieben, doch mit keinem von beiden hatte ich Erfolg. War ich zuerst nur neugierig, so war ich jetzt besessen, und als ich in der zunehmenden Dämmerung nach Hause kam, schwor ich zu den hundert Göttern dieser Gruft, dass ich mir eines Tages um jeden Preis Zutritt zu den schwarzen, kalten Tiefen verschaffen würde, die nach mir zu rufen schienen. Der Arzt mit dem stahlgrauen Bart, der mich jeden Tag besucht, sagte einmal zu einem Besucher, dass diese Entscheidung der Anfang meiner bedauernswerten Monomanie war, doch ich will das endgültige Urteil darüber meinen Lesern überlassen, wenn sie alles erfahren haben.
Die Monate, die auf meine Entdeckung folgten, verbrachte ich mit vergeblichen Versuchen, das komplizierte Vorhängeschloss an der einen Spalt offen stehenden Gruft zu bezwingen, und mit vorsichtigen Erkundigungen über das Wesen und die Geschichte dieses Gebäudes. Mit den bekanntermaßen hellhörigen Ohren eines kleinen Jungen erfuhr ich viel, doch eine mir eigene Geheimniskrämerei hielt mich davon ab, jemandem von meinen Erkenntnissen oder meinem Entschluss zu erzählen. Es ist vielleicht erwähnenswert, dass ich von dem, was ich über das Wesen der Gruft erfuhr, weder überrascht noch verängstigt war. Meine ziemlich ungewöhnlichen Vorstellungen über das Leben und den Tod hatten mich dazu gebracht, eine unbestimmte Verbindung zwischen dem kalten Lehm und einem lebenden Körper zu vermuten, und ich spürte, dass die mächtige und finstere Familie des abgebrannten Herrenhauses in irgendeiner Form in dem steinernen Grabmal präsent war, das ich erkunden wollte. Geflüsterte Geschichten über die abseitigen Rituale und gottlosen Vergnügungen, die in der Vergangenheit in dem alten Saal stattgefunden hatten, weckten in mir ein noch größeres Interesse an dem Grab, vor dessen Tor ich jeden Tag ein paar Stunden saß. Einmal warf ich durch den schmalen Türspalt eine Kerze hinein, konnte aber außer einer feuchten Steintreppe, die nach unten führte, nichts erkennen. Der Geruch des Ortes stieß mich gleichzeitig ab und verzauberte mich. Ich spürte, dass ich ihn von früher kannte, aus einer Vergangenheit, die jenseits der Erinnerung liegt, sogar jenseits meines Aufenthalts in diesem Körper hier.
In dem Jahr nach der Entdeckung des Grabes stolperte ich auf dem mit Büchern vollgestopften Dachboden unseres Hauses über eine wurmstichige Übersetzung von Plutarchs Parallelbiographien. Als ich vom Leben des Theseus las, war ich sehr beeindruckt von dem Abschnitt, in dem von dem großen Stein berichtet wird, unter dem der jugendliche Held seine Bestimmung finden sollte, wenn er alt genug wäre, das riesige Gewicht anzuheben. Diese Legende zähmte meine brennende Ungeduld, die Gruft zu betreten, denn sie gab mir das Gefühl, dass die Zeit noch nicht gekommen war. Ich redete mir ein, warten zu müssen, bis ich genügend Kraft und Erfindungsgabe besäße, die mich in die Lage versetzten, die schweren Ketten an der Tür mit Leichtigkeit zu öffnen, und bis dahin wäre es besser, sich in das zu fügen, was der Wille des Schicksals schien.
Folglich wurden meine Aufenthalte vor dem feuchten Steinportal seltener und ich verbrachte die meiste Zeit mit anderen, gleichfalls befremdlichen Beschäftigungen. Manchmal stand ich in der Nacht ganz leise auf, um über jene Friedhöfe und Begräbnisstätten zu wandern, von denen mich meine Eltern ferngehalten hatten. Was ich dort gemacht habe, erzähle ich besser nicht, denn ich bin mir über die Realität bestimmter Dinge jetzt nicht mehr sicher, doch ich weiß, dass ich an Tagen nach solchen nächtlichen Streifzügen meine Umgebung häufig mit der Kenntnis von Dingen verblüfft habe, die seit Generationen in Vergessenheit geraten waren. Nach einer solchen Nacht überraschte ich meine Mitmenschen mit einem seltsamen Hinweis auf das Begräbnis des reichen und berühmten Richter Brewster, einer Persönlichkeit in der Geschichte dieses Landstrichs, der 1711 beigesetzt worden war und dessen Schiefergrabstein, in dem ein Totenkopf und gekreuzte Knochen eingemeißelt waren, langsam zu Staub zerfiel. In einem Anfall von kindlicher Fantasie beschwor ich, dass nicht nur der Totengräber Goodman Simpson vor der Beerdigung die Schuhe mit den silbernen Schnallen, die Seidenstrümpfe und die Samthosen des Verstorbenen gestohlen hätte, sondern auch, dass sich der nicht ganz tote Richter am Tage nach der Beisetzung noch zwei Mal in seinem Sarg herumgedreht hätte.
Doch der Gedanke, die Gruft zu betreten, ging mir nie aus dem Kopf und wurde noch von der unerwarteten genealogischen Entdeckung verstärkt, dass meine Vorfahren mütterlicherseits eine schwache Verbindung zu der als ausgestorben geltenden Familie Hydes aufwiesen. Als Letzter meiner väterlichen Linie war ich auch der letzte Nachkomme dieser älteren, geheimnisvolleren Linie. In mir breitete sich das Gefühl aus, das Grab gehöre mir, und ich fieberte mit heißem Verlangen dem Tag entgegen, an dem ich durch das Steinportal und die glitschigen Steinstufen hinab in die Dunkelheit schreiten würde. Ich entwickelte jetzt die Angewohnheit, angespannt an dem schmalen Spalt an der Tür zu horchen, wobei die bevorzugte Zeit für meine befremdliche Nachtwache die stillen Stunden um Mitternacht waren. Als ich volljährig wurde, hatte ich vor der verwitterten Fassade im Abhang eine kleine Lichtung in dem Dickicht geschaffen, und die umgebende Vegetation war wie die Wände und das Dach einer Gartenlaube darum herumgewachsen. Diese Laube war mein Tempel, die versperrte Tür mein Schrein, und dort lag ich auf dem Moos und hing absonderlichen Gedanken nach und träumte merkwürdige Träume.
Es war eine schwüle Nacht, in der mir die erste Enthüllung zuteilwurde. Ich musste aus Müdigkeit eingeschlafen sein, denn als ich die Stimmen hörte, hatte ich das deutliche Gefühl aufzuwachen. Ich zögere, von deren Klang und Akzent zu sprechen, und über ihr Wesen werde ich gar nichts sagen, doch ich kann sagen, dass sie in Wortwahl, Betonung und der Art der Aussprache eine unheimliche Andersartigkeit aufwiesen. Von dem groben Dialekt der puritanischen Kolonisten bis hin zu der präzisen Sprechweise von vor fünfzig Jahren schien jede Spielart der Ausdrucksweise in Neuengland vertreten, doch diese Tatsache wurde mir erst später bewusst. Zu diesem Zeitpunkt wurde meine Aufmerksamkeit von einem anderen Phänomen eingenommen, ein Phänomen, so verschwommen, dass ich keinen Eid darauf leisten kann, dass es real war. Ich hatte wohl die Vorstellung, dass bei meinem Erwachen in dem tief im Hang liegenden Grabmal ein Licht schnell gelöscht worden war. Ich glaube nicht, dass ich erstaunt oder erschreckt war, doch ich weiß, dass ich mich in dieser Nacht entscheidend und nachhaltig verändert habe. Als ich nach Hause kam, ging ich sofort zu einer verrotteten Kiste auf dem Dachboden, worin ich den Schlüssel fand, mit dem ich am nächsten Tag ganz einfach die Barriere überwand, gegen die ich so lange vergeblich angerannt war.
Im sanften Licht des späten Nachmittags betrat ich zum ersten Mal die Gruft in dem einsamen Hang. Ich war wie verzaubert, und mein Herz hüpfte vor einer Erregung, die ich nur als verworfen bezeichnen kann. Als ich die Tür hinter mir schloss und die feuchten Stufen im Licht meiner einsamen Kerze hinabstieg, hatte ich das Gefühl, den Weg zu kennen, und wenn die Kerze auch in den stickigen Ausdünstungen des Ortes flackerte, fühlte ich mich eigenartigerweise in der muffigen Grabesluft zu Hause. Als ich mich umsah, erblickte ich viele Marmorplatten, die Särge oder Überreste von Särgen trugen. Einige waren versiegelt und gut erhalten, andere aber waren fast verschwunden und nur die silbernen Griffe und Tafeln waren in weißlichen Staubhufen zurückgeblieben. Auf einer der Tafeln las ich den Namen von Sir Geoffrey Hydes, der im Jahr 1640 aus Sussex gekommen und ein paar Jahre später hier gestorben war. In einer auffälligen Nische stand ein ziemlich gut erhaltener und leerer Sarg, an dem ein einzelner Name angebracht war, der mich zugleich lächeln und erschaudern ließ. Auf einen befremdlichen Impuls hin kletterte ich auf die breite Marmorplatte, löschte meine Kerze und legte mich in die leere Kiste.
Im Morgengrauen schwankte ich aus der Gruft und verschloss hinter mir die Tür mit der Kette. Ich war nicht länger ein junger Mann, obwohl erst einundzwanzig Winter meinen Körper hatten frösteln lassen. Die Frühaufsteher unter den Dorfbewohnern, die mich auf dem Nachhauseweg sahen, musterten mich auf seltsame Art und wunderten sich über die Anzeichen von ausschweifenden Vergnügungen bei jemand, der für seine nüchterne und zurückgezogene Lebensweise bekannt war. Ich zeigte mich meinen Eltern erst nach einem langen und erfrischenden Schlaf.
Von da an besuchte ich die Gruft jede Nacht und sah, hörte und tat Dinge, an die ich mich nicht erinnern darf. Meine Sprechweise, die schon immer von den Lebensumständen beeinflusst wurde, war das Erste, was der Veränderung unterlag, und meine plötzlich auftretende altertümliche Sprache fiel schon bald auf. Später bestimmten eine befremdliche Kühnheit und Verwegenheit mein Verhalten, bis ich schließlich unbewusst eine weltmännische Art an den Tag legte, die nicht zu meiner lebenslangen Abgeschiedenheit passte. Meine vormals stille Zunge sprach mit der spielerischen Grazie eines Chesterfield oder mit dem gottlosen Zynismus eines Rochester. Ich zeigte eine eigentümliche Gelehrtheit, ganz anders als das mönchhafte Wissen, über das ich in meiner Jugend gebrütet hatte, und beschrieb die Vorsatzblätter meiner Bücher mit lockeren, improvisierten Spottgedichten, die an Gay, Prior und die begabtesten augustinischen Gelehrten und Verseschmiede erinnerten. Eines Morgens beim Frühstück kam es fast zur Katastrophe, als ich in Nachahmung eines angetrunkenen Tonfalls einen Erguss weinseligen Frohsinns des achtzehnten Jahrhunderts, ein Stück georgischer Ausgelassenheit, die nie in einem Buch gestanden hat, zum Besten gab, der etwa so lautete:
Her zu mir, Freunde, mit den Humpen voll Bier,
Und trinkt auf das Jetzt, solang ihr noch hier,
Häuft auf die Teller euch ein gut’s Stück vom Rind,
Denn Speisen und Trank geben, dass fröhlich wir sind:
So füllt Euer Glas,
Bald endet der Spaß;
Weil auf König und Maid leert ein Toter kein Fass!
Anakreons Nase war rot, sag einer an;
Doch stört so’n Zinken einen lustigen Mann?
Zum Henker! Rot bin ich lieber vom Gerstensaft,
Als weiß wie ’ne Lilie – und in Grabeshaft!
Nun, Betty, mein Schatz,
Komm gib mir ’nen Schmatz;
Denn für Wirtstöchter ist in der Hölle kein Platz!
Jung Harry ist auch nicht mehr ganz taufrisch,
Verliert bald die Peruk’ und rutscht unter’n Tisch
Doch füllt die Pokale, lasst mir keinen geleert –
Besser doch unter’m Tisch als unter der Erd!
So schwelget und schluckt,
Wenn der Durst Euch juckt;
Sechs Fuß unter’m Rasen wird sich nicht gemuckt!
Hol’s der Teufel! Ich kann kaum mehr geh’n;
Verdammich, und auch weder reden noch steh’n!
Heh, Gastwirt, schaff Er mir Platz auf einer Bank;
Ich bleib noch was hier, denn meine Frau ist krank!
Jetzt setz’ ich mich hin;
Sonst schlag ich lang hin,
Doch treib’ ich’s lustig, solang ich auf Erden bin!
Ungefähr um diese Zeit entwickelte sich meine heutige Angst vor Feuer und Gewitter. Waren mir diese Dinge zuvor gleichgültig gewesen, empfand ich nun eine unaussprechliche Furcht davor und zog mich in die innersten Räume des Hauses zurück, wenn sich am Himmel ein solches elektrisches Schauspiel ankündigte. Eine meiner beliebtesten Zufluchtsstätten war der verfallene Keller des abgebrannten Herrenhauses, und ich stellte mir immer vor, wie das Gebäude wohl zu seiner Blütezeit ausgesehen hatte. Einmal verblüffte ich einen Dorfbewohner, indem ich ihn völlig selbstgewiss zu einem niedrigen Zwischenkeller führte, von dessen Existenz ich zu wissen schien, obwohl dieser schon seit Generationen nicht mehr aufgesucht worden und in Vergessenheit geraten war.
Zuletzt geschah, was ich schon lange befürchtet hatte. Meine Eltern, beunruhigt vom veränderten Verhalten und Erscheinungsbild ihres einzigen Sohnes, begannen über meine Unternehmungen ein Spionagenetz auszubreiten, das zu einer Katastrophe zu führen drohte. Ich hatte niemandem von meinen Besuchen des Grabes erzählt und mein Geheimnis seit den Kindertagen mit religiöser Inbrunst gehütet, doch nun war ich gezwungen, bei meinem Weg durch die Irrgärten der bewaldeten Senke Vorsicht walten zu lassen und mögliche Verfolger abzuschütteln. Meinen Schlüssel zur Gruft, von dem nur ich wusste, trug ich an einer Schnur um den Hals. Niemals nahm ich etwas von den Dingen, die ich im Grabmal entdeckte, mit hinaus.
Eines Morgens, als ich aus dem feuchten Grab herauskam und mit zitternden Händen die Kette vor dem Portal verschloss, gewahrte ich im Dickicht das schon lange befürchtete Gesicht eines Beobachters. Das unvermeidbare Ende war nah, denn meine Laube war entdeckt und das Ziel meiner nächtlichen Ausflüge enthüllt. Der Mann sprach mich nicht an, deshalb eilte ich nach Hause, um zu belauschen, was er meinem sorgengeplagten Vater berichtete. Standen meine Besuche hinter der mit Ketten verschlossenen Tür davor, aller Welt bekannt zu werden? Stellen Sie sich meine freudige Überraschung vor, als ich hörte, wie der Spion meinen Eltern in vorsichtigem Flüstern mitteilte, dass ich die Nacht in der Laube vor dem Grab verbracht und mit schläfrigen Augen den schmalen Spalt in der verschlossenen Tür betrachtet hätte. Welches Wunder hatte den Beobachter so in die Irre geleitet? Nun war ich überzeugt, dass eine übernatürliche Macht mich beschützte. Durch diese gottgesandten Umstände wurde ich kühn und begab mich ganz offen zu der Gruft, überzeugt davon, dass niemand mein Eintreten sehen könne. Ich muss nicht lange beschreiben, dass ich eine Woche lang in vollen Zügen die Freuden dieser Leichenfledderei genoss, bis sich das Ding zeigte und ich zu dieser verfluchten Heimstatt des Kummers und der Eintönigkeit gebracht wurde.
Ich hätte in jener Nacht nicht hinausgehen sollen, denn ein Hauch von Donner lag in den Wolken und aus dem stinkenden Sumpf am Grund der Senke stieg ein höllisches Phosphoreszieren auf. Auch der Ruf der Toten war anders. Statt des Grabmals am Hang rief jetzt der niedergebrannte Keller auf der Hügelkuppe nach mir, und der dort herrschende Dämon streckte seine unsichtbaren Finger nach mir aus. Als ich aus einem davor liegenden Hain auf die Lichtung vor die Ruinen trat, sah ich im dunstigen Mondlicht etwas, das ich immer irgendwie erwartet hatte. Das seit einem Jahrhundert zerstörte Herrenhaus erhob sich vor dem staunenden Betrachter wieder in seiner alten Pracht, und alle Fenster glänzten im Licht unzähliger Kerzen. Die Kutschen der Bostoner Honoratioren rollten die lange Auffahrt hinauf, während eine vielköpfige Abordnung gepuderter Stutzer der benachbarten Herrensitze zu Fuß ankam. Ich mischte mich unter die Menge, obwohl mir klar war, dass ich eher zu den Gastgebern als zu den Gästen gehörte. Überall im Saal war Musik, Gelächter, und der Wein floss in Strömen. Ich erkannte eine Reihe von Gesichtern, doch es wäre einfacher gewesen, wenn sie eingeschrumpft oder von Tod und Verfall aufgelöst gewesen wären. In einer wilden und unbändigen Menge war ich der Wildeste und Ausgelassenste. Schreckliche Gotteslästerungen flossen über meine Lippen, und in entsetzlichen Ausbrüchen achtete ich kein Gesetz Gottes, der Menschen oder der Natur.
Plötzlich erklang hoch oben im Dach ein Donnerschlag, dessen Dröhnen selbst noch die ekelhafte Feier übertönte, und brachte die betrunkene Gesellschaft zum Schweigen. Rote Flammenzungen und sengende Hitze schlossen das Haus ein und die vom Grauen eines Unheils, das selbst noch die Grenzen der ungezügelten Natur überschritt, gepackten Zecher flohen schreiend in die Nacht. Ich blieb als Einziger zurück, von einer niederschmetternden Angst, wie ich sie niemals zuvor verspürt hatte, in meinen Sessel gebannt. Und dann ergriff ein weiteres Grauen Besitz von mir. Wenn ich bei lebendigem Leib verbrannte und meine Asche in alle Winde zerstreut würde, dann würde ich nie im Grabmal der Hyde beerdigt werden! Stand dort nicht schon mein Sarg für mich bereit? Hatte ich nicht das Recht bis zum Ende aller Tage zwischen den Nachkommen von Sir Geoffrey Hyde zu ruhen? Jawohl! Ich würde mein Erbe im Grabmal beanspruchen, selbst wenn meine Seele die Zeitalter auf der Suche nach einer anderen passenden Wohnstatt durchstreifen müsste, die dann den freien Platz in der Nische in der Gruft einnehmen würde. Jervas Hyde wird niemals das traurige Schicksal des Palinurus teilen!
Als das Trugbild des brennenden Hauses verblasste, befand ich mich schreiend und um mich schlagend in den Armen zweier Männer, einer davon war der Spion, der mir zur Gruft gefolgt war. Es goss in Strömen, und am südlichen Horizont zuckten Blitze eines Gewitters, das vor Kurzem über uns hinweggezogen war. Mein Vater stand mit sorgenvollem Gesicht dabei, als ich forderte, in das Grab gelegt zu werden, und beschwor die Männer in einem fort, mich so sanft wie möglich zu behandeln. Ein schwarzer Kreis auf dem Boden des zusammengefallenen Kellers zeugte von einem heftigen Blitzeinschlag, und von dort brachte eine Gruppe von Dorfbewohnern mit Laternen ein kleines altertümliches Kästchen, das der Blitzschlag ans Licht gefördert hatte.
Ich gab meine vergeblichen und nutzlosen Befreiungsversuche auf und beobachtete die Anwesenden, wie sie ihren Schatzfund begutachteten, und man erlaubte mir, daran teilzunehmen. Das Kästchen, dessen Schlösser von dem Blitz, der es zutage gefördert hatte, aufgebrochen worden waren, enthielt viele wertvolle Papiere und Dinge, doch ich hatte nur Augen für ein einziges. Es war eine Porzellanminiatur eines jungen Mannes mit hübscher Perücke und trug die Initialen »J. H.«. Das Gesicht vermittelte mir den Eindruck, in einen Spiegel zu schauen.
Am nächsten Tag brachte man mich in diesen Raum mit den vergitterten Fenstern, doch durch einen alten und einfältigen Diener, den ich in meiner Kindheit gemocht hatte und der wie ich den Friedhof liebt, wurde ich über bestimmte Dinge informiert. Was ich gewagt hatte, über meine Erlebnisse in der Gruft zu berichten, brachte mir nur mitleidiges Lächeln ein. Mein Vater, der mich regelmäßig besucht, behauptet, ich hätte nie das verschlossene Portal durchschritten, und beschwor, dass, nachdem er es untersucht hatte, das verrostete Vorhängeschloss in den letzten fünfzig Jahren nicht berührt worden sei. Er sagte auch, dass alle Dorfbewohner von meinen Besuchen bei der Gruft gewusst hätten und man mich häufig beobachtet hätte, wenn ich in der Laube vor der schaurigen Fassade schlief, die halb offenen Augen auf den Spalt gerichtet, der ins Innere führte. Gegen diese Behauptungen habe ich keinen stichhaltigen Beweis anzubieten, denn ich habe meinen Schlüssel bei dem Handgemenge in jener grausigen Nacht verloren. Die seltsamen Dinge aus der Vergangenheit, die ich bei meinen nächtlichen Treffen mit den Toten erfahren habe, tat er als Ausgeburten meiner lebenslangen und alles bestimmenden Beschäftigung mit den alten Büchern in der Familienbibliothek ab. Gäbe es nicht meinen alten Diener Hiram, dann wäre ich zu diesem Zeitpunkt schon vom meinem Wahnsinn überzeugt gewesen.
Hiram aber, treu bis in den Tod, bewahrte seinen Glauben an mich und hat das getan, was mich dazu brachte, zumindest Teile meiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu bringen. Vor einer Woche hat er das Schloss an der Kette, die das Grab verschließt, aufgebrochen und stieg mit einer Laterne in die düstere Tiefe hinab. Auf einer Platte in einer Nische fand er einen alten, aber leeren Sarg, dessen angelaufene Platte nur ein einziges Wort trug: Jervas. Sie versprachen mir, mich in diesem Sarg und in dieser Gruft zu beerdigen.