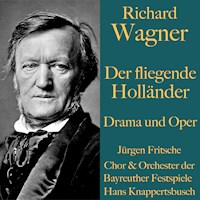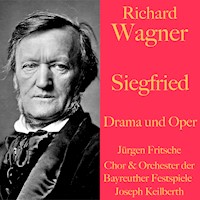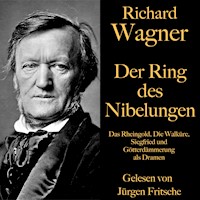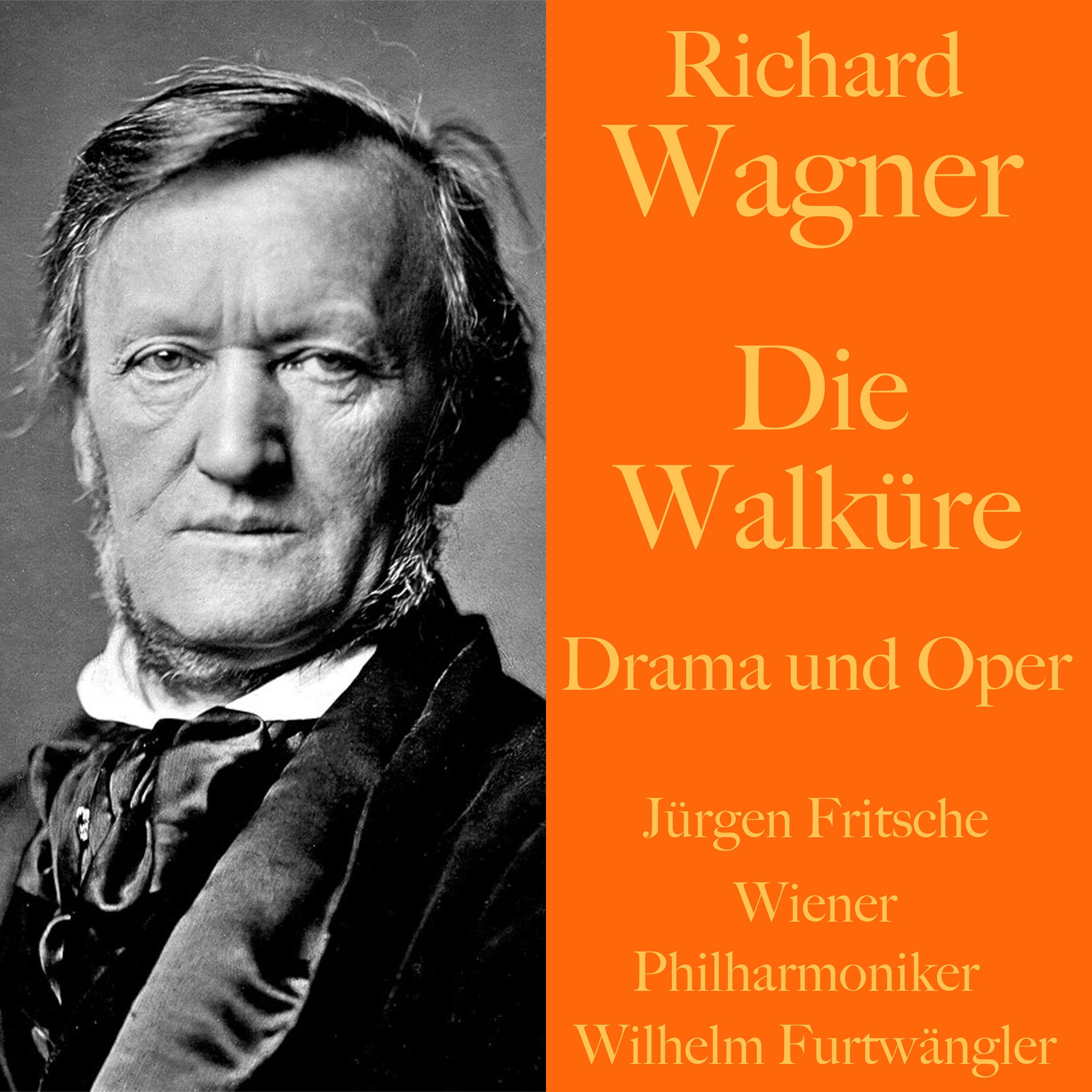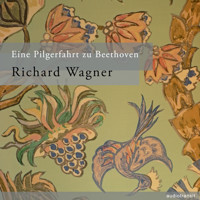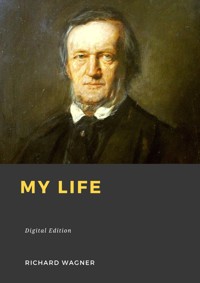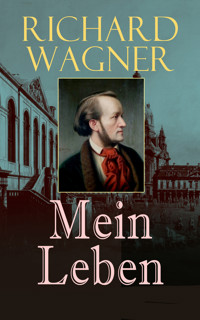9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Traumhafte Landschaften, Verrat und Liebe, Gestern und Heute. Generation für Generation geraten die Mitglieder einer Handwerkerfamilie aus dem rumänischen Banat in den Strudel der großen Geschichte. Die Beerdigung des Vaters ist der Anlass für Werner Zillich, sich die Geschichte seiner Familie vor Augen zu führen, einer schwäbischen Handwerkerfamilie im Banat. Die Müller, Pferdehändler oder Hausfrauen hatten keinerlei Einfluss auf das Weltgeschehen, dennoch hat es ihr Leben folgenreich beeinflusst. So berichtet Zillich vom Abenteuer einer Amerika-Auswanderung im 19. Jahrhundert und vom Liebesentzug eines zurückgelassenen Kindes; er erzählt von einer heimlichen Liebe im Arbeitslager der Nachkriegszeit und von der käuflichen Lust junger ungarischer Prostituierter unserer Tage. Ein bedeutendes Familienepos von großer Wärme und Klugheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Richard Wagner
Richard Wagner, geboren 1953, ist Autor von Lyrik und Prosa sowie Journalist und Essayist. Geboren im Banat, begann er im Kreis der Aktionsgruppe Banat engagierte Lyrik zu schreiben. 1987 konnte er mit seiner damaligen Frau Herta Müller in die BRD ausreisen. Er lebt seitdem in Berlin. Veröffentlichung mehrerer Gedichtbände, ausgezeichnet u. a. mit dem Sonderpreis des Leonce-und-Lena-Preises und dem Förderpreis des Andreas-Gryphius-Preises. 2014 wurde ihm das Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland verliehen.
Informationen zum Buch
Traumhafte Landschaften, Verrat und Liebe, Gestern und Heute. Generation für Generation geraten die Mitglieder einer Handwerkerfamilie aus dem rumänischen Banat in den Strudel der großen Geschichte.
Die Beerdigung des Vaters ist der Anlass für Werner Zillich, sich die Geschichte seiner Familie vor Augen zu führen, einer schwäbischen Handwerkerfamilie im Banat. Die Müller, Pferdehändler oder Hausfrauen hatten keinerlei Einfluss auf das Weltgeschehen, dennoch hat es ihr Leben folgenreich beeinflusst. So berichtet Zillich vom Abenteuer einer Amerika-Auswanderung im 19. Jahrhundert und vom Liebesentzug eines zurückgelassenen Kindes; er erzählt von einer heimlichen Liebe im Arbeitslager der Nachkriegszeit und von der käuflichen Lust junger ungarischer Prostituierter unserer Tage.
Ein bedeutendes Familienepos von großer Wärme und Klugheit.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Richard Wagner
Habseligkeiten
Inhaltsübersicht
Über Richard Wagner
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Impressum
1
Sie sind tot. Alle sind tot. Sie liegen in ihren Gräbern auf dem Dorffriedhof. Auch mein Vater liegt dort. Seit gestern. Ruht, wie sein Grabstein sagt. Der Grabstein, neu abgeschliffener, verwitterter Marmor, auf dem bereits der Name meiner Mutter steht. Der Name und das Geburtsjahr. Den Platz für das Sterbejahr hat der Steinmetz frei gelassen. Sie lebt ja noch. Sie und ich: Wir leben noch. Wir sind die letzten der Familie. Denn meine Tochter zählt nicht. Sie ist bei meiner Frau.
Ich werde mich gleich von meiner Mutter verabschieden. Sie wird denken, was sie immer denkt: Es ist das letzte Mal, dass sie mich sieht. Bis zum nächsten Mal wird sie tot sein, denkt sie. Und so ist jeder Abschied ein Heftromanabschied.
Meine Mutter hat die halbe »Gartenlaube« gelesen. Eugenie Marlitt. Nataly von Eschtruth und Hedwig Courths-Mahler dazu. Und sie hat eine Menge daraus gelernt. So macht sie aus jedem Tagesereignis eine weitere Komponente des großen sentimentalen Plots, der das Leben ausmisst. Schlägt immer neue Kapitel des Frauenschicksals auf. Manchmal denke ich, alles, was sie sagt, ist das Ergebnis dieser unentwegten Lektüre von Spalten, von Zeitungspapier. Von Heften, die gar nicht wie Bücher aussehen, und damit an Überzeugungskraft gewinnen. Als wären es Zeitungsmeldungen. Nachrichten von der Liebe. Alles, was aus ihrem Mund kommt, ist für mich gewissermaßen ein Zitat der Marlitt, die wohl für einen großen Teil ihres Lebens auf den Rollstuhl angewiesen war. Meine Mutter ist kerngesund.
Ich mache die Tür hinter mir zu, sie weint. Wegen Karls Tod, wegen meiner Abreise. Ich bringe mein Gepäck zum Auto. Sie weint und lebt. Sie wird steinalt, älter als ich. Sie wird mich überleben. Sie und der Mühlstein vor dem Haus. Der uralte Mühlstein aus der Wassermühle, den mein Vater dort abgelegt hat, als Wahrzeichen und Sitzbank. Karl hat zwar nie eine Mühle besessen, aber er leistete sich dafür einen Mühlstein. Einen Stein aus einer aufgegebenen Mühle. Kein Mensch braucht mehr einen Mühlstein. Kaum einer weiß noch, was ein Mühlstein ist. Es ist alles Geschichte, Industriegeschichte. Der nutzlose Mühlstein wurde zur kalten Sitzgelegenheit. Der Müller, mein Vater, ist tot.
Der Mühlstein liegt unter den Pflaumenbäumen. Die reifenden Pflaumen leuchten dunkelblau zwischen dem Blattwerk. Auf das Fleisch der Pflaume beißen, den Kern ausspucken. Einen flachen roten Kern. Spiel. Den Kern in der Mundhöhle behalten, am Gaumen entlangführen, unauffällig in die Backentasche versenken. Verzweifeltes Spiel: Wer hat die meisten Kerne im Mund? Reife Pflaumen liegen im Gras. Ein Ball, der darüber rollt. Ferne Stimmen. Kinderstimmen. Finde sie, wenn du kannst.
Ich fahre heute noch. Heute noch fahre ich zurück. In den milden Septemberabend hinein. Zurück nach Deutschland. In zwei Stunden werde ich an der Grenze sein. Um diese Zeit ist dort wenig los. Das weiß ich aus Erfahrung. Wenn ich Glück habe, kann ich vor der Nacht in Budapest sein.
»Bleib doch noch«, sagt sie mit schwacher Stimme. Mit gekonnt schwacher Stimme, denke ich mir. Ich habe gepackt. Wir sitzen am Tisch. Ich esse. Schafskäse, Wurst, Tomaten, Weißbrot. Tomaten mit dem Geschmack, wie sie ihn in Deutschland nicht haben. Tomaten, im Garten gereift. Sie machen aus meinem Mund für einen Augenblick einen Kindermund.
Meine Mutter sitzt mir gegenüber. Sieht mir beim Essen zu. Sitzt so, als wolle sie jeden Augenblick aufstehen, für den Fall, dass ich noch etwas brauchen sollte, einen Tee, einen Kaffee, damit ich nicht am Steuer einschlafe. Sie fürchtet jedesmal, ich könnte am Steuer einschlafen. Deshalb muss ich sie, wenn ich zurück bin, wenn ich wieder in Sandhofen bin, sofort anrufen. Damit sie beruhigt ist. Nein, es ist nichts passiert.
Bleiben. Ich antworte leise, aber bestimmt. »Du weißt, ich muss arbeiten«, sage ich, und damit bin ich Teil des Rituals zwischen uns.
Arbeiten, denke ich mir. Eine gute Formulierung. Die beste Ausrede in der Welt der kleinen Leute. Damit kommt man immer durch. Arbeiten als Schicksal.
Ich habe nicht viel Gepäck. Nur das Nötigste. Beim Wegfahren hat man nicht viel. Und seit ein paar Jahren auch auf der Hinfahrt nicht. Es ist nicht mehr mit früher zu vergleichen. Als man alles mitschleppen musste, vom Suppenwürfel bis zum Toilettenpapier. Jetzt bekommt man das meiste. Man kann es kaufen. Vorausgesetzt, man hat das nötige Kleingeld. Manche packen beim Wegfahren ja immer noch ’ne Menge ein. Die sogenannten antiken Stücke, die Wanduhren und die Kaffeemühlen, haben sie zwar längst unter Aufbietung aller Tricks und Bestechungskünste an den Zöllnern vorbeigebracht, aber sie nehmen heute noch die Marmeladengläser und die Räucherwurst mit. Beides schmecke in Deutschland nicht. Es sei wie mit den Tomaten. Alles ohne jeden Geschmack. Industrie pur.
Der Dorfmensch muss dem Herstellungsprozess nachspüren können. Dem Wirken der eigenen Hände. Ich esse nur, was deine Hände zubereitet haben, pflegte mein Großvater zu meiner Großmutter zu sagen. Er sagte es stets in Anwesenheit anderer Leute. Mit Vorliebe an Familienfesten. Wenn man sich ins beste Licht zu rücken suchte und es den anderen dann doch mal so richtig sagte. Durch die Blume, wie mein Vater lachend versicherte, aber um so deutlicher. Eine wahre Kunst. Wahrscheinlich gab es diese Feste überhaupt nur, damit man es sich gegenseitig geben konnte. In einem wahren Wettbewerb der Andeutungen und Anspielungen. Wer am besten austeilen konnte, war der Sieger.
Geschickte Hände. Ein Kompliment im Meer der Intrigen.
Wallendes Weizenfeld. So weit das Auge reicht, Feld und Himmel. Gelb und blau. Ein letzter Blick. Ein Foto.
Im Grunde geht es um die liebe Nostalgie. Der Geruch der Räucherwurst und der Geschmack der Aprikosenmarmelade, sie sollen an die verschwundene Kinderwelt erinnern, auf die sie in Deutschland nichts bringt. Sie leben an Orten, die keimfrei sind. Frei von jedem Erinnerungsanstoß, von jeder Gedächtnisstütze. Deshalb haben sie diese Fotos an der Wand, die Fotos von zu Hause. Nein, sie werden trotz aller gegenteiligen Beteuerungen in Deutschland nie heimisch werden, weder in Augsburg noch in Erlangen, denn man lebt nicht von der Gegenwart allein. Niemand lebt von der Gegenwart allein. Umsonst predigt man ihnen von der Neuen Heimat. Die Vergangenheit bleibt eine zwischen ihnen und den Einheimischen hochgezogene Wand. Darüber sagt keiner was, aber immer heißt es wir und dann sie. Wir und sie.
Lissi steht vor dem Haus. Die kleine, verlorene Frau winkt dem Sohn nach. Ich sehe sie zuletzt noch im Rückspiegel, mache ein Handzeichen. So einfach ist das. Ich lasse sie mit der Trauer um den verstorbenen Mann allein. Es ist ihre Sache. Meine Anteilnahme kommt mir wie eine nachträgliche Einmischung vor.
Lissi und Karl haben neunundvierzig Jahre lang zusammen gelebt. Das ist mehr als mein eigenes Leben. Es liegt hinter einer verschlossenen Tür, durch deren Schlüsselloch ich immer wieder blicke, aber nichts sehe. Meine Ansichten über das Leben meiner Eltern gründen auf Vermutungen. Ich sammle Vermutungen über das Leben meiner Eltern. Seit Jahren schon suchte jeder der beiden sich mir gegenüber ins rechte Licht zu rücken. Als hätten sie von meinem heimlichen Hobby gewusst. Bei meinen Besuchen verhielten sie sich so, als hätten sie Hintergedanken, die zu verbergen ihnen kaum gelang.
Das Haus, unser Haus, steht am Dorfrand. Zwischen Dorf und Fluss. Vom Hof aus blickt man auf die Felder, und weit hinten auf die Auwälder am Fluss. Die Felder meiner Kindheit, der Fluss meiner Kindheit. Der träge Fluss, der von oben, aus den Karpaten kommt, ein Gebirgsfluss, der in der Ebene aber langsam ist und breit, es ist sein Unterlauf, wie wir in der Schule lernten, gleich hinter der Grenze, drüben in Ungarn, mündet er in die Theiß.
In meiner Kindheit gehörten die Felder niemandem, sie gehörten dem Staat. Es wuchs mal Weizen darauf, mal Mais. In endlosen Reihen. Der Mais war uns Kindern lieber, weil wir zwischen den Stauden herumtoben konnten, sobald er hoch genug gewachsen war. Fangen spielen und sich verstecken. Die Maisblätter waren hart, lief man zu schnell, schlugen sie einem mit ihren scharfen Rändern ins Gesicht. Die Haut brannte noch lange danach, als hätte man gearbeitet. Der Mais bildete für das Kinderauge ein Labyrinth. Mein Großvater allerdings sah darin die unsichtbaren Linien der früheren Aufteilung. Die schmalen Gräben, die die damaligen Besitzer der Felder zur Markierung gezogen hatten. Pfähle und Feldsteine. Er zeigte darauf, aber ich konnte nichts sehen. In Bastians Kopf waren die Besitzverhältnisse der Vorkriegszeit wie auf einer Landkarte markiert.
Steht man im Hof, hat man das Dorf im Rücken. Das Haus wurde vor dem Ersten Weltkrieg gebaut. Es wurde für John und Katharina gebaut. Wenn wir »unser Haus« sagten, war mehr als der Familienbesitz gemeint, buchstäblich die Verortung der Familie. Und es hieß unverändert »unser Haus« auch in den fünfziger Jahren, als die Kommunisten es uns weggenommen hatten, uns aber weiterhin drin wohnen ließen. Sie nahmen es uns auf dem Papier weg und gaben es uns auf dem Papier wieder zurück. Wir hatten Glück, andere hat man deportiert. Wir durften in unserem Haus bleiben. Wir waren ja keine Großbauern, keine Kulaken.
Ohne Haus keine Familie. Unser Haus, ich werde es verkaufen. Ich fahre die Schlaglochstraße hoch. Fahre ins Dorf hinein. Haus um Haus zieht das Dorf der Toten an mir vorbei. Ich sehe die Bewohner vor mir, die Stichwortgeber meiner Kindheit. Ihre Namen stehen auf den Grabsteinen. Sie wohnen jetzt in einem Dorf unter der Erde und machen alles noch einmal, und es wird auch diesmal nicht besser. Da unten, unsichtbar, lebt das Dorf weiter. In einer Wiederholungsschleife, die so lange läuft, wie die Erinnerung standhält. Ich murmele die Namen. Solange ich die Namen noch weiß, kann das Dorf unter der Erde weiterbestehen.
Am Straßenrand, vor den Häusern, sind die Baumstämme mit Kalk bestrichen. Das soll gegen die Käfer helfen, die Schädlinge aller Art, mit denen der Bauer jahraus, jahrein zu kämpfen hat. Vielleicht ist es aber auch nur das Weiß des Kalks, das die Bäume verschönern soll. Man bestreicht sie vor den Feiertagen, vor Ostern und vor der Kirchweih. So war es früher, und so ist es geblieben, die Rumänen haben den Brauch übernommen.
Ich fahre vorsichtig. Es ist besser so. Die fahren hier nämlich wie die Irren. Die meisten haben erst seit der Wende einen Führerschein. Seit der Revolution, wie man hier sagt; und das, weil ein paar Menschen erschossen wurden. Die meisten wahrscheinlich von den eigenen Leuten, aus Nervosität. Aber was ist die Revolution anderes als ein Ausdruck kollektiver Nervosität? Sie fahren wie die Säue. Man könnte meinen, sie halten ihre Fahrweise für eine revolutionäre Errungenschaft.
Vor der Kirche biege ich links ein, werfe einen Blick auf die Klosterschule, in die meine Mutter ging, um bei den Nonnen lesen und schreiben zu lernen. Bei den Nonnen vom »Notre Dame«, bei den Schwestern, zu denen ich auch ging, aber erst viel später, nach dem Krieg, als die Nonnen keine Nonnen mehr sein durften und das »Notre Dame« geschlossen wurde und der ehemalige Polizist als Narr durchs Dorf lief und zu jedem, den er antraf, sagte: »Ich hätte es nicht tun dürfen!«
Als die Kommunisten die Macht übernahmen, hat er die Madonna über dem Klosterschuleneingang, die Gipsmadonna, mit dem Hammer zertrümmert. Wahrscheinlich wollte er sich damit bei den Kommunisten einen guten Namen machen, vom Polizisten zum Milizmann mutieren, statt dessen erhob ihn Gott zum Narren. Die Madonna aber leuchtete immer noch über dem Eingang, sagten die Leute, wenn sie unter sich waren, wer sie sehen wolle, könne sie sehen.
Als ich in diese Schule ging, war es eine Schule der Pionierlieder. Ich habe sie alle vergessen. Wir malten Buchstaben wie eh und je, und zwei mal zwei war vier und manchmal auch mehr. Bei den Kommunisten war es öfter auch mehr, wie mein Großvater sagte. Ich höre sein dröhnendes Lachen und sehe das missbilligende Kopfschütteln meiner Großmutter. Sie hatte Angst.
Ich fahre am Friedhof vorbei. Auch die Nonnen liegen jetzt dort. Auf den Grabsteinen dürfen sie wieder Nonnen sein. Auf den Grabsteinen stehen ihre Klosternamen, allerdings kaum noch zu entziffern. Von ihnen hat meine Mutter viel gelernt, wie sie sagt. Alles, was sie nicht von ihrer Mutter gelernt hat, hat sie von den Nonnen gelernt, von den Schwestern. Von ihrer Mutter habe sie gar nichts gelernt. Nicht einmal über die Blutung habe diese sie aufgeklärt, so dass das junge Mädchen, als das Blut kam, dachte, es müsse sterben, sagt sie. Sagt es immer noch wie einen Vorwurf gegen ihre Mutter, gegen Theresia, die auf dem Friedhof liegt, seit bald fünfzehn Jahren.
Ich sehe die Trauergemeinde vor mir. Die gestrige Trauergemeinde. Meinen Reisegrund sozusagen. Die alten Menschen, jeder mit seiner Geschichte. Jeder mit der Last seiner Geschichte. Ihre Gebärden sind langsam, als sollten sie das Gewicht der Erfahrungen unterstreichen. Alles Stoff für Romane, wie sie dir versichern. Heftromane.
Manche dieser Geschichten kenne ich, manche nicht. Die meisten kenne ich von meinem Vater. Gott hab’ ihn selig. Wenn er diese Geschichten erzählte, winkte Lissi meistens ab. »Was erfindet er denn schon wieder«, sagte sie zu mir. Man konnte den Eindruck haben, sie sei von ihm, meinem Vater, irgendwann, in einer entscheidenden Situation, belogen worden und habe sich nach und nach an seine Geschichten gewöhnt. Vielleicht wurde diese vermeintliche große Lüge meines Vaters dadurch unwichtiger, wenn alles andere, was er zum besten gab, auch nicht allzu ernst zu nehmen war. Das ist eine meiner Schlüssellochthesen.
Darum aber ging es jetzt nicht. Das war jetzt egal. Es ging darum, ihn zu begraben, Abschied zu nehmen. Dafür waren sie gekommen. Zum großen Abschiednehmen. Nichts Schlechtes über die Toten, nichts Gutes von den Lebenden. Selbst der Zigeuner war da, der kleine Georg. Auch er stand am Grab und bekreuzigte sich. Was für Zeiten, in denen sich sogar die Kommunisten bekreuzigten!
Der Pfarrer ist ein Rumäne. Er hat seine Pfarrei im Nachbardorf. Das Weihrauchfässchen schwenkte ein Greis. Früher waren es Kinder, Ministranten. Sie erschienen mir immer wie Verkleidete. Die ganze Kirche kam mir wie eine Verkleidungsangelegenheit vor. Ministrant war ich ein einziges Mal, steckte nur einmal unbeholfen in dem Gewand, ein weißer Engel mit Zahnschmerzbacke. Als hätte ich den Mund voller Pflaumenkerne gehabt, als wäre es verboten gewesen, auch nur einen einzigen Kern auszuspucken.
Die Rumänen spucken, hieß es, die Walachen. Wer wollte schon ein Walache sein.
»Du hast falsch vorgedient«, sagte meine Großmutter. Sie sagte es vorwurfsvoll. Alles sagte sie vorwurfsvoll. Es muss kein Vergnügen gewesen sein, an der Seite dieser Frau zu leben. Ich weiß nicht mehr, was ich falsch gemacht hatte. Ich weiß nur noch diesen einen erratischen Satz. Vorwürfe sind am stärksten, wenn die Gründe wegfallen. Wenn kein Wann und Wo und Warum mehr gilt, triumphiert der Vorwurf, wird zur Schuldbezichtigung. Theresia war eine Meisterin der Bezichtigung. Vielleicht hat mein Großvater wegen solcher Sätze mit dem Trinken angefangen.
Mehrere alte Frauen sangen die vorgeschriebenen Lieder. Sie standen in ihren altmodischen Sonntagskleidern am Grab. Kleidern, die seit Jahrzehnten auf dem Bügel hingen. Im Mottenkugelschrank. Wäre nicht der Weihrauch gewesen, hätte man die Mottenkugeln gerochen. Die Frauen sangen mit zittriger Stimme. Es war das, was von einem ganzen Chor übriggeblieben ist, vom Mädchenchor von vor fünfzig Jahren.
Die Singmädchen, wie sie genannt wurden, sind jetzt achtzig oder tot. Ihre Mädchengesichter füllen unser Familienalbum. Das Album, das John und Katharina aus Amerika mitgebracht haben und das zwei Weltkriege überlebt hat. Nur die eingebaute Spieluhr geht nicht mehr. Entweder haben die Russen sie kaputtgemacht oder eines der Kinder. Die Kinder haben viel kaputtgemacht, das meiste aber die Russen. Das haben uns die Männer im Dorf oft genug erklärt. Wir Kinder kannten die Russen ja nicht. Wir sahen sie nur im Kino. In den Kriegsfilmen, die man uns im Dorfkino zeigte, sonntags vormittags, damit wir nicht in die Kirche gingen. Wir sahen die Kinohelden und hörten uns die Geschichten der Männer aus dem Dorf an. Unsere Kinorussen wussten nicht, dass man die Armbanduhr aufzog und den Fahrradschlauch aufpumpte. War die Uhr abgelaufen, nahmen sie sich eine neue, war die Luft aus dem Fahrradschlauch entwichen, warfen sie das Rad weg.
Wohin man auch blickt, es ist aus, es ist vorbei. Eine Welt ist untergegangen, sage ich mir. Ich denke es mit Marlitt-Pathos. Der Hang der Banater Schwaben zum Selbstmitleid ist größer noch als ihr sprichwörtlicher Fleiß. Zweihundertfünfzig Jahre in Nichts verwandelt. In Luft aufgelöst. Von dieser Geschichte zehren wir, wenn sonntags das Telefon geht in Deutschland und von den Toten geredet wird. Den teuren, fernen Toten.
Der kleine Georg drückte meiner Mutter die Hand, sie erwiderte seinen Blick nicht. Nein, sie erwiderte seinen Blick nicht. Ich habe das genau geprüft. Es ist mir nämlich wichtig. Wichtiger, als ich mir eingestehen will. Der kleine Georg hatte hier eigentlich nichts zu suchen. Wirklich nicht. Aber wer hätte es ihm sagen sollen? Gegen den kleinen Georg hatte man keine Handhabe. Noch nie.
Der Pfarrer, der Rumäne, sprach sein holpriges Deutsch. Es ist das Deutsch für die letzten. Eine Improvisation aus dem katholischen Seminar in Alba Iulia. Die Parodie der Sakramente. Als rufe man die Menschen an, und sie sind unter der Erde oder in Deutschland. Das gute Deutsch ist unter der Erde oder in Deutschland. Der Pfarrer sagte was Nettes über meinen toten Vater. Er kannte ihn nicht. Aber das macht nichts. Gott wird es ihm nicht übelnehmen, er wird eher sein Komplize sein, und was wir denken, ist sowieso egal. Wir zählen nicht. Gott hat andere Sorgen.
Während der Pfarrer sein Pflichtritual abhielt, sah ich mich um. Das Totenhaus war eine Ruine, der Leichenwagen darin nur noch ein Gerippe. Was die Rumänen nicht gebrauchen konnten, war noch dran. Mehr nicht. Den Wagen hatte mein Großvater für die Kirchengemeinde gebaut. Der Vater meiner Mutter, Bastian. Er liegt nebenan, in seinem Grab. Darüber ist eine Betondecke gegossen. Eine Betondecke, die Risse zeigt. Halsabschneider haben sie seinerzeit gegossen, in den Achtzigern. Bastian hat den Leichenwagen, den Totenwagen, wie man im Dorf sagt, mit viel Sorgfalt gebaut. Er hat ihn dem ausgedienten alten Wagen nachgebaut. So konnte man denken, es sei immer derselbe Totenwagen und es ginge in die Ewigkeit, nicht ins Nichts. Es war eine Ehre für ihn, den Totenwagen nachbauen zu dürfen.
Auf den meisten Gräbern liegen Betonplatten. Deckel, sagen die Leute. Als sollte die Ewigkeit vorgetäuscht werden. Aber für wen? Hallo, ihr Engel, grüß Gott, Walachen, wir waren da, wir, die fleißigen Deutschen. Die Schwaben.
Wir sind doch alle fort, mit Kind und Kegel, wir hätten auch die Friedhöfe mitnehmen sollen. Ein paar Mark für die Kommunisten, und sie hätten uns auch die Friedhöfe mitgegeben. Die verkaufen doch alles, und anschließend werfen sie es dem Käufer vor, so, als hätte man sie genötigt. Die Rumänen aber muss man nicht nötigen. Sie sind immer dabei. Ob es um Stalingrad geht oder um die Nato. Oder um die Friedhöfe.
Ich sehe die Kastanienallee vor mir, die alte Friedhofsallee. Es gibt sie schon lange nicht mehr. Sie ist nur noch eine Einbildung von mir. Ein Aquarell meiner Kindheit, vom Dorfmaler angefertigt. Ein Aquarell in einem Hausflur. Kastanien, fallende, platzende Kastanien. Als könnten sie einem auf den Kopf fallen. Unerwartet. Jederzeit. Kinderangst.
Einer der Pfarrer hat mit seinem Kirchenrat vor vielen Jahren die Allee abgeholzt, das Holz zu Geld gemacht und das Geld mit Gottes Segen verjubelt. Gott, der überall war, in allen Reden und Ausreden, und doch so wenig ausrichten konnte. Gott, den es wahrscheinlich nur gab, um uns vor Augen zu führen, wie wenig man selber entscheiden konnte.
Früher blieben die Pfarrer ein Leben lang im Dorf. Sie kannten jeden, und jeder wusste, mit wem der Pfarrer ins Bett sprang. Einer schrieb sogar Gedichte, die er seinen Verehrten widmete. Er veröffentlichte die Poesie in Temeswarer und Budapester Zeitschriften, die im Dorf kein Mensch kannte. So konnte er sich wenigstens in den Gedichten zu seinen heimlichen Affären bekennen. »Wenn wir beisammen, streb ich immer / Dein Antlitz mir zu prägen ein, / Dass ich an seinem Rosenschimmer / Mich freuen mag, wenn ich allein.« Der dichtende Pfarrer trug einen Zylinder, wenn er durchs Dorf eilte. Er ist uralt geworden. Zuletzt verwechselte er die Hochzeiten mit den Begräbnissen, aber man sah es ihm nach. Der Unterschied war ohnehin nicht allzu groß.
Als es dem Ende zuging, gaben die Pfarrer sich die Klinke in die Hand. Es war ein ständiges Kommen und Gehen, nichts war mehr sicher. Einer hat sogar die Kirche leer geräumt, unter dem Vorwand, sie modernisieren zu wollen. Er hat die Fresken des Dorfmalers Fink übermalen lassen. Als wären wir Protestanten. So weit ist es gekommen. Jeder von denen hat was verändert oder auch nur geklaut. Weil sie Pfarrer waren, brauchten sie für alles eine Rechtfertigung, noch der dümmste Diebstahl verlangte nach einer geistigen Verbrämung. Sie sind alle längst in Deutschland oder in Deutschland unter der Erde. Sie haben in Deutschland ihren Frieden gefunden, und in den Särgen raschelt das Papiergeld in ihren Taschen.
Der Friedhof aber ist der allerletzte Versuch, Normalität vorzutäuschen. Die Grabsteine geben immer noch den sozialen Unterschied an. Als sei die Welt in Ordnung. Schwarzer Marmor, weißer Marmor, Schmiedeeisen, Sandstein, Holz. Von den beiden Kapellen nicht zu reden. Aber der Marmor hat Einschüsse aus dem letzten Weltkrieg, und die Kapellen sind zwar verschlossen, aber jeder weiß, sie wurden geplündert und wieder geplündert. Und abends schlichen sich die jungen Leute hinein, um zu ficken. In den Kapellen verloren sie jede Hemmung. So nah bei den Särgen fiel es ihnen leicht, sich aufeinanderzustürzen.
Von den Familien, den reichen, ist so gut wie nichts mehr übrig. Sie wurden enteignet und verhaftet und vertrieben. Ob sie was getan hatten oder nicht. Der Sohn der einen, der Hans Michelbach, hat zwar das Nazitum ins Dorf gebracht, die anderen aber hatten mit den Nazis wenig zu tun, weniger als die meisten Bauernjungen. Der Antifaschismus jedoch war nicht wählerisch. Jedenfalls nicht in der Hand der Kommunisten. Für sie galt jeder, der ihnen ein Dorn im Auge war, als Faschist.
Ich fahre die Kurve am Friedhof entlang, obwohl es ein Umweg ist. Ich drehe eine Ehrenrunde für meinen Vater, für Karl, danach geht es auf die Landstraße hinaus, Richtung Grenze.
Diesen Weg kenne ich auswendig. Es ist meine Piste. Ich fahre ihn seit fünfzehn Jahren. Einmal, manchmal zweimal im Jahr. Er ist unverändert. Unverändert schlecht. Er wird immer irgendwie befahrbar sein und immer nur Kopfschütteln hervorrufen. Die Straße ist von Anfang an schlecht gewesen. Als sei es ein besonders kunstvolles Bauen, was hier zur Anwendung kam. Wie Speer den Ruinenfaktor mitplante, so scheint es hier der Schlaglocheffekt gewesen zu sein. Das ist der Unterschied zwischen den Nazis und den Kommunisten.
Das Dorf liegt hinter mir. Vor mir das flache Land des nördlichen Banats. Die Heide. Die Kastanien am Straßenrand, die Maulbeerbäume, die verlorenen Akazien am Horizont. Wäldchen waren das einmal, kleine Akazienwäldchen, die die Ackerflächen und Weiden zierten, zur Grundwasserregulierung. So hatte man sich das seinerzeit in Wien ausgedacht, in den Ämtern, die die Kolonisation planten. Im kaiserlichen Wien der Maria Theresia. Sie hatten einen Ordnungsgedanken im Kopf, dem alles unterworfen wurde, auch die Natur. Es waren Beamte Gottes. Sie hatten das Unerschütterliche, das nötig ist, um Dauerhaftes zu leisten. Wenn ich daran denke, wie wir in Sandhofen bauen, vergeht mir die Zuversicht. Wir bauen ja auch nicht für Maria Theresia.
In den letzten zwanzig Jahren haben Zigeuner und Rumänen um die Wette abgeholzt. In der Zeit des Diktators aus Not und danach, weil es keine Autorität mehr gab, die sie davon abhalten konnte. Sie hatten ihre Freiheit. Es war die Freiheit, Wälder abzuholzen. Auch das kann Freiheit bedeuten. Rücksichtslosigkeit, auch gegen sich selbst. Die Wälder fehlen auch ihnen, den Abholzern. Aber so weit denken sie nicht. Sie denken nicht über den Tag hinaus. Sie haben keinen Plan. Einen Plan zu haben halten sie für Kommunismus. So verwirrt sind die Abholzer.
Ich will weg. Weit weg. Es ist immer noch so, als wäre ich auf der Flucht. Längst ausgewandert und trotzdem noch auf der Flucht. Immer noch die Angst, nicht weit genug weggegangen zu sein. Immer noch in Gefahr, gehetzt zu werden. Und sei es von der Erinnerung und dem bösen Verdacht, man werde das alles niemals los. Ich hätte nach Amerika gehen sollen.
Amerika. Um mir die Zeit zu vertreiben, während der langen, einsamen Autofahrt, die mir bevorsteht, denke ich mir die Urgroßeltern auf die Feierabendwiese vor mir. Stelle sie auf wie Figuren aufs Brett. Aufs Schachbrett des Banats. Hole sie mir aus dem Nichts: Katharina und Johann. Die jungen Leute, lange vor dem Ersten Weltkrieg. Halbwüchsige. Wie alt werden sie gewesen sein, sechzehn, siebzehn?
»Wir fahren nach Amerika«, sagt Johann. Nach Amerika. Das Wort klingt in den Ohren.
Sie stehen auf dem Feld, auf dem abgeernteten Feld, das nicht ihnen gehört. Das Dorf liegt hinter ihnen. Weit hinter ihnen. Sie sehen es nicht. Sie blicken über die Stoppelfelder, über das flache Land, über dem die Sonne steht, eine ferne Abendsonne und doch brütend heiß. In diese Abendsonne blicken sie. Als wäre es eine Verheißung.
Sie stehen da, als wären sie schon weg. Er, der Mann. Sie, an seiner Seite, die Frau. Sagt nichts. Als wollte sie nur einverstanden sein.
»Wir fahren nach Amerika«, sagt er jetzt lauter. Viel lauter. Er brüllt es fast. Als sei eine Beschwörung nötig. Aber die Buchen am Feldrand stehen still. Kein Lüftchen regt sich.
»Das Kind bleibt hier«, sagt er. Ein Machtwort.
Das Kind bleibt hier. Es ist wie ein Echo. Als hätte es der Kuckuck gerufen. Aus dem Akazienwäldchen drüben am Fluss. Der verdammte Kuckuck. Katharina senkt den Kopf. Sie legt die Hände ineinander, presst die Finger zusammen, bis sie die Knochen spürt. Ihr Kind.
Sie schweigen.
Sie sind zu jung, und keiner ist für die Heirat, keiner aus der Verwandtschaft, von beiden Seiten nicht, und über das Kind schütteln alle nur den Kopf. Nein, ihnen wird niemand was anbieten, kein Feld und kein Haus und kein Guten Tag. Sie werden gehen, gehen müssen. Weggehen. Das Kind wird bleiben. Es ist zu klein. Zu klein für Amerika. Es wird bei den Großeltern bleiben. Es kann ja nichts dafür.
Sie sprechen im »Casino« vor, in der Dorfmitte, beim Betreiber. Er ist Gastwirt und Hotelier und vertritt auch die Agentur Mißler, die die Auswanderung regelt. Es gibt jetzt Billigkarten. Schon für neunzig Kronen. Mit zweihundert wären sie dabei. Es gilt, die zweihundert Kronen aufzutreiben. Viel Geld für die beiden. Sie leihen das Geld, sie werden es in Amerika verdienen. Jetzt sind sie noch nicht einmal in Amerika und haben bereits Amerikaschulden. Die Leute reden. »Sie lassen das Kind hier«, sagen die Leute. »Und woher haben sie das Geld?« Ja, woher?
Viele Wochen später sind sie auf dem Schiff, irgendwo auf dem Schiff, und Katharina ist krank, seekrank und sonstwas. Das Schiff schwenkt sie hin und her. Wie im Taumel ist sie über den Kontinent gereist. Es war ihr schwindlig von all den Städten. Von Budapest bis Hamburg. Die Welt erschien ihr so groß, dass sie dachte, sie müsste sterben, weil sie zu lange zu fahren hatte. Sie wiederholte unentwegt die Namen der Orte, als wollte sie sich vergewissern, dass das alles seine Richtigkeit hatte. Und dann sah sie das Kind vor sich. »Theresia« hatten sie es genannt. Theresia, das Kind, schob sich vor das Zugfenster. Immer wieder. Schrie. Johann legte den Arm um Katharina. »Wir schaffen es«, sagte er. Er sagte es mehr zu sich selbst. Aber seine Stimme blieb fest.
Die Zugfahrt war ja erst der Anfang. Es war nur der Weg zum Hafen, die große Reise sollte erst die Schiffsreise sein. Es folgte das Warten bis zur Einschiffung. Veddel, Hamburg. Gesundheitskontrolle. Desinfektion. Kreuzverhör. Fünf Tage, das Ganze. Über der Eingangshalle der Spruch: »Mein Feld ist die Welt.« Die Raddampfer am Kai. Mit ihnen fuhr man zum Passagierschiff hinaus. Immer wieder stiegen Menschen auf die Dampfer, verschwanden auf das Schiff. Immer neue Menschen, zahllose Menschen. Katharina dachte, sie wird das Banat nie wiedersehen. Das Banat nicht und das Kind nicht. Theresia.
Johann aber hat nichts, gar nichts. Einmal auf dem Schiff, auf dem großen Schiff, läuft er von einem Deck zum anderen und redet mit tausend Menschen, und aus Johann wird John, und sie sagt nichts. Lächelt manchmal, als wollte sie ihm die Freude nicht verderben, ihrem Johann, der sogar schon englisch spricht. Es ist ein Wunder mit Johann, ein Glücksfall. Er hat bereits Freunde, Zoltán und Demeter, die wollen nach Ohio. Kennen dort Leute, die ihnen helfen werden. Johann will mit. Zoltán und Demeter sind Träumer. Zuversichtliche Träumer. Stadtmenschen. Sie reden immer nur von der Zukunft, und sie reden von ihr so, als würden sie bereits in ihr leben. Selbst Katharina muss lächeln, wenn sie ihnen zuhört. Sie sitzt im Zwischendeck, als sitze sie neben all diesen Menschen. Als nehme sie sie aus der Ferne wahr. Es sind Melancholiker und Träumer. Die Träumer schmieden Pläne, die Melancholiker haben suchende Augen. Es gibt Streit und wieder Streit. Männer müssen auseinandergebracht werden. Wegen Kleinigkeiten. Missverständnissen beim Kartenspiel. Verdächtigungen. Frauen schreien plötzlich auf und sind nur schwer zu beruhigen. Kaum vorstellbar, woran sich ein Streit entzünden kann. Zehn Tage auf See sind zehn Tage auf See. Dazu die lange Anfahrt und die Wartezeit am Hafen. Ein Narrenschiff.
Zoltán und Demeter laufen stets zusammen auf den Schiffsdecks herum, man hält sie für Brüder. Sie sind es aber nicht. Sie sind nicht einmal miteinander verwandt. Sie kommen bloß aus demselben Ort, aus Nagyvárad, in Ungarn. Und wenn man so weit weg ist von zu Hause und von allen Ufern, genügt das, um zusammenzugehören. Um wie Brüder zu sein.
Katharina hört Zoltán und Demeter zu, und es geht ihr besser. Die beiden sprechen untereinander ungarisch, mit Katharina aber deutsch. Katharina versteht nur ein paar Worte Ungarisch. Das ist zwar Amtssprache im Banat, aber im Dorf leben ja nur Schwaben. Und warum sollten die ungarisch sprechen? Nur wer herumgekommen ist, die Gegend abgestreift hat, der Streuner, der Händler und der Handwerker, der Jude, sie sprechen ungarisch. Auch Johann, ihr Johann, ein bisschen jedenfalls, obwohl er keines von den vieren ist. Denkt sie. Sie denkt wieder an ihr Kind, an Theresia. Im Magen dreht sich ein Stein. Er dreht sich einmal herum. Dann liegt er wieder still.
Das Schiff ist groß und voller Gerüchte. Die wandern von Deck zu Deck und nehmen immer wildere Formen an. Das Schiff ist zu groß. Angst und Hoffnung beherrschen die Gefühle der Auswanderer. Sie suchen der Angst Herr zu werden, indem sie sich der Hoffnung hingeben. Dazu gehört das Ausmalen der Zukunft. Es ist wie das Kolorieren einer Postkarte. Immer wieder kommt die Rede auf die unglaublichen Möglichkeiten, die die Weiten des amerikanischen Westens einem bieten können. Auf die große Freiheit, die Freiheit, Land abzustecken. So viele Felder, wie daheim das ganze Dorf besitzt. Die Leute erzählen sich die Geschichten aus den Gazetten. Die Phantasie blüht wie in einem Amerikaroman, es ist ein gutes Gefühl. Für einen Augenblick ist der Amerikaroman die einzig mögliche Wirklichkeit. Aber dann hört sie plötzlich wieder die Kinderstimme. Sie ist bleich, spürt einen Brechreiz, drückt die Handfläche auf den Magen. Es geht vorbei.
So kommen sie an, ohne das Kind, vor New York. Die Stadt ist zum Greifen nah und doch unerreichbar. Das Gerücht schlägt zu: Die Amerikaner werden sie nicht an Land lassen. Jeder Tag hat sein Gerücht. »Alles nur ein Gerücht«, sagt Demeter. Sie werden auf die Insel gebracht, nach Ellis Island. Hocken vor der Stadt. Wie eine Postkarte liegt hinter dem Wasser Manhattan. Die Türme, die Häuser sein sollen. »Die Wolkenkratzer«, wie Zoltán sagt. Quarantäne. Sie werden ausgefragt und angeschaut. Woher? Wohin? Warum? Alles wird aufgeschrieben. Die Beamten halten riesige Register bereit. Landwirtschaft. Sie nicken. Gemüse, okay.
Zoltán und Demeter schwören auf Ohio. Und das hat bei ihnen nichts mit Feldern zu tun, nichts mit Erde. Sie sind Städter. Demeter kennt sogar Gedichte, ungarische. Er rezitiert eines Abends für Katharina: »Igen: élni, mig élünk, / Igen: ez a szabály. / De mit csináljunk az élettünkel, / Ha fáj?« Auf deutsch: »Ja: solang man lebt, leben / Ja: diese Regel nur zählt. / Doch was sollen wir tun mit dem Leben, / Wenn es uns quält?« Ady Endre. Ein Dichter der jungen Generation.
Zoltán und Demeter schwören auf ihre Freunde in Ohio, die ihnen Arbeit geben werden, auf dem Bau in Cincinnati. Das ist eine Riesenstadt. Es wird dort viel gebaut. Fürs erste ist gesorgt. Dann wird man weitersehen. Und alles wird gut, Katharina. Sie sagen: Kathi. Ungarisch ist das. Nem sirni. Nicht weinen.
Johann und Katharina schließen sich Zoltán und Demeter an. Die Reise kann weitergehen. Es ist amtlich. Sie liegen einander in den Armen. Alle vier. Immer noch weiter geht es, ins Landesinnere. In diese Ortschaft, einen Vorort von Cincinnati. Dort heißt es bleiben. Endlich bleiben. In Amerika, Viktoria! Bleiben und Geld verdienen. Dollar. Magisches Geld. Taler. Wie viele Kronen sind es, denkt sie anfangs. Dann denkt sie es nicht mehr.
Katharina ist jetzt so weit weg von ihrem Kind, dass sie manchmal denkt, eine von ihnen ist tot. Entweder Theresia oder sie selber.
Sie verdienen das erste Geld mit einem Gemüsehandel und Gott weiß mit was sonst. John fährt das frische Gemüse frühmorgens zum Markt, verkauft es mit lautstarken Sprüchen, macht die Leute froh, einkaufsfroh. Schlagfertig und witzig, wie er ist, wird er alles los. Der Fratschler. Abends ist John in den Kinos von Cincinnati, mit seinen Kumpels, a baratok, mit Zoltán und Demeter und den anderen vom Bau, in den Nickelodeons und Kneipen. Er kommt spät nach Hause, ist redselig, erzählt ihr all die Filme, all die Geschichten von der Leinwand, die ihn faszinieren. Tölpel und Damen, Sahnetorten im Gesicht, Schlägereien um nichts und wieder nichts. Und alles so schnell, dass man immer nur lachen muss. Kintopp. Oder einem das Lachen vergeht, angesichts der Schicksale, von denen berichtet wird. »Life of an American Fireman«, worin ein Feuerwehrmann in sechs Minuten ein Mädchen rettet. »The Little Train Robbery«, der Zugraub, von Kinderdarstellern gespielt. »Maniac Chase«, »Two Woman and a Man« und »The Kleptomaniac«. Das ganze schaurige Leben. Sie hört zu. Er ist ihr Mann.
Manchmal kommt John mit lädierter Jacke und Beule im Gesicht an. Er hat sich wieder einmal geprügelt. Er kann es ihr erklären. Sie schüttelt den Kopf, verarztet ihn.
»Sei nicht so jähzornig«, sagt sie.
Sie selber geht nie ins Kino. Er hat sie nicht ausdrücklich dazu eingeladen, sie hat aber auch keine allzu große Neugier darauf. Mit dem Gemüse hat sie alle Hände voll zu tun. Sie muss schließlich dafür sorgen, dass der Wagen gut bestückt ist, für den Markt. Bald schon überlässt er ihr auch den Verkauf, geht mit seinen Freunden auf den Bau. »Mehr Geld«, sagt er. »Wir brauchen es.« Sie haben die Passage abzustottern. Und mit leeren Händen kann man auch nicht zurück. Kein Auswanderer kann sich ohne Geld im Dorf blicken lassen. Sonntags geht er manchmal zu den »Reds«. Aber Baseball ist nicht seine Welt.
Sie lernt Englisch von den Frauen, von den Hausfrauen aus der Nachbarschaft. Notenglisch. Sie lernt Lieder. Kinderlieder. Von den Kleinen von nebenan. Die alle wie Theresia aussehen und Tante Kathy lieben. Aunt Kathy. Sie lernt amerikanische Kinderlieder. Singt sie. »O do you know the muffin man, / That lives on Drury Lane?« Stellt sich vor, sie singt sie für die Tochter. »O say busy bee / Where now are you going? To work or to play?«
Den Gemüsehandel betreibt sie jetzt selber, mit den Nachbarn. Die kommen aus Kroatien, sind bereits seit einem Jahrzehnt im Land. Kroatien liegt in Ungarn, wie das Banat. Man versteht sich. Dragica, die Nachbarin, wird ihre beste Freundin.
Dann findet sie die Arbeit in der Fabrik. Hemden nähen. Das ist was Neues und gut bezahlt, besser als das Gemüse. Sie fährt jetzt täglich mit dem Streetcar in die Stadt. Die Stadt, die auf sieben Hügeln steht. »Wie Rom«, hat Demeter gesagt. Wie Rom kommt sie ihr vor.
John bringt seine Kumpels mit nach Hause. Sie schmeißen eine Runde. Eine Runde Karten. John, Demeter, Zoltán und Simon. Simon arbeitet auch auf dem Bau. Sie knallen die Karten auf den Tisch, sind laut. Rauchen. »Kathy«, ruft John, »ein Gulasch. Ein Gulasch hätten wir gern.«
Und sie bekommen ihr Gulasch. Männer. »So ist das Leben«, sagt Dragica. »Die Männer sind laut, aber sie meinen es nicht so. Sie meinen es gut.«
John und Kathy verdienen ihr Geld und legen es beiseite, und sie schreibt die schönen Postkarten nach Hause zu den Eltern im Banat, für das Kind, für Theresia. Auf den Postkarten sind all die Städte und Landschaften zu sehen, die sie selber niemals zu Gesicht bekommt: New York, Chicago. Sie ist ja nicht zum Vergnügen in Amerika, sondern um zu arbeiten. Geld zu verdienen und zu sparen. Man hat es und hat es doch nicht.
John geht seiner Wege, aber er kommt zurück. Auf John ist Verlass. Auch wenn die Nachbarinnen reden. Auch wenn sie mit dem Zaunpfahl winken und den Kopf schütteln, als wollten sie sagen: Kathy, bist du blind? John ist John. Sie dreht sich um, rennt ins Haus. Es klopft, Dragica ist da. Dragica redet und redet, und Kathy nickt. So ist das Leben. So könnte es sein. Ein Leben in Amerika. Ein Kind vielleicht, es wäre ein Grund zum Bleiben. Aber es kommt kein Kind. Nein, es kommt keines. Theresia lässt es nicht zu. Jedes Kind, das käme, wäre ein Kind gegen Theresia.
Bleiben. Schmerz. Bleiben. Kein Reim.
Die Jahre vergehen. Und als keiner mehr damit rechnet, auch sie selber nicht, fahren sie doch noch zurück. Über Nacht. Und das hat mit John zu tun. Mit einer nie geklärten Angelegenheit von John. Er soll einen Mann aus dem Fenster geworfen haben, heißt es, aus dem dritten Stock. Im Zorn. Den Kartenspieler, heißt es, den vierten Mann. Simon? Keiner, außer John, weiß Genaueres. Nur Zoltán und Demeter, sie waren dabei. Aber wer weiß, was aus denen geworden ist. Sie sind ebenfalls aus Ohio weggegangen und im übrigen längst tot.
Im Dorf wird es ein Gerücht geben. John habe eine Liebschaft gehabt. Eine verheiratete Frau. Der Mann habe ihn zur Rede gestellt. Es war ein Kumpel vom Bau. Simon? Andere sagen, er habe mit dem Mann unsaubere Geldgeschäfte gehabt. Geldgeschäfte?
Nach einer langen Reise sind sie wieder da. Die Tochter ist zehn und in der Schule. Die Großmutter holt sie ab und bringt sie nach Hause. Sagt: »Deine Mutter ist da!« Mehr sagt sie nicht.
Eine fremde Frau steht vor Theresia. Sie steht in einem modischen Kleid vor ihr, wie es die Frauen im Casino tragen, wo die Reichen des Dorfes hingehen, die Noblen, wie meine Mutter heute noch sagt. Vielleicht meint sie die Notabeln. Theresia kennt das Casino, weil sie ab und zu die Bälle dort einsammelt, für ein paar Kreuzer, für einen halben Gulden, zwei Kronen, wenn die Damen Tischtennis spielen.
Das Casino ist nicht wirklich ein Casino. Es ist alles in einem: Café und Ballsaal, Billard und Tischtennis, Salon und Kartenrunde. Es ist alles, außer ein Wirtshaus. In den Wirtshäusern hocken die Bauern und die Handwerker. Jeder in seinem Wirtshaus. Es gibt, außer den vielen kleinen Klitschen an den Straßenecken, das Wirtshaus der Bauern und das Wirtshaus der Handwerker. Eigentlich sind es Ballhäuser, in denen die Jugend samstags tanzt. Sich unter den prüfenden Augen der am Rand sitzenden Eltern paart.
»Das ist deine Mutter«, hört sie die Großmutter sagen. Sie nickt verlegen, und die Frau, die ihre Mutter ist, kommt auf sie zu und bleibt vor ihr stehen und sagt: »Grüß dich, Theresia, groß bist du geworden. Ich habe dir viele schöne Sachen mitgebracht. Hoffentlich passen sie.« Sie sieht ein bisschen aus wie die Damen im Casino, wirkt aber, im Gegensatz zu den Damen, unbeholfen. »Grüß dich, Theresia«, sagt sie noch einmal.
John und Katharina waren neun Jahre in Amerika. John sagt zu Katharina jetzt Kathy. Sie sind wieder da, weil sie genügend Geld haben. Deshalb. Oder wegen des Kindes. Oder es ist alles ganz anders gewesen. Vielleicht so, wie mein Vater es mehrfach behauptet hat: John habe in Amerika im Streit einen Mann aus dem offenen Fenster geworfen. Aus dem dritten Stock. Deshalb seien sie abgereist. Mein Vater erzählte das genüsslich. Vielleicht ist es erfunden, denke ich mir. Vielleicht sind sie ohne jeden Grund zurückgekommen. Mein Vater erscheint mir in der Sache nicht glaubwürdig. Er ist der Eingeheiratete, der über die Familie lästert. Woher aber hat er die Geschichte?
Ich muss jetzt langsamer fahren. Ich habe das Straßenstück mit dem Kopfsteinpflaster erreicht. Hier ist ihnen der Asphalt ausgegangen. Die Bonzen und ihre Handlanger haben zuviel geklaut. Zu viele ihrer Höfe mit asphaltiert. So reichte der Asphalt nicht aus, und nun sind seit zwanzig Jahren drei Kilometer Kopfsteinpflaster zu überwinden.
Geduld, sage ich mir, gleich geht’s wieder schneller. Bißchen Anschauungsunterricht, wie es früher war, als man mit dem Pferdewagen über das Kopfsteinpflaster zockelte. »Seht ihr den Fortschritt!« hätten die Kommunisten gerufen.
Drüben ist der Damm, der Deich, den noch die Österreicher gebaut haben. Nachdem sie die Türken verjagt hatten und unsere Ahnen angesiedelt haben. In der Zeit von Maria Theresia. Prinz Eugen hieß der Befreier. Der edle Ritter, wie das Lied über ihn besagt. Meine Mutter kann es noch singen. Hinter dem österreichischen Damm liegt der Wald und dahinter der Fluss. Der Fluss meiner Kindheit, die Marosch. Ich fuhr mit dem Fahrrad vom Frühjahr bis zum Herbst die drei Kilometer von unserem Haus bis zur Siedlung am Fluss. Die Siedlung liegt in der Au. Man fuhr über den Damm in die Siedlung hinein. Die Hunde kläfften, und ich hatte jedesmal Angst.
Im Fluss ankerten früher die Mühlen. Schiffsmühlen. Aufgebaut auf zwei großen, nebeneinander liegenden Kähnen. Sie standen in der Strömung, und der Fluss drehte das Mühlrad, und das Mühlrad bewegte die Steine, die Mühlsteine, und die zerrieben den Weizen, das Korn. Ich kenne diese Mühlen von alten Fotos.
Die Schiffe waren bis über die Wasserlinie aus starken Eichenbrettern gebaut. Der obere Teil bestand aus Tannenholz. Das Wasserrad war auf einer Achse zwischen den beiden Schiffen montiert. Die Schiffe wurden durch Balken so weit auseinandergehalten, dass das Wasserrad dazwischen Platz hatte. Bug und Heck wurden durch Ketten mit dem Ufer verbunden. Eine solche Mühle besaßen die Großeltern meines Vaters vor dem Ersten Weltkrieg.
John und Kathy ziehen vorübergehend ins Haus von Katharinas Eltern ein. Sie wollen Feld kaufen. Wie alle, die aus Amerika zurückkommen, wollen sie Feld kaufen. Es war schließlich der Zweck ihres Amerikaaufenthalts, im Banat Feld zu kaufen. Dann wird ihr eigenes Haus gebaut. Das Haus am Dorfrand. Die gesamte Verwandtschaft legt Hand an. Mit schwarzer Stampferde werden die Mauern hochgezogen, dicke Mauern, die später, wenn die Schwarzerde glasig geworden ist, vor Hitze und Kälte schützen. Sie ziehen die Wände hoch und setzen den Dachstuhl darauf, den Dachstuhl aus leichtem Holz. Und darauf kommen die Ziegel, die aus Hatzfeld geliefert werden, von der Firma Bohn. Für die Dollars von John und Kathy, sonst hätte man Rohr aus den Sümpfen am Fluss verwendet. Das Rohr ist so gut wie die Schwarzerde, aber jetzt sind Ziegel modern, und wer sich Ziegel leisten kann, hat Ziegel auf dem Dach. Wer in Amerika war, muss Ziegel auf dem Dach haben. John und Kathy bauen auch kein Giebelhaus wie die Bauern, kein Langhaus, in dem die Zimmer wie in einem Zugwaggon aufeinanderfolgen. Sie bauen ein Querhaus, mit vielen Fenstern zur Straße.