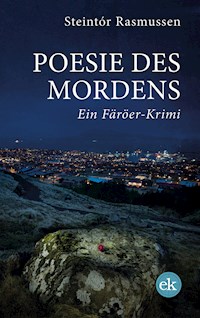Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag edition krimi
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
"Die lange Stricknadel hatte sie in ihrem Jackenärmel versteckt. Der Tod lag in ihren Händen. Und in ihrem Kopf verbarg sich die Geschichte über das Leben, das ihr genommen worden war." Seit Generationen ist das kleine färöische Küstenstädtchen Norðvík eine eingeschworene Gemeinschaft. Doch ein grausam verübter Mord erschüttert die religiösen Bewohner in ihren Grundfesten. Die unzähligen Vergehen des Opfers entfesselten einen tiefsitzenden Hass und zeigen, welche dunklen Verstrickungen sich hinter der Inselgemeinschaft verbergen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Steintór Rasmussen
Hass stirbt nie
Färöer-Krimi
Martin Schürholz (Übersetzer)
1. Auflage 2019
Copyright © 2019 by edition krimi, Hamburg
edition krimi
Alle Rechte vorbehalten
* * *
Übersetzung: Martin Schürholz
Umschlaggestaltung: © Annelie Lamers, edition krimi
Umschlagmotiv: © Eyðbjørn Jacobsen
* * *
ISBN 978-3-946734-73-4 (ebook)
ISBN 978-3-946734-72-7 (print)
* * *
www.edition-krimi.de
Sie hatte es geschafft, ungesehen ins Haus zu kommen. Hatte hinter sich die Tür geschlossen und war schnell durch die Küche ins kalte Esszimmer geschlichen. Allem Anschein nach war hier seit mehreren Tagen keiner mehr gewesen. Sie fühlte sich etwas sicherer. Die Augen gewöhnten sich rasch an die Dunkelheit. Sie schaltete ihre Taschenlampe ein und fand eine Tischleuchte, die ihr das Licht spendete, das sie brauchte. Schließlich sollte kein einladender Kronleuchter jetzt Gäste ins Haus locken. Sie öffnete die Schiebetür und gelangte ins Wohnzimmer.
Mit der Hand tastete sie die Innenwand ab und fand den Schalter, mit dem sie die Glühbirne in einem tabakvergilbten Lampenschirm anknipste. Die vielen Familienbilder an den Wänden starrten leblos auf sie herab. Sie sah sich um. Die Vergangenheit. Warum nur konnte sie nicht einfach alles hinter sich lassen?
Aber das war leichter gesagt als getan. Diese Geschichte verfolgte sie schon seit ihrer Kindheit. Hier und jetzt wollte sie diesen Albtraum beenden. Sonst wäre sie nicht still und heimlich wieder in ihren Heimatort gekommen, um alles im Verborgenen auszukundschaften.
Sie blätterte im Fotoalbum. Zunächst eher gleichgültig durch die älteren Bilder, doch dann kam sie, mit immer größer werdendem Widerwillen, zu der Zeit, die auch ein Teil von ihr geworden war. Ohne dass sie es gewollt hatte.
Dort war er. Zusammen mit ihr. Der Konfirmand. Das Jugendbild. Der Liebhaber. Dieser verfluchte Pfingstpimmel. Hallvin hatte also recht gehabt. Ihr wurde schwindelig. Er wusste es! Niemand hat das Recht, die Wahrheit zu missbrauchen. Anzunehmen, man könne ein Leben auf einer Lüge aufbauen.
Vielleicht hatte alles hier im Wohnzimmer begonnen? Während die ahnungslose Großmutter im Dachgeschoss schlief und Per, ihr Mann, sich auf dem Meer abrackerte. Die Geheimnisse, die diese kleine Siedlung zu verstecken wusste, waren nicht unerheblich.
So wie es aussah, hatte sich in diesem Haus nicht wirklich etwas verändert. Alles war, wie es früher einmal gewesen war. Sozusagen ein gewöhnliches, altes färöisches Heim. Über dem Türrahmen hing immer noch das Schild ‚Herr, segne dieses Haus‘. Gestickte Engel und Glockenstränge schmückten die Wände. Die Möbel waren alt und verschlissen. Zwei Gemälde von unbekannten Künstlern füllten die kleine Stube mehr als genug. Das eine zeigte das Dorf unter dem Norðurfjall zur Zeit der 50er Jahre, das andere Jesus, wie er über das Wasser ging. Auf dem dunklen Couchtisch standen ein Aschenbecher und eine Porzellanschale, auf der ein Eisbär zu sehen war. Die Bibel, das Kirchengesangs- und das Liederbuch des färöischen Volkes standen mit breiten Rücken im Regal. Und auf dem Boden der geflochtene Weidenkorb mit seinen groben Kanten und den langen, spitzen Stricknadeln.
Sie bemerkte, dass sich die Haustür öffnete. Hörte Schritte auf dem Fußboden und diese wohlbekannte Stimme. Die gleichen Schritte wie die, die sie an dieses gewissenlose Verbrechen erinnerten, die dieses Gefühl, verfolgt zu werden, in ihr auslösten. Diesen immer wiederkehrenden Fluch. Dieser abscheuliche Verlierertyp. Ist da jemand? Sein niederträchtiges Lachen bohrte sich wie ein Dolch in ihre Brust. Sie sah den Schatten in der Tür.
Die lange Stricknadel hatte sie in ihrem Jackenärmel versteckt. Sie ließ den Stahlkörper zwischen ihren Fingern hinausgleiten, als wäre er ein gespitzter Bleistift. Der Tod lag in ihren Händen. Und in ihrem Kopf verbarg sich die Geschichte über das Leben, das ihr genommen worden war.
* * *
18. August 1990
Ein Sonnenstrahl hatte den Weg ins Mädchenzimmer gefunden und die Wand erreicht, an der Madonna mit ihren himmelblauen Augen und blutroten Lippen hing und in den Raum hineinstierte. Das Gesicht der Frau war blass. Auf dem Kopf trug sie eine zerbrochene Schallplatte mit der Aufschrift ‚Like a prayer‘.
Anita hatte es zumindest noch geschafft, das ‚Vater unser‘ zu beten, als sie spätabends zu Bett gegangen war, hatte dann aber vergessen, die Gardinen zuzuziehen. Nun wurde sie vom starken Licht und dem Gefühl von kleinen Schmetterlingen im Bauch geweckt. Sie gähnte und rieb sich den Schlaf aus den Augen. Das Erste, was sie an diesem Morgen sah, war das Poster der weltbekannten amerikanischen Sängerin, das sie in Dänemark gekauft hatte, als sie dort mit ihrer Familie zwei Wochen Urlaub gemacht hatte. Nun hing es in den goldenen Lichtstrahlen drüben an der Wand. Ihr rätselhaftes Vorbild. Sie konnte schon viele Lieder dieser Platte auswendig. Irgendetwas hatte diese Frau ihr zu sagen.
Wie spät mochte es sein? Sie hörte ihre Mutter unten herumhantieren. Und dann die Stimme ihres Vaters. Er war noch nicht zur Arbeit gefahren. Plötzlich war Anita hellwach. Sie sprang aus dem Bett. Der erste Schultag nach den Sommerferien stand bevor. Es würde nett sein, alle aus ihrer Klasse wiederzusehen. Und sicher auch spannend werden, mit neuem Stundenplan wieder in die Gänge zu kommen. So wie jedes Jahr. Selbst Ronja sollte gestern Abend mit dem Passagierschiff nach Hause gekommen sein. Sie hatten sich fast sieben Wochen lang nicht gesehen.
Die Schule stand wie eine missratene Baracke im Zentrum der Stadt, inmitten von Wohnhäusern und Gärten. Im ältesten Gebäude, in dem die Kinder der sechsten Klasse das neue Schuljahr verbringen würden, blätterte die Farbe von den Wänden ab, und durch die Fensterritzen zog es fürchterlich. Aber das war nicht einmal das Schlimmste. Denn die Tapete löste sich von dem alten Beton, der mit gefährlichem Staubpulver und Schimmelpilzen infiziert war. Direkt beim Haupteingang lag der Aufenthaltsraum. Durch die großen, geplatzten Fensterscheiben hindurch konnte man Schüler und Lehrer zu Fuß oder auf Fahrrädern zur Schule kommen sehen. Ein paar Mopeds knatterten durch die umliegenden Straßen. Autos, Vögel und weitere Geräusche eines ganz normalen Alltags drangen durch die Fenster.
Früh an diesem Morgen ertönte der Gesang eines Stars im großen Laubbaum. Ein Ausdruck purer Lebensfreude oder eher ein Klagelied, weil es nun mit der Ruhe vorbei sein würde? Der glänzende Vogel trällerte unbeirrt seine Melodie, begleitet vom Pfeifen des Hausmeisters, der mit schwerem Schlüsselbund in der Hand unterwegs war, um sämtliche Türen des heruntergekommenen Gebäudes aufzuschließen.
Ursprünglich hatte man davon gesprochen, eine neue Schule zu bauen. Aber dann wurden die Lehrer aufgefordert, sich noch einige Jahre zu gedulden. Sie sollten versuchen, den Kindern etwas über Prioritäten beizubringen. Die Strand- und Uferpartien zu pflastern oder teilweise zu asphaltieren, das käme an erster Stelle. Den natürlichen Hafen, der von hohen Bergen eingerahmt war, wollten sie mit einer mehrere Hundert Meter langen Kaimauer versehen. Das ganze Hafenareal sollte Grundlage für Industrie- und Gewerbeflächen werden, dazu mussten die Straßen verbreitert werden. Nach den Plänen, die man den Einwohnern vorlegte, wollte man ein Großteil des Zentrums überdachen. Die Bürger fragten scherzhaft, ob sie dann etwa in Hausschuhen losziehen könnten. Viele schüttelten den Kopf und konnten sich kaum vorstellen, dass ein so ambitionierter und teurer Plan realisiert werden könne. Niemand war sich dessen sicher, andererseits schien in den 80er Jahren nahezu alles möglich. Auf der kleinen Inselgruppe draußen im kalten Atlantik, auf der gerade einmal 48 000 Menschen lebten, herrschten der Glaube an den Fortschritt und wahrer Tatendrang. Die Leute schwebten über den Wolken und bewegten sich auf hohen Wellen der Euphorie. Die Verlockung, mit der Strömung zu schwimmen, war groß. Das Ausland zeigte sich entsetzt und fragte sich, ob die Färinger ihre Bodenhaftung verloren hätten. Denn die guten Jahre könnten doch auch schnell wieder vorbei sein.
„Pass’ auf die Autos auf“, hatte die Mutter zu Anita gesagt, bevor diese zur Schule radelte. Das sagte sie immer, wenn die Tochter das Fahrrad nahm oder sich zu Fuß auf den Weg machte. Die Mutter mochte es nicht, dass in der Stadt so viel Verkehr war. Wenn doch nur alle Lastwagenfahrer so führen wie ihr Mann. Die meisten dieser jungen Männer sausten mit viel zu hoher Geschwindigkeit durch die Wohngebiete. Sie fuhren für einen Akkordlohn, also galt es, das Gaspedal durchzutreten.
Aber Anita hatte an diesem Morgen viel Zeit und versprach, gut Acht zu geben. Lächelnd winkte sie ihrer Mutter zu, die am Fenster stand und der Tochter mit ihren Blicken folgte. Den beinahe leeren Ranzen trug Anita auf dem Rücken. Ihre nagelneuen Schnürsenkel-Schuhe presste sie in die Pedale, und die Räder drehten sich wie ein Jahr in der Umlaufbahn des Wissens. Die Sonne schien aus dem wolkenlosen Himmel auf Anitas langes, helles Haar. Mamas kleines Mädchen, das so groß und hübsch geworden war. Sie ging nun in die sechste Klasse. An diesem ersten Mittwochmorgen nach den Sommerferien brauchten die Kinder aus ihrer Klasse nicht vor der zweiten Stunde zu erscheinen.
Da es keinen Radweg gab, hielt sich Anita auf der rechten Seite der Straße. Je näher sie der Schule kam, desto dichter wurde der Verkehr, und so lenkte sie schließlich das Rad auf den Fußgängerweg. Dort fühlte sie sich sicherer, obwohl sie wusste, dass es eigentlich verboten war. Aber was sollte sie sonst tun? Die großen Lastwagen wirbelten Dreck und Rauch auf, und sie drängelten ganz fürchterlich. Es war schon merkwürdig, dass an einem solchen Tag so viele Leute im Auto saßen.
In einem weißen Mazda 626 fuhr Bjarnhardur Person durch die Stadt. Der Staub auf den ausgedörrten Straßen hatte sich wie ein schmutziger Teppich auf das heiße Blech gelegt. Genauso unrein dürfte wohl das Gewissen des Mannes am Steuer gewesen sein. Er wusste, wann die Kinder zur Schule gingen, und daher auch, ab wann eine bestimmte Mutter allein zu Hause war.
Das herrliche Sommerwetter schenkte Männern und Frauen gleichermaßen die Lust, zu leben. Früher waren sie im Verborgenen zusammen gewesen. Ihre Art zu lieben und dabei alle sexuellen Grenzen bis zum äußersten auszureizen, würde diesen unbeschreiblichen Morgen nicht minder aufregend werden lassen. Bevor diese Frau geheiratet hatte, hatte Bjarnhardur sie fest im Griff gehabt. Dass sie sich in ihren jungen und von Dummheit geprägten Jahren dann von diesem schleimigen Prediger hatte verführen lassen, war jetzt ihr Problem. Gott wusste, ob der Pastor etwas ahnte.
Bjarnhardur fuhr nordwärts und wendete das Auto an der alten Tunnelmündung. Er hielt an und überlegte, wie stark der entgegengesetzte Verkehr sein mochte. Dann drehte er seinen behaarten, starken Arm und schaute auf die Uhr. Es war bald neun. Nun stand es ihm frei zurückzufahren.
Die Sonne spendete bereits Wärme, als Anita unterhalb der Kirche auf zwei Kindergärtnerinnen traf, die eine Gruppe aufgeregter Kinder anführten. Sollte sie wieder auf die Hauptstraße zurückkehren? Anita schaute sich um und betätigte, hauptsächlich zum Spaß, die Fahrradklingel. Die Kinder waren bei guter Laune und grüßten. Sie wichen zur Seite, sodass sie vorbeifahren konnte. Vielleicht würde sie später auch einmal Kindergärtnerin werden. Sie selbst hatte keine jüngeren Geschwister, obwohl sie sich das so sehr gewünscht hatte. Dafür gab es aber einen großen Bruder, der Dennis hieß. Er war gerade 18 geworden und bereits seit einiger Zeit mit dem Fischkutter unterwegs.
An der großen Kreuzung, wo die Stadtverwaltung nach zahlreichen Diskussionen über Verkehrssicherheit Ampeln und Zebrastreifen eingerichtet hatte, stand Tarina und wartete darauf, die Straße überqueren zu können. Anita stieg vom Fahrrad ab, damit die beiden den Rest des Weges zusammen gehen konnten. Tarina strahlte über das ganze Gesicht und schwärmte davon, wie toll es im Sommerlager gewesen war. Dort hätte es Mädchen aus dem ganzen Land gegeben. Eine ganze Woche lang hätten sie dort gespielt und viel gelacht. Sogar verschiedene Wettbewerbe hätten sie ausgetragen, wären in kleinen Gummibooten herumgepaddelt und hätten Forellen geangelt. Und dann erst die Ausritte in die freie Natur. An anderen Tagen hatten sie gemalt, gesungen und über Jesus gesprochen. Es hätten auch einige Mädchen aus Norðvík am Lager teilgenommen. Ruth und Martha aus ihrer Klasse seien selbstverständlich dabei gewesen. Und sogar Maria. Das sei das Allerbeste gewesen. Sie hätte nicht erwartet, dass Maria mit gedurft hätte. Aber das habe wirklich Spaß gemacht, sie hätten sogar alle auf dem gleichen Zimmer gewohnt. Anita solle beim nächsten Mal doch auch mitkommen! Aber die fühlte sich ein bisschen außen vor. Ihre Mutter wollte nicht, dass sie mit in dieses Sommerlager fuhr. Die Kinder dort gehörten nicht zu ihrer Gemeinde. Mehr gäbe es dazu nicht zu sagen.
„Ich bin in Dänemark gewesen, und dort gab es fürchterlich viele Bienen.“ Anita zuckte ein bisschen, als sie das sagte, und auf ihrer Wange bildeten sich Lachgrübchen.
„Bist du etwa erlöst worden?“ Die Frage kam wie aus heiterem Himmel.
Anita blickte leicht erzürnt zu Tarina auf. „Ja, das bin ich“, sagte sie und wechselte schnell das Thema. „Ronja kommt heute in die Schule. Ich freue mich so sehr, sie zu sehen. Sie ist in den Ferien durch Italien und Schweden gereist und dürfte ziemlich braun sein.“
Als sie das Schulgelände erreichten, kam Hallvin auf seinem Mofa angefahren. Ein Mädchen aus der 8. Klasse saß auf dem Rücksitz. Er setzte sie am Eingangsportal ab. Hallvin zündete sich eine Zigarette an und schaute sich um, so als wünschte er sich, dass ihn ein Lehrer sehen und bitten würde, diese wieder auszumachen. Vielleicht wollte er sich auch nur vor den jungen Mädchen aufspielen. Alle wussten, wer Hallvin war. Er tat nur das, wozu er Lust hatte. Auch wenn es gegen Regeln und Gesetze verstieß.
Die beiden Mädchen gingen Richtung Eingang. Tarina sah zu Boden. Als wolle sie dem Blick des Jungen ausweichen, der dort in seiner schwarzen Lederjacke stand und sie empfing wie der König der Schule. Möglicherweise hatte sie ein wenig Angst vor ihm. Anita dagegen war eher beeindruckt von einem jungen Pärchen, das flirtete, knutschte und dümmlich lachte, wenn es jüngere Schüler vorbeilassen musste.
Die Mittagspause verbrachten alle draußen. Einige Jungen spielten auf der Wiese Fußball, während eine junge, lächelnde Lehrerin auf dem heißen Asphalt stand und ein Hüpfseil schwang, zwischen dessen Enden sich eine Schar fröhlicher Kinder vergnügte.
In einer weiteren Runde standen einige Jungen, und an der Wand saßen die Mädchen in gestreiften Blusen oder T-Shirts und plauderten, kicherten oder sahen einfach hinauf in den blauen Himmel. Die Wettergötter meinten es so gut mit ihnen. Es machte einfach Spaß, die Jacken und Pullover auszuziehen und Gesicht und Arme von den Sonnenstrahlen streicheln zu lassen.
Dieser Moment brannte sich im Gedächtnis der sieben Mädchen aus der 6a fest ein. Das hatten sie insbesondere Bjørg zu verdanken, einem Mädchen aus der Nachbarklasse, die mit Ronja befreundet war und die sie im Laufe ihres Lebens alle noch besser kennenlernen sollten.
Bjørg hatte an diesem Tag eine Kodak-Kamera in die Schule mitgebracht und versuchte, den Mädchen für ein Foto ein Lächeln zu entlocken. Sie wollte den Film gerne voll haben, um ihn dann entwickeln zu lassen.
„Es ist noch ein Bild übrig, ihr bekommt also nur diese eine Chance“, sagte sie wie eine professionelle Fotografin und ging einige Schritte zurück, damit alle auf dem Foto Platz fanden. Es gelang ihr. Die Mädchen standen alle und niemand blinzelte in die Sonne.
„APFELSIIIINE!!“
Links außen stand Jórun, die beinahe schon genauso große Brüste hatte wie die Mathelehrerin. Neben ihr Maria und Tarina, die sich liebevoll Schulter an Schulter aufgestellt hatten. In der Mitte Anita in einer weißen Sommerbluse und mit rotem Blumenschmuck im Haar. An ihrer Seite die sonnengebräunte Ronja im Tutti-Frutti T-Shirt, in dem sie einem lächelnden spanischen Apfelsinenmädchen ähnelte. Rechts von Ronja das kindlichste Mädchen der Gruppe, Ruth. Mit ihren kurzen Haaren glich sie eher einem Jungen. Und am äußeren Ende des Bildes die lange und verzagte Martha, die ein großes Kreuz auf der Brust trug.
KLICK! Bjørg versprach, dass sie alle das Ergebnis zu sehen bekämen, sobald sie den entwickelten Film in 14 Tagen zurückhätte. Und sollte das Bild geglückt sein, würde sie Anita einen Abzug geben.
Die Schulglocke klingelte. Sie warteten etwas beunruhigt und angespannt auf Tummas Pól, den sie als Erdkunde- und Geschichtslehrer bekommen sollten. Von den Schülern anderer Klassen hatten sie schon viel über diesen Mann gehört und ihn in einigen wenigen Vertretungsstunden auch selbst erlebt. Daher wussten sie, dass Tummas Pól in seinem Beruf als Lehrer völlig aufging. Dem Hören nach hatte er sich noch nicht einen Tag krankgemeldet, seit er 1975 an der Schule angefangen hatte. Er war nicht verheiratet und duldete weder Lärm noch Schüler, die nichts konnten oder gar den Unterricht störten. Sie sollten besser nicht erwarten, dass er bei Sonnenschein einmal einen Ausflug mit der Klasse machen würde. Vielmehr stand er in dem Ruf, ein Lehrer mit festen Prinzipien zu sein. Und streng noch dazu. Es gäbe keine Stunde, in der mal gespielt wurde. Die älteren Schüler wussten einiges darüber zu berichten. In den ersten Berufsjahren sei ihm ziemlich leicht die Hand ausgerutscht. Er hätte nicht gezögert, die Kinder mit brennenden Ohrfeigen und Nachsitzen zu bestrafen. Nach heutigem Schulgesetz war das nicht mehr erlaubt. Jetzt mussten die Lehrer, selbst Tummas Pól, aufpassen, dass sie nicht von den Eltern oder der Schulleitung angezeigt wurden.
Anita fühlte sich dennoch unsicher, als ein großer Mann in brauner Polyesterhose und kariertem Sakko die Tür öffnete und die 6a aufforderte, sich in einer geraden Reihe aufzustellen, um ihm in den Klassenraum zu folgen.
Sie setzten sich still hin, jeder auf seinen Platz, und warteten ab, was Tummas Pól jetzt sagen würde. Er hatte zwei Stapel Bücher auf das Lehrerpult gelegt, die so aussahen, als wären sie schon alt und häufig gebraucht worden.
„Guten Tag, alle zusammen. Willkommen zurück in der Schule!“
„Danke gleichfalls“, antwortete die ganze Klasse höflich im Chor.
„Ich werde euch in Erdkunde und Geschichte unterrichten. Gleich teile ich die Bücher aus, in die ihr bitte eure Namen schreibt. Denkt daran, sie mit einem Schutzumschlag zu versehen. Für heute steht Erdkunde auf dem Plan. Ich werde daher einen Teil der Stunde nutzen, über Länder und Städte zu sprechen und euch kennenzulernen.“ Tummas Pól versuchte, freundlich zu wirken. Aus der Klasse war kein Mucks zu hören.
Als die Schüler die Bücher bekommen hatten, ließ der Lehrer eine Landkarte von der Decke herab. Er zögerte einige Sekunden, sah die Klasse an und entrollte die Karte mit allen europäischen Ländern vor der grünen Tafel. Selbstgefällig nahm er den Zeigestock von der Wand und zeigte lächelnd auf die Färöer-Inseln, dann auf Dänemark und schließlich auf Griechenland.
„Ja, ich selbst habe im Sommer eine interessante Reise gemacht. Es ist heute so einfach, zu fliegen und weit in der Welt herumzukommen. Die antike und kulturell so reiche Stadt Athen, mit all ihrer Mythologie, ihren historischen Schutzwällen und Gebäuden auf den Felsen der Akropolis, die solltet ihr euch für die Geschichtsstunden auch einmal ansehen. Nun würde ich gerne hören, wozu all die hübschen Damen dieser Klasse ihre kostbaren Sommerferien genutzt haben …“
Tummas Pól stellte sich auf die Zehenspitzen. Die Klasse folgte ihm mit aufmerksamen Blicken, während er mit kleinen, lautlosen Schritten zu dem Tisch hinüber tippelte, an dem Ronja mit ihren Gedanken anscheinend in einer anderen Welt weilte. Tummas Pól schaute sich im Klassenraum um, ehe er mit dem Zeigestock in das schwarze Haar des Mädchens stichelte. Ausgerechnet die schöne Ronja mit ihren großen braunen Augen und ihren kreideweißen Zähnen.
„Und du heißt?“
„Ronja Róksdóttir.“
„Es sieht fast so aus, als wärst du im Sommer auf Reisen gewesen?“
„Ja, ich war vier Wochen lang im internationalen CISV-Kinderfreizeitlager in Venedig in Italien und danach zwei Wochen bei meinem Papa in Schweden.“ Ronja sprach fast wie eine Erwachsene. Sie war Einzelkind und wohnte bei ihrer Mutter in Norðvík. Keiner aus ihrer Klasse hatte ihren Vater je gesehen. Er war Boxer und wohnte im Ausland. Das wussten sie alle.
„Das hört sich wahrlich interessant an.“ Tummas Pól gelang es, Ronja an die Tafel zu beordern, wo sie ihnen auf der Europakarte diese interessante norditalienische Stadt zeigen sollte, die direkt auf Meeresspiegelniveau liegt und in der die Leute nicht in Autos, sondern mit Booten zwischen den Häusern fahren.
„Das Sommerlager lag etwas außerhalb der Stadt. Wir waren aber drei Tage direkt in Venedig, wo wir auch mit einer Gondel gefahren sind“, berichtete Ronja. „So heißen die kleinen Boote, welche die Rundfahrten für Touristen machen. Der Mann, der unsere Gondel steuerte, hatte nur ein Ruder, und unterwegs sang er für uns.“
Ronja konnte gut erzählen. Fast besser als der Lehrer selbst. Alle hörten zu, nur ein paar Jungen schauten sich etwas einfältig an, als sie diesen amüsanten Namen des Bootes gebrauchte: Gondel. Das klang beinahe wie …
„Du bist auf den Kanälen Venedigs gefahren und hast die alte italienische Kultur erlebt. Alle Achtung! Dann hast du sicherlich auch Spaghetti und Pizza gegessen?“
Ronja erklärte, dass sie in den Ferien weder Schwarzbrot noch Äpfel zu essen bekommen hatte. Aber das habe ihr auch nicht gefehlt. Das Essen habe dennoch allen geschmeckt. Auch den Kindern aus Afrika, Indien und den USA. Sie hätten jeden Tag Tomaten gegessen, und sie habe sogar Oliven probiert. Zuerst hätte sie gedacht, dass es Weintrauben seien. Aber dann habe es so bitter geschmeckt, dass sie alles ausspucken musste.
„Danke“, sagte Tummas Pól. „Du wirst bestimmt einmal eine gute Reiseführerin, wenn du groß bist, Ronja.“
Wie denn wohl dieses Mädchen hieße, und was sie Spannendes zu erzählen hätte? Tummas Pól ließ den Zeigestock auf den Tisch hinuntergleiten, an dem Jórun saß.
„Oh … Ich heiße Jórun, und ich bin im Sommer nicht weg gewesen. Doch, ja, ich war eine Woche in Hvannasund, und da haben wir mit der ‚Másin‘ einen Ausflug auf die Insel Fugloy gemacht.“
„Alle Achtung“, sprudelte es aus Tummas Pól heraus. Jórun war klar, dass er das aus reinem Spott sagte. Ihr wurde warm im Gesicht vor Verlegenheit. Sollte sie sagen, dass sie mit den Pfadfindern unterwegs gewesen war und in Høgadalur gezeltet hatte oder dass sie mit ihrem Vater am Kap Enniberg gewesen war? Sie zog es vor zu schweigen. Jórun nahm sich vor, diesem vertrockneten, strengen Lehrer niemals etwas zu sagen.
Tummas Pól schien sie gleichgültig zu sein. Er beeilte sich, weiterzukommen. Es war aufregender, Maria zuzuhören, die zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern mit dem Auto rund um Island gefahren war und dabei große Wasserfälle, Gletscher und heiße Quellen gesehen hatte.
„Ein Mädchen schaffen wir noch in dieser Stunde. Ich glaube zu wissen, dass du Ruth heißt und nach deiner Oma benannt worden bist?“
„Ja, aber das ist ein biblischer Name. Ruth war die Stammmutter von König David.“
„Alle Achtung“, sagte Tummas Pól nun schon zum dritten Mal in dieser Stunde. Jórun sah auf und richtete ihren Blick auf die nette, kleine Ruth, die den Sarkasmus in der Stimme des Lehrers nicht erkannte.
„Ich bin eine ganze Woche im Sommerlager gewesen. Das war sehr lustig und lehrreich. Wir spielten draußen, sangen und lasen in der Bibel …“ Ihre Stimme klang schrill und die Worte kamen abgehackt.
„Danke, Ruth. Du wirst sicherlich mehr davon im Religionsunterricht erzählen können. Hier läuft uns bereits die Zeit davon.“
Tummas Pól holte das Protokoll aus der Lehrerschublade hervor, zögerte einen Moment, las sich schnell alle Namen durch und schaute einen Augenblick in die Rubrik, in der die Eltern aufgeführt waren. Da war etwas, das ihm nicht so ganz logisch erschien. Da würde er sich zweifellos erst einmal schlaumachen müssen.
Sieben Mädchen und dreizehn Jungen, denen dieses Land irgendwann einmal vertrauen sollte, fragte er sich. Aja. Ich glaube daran.
Tummas Pól lächelte die Klasse an, die bereits die Bücher in die Tasche gepackt hatte und darauf wartete, raus in die Sonne entlassen zu werden. Er dachte sich das Seine. Aber es war am besten, möglichst wenig davon auszusprechen.
„Beim nächsten Mal haben wir Geschichte. Es ist von größter Bedeutung, über das Alte und Vergangene Bescheid zu wissen. Ihr seid die Zukunft des Landes. Irgendwann einmal wird vielleicht auch euer Leben eine spannende Erzählung oder gar Geschichte sein.“
NOVEMBER 2016
Zwei leise Pieptöne des Telefons und ein roter Kringel um Mittwoch, den 23. November 2016, erinnerten in diesem neuen digitalen Zeitalter daran, dass sich sechs Frauen zu einem gemütlichen Abend des Strickclubs treffen wollten.
Anita war wütend. Sie ging auf und ab, nahm das Telefon in die Hand, überlegte anzurufen, verzichtete dann aber darauf. Sie konnte genauso gut noch warten, obwohl das leichter gedacht als getan war.
Sie schaute auf die Uhr, es war 20.05 Uhr. Ihre kleinen Engel schliefen schon friedlich in ihrem gemeinsamen Schlafzimmer im Dachgeschoss. Ohne die geringste Ahnung, wie ungerecht die Welt sein kann. Das Mädchen ging in die erste und der Junge in die dritte Klasse.
Wie die Zeit vergeht. Nun war es nur noch gut ein Monat bis Weihnachten. Die Kinder wurden jeden Tag etwas aufgeregter. Und Anita freute sich mit ihnen.
Aber warum mussten in der dunklen Jahreszeit immer so schreckliche Dinge passieren? Sie bekam diese surreale Geschichte nicht aus dem Kopf. Dieser abscheuliche Vorfall, über den noch keine Medien berichtet hatten.
Denn dass irgendetwas Furchtbares passiert sein musste, hatte Anita sofort dem Gesichtsausdruck von Jákup, der bereits seit zehn Jahren bei der Polizei in Norðvík arbeitete, angesehen. Sie waren schon lange, bevor er seine Ausbildung begonnen hatte, ein Paar gewesen. An diesem Nachmittag war es nicht schwer, ihm anzumerken, dass etwas Ernstes vorgefallen war. Ursprünglich hatte Jákup den ganzen Tag zu Hause bleiben wollen, denn er hatte den Kindern versprochen, den alten Tretschlitten zu reparieren, falls er das hinbekommen würde. Aber dann kam ein Anruf, der ihm den Boden unter den Füßen wegzog. Selbst als er zum Abendessen nach Hause kam, um eine kurze Pause einzulegen, hatte er noch ernst und blass ausgesehen. Jákup hatte nichts gegessen, nur die Schafsschulter angestarrt, die sie auf den Tisch gebracht hatte. Dann hatte er sich die Hand vor den Mund gehalten und war zur Toilette gelaufen, um sich zu übergeben. Er wollte keine Details verraten von dem, was sich wirklich zugetragen hatte. Aber er konnte sein Entsetzen kaum verbergen.
Sie wohnten in einer kleinen Siedlung, wo sich Gerüchte schnell verbreiteten. Anita sollte jedenfalls nicht herumtratschen. Auch heute Abend nicht, wenn sie alle zu ihr in den Strickclub kommen würden.
Anitas Kopf platzte fast vor Gedanken. Die Körnerbrötchen im Backofen hatten bereits Farbe angenommen und waren jeden Moment soweit, herausgeholt und auf die schwarze Steinplatte gelegt zu werden. Sie hatte Eier gekocht und die Schalentiere aus dem Kühlschrank genommen. In einer Stunde würden die Ersten kommen. Es war nicht gerade wenig, was sie heute Abend anzubieten hatte. Ob Maria die Einladung bekommen hatte? Und Lina, würde sie wohl kurzfristig Bereitschaftsdienst im Krankenhaus haben?
Anita versuchte, überall gleichzeitig zu sein. Aufräumen, es gemütlich machen und das Essen im Auge behalten. Als das erledigt war, waren da noch die Winterjacken, die übereinander gehängt, und die Schuhe, die ordentlich auf ihren Platz gestellt werden mussten. Sie schaltete die Außenlampe an, die einen gelblichen Schein auf das selbst gemachte, an der Haustür angebrachte Schild warf. Mit schmucken Buchstaben stand darauf geschrieben: Undir Garðavatni 10. Hier wohnen Bjørk, Bárður, Anita & Jákup á Trom.
Das Haus hatten sie vor fünf Jahren bauen lassen. Sie beide waren in Norðvík geboren und aufgewachsen, sodass nie ein Zweifel daran bestanden hatte, wo sie in Zukunft leben würden. Mehrere Jahre lang war die Nachfrage an Grundstücken groß, und sie hatten geduldig auf der Warteliste der Stadtverwaltung gestanden. Als dann die neue Parzellierung des zuvor geschützten, idyllischen Gebiets am Garðavatn vorgenommen wurde, hatten sie diese Chance genutzt. Dank der sonnigen Lage und dem herrlichen Blick auf Suðurvík hätten sie für ihr Haus kaum einen besseren Ort finden können.
Die Gebirgssilhouette verbarg sich an diesem Mittwochabend im November allerdings in der Dunkelheit. Und Anita hatte wahrlich an anderes zu denken als an das, was sie tagtäglich durch ihre großen Fenster sah.
Gnade uns Gott! Der Wind sauste draußen durch die kahlen Äste. Selbst drinnen spürte sie den Luftzug auf der Haut, sodass die Härchen auf ihren Armen zu Berge standen. Sie goss den hellroten Hummer ab, der mit seinen toten Augen zu ihr hinaufstarrte. Anita hätte beinahe gekotzt. Sie brauchte ein Glas kaltes Wasser, ehe sie es mit diesem Geschöpf auf dem Tisch aufnehmen konnte.
So wie Jákup sich angehört hatte, war jemand ermordet worden. Die Polizei war zwischen drei und vier bei der angegebenen Adresse gewesen. Es sei ein erschütternder Anblick gewesen. Anita wollte sich selbst nichts vormachen. Zwei Kräfte stritten in ihrem Inneren: Einerseits klang es entsetzlich, andererseits aber auch spannend.
Sie schaute erneut auf die Uhr und nahm die Brötchen aus dem Ofen. Keiner hatte sich abgemeldet. Demnach würden sie heute Abend zu sechst sein. Die vier Klassenkameradinnen und dazu Bjørg, die Freundin aus der Parallelklasse, und Lina, die inzwischen mit Anitas Bruder verheiratet war.
Sie ließ warmes Wasser laufen und wusch sich die Hände. Als eine der Ersten hatte sie die Nachricht bekommen, die sich rasch verbreiten würde: Hallvin war auf rätselhafte Weise gestorben.
* * *
Er lag mit weit aufgerissenem Mund und starren, nach oben gerichteten Augen auf dem Fußboden. Es war zweifellos nur noch eine Frage von Minuten, bis die Seele versuchen würde, jenseits des Horizonts um Obdach zu bitten. Sie schaute auf sein Gesicht und den steif werdenden Körper. War er schon tot? Steckte nur so wenig Widerstand in diesem Mann, der früher einmal so gewaltbereit und böse gewesen war? Sie schob eine zweite Stricknadel durch die Rippen hindurch und bohrte sie in sein Herz.
So, die Arbeit war getan. Aber würden die Menschen bei Gericht das gutheißen, was sie getan hatte? Wohl kaum. Wenn es mit ihr in Verbindung gebracht würde, wäre sie gebrandmarkt. Ein für alle Mal. Obwohl sie doch schon genug gestraft war.
Vorsichtig öffnete sie die Haustür einen Spalt. Draußen war es pechschwarz und still. Sie atmete die reine Luft tief ein und blies Millionen von Molekülen hinauf zum Himmel. Und ging dann wieder in den feuchten Flur. Drehte den Schlüssel um. Niemand würde mehr kommen. Sie war jetzt ganz ruhig. Sie war schon immer gut vorbereitet gewesen auf das, was sie tat.
Jetzt galt es, mögliche eigene Spuren zu beseitigen und sich etwas einfallen zu lassen, das die Polizei in die Irre führen könnte.
Mit einem Küchenhandtuch putzte sie alle Stellen ab, die ihre Finger berührt hatten. Die Türschlösser, den Strickkorb, den Wohnzimmertisch, die Armlehne des Sessels und die Fotoalben. Außer dem einen Teil, das sie mitnehmen wollte.
Im Flur ließ sie die Lampe brennen, damit das Haus nicht so dunkel und unheilvoll aussah.
Sie sah in die stille und menschenleere Nacht hinaus. Oh, was für eine Ruhe sie jetzt empfand. Vor ihm.
* * *
Zwischen drinnen und draußen herrschte ein Temperaturunterschied von etwa 20 Grad. Jenseits der Scheibe lag eine andere Welt.
Das Schild trug die Aufschrift ‚Global‘. Ronja drückte die schwere Tür auf und gelangte ins Warme. Sie blies die Winterluft aus ihren Lungen und hinterließ kleine Tauperlen auf dem blanken Glas. Im Korridor sah sie eine gut gekleidete Frau, die sie in dunklem Mantel, mit Kopftuch und dunkelgrüner, selbst gestrickter Mütze in Empfang nahm. Ronja grüßte, befeuchtete ihre eisigen Lippen und lächelte ihr eigenes Spiegelbild an. Die Außentür glitt wieder zu, die Laute der Autos und Fußgänger ebbten ab und gingen in einen neuen Geräuschmix aus Espressomaschine, Tellergeklapper, Musik und Kaffeegeschwätz über.
Ronja gefielen der Stil und die Atmosphäre dieses neuen Lokals. Sie fühlte sich gleich wie zu Hause, als sie in den warmen, gemütlichen Raum eintrat und ihr der Duft von frischgemahlenem Kaffee Arabica in die Nase stieg. Am Tisch unter einem Mandela-Bild saßen zwei homosexuelle Männer und schauten einander tief in die Augen, während sie aus kleinen Tassen Mokka schlürften, der ursprünglich aus der gleichnamigen Hafenstadt stammte. Von einer kaffeeliebenden Halbinsel, die ins Rote Meer hineinragte.
Sie selbst bestellte eine Kanne grünen Tee mit Chinablättern sowie ein Körnerbrot mit Schinken aus Múli und Käse. Der Mann hinter der Theke nahm freundlich ihre Bestellung entgegen. Locker warf er ein, dass es heute draußen sowohl dunkel als auch kalt sei.
„Wie soll ich sagen“, fuhr er fort, „du bist hier im ‚Global‘ jederzeit willkommen, ein wärmendes Plätzchen an unserer Feuerstelle zu finden. Oder auch, um die Aussicht aus jedem dieser Fenster zu genießen, aus denen du auf die Straßen der Stadt schauen und die Lichtmasten der Bucht zählen kannst.“
Jeder Besucher hatte das Gefühl, er sei hier im Zentrum der Welt. Tagsüber konnte man einen leichten Imbiss bekommen und, je nach Bedarf, exotische Speisen und Getränke genießen oder zumindest probieren. Für Ronja war es Balsam für die Seele, sich einen Moment hinzusetzen, sich bedienen zu lassen, mit irgendwem zu sprechen, nur da zu sitzen und zu beobachten, Leute anzuschauen oder sie einfach ihre Arbeit tun zu lassen.
Die Hintergrundmusik stammte aus allen Teilen der Welt und lullte sie ein. Die Bilder an den dunklen Wänden zeigten bedeutende Persönlichkeiten der Zeitgeschichte. An der Innenwand, an der Ronja saß, schaute Mahatma Gandhi friedfertig vor sich hin. An seiner Seite stand Mutter Teresa und streckte ihre Hände einer Gruppe von Kindern entgegen. Obwohl Ronja allein war, fühlte sie sich in guter Gesellschaft.
Für einen gewöhnlichen Mittwoch war das ‚Global‘ ausgesprochen gut besucht. Zwei Pärchen saßen auf der anderen Seite des Raumteilers und lachten über die Anekdote eines Mannes, der an ihrem Tisch stand und ihnen erzählte, was ihm passiert war. Schräg gegenüber diskutierten einige Schüler über die Fähigkeiten des neuen Bürgermeisters und stritten darüber, wer denn nun die große mexikanische Pizza, die sie sich zuvor so christlich geteilt hatten, bezahlen solle.
Ein anderer Grund für Ronjas Vorliebe für dieses Lokal war, dass das ‚Global‘ nur einen Steinwurf von ihrer Wohnung, die sie kürzlich bezogen hatte, entfernt lag. Es war so viel passiert während ihrer Abwesenheit, und auch die Stadt hatte sich ziemlich verändert. Neue Arbeitsplätze in fast allen Bereichen hatten viele Zuwanderer herbeigelockt, die das gesamte Geschäfts- und Kulturleben beeinflussten.
Nach kurzer Zeit kam der freundliche Kellner mit seinem Tablett herbei. Messer und Gabel waren in eine Stoffserviette eingerollt, und aus der Teekanne dampfte es. Er stellte den Teller mit dem Essen vor ihr auf den Tisch. „Wohl bekomm’s!“
Ronja Róksdóttir bedankte sich und verschlang bereits mit den Augen das typisch färöische Brot, dessen Originalrezept von Guttorm aus Múli stammte.
Doch ja, auch das Leben in Norðvík im Allgemeinen gefiehl ihr gut. Es war nicht verkehrt, hier zu leben. Auch nicht für eine 38-jährige, unverheiratete Frau. Nach mehreren Jahren im Ausland hätte sie nicht erwartet, dass sie sich in ihrer alten Heimatstadt wieder so wohl fühlen würde. Es war eine gute Entscheidung gewesen, zurück nach Hause zu ziehen. In dieser Stadt hatte sie ihre Kinderschuhe abgelaufen, etliche Schuljahre absolviert und den ersten Teil ihrer Jugend verbracht. Mit den Eltern war es ihr mal so und mal so ergangen, aber beide hatten sie, jeder auf seine Art, unterstützt und ihr viel Gutes mit auf den Weg gegeben. Ihr Papa hatte überall und nirgendwo gelebt. In jungen Jahren war er Berufsboxer gewesen. Aber im Laufe der Jahre wurden die Zeitintervalle zwischen den Siegen immer länger, und nach einigen großen Enttäuschungen im Ring begann der persönliche und finanzielle Niedergang. Ronja hatte in all den Jahren dennoch engen Kontakt zu ihm gepflegt. Er war ihr bis zu seinem allerletzten Tag ein liebevoller Ratgeber, obwohl er sich durch die 49 Jahre, die ihm das Leben schenkte, nur hindurchgeboxt und -geschlagen hatte, ehe er – als gefallener Verlierer – starb.
Ja, Friede sei mit ihm, seufzte Ronja. Sie selbst wollte aus ihrem Leben immer das Beste herausholen. Mit dem Bambusstäbchen rührte sie in der großen, pinkfarbenen Teetasse herum und probierte die frischen chinesischen Kräuter. Diese hätten ihr auch nicht besser geschmeckt, wenn sie nun in Århus oder London gesessen hätte. Aber diese Zeiten waren nun einmal vorbei.
Ronja scrollte zufrieden durch die Datei auf ihrem Laptop, las den ganzen Text noch einmal und nahm einige Korrekturen vor. In ihrem Bericht über den norwegischen Halbfäringer Hans Waagberg versuchte sie, diesem kürzlich abgereisten Arzt nahezukommen. Der Artikel war überaus wichtig, denn der alte Arzt war auf seinem Gebiet kompetent, beliebt und ehrlich gewesen. In seinen Sprechstunden redete er nicht um den heißen Brei herum. Er hatte den Mut, auch über politische Einrichtungen und die Arbeit der Krankenhäuser zu sprechen und dabei anzudeuten, wie hilflos dort so manche Patienten ‚geparkt‘ wurden. Die ‚Vorgärten des Todes‘, wie er die neuen Altenwohnheime nannte, seien unnötig teuer, steril und eine oberflächliche Lösung – sowohl für die Bevölkerung als auch die Gesellschaft. Es sei halt leichter, nicht selbst Hand anlegen zu müssen, hatte Waagberg gesagt.
Ronja Róksdóttir drückte auf ‚Senden‘ und steckte den kleinen PC wieder in die Tasche. Ihr Bericht würde in der ‚Vikan‘ zu lesen sein, einer Zeitung, die regelmäßig jeden Freitag in Druck ging. Bruchstücke des Artikels würden zusätzlich in der digitalen Version dieser dänisch-färöischen Zeitung veröffentlicht werden, die im letzten Jahr viele neue Leser gewonnen und somit ein Loch in der Medienlandschaft gestopft hatte.
Nun würde sie gerne eine Zigarette rauchen. Auch wenn sie sich jeden Tag selbst betrog, indem sie sich einredete, sie wäre eine Gesellschaftsraucherin, gefiel es ihr, allein an die Luft zu gehen. Zum dritten Mal an diesem Tag drückte sie eine ‚Prince light‘ aus der weichen Packung.
Der Geschmack von kalter Novemberluft und zeitlosem Rauch gab ihrem Körper ein gutes Gefühl. Sie dachte über ihr Leben und ihre Zukunftschancen nach. Die Arbeit beanspruchte einen großen Teil ihrer Zeit, doch all die Jahre hatten ihr auch wertvolle Erlebnisse, Liebe und ein harmonisches Miteinander geschenkt. Aber es war genauso wichtig, den Augenblick zu nutzen. Heute Abend würde sie gemeinsam mit fünf netten, redseligen Freundinnen am Strickclub teilnehmen. Das war niemals langweilig, und oft wurde es spät, ehe sie nach Hause kam. Es fehlte an nichts. Morgen hatte sie vor, einen arbeitsfreien Tag einzulegen. Sie machte zwei Schritte auf den Standaschenbecher zu. Als Journalistin gelang es ihr nicht, die Augen von der Polizeiwache fernzuhalten.
Was mochte dort wohl los sein? Zwei Polizeiwagen aus Tórshavn an einem Mittwochnachmittag in Norðvík? Das blaue Auto könnte das der Kriminalabteilung sein. Denk nicht immer an die Arbeit, versuchte sie sich selbst zu überzeugen. Das Tageswerk ist vollbracht, heute Abend stehen selbst gebackene Milchbrötchen und ein Stricknadelabend bei Anita auf dem Programm. Sie freute sich darauf, alle wiederzusehen, und dachte über die Worte nach, die ihre Oma immer zu sagen pflegte: „Eine Frau ist die, die strickt“. Sie prustete los. „Ja, dann bin ich das eben nicht“, kicherte sie vor sich hin.
* * *
Mit Widerwillen und Verachtung schaute sie auf den toten Mann. In Kürze würde alles, was ihn ausgemacht hatte, erstarren. Jeder einzelne Muskel dieses verfluchten Körpers. Rigor mortis. Sie verspürte große Lust, ihm den Penis abzuschneiden und in das aufgerissene Maul zu stopfen. Quasi als letzten Gruß und letztes Dankeschön. Dieser Gedanke reizte sie. Aber sie ließ es sein. Die Tat war schließlich nicht von einem perversen Psychopathen verübt worden. Sie wollte alles rechtfertigen können. Vor Gott und den Menschen. Die Polizei sollte nicht gleich das Motiv erkennen. Alle sollten sie unter Verdacht geraten … Die Familie, die Schwester, der Vater, die unterdrückte Frau, das Nickepüppchen, die Liebhaberin, die Partyfreunde und die Frauen aus dem Strickclub. Aber ihr Werk war noch nicht vollendet.
Sie schaute sich im Wohnzimmer um und ging hinüber zur Kommode. Dort stand ein gerahmtes Bild von vier Kindern. Es war wohl vor mehr als einem halben Jahrhundert aufgenommen worden. Am Konfirmationstag Tróndurs, der jetzt einen toten Sohn hatte. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto lag dessen Hand selbstbewusst auf der Schulter seines kleinen Bruders, der wiederum seitwärts in ein leeres Heim blickte. Die beiden Mädchen standen vorne. Die Jüngere trug ein weißes Kleid und hatte das Haar zu schmalen Zöpfen geflochten. Sie lächelte und ließ die runden Kinderzähnchen erkennen. Das ältere Mädchen hatte einen dunklen Rock und eine Bluse im gleichen Farbton an. Es sah betrübt und angsterfüllt aus, so als hätte ihr jemand gesagt, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte.
Viele Jahre später hatten sie und ihre Freundin hier in der Stube gesessen und gemalt, als der Großvater des Hauses nicht daheim gewesen war. Die Kinder fürchteten ihn. Sie selbst hatte diesen Mann nur einmal gesehen. Er war gewalttätig, man konnte ihm genauso wenig trauen wie einem bissigen Hund. Und große, behaarte Hände hatte er. Aber die Großmutter war immer nett und gut zu ihnen, gab ihnen zu trinken und brachte ihnen das Stricken bei. Später wurde ihnen gesagt, sie sollten dieses Haus im Ortsteil við Steiná nicht mehr allein aufsuchen. Und Marina hielt sich fern von ihm.
All das war nun Vergangenheit. Sie selbst würde diese Geschichte beenden. Den übelsten Teil dieser Schande töten, zu der sie, gezwungenermaßen und gegen ihren eigenen Willen, auch gehörte. Sie hatte sich nicht ohne Grund so spät am Abend ins Haus geschlichen. Ihre Mission war in Kürze erfolgreich beendet. Nun galt es, von hier wegzukommen, ohne Spuren zu hinterlassen. Und tatsächlich zurückzufinden ins Leben. Viele Jahre hatte sie sich danach gesehnt, Frieden mit der Vergangenheit zu schließen und die Zukunft in den Griff zu bekommen. Sie wollte einfach nicht mehr gefesselt sein. Sich endlich aus der alten Zwangsjacke befreien und eigene Verhaltensmuster entwickeln.
Sie blätterte im Fotoalbum. Und verharrte bei dem Mädchen im Konfirmationskleid. Es sah so unschuldig aus. Wie ein schöner Engel. Das Mädchen mit dem Silberherzen. Das seine beste Freundin betrogen hatte.
* * *
Die rote Lampe erhellte den kleinen Raum, in dem sich die Angestellten in grünen und weißen Kitteln jeden Tag mehrfach trafen. Sie saß gerade allein dort und schaute auf den Bildschirm, als sie folgende Nachricht hörte: „Lina Válará, bitte in Zimmer 2 kommen.“ Es war ungewöhnlich, dass ihr Name durch die Sprechanlage aufgerufen wurde. Auf diese Art in den Obduktionsraum zitiert zu werden, erschien ihr etwas beunruhigend.
Lina mochte ihre Arbeit im Krankenhaus. Die Wochen, in denen sie die Frühschicht hatte, gefielen ihr am besten, denn dann konnte sie die Kinder zur Schule bringen, ehe sie selbst ihren Dienst antrat.
Sie war mit einem Seemann verheiratet, der fast die Hälfte des Jahres unterwegs war. Daher war es manchmal schwierig, zu Hause alles unter Kontrolle zu halten. Lina stammte aus Tvøroyri und hatte selbst keine Verwandtschaft in Norðvík. Aber die Familie ihres Mannes hatte sie sehr gut aufgenommen. Anita, seine jüngere Schwester, war viele Jahre lang ihr Rettungsanker, nachdem sie als junges Mädchen von der Südinsel in diesen dunklen und fremden Landesteil gezogen war. Und so war es ein Glücksfall für sie, dass sie als eine der Ersten in diesen gemütlichen Strickclub aufgenommen wurde, dessen gesponnener Leitfaden aus einigen Freundinnen bestand, die seit der ersten Klasse, seit 1985, zusammengehörten.
Obwohl ihr Mann zur See fuhr und ihr der Schichtdienst oft dazwischenkam, konnte sie in den dunklen Wintern einige Abende gemeinsam mit ihnen verbringen. Und sie freute sich jedes Mal darauf.
Aber jetzt nahm der ruhige Arbeitstag eine ungewohnte Wende. Es war schon nach halb vier, Lina wollte gerade ihre Arbeitskleidung ablegen, als sie plötzlich aufgefordert wurde, einen Raum für einen Toten herzurichten. Als Krankenschwester hatte sie Erfahrung auf fast allen medizinischen Fachgebieten gesammelt. Leben und Tod gehörten im über 100 Jahre alten Krankenhaus von Norðvík von jeher zu den treuen Begleitern. Aber die Zeiten hatten sich geändert. Lina war froh darüber, ihre drei Kinder bekommen zu haben, bevor das Risiko einer späten Geburt zu groß wurde. Medizinische Spezialisten hatten empfohlen, dass alle Frauen zur Entbindung nach Tórshavn fahren sollten. Die Sicherheit für Mutter und Kind müsse zwar im Vordergrund stehen; es sei dennoch vertretbar, zwei Entbindungsstationen im Land zu schließen, verteidigten kluge Politiker ihren Beschluss vehement. Mit dem Ergebnis, dass Hebammen schon öfter die Schädeldecke des Kindes sehen konnten, wenn die Eltern in ‚Geburts-Havn‘ eintrafen. Leichen durften die Norðvíker, oder in diesem Fall sogar eine Südinsulanerin, jedoch weiterhin entgegennehmen.
Lina hastete auf dem harten Boden die gekalkten Wände entlang. Der alte Pförtner nahm sie mit völlig nichtssagendem Gesichtsausdruck in Empfang. Sie musste schon nachfragen, wollte sie etwas in Erfahrung bringen.
„Ein junger Mann ist heute tot aufgefunden worden. Der Leichenwagen kann jeden Moment eintreffen.“
* * *
War er ein Teil ihrer Familie? Der Ursprung ihres Schicksals und des Kreuzes, das sie zu tragen hatte? Der Vater, die Oma oder der Opa?
Sie spürte unbändige Wut in sich aufkommen und hatte größte Lust, die Fotos zu zerreißen und das Haus in Brand zu stecken.
Beruhige dich, beruhige dich …
Gott und der Teufel hatten sich lange genug um ihre Seele gestritten. Jetzt sollten sie gefälligst über den toten Mann, der auf dem Wohnzimmerboden lag, verhandeln. Ihr selbst würde schon vergeben werden. Ihre Nächsten und Liebsten würden sicher eine Falschaussage machen. Sie alle hatten ihr niemals die Wahrheit gesagt. Ihre ganze Kindheit war auf Lügen aufgebaut. Sie war immer zu gutgläubig gewesen. Hatte gehorcht und Vater und Mutter geehrt. War hilfsbereit und gehorsam gewesen. War in die Sonntagsschule gegangen, hatte die Bibel gelesen und alles geglaubt, was die Eltern und Lehrer sagten.
Wussten die Mädchen aus der Klasse davon? Hatten sie wohl im Strickclub darüber gesprochen? Sie verhöhnt, verspottet oder auf sie herabgeschaut? Wurde sie nur deswegen eingeladen? Aber wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Ihre Miene hellte sich auf. Es war gut, dass sie gerade niemand sah. Sie würden denken, sie wäre krank oder gar unzurechnungsfähig. In diesem Spiel war sie allen etwas voraus. Ihr gegenüber würden die Leute kein Misstrauen hegen. Aber sie wusste, wer unter Verdacht geraten und den Mord angehängt bekommen könnte.
* * *
Jórun Flink Olsen hatte den Kranken- und den Polizeiwagen über den Sjóvarvegur stadtauswärts fahren sehen. Nach neun demütigenden Jahren hatte sie die Schule geschmissen, weil die ihr nur wenig gebracht hatte, und probierte anschließend verschiedene Aushilfsjobs hier in der Stadt aus. Seit nunmehr zwei Jahren stand sie abwechselnd an den großen Bratpfannen und Gewürzmaschinen der neuen Fischverarbeitungsfabrik ‚Deiggj‘, die an dem Weg hinunter zur Bucht, im südlichen Teil der Stadt, lag.
In der Kaffeepause gingen einige der Frauen hinaus, um eine Zigarette zu rauchen. Auch sie hatten ein Polizeiauto und die Ambulanz mit hoher Geschwindigkeit in den Ortsteil við Steiná jagen gesehen, der von nur wenigen Menschen bewohnt war.
Jórun malte sich aus, dass in dem Haus etwas passiert sein musste, in dem Halla, die Frau von Per, dem Aussortierten, wie er auch genannt wurde, bis vor wenigen Monaten gewohnt hatte. Jórun seufzte und schüttelte den Kopf … Die glücklose Halla. Laut gut informierter Kreise des häuslichen Pflegepersonals schaute sie stets sehnsüchtig zu den Nachbarn hinüber, die auf dem Friedhof ihre letzte Ruhe gefunden hatten. Ihr Mann und die zwei Kinder waren schon vor ihr ins Reich der Toten hinabgefahren.
Maya hielt mit ihren schmalen, braunen, vorwitzigen Augen Ausschau, wo bloß Jórun blieb, während Lissy den grauen Zigarettenqualm durch ihre hellroten Lippen pustete. Beide warteten darauf, dass Jórun, die fast immer alles über alle wusste, herauskommen würde, um ihnen endlich zu erzählen, was denn los sei.
„Irgendetwas ist bei Lallvin passiert.“ Jórun versuchte, witzig zu sein. „Ich meine natürlich Hallvin. Er lebt in dem Haus, das die Familie von der Großmutter geerbt hat.“
Jórun war humorvoll, aber einfach gestrickt. Obwohl es nicht spaßig ist, wenn jemand die Polizei und einen Krankenwagen auf dem Hof stehen hat, brachte sie die anderen zum Lachen. Jórun kannte Hallvin besser als viele andere. Sowohl aus der Schule als auch aus ihrer Jugend. Er sei ein Luftikus und ziemlich ungenierter Kerl gewesen, der sich Lehrern und Schülern gegenüber wie ein wahres Arschloch benommen hatte. Viele hätten Hallvin gehasst und Angst vor ihm gehabt. Jórun schmunzelte und schaute ihre Arbeitskolleginnen fragend an … Ob sie denn seinen Onkel gekannt hätten, Bjarnhardur? Der sei ein berüchtigter Frauenheld gewesen und mehrfach im Jahr auf Abwege geraten. Wenn er in der richtigen Stimmung war, sei es für alle erwachsenen Frauen gefährlich gewesen, sich draußen allein aufzuhalten. So viel wüsste sie.
Lissy und Maya grinsten angewidert, ließen Jórun aber weitere spannende Geheimnisse auskramen.
„Bjarnhardur ist vor einigen Jahren gestorben. An einem schönen Sommertag im August hat er sein Auto ins Meer gesetzt. Habt ihr denn auch von dieser Geschichte nichts gehört? Einige behaupteten, er hätte einen Herzstillstand erlitten, nachdem er wieder mal bei einem Frauenzimmer war.“
Die drei amüsierten sich in ihrer Pause blendend und rätselten darüber, was denn nun wirklich passiert sein könnte, entweder am Sjóvarvegur oder in einem der anderen Häuser in við Steiná, wie dieser Stadtteil auch genannt wurde. Als die Zigaretten erloschen waren und sie wieder an der Maschine stand, die Knoblauch und färöisches Meeressalz auf die Fischstücke spritzte, drehten sich die Gedanken in ihrem Kopf weiter.
Sie dachte über Hallvin nach, mit dem sie gemeinsame Mofa- und Autotouren unternommen hatte, damals, als sie und die Freundinnen in die Stadt gingen, um nach Jungs Ausschau zu halten.
Und so erinnerte sie sich wieder an die Schulzeit und ihre Jugendjahre, die viel zu schnell vorübergegangen waren. Sie selbst hatte schon sehr früh erwachsen ausgesehen. Als sie 13, 14 war, glaubten viele Leute, dass sie und ihre Mutter Schwestern seien. Das war nicht immer lustig. Sie musste daher ausbrechen. Sich ungezügelter geben, härtere Musik hören, die Augenlider bemalen und die Haare an den Seiten und im Nacken wegrasieren. Eine Zeit lang ähnelte sie einer geächteten Indianerin.
Über ein Jahr lang mochte ihr Vater seine rebellisch eingestellte Tochter kaum anschauen. Die Mutter seufzte und versuchte sich als Friedensstifterin. Sie sprach auf eine eher pädagogische Art von Teenagern, die nicht wussten, ob sie noch Kind oder schon Erwachsene waren und von jungen Leuten, die daran zweifelten, ob sie als Mädchen oder als Junge zur Welt gekommen waren. Weder der Vater noch sie selbst hörten der Mutter zu, was kaum dazu beitrug, die Stimmung im Haus zu verbessern.