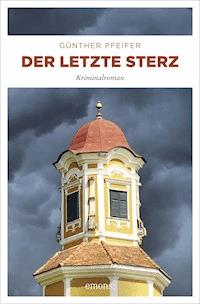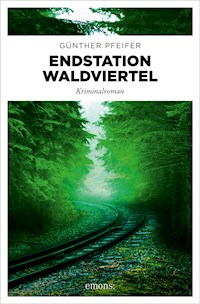Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hawelka & Schierhuber-Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
HAWELKA & SCHIERHUBER - ZWEI INSPEKTOREN MIT KULTPOTENZIAL In dem winzigen Dorf Vestenötting ist ein Unglück passiert. Hawelka und Schierhuber werden ins Waldviertel berufen, um der Sache ordentlich auf den Grund zu gehen. Der Birnstingl ist nämlich nicht von allein in seine Kreissäge gefallen. Nur, welchen Ermittlungsansatz wählen: Stammtischmethode oder Dorfsäufervariante? Die zwei Inspektoren können sich in diesem Fall nicht recht einig werden. Dabei haben sie sonst so viel gemeinsam: Beide hören auf den Vornamen Josef, sind fünfzig plus, leicht übergewichtig und erstklassige Zweite-Wahl-Ermittler bei der Wiener Kriminalpolizei. ABENTEUERLICHE VERWICKLUNGEN UND HERRLICH ORIGINELLE FIGUREN Jammerschade nur, dass im Dorf zwar alle alles wissen, aber keiner etwas gehört oder gesehen haben will. Die Kriegerdenkmalpflegerin, die Tag und Nacht durchs Dorf schleicht, genauso wenig wie der geizige Feuerwehrhauptmann oder Birnstingls Nachbar Tersch mit seinen hundert Katzen. Als dann allerdings ein Fremder beginnt, die Kätzchen vom Tersch an die Volksschulkinder zu verschenken, bekommt der Fall einen abscheulichen Beigeschmack. Die Dorfbewohner blasen schon zur Hexenjagd, als ein nächtlicher Einsatz Hawelka und Schierhuber in eine ganz andere Richtung führt ? Pures Krimivergnügen mit einer Riesenportion Humor, viel Lokalkolorit und Figuren, die man einfach ins Herz schließen muss. - Ermittlerduo mit Kultfaktor - Mord im beschaulichen Waldviertel - spritzige Krimi-Unterhaltung "Für Fans von Rita Falk und Herbert Dutzler ist dieser Krimi eine wahre Entdeckung!" "Ein wahrer Leckerbissen für alle, die spritzig-leichte Krimi-Unterhaltung und schrägen Humor mögen. Bitte mehr davon!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günther Pfeifer
Hawelka & Schierhuber laufen heiß
Ein Waldviertler Mordbuben-Krimi
Günther Pfeifer
Hawelka & Schierhuber laufen heiß
Gewidmet Didi Jäger
(1962–2011)
Prolog
15. Juni
»So war das«, wiederholte der Feuerwehrkommandant zum x-ten Mal. Sie saßen schon seit Stunden zusammen. Der Rauch im Wirtshaus war mittlerweile genauso dicht wie nachmittags beim Brand.
»Das ist wegen der Sparsamkeit passiert«, behauptete Wagner. »Von mir aus könnt’s ihr auch Geiz dazu sagen.«
»Kompletter Blödsinn«, stellte der Wirt fest.
»Was?«, fragte Wagner. Er glaubte, sich verhört zu haben. »Willst du damit sagen, dass es nicht am Birnstingl seiner Sparsamkeit gelegen ist? Willst du vielleicht abstreiten, dass er sparsam war? Oder, sagen wir es, wie es ist: sierig1?«
»Na, das streitet ja wohl keiner ab«, bemerkte Klausner und hob sein Bier. »Gar kei…«
»Ich schon«, unterbrach ihn der Feuerwehrkommandant. »Ich schon. Weil das nicht sierig ist, wenn man sparsam ist. Das sind komplett unterschiedliche Verhaltenssachen. Komplett. Wenn du nämlich behauptest, dass jeder, der sparsam ist, sierig ist, dann musst du mich auch sierig nennen. Dann musst du mir das aber ins Gesicht sagen, dass ich sierig bin. Bin ich sierig?« Er hatte seine ohnehin schon laute Stimme noch mehr erhoben und alle hörten den aggressiven Unterton heraus, der typisch für den Feuerwehrkommandanten war.
»Hab ich das gesagt?«, fragte Klausner unbeeindruckt und nahm noch einen Schluck.
»Du hast gesagt, dass …«
»Natürlich sind das zwei Paar Schuhe. Das ist klar. Das streitet niemand ab. Das sind zwei völlig unterschiedliche …«, wollte Döller schlichten.
»Bin ich sierig, oder was?« Der Feuerwehrkommandant war aufgestanden und bezog die anderen Leute im Wirtshaus mit ein, indem er die Frage noch zweimal wiederholte und dabei von einem Tisch zum anderen blickte.
»Bin ich sierig?«
»Kompletter Blödsinn«, schüttelte der Wirt den Kopf.
»Ob ich sierig bin, will ich wissen!« Der Kopf des Kommandanten hatte mittlerweile die Farbe des einzigen Feuerwehrautos von Vestenötting angenommen. Die anderen vermieden den direkten Blickkontakt und kümmerten sich um ihre Getränke. Der Kommandant war nicht geizig, das wussten alle. Trotzdem gab niemand eine Antwort auf die kasernenhofartig artikulierte Frage. Man ließ sich einfach nicht gerne zwingen. Außerdem amüsierte sein Ausbruch die nicht direkt Betroffenen ein bisschen. Man wollte sich schließlich unterhalten, wenn man schon ins Wirtshaus ging.
»So. Sierig bin ich also. Sierig. Ich! Ich bin sierig! Dann will ich euch einmal etwas fragen«, er war vom Tisch weggegangen und stand nun mitten im Raum, wo er alle im Blick hatte. »Wer hat denn zum Jubiläum vom Pfarrer einen Ochsen braten lassen? Wer? Und wer brennt2 der Feuerwehrjugend aus der eigenen Tasche drei Kisten Bier? Nach jeder Übung! Und sponsert einmal im Jahr zu denen ihrer Florianiparty das Feuerwerk? Wer ist denn da so sierig? Ha? Ha?! Bin das vielleicht ich? Na, sicher, weil ich ja so sierig bin, zahl ich das alles. Ich bin bekannt für meine Sierigkeit! Und zu meinem Fünfziger, da hab ich nur das ganze Dorf eingeladen und das Bier war auch das billigste, das zu kriegen war. Oder? Irgendein billiges Dosenbier vom Hofer war das sicher. Oder? Weil ich ja so sierig bin!« Die Feuerwehrautofarbe hatte einem kräftigen Violett Platz gemacht. Gesund konnte das nicht sein. Das Bier zu seinem Fünfziger war Fassbier aus einer Privatbrauerei gewesen. Sündhaft teuer. »Und jeder hat ein halbes Würstel gekriegt. Höchstens! Oder?« Er blickte wild umher, bereit, sofort jeden zu zerfleischen, der nickte. Aber niemand nickte. Erstens hatte es reichlich vom Spanferkel, außerdem Steaks und Brathendl gegeben, und zweitens hätte ein leichtes Nicken genügt, um eine Katastrophe auszulösen. Aber die Mundwinkel des einen oder anderen zuckten verdächtig. Der Feuerwehrkommandant kannte seine Zechgenossen, kannte dieses Mundwinkelzucken und kannte auch die Machtlosigkeit dagegen. Das machte ihn vollends rasend. Er holte tief Luft, und in diese Pause hinein sagte Klausner ganz ruhig: »Das Dosenbier beim Penny ist aber noch um einen Cent billiger als beim Hofer – also sagt’s nicht, dass er sierig ist.« Zufrieden widmete er sich wieder seinem Glas.
Nach einem Moment der Stille brach ein wahrer Orkan los. Die Männer kreischten vor Lachen. Tränen flossen und es wurde nach Luft geschnappt. Wagner schlug Klausner auf die Schulter, so fest, dass dem das Bier überschwappte. Der Feuerwehrhäuptling sah die Niederlage ein und fügte sich seinem Schicksal. Er schaffte es sogar, ein wenig mitzulachen.
»Natürlich bist du nicht sierig, Alter«, tröstete Wagner den Geschlagenen. »Du bist sparsam, das ist nicht dasselbe wie sierig. Bei dir nicht. Sparsam ist nicht automatisch sierig.«
»Niemals.« Das war der Wirt.
»Aber beim Birnstingl, das war keine Sparsamkeit, das war Sierigkeit«, fuhr Wagner fort. »Das müsst ihr doch zugeben. Er war geizig. Sierig. Oder ist es vielleicht nicht sierig, mit einer Bastelsäge Holz zu schneiden? Jahrelang? Mit einem Dreißiger-Blatt?«
»Das ist nicht Geiz, das ist Schwachsinn«, stellte Klausner fest.
»Mit einem Dreißiger schneid ich vielleicht Dachlatten durch und ab und zu einen Fünf-Achter-Staffel, aber doch kein Brennholz«, stimmte Döller zu.
»Buche überhaupt.«
»Buche oder Fichte, das ist ganz wurscht, du kannst mit einem Dreißiger gar nichts schneiden, außer die kleinsten Äste, das sagt einem der gesunde Menschenverstand«, meldete sich Wagner wieder. Die anderen nickten. Der Fall war klar. Ein Dreißiger-Blatt war unbrauchbar.
»Wenn er sparsam gewesen wäre, ich sag sparsam und nicht sierig, also, wenn er nur sparsam gewesen wäre, dann hätte er von mir aus auf die Wippe verzichtet und hätte sich eine normale Tischsäge gekauft. Das wäre sparsam gewesen, eine Tischkreissäge, aber mit einem Fünfziger-Blatt. Das wäre sparsam. Aber eine Micky-Maus-Säge3 mit einem Dreißiger-Blatt, das ist Sierigkeit, wie sie im Buche steht.«
»Ja, ja, aber da hilft dir das beste Fünfziger-Blatt nichts, wenn du mit tausend Watt herumrurchelst4, oder sollen es meinetwegen fünfzehnhundert gewesen sein.« Döller trank sein Bier aus und winkte dem Wirt.
»Sophie!« Der Wirt rührte sich nicht, sondern gab die Bestellung weiter, und die Kellnerin eilte herbei, um das leere Krügel zu holen.
»Wenn ich ein Dreißiger hab, ist es klar, dass ich das Schutzblech wegnehmen muss«, meldete sich jetzt erstmals wieder der Feuerwehrkommandant zu Wort.
»Na logisch, weil du sonst oben anstehst mit den Trümmern. Und drehen musst du sowieso die ganze Zeit. Da schneidest du nicht einmal durch, sondern zwei-, dreimal! Und das bei einem Buchenen, da ist der Motor schon nach einem halben Meter müde.«
»Klar«, sagte der Wirt.
»Tausend Watt, oder meinetwegen fünfzehnhundert, das ist nichts. Gar nichts ist das. Und ein Dreißiger-Blatt. Schwachsinn so was! Dreitausend Watt und ein Fünfziger. Das lass ich mir einreden«, wollte Wagner die Diskussion beenden.
»Mindestens.« Die anderen waren noch nicht fertig. Dieses Thema konnte man ruhig vertiefen.
»Mit dreitausend Watt wäre das kein Problem gewesen. Da wäre das Blatt durch, und aus. Nichts wäre stecken geblieben und zum Brennen hätte auch nichts angefangen.« Angesichts dieser unumstößlichen Erkenntnis schnippte der Feuerwehrkommandant nach der Kellnerin, symbolisierte zwischen Daumen und Zeigefinger ein sehr kleines Glas und machte eine nachlässige Kreisbewegung, die alle am Tisch Sitzenden einschloss. Die Kellnerin verstand und machte sich daran, eine Runde Schnaps einzuschenken. Die Stimmung versprach, wieder zu steigen.
»Mit einer Wippsäge wäre es noch weniger Problem gewesen, weil da hätte es gar nichts zum Steckenbleiben gegeben.« Manchmal hatte Klausner ein Talent zum Stimmungszerstörer. Trotzdem sahen sie sich gezwungen, beipflichtend zu murmeln und nachdenklich am Bier zu nippen.
»Ja, sicher, aber der Brand ist nun einmal durch den zu schwachen Motor ausgelöst worden, da brauchen wir gar nicht drüber reden«, beharrte Wagner auf der vom Sachverständigen aus Tulln festgestellten und somit amtlichen Tatsache.
»Kein Thema«, stimmte der Wirt zu.
»Wo hast du ihn?« Der angesprochene Feuerwehrkommandant zog zum fünften Mal an diesem Abend den Tullner Bericht aus der Tasche und reichte ihn Wagner. Dieser überflog ihn und zitierte auszugsweise: »… durch Verfangen des Sägeblattes … blieb der Elektromotor der Säge … eintausendfünfhundert Watt …«
»Hab ich ja gesagt: ‚Tausend Watt, oder von mir aus auch fünfzehnhundert‘«, unterbrach Döller triumphierend.
»Ja, ja, also … durch das Steckenbleiben des Elektromotors … bla, bla, bla, … Überhitzung und in weiterer Folge zum Verschmoren … infolge des feinen Sägemehls … möglicherweise Zugluft in dem Schuppen … So ein Blödsinn, seit wann heißt ein Stad’l Schuppen? … zu einem sich rasch ausbreitenden Brand. Na bitte, da haben wir’s schwarz auf weiß – Steckenbleiben! Fünfzehnhundert Watt! Brand!« Wagner schwenkte den Bericht. Inzwischen waren die Schnäpse gekommen, man trank auf das Wohl des Kommandanten, der somit von jeglichem Geizvorwurf entbunden war und der ihnen das beim Bezahlen selbstverständlich nochmals unter die Nase reiben würde. Anschließend belauerte man sich aus den Augenwinkeln, weil nach der ex getrunkenen Feuerwehrkommandantenschnapsrunde eigentlich der richtige Zeitpunkt gewesen wäre, bei der noch am Tisch stehenden Kellnerin eine weitere zu bestellen, sich aber niemand vordrängen wollte – nicht aus Geiz, versteht sich, sondern aus Höflichkeit. Schließlich zuckte Klausner mit den Schultern, meinte: »Die nächste auf mich«, und wandte sich Wagner zu.
»Na klar ist der schwache Motor an dem Brand schuld. Aber wenn der Birnstingl eine Wippsäge gehabt hätte, dann wäre er von mir aus ausgerutscht und reingefallen, aber gar nichts wäre passiert. Das Schutzblech hätte ihm vielleicht einen blauen Fleck gemacht, sonst nichts. Aber so hat auch der schwache tausend Watt-, oder von mir aus fünfzehnhundert-Watt-Motor genügt, um ihm mit dem Dreißiger-Blatt das Brustbein durchzuschneiden und ihm die Lunge zu zerfetzen, bevor es irgendwo im Rückenmark stecken geblieben ist und den Motor überhitzt hat. Da könnt’s ihr sehen, dass auch eine Micky-Maus-Säge ganz schön was leisten kann. Tod, Brand, alles da.«
Einsatz
Einen Tag später
Er hatte sich ein langes Wochenende verdient. Aber Fenstertage waren begehrt und bei der Wiener Kriminalpolizei war Hawelka nicht gerade das Alphamännchen. Eher einer der braven Beamten, den man oft bittet, zugunsten des eigenen Rafting- oder Bungee-Jumping-Wochenendes auf sein Ansuchen zu verzichten. Angesucht hatte er trotzdem. Und den Fenstertag freibekommen! Das war von Schierhuber und ihm beim Resniczek, ihrem Stammlokal, ausgiebig begossen worden. Ein schöner Mittwochabend. Der nächste Tag, der Feiertag, war auch noch schön gewesen. Dann hatte die Berlakovic angerufen.
»Es ist nicht meine Manier, dass ich einen vom trauten Kamin wegholen lasse«, dröhnte der Erzherzog zwanzig Minuten später. »Weil ich bin ein Freund von der Freizeit. Freizeit, die einem zusteht. Wenn sie einem zusteht! Aber, wie sagt man so schön? Den Letzten beißen die Hunde! Und wenn der Henk einen Kurs in … na, da irgendwo im Ausland macht, und wenn der Liechtenstein einen Peitscherlbubenmörder suchen muss, wenn zwei im Urlaub in Fernost sind und wir einen Hilferuf von die Kollegen aus dem schönen Niederösterreich bekommen – was glauben Sie, wer mir da einfällt? Ich geb Ihnen einen Tipp, aber keinen Tipp X: Mit ‚Hawel‘ fängt er an und mit ‚ka‘ hört er auf. Und nicht, dass Sie auf den tschechischen Ex-Präsidenten tippen, weil der schreibt sich mit ‚v‘ und hat kein ‚ka‘ angehängt. Und der Kaffeesieder ist schon tot, also wer, glauben S’, wird es sein?«
Der Erzherzog hieß eigentlich Johann P. Zauner, war Hofrat und Leiter der Mordkommission. Wofür das »P.« stand, wusste niemand. Warum man ihn »Erzherzog« nannte, wusste auch niemand. Eigentlich wusste man überhaupt sehr wenig von Zauner. Gerüchte gab es dafür umso mehr. Angeblich war er in seiner Jugend ein sogenannter »wilder Hund« gewesen. Ein paar Jahre in der Fremdenlegion, dann beim österreichischen Bundesheer als Ausbildner, später als Spieß. In dieser Phase war er wohl stecken geblieben. Zumindest von Ausdruck, Gehabe und Lautstärke her. Nicht karrieremäßig. Da ging es weiter: Umschulung zum Polizisten, Kriminalpolizisten, Sonderermittler, schließlich Beamtenaufstiegsprüfung, und jetzt also seit Jahren schon Leiter der Mordkommission. Längst alt genug, um in Pension zu gehen. Viele seiner Mitarbeiter beteten jeden Tag darum. Umsonst.
»Das mit den Niederösterreichern ist so eine Sache. Wenn’s nach mir geht, dann sollen sich die Bauernschädeln umbringen, wie sie wollen und wann sie wollen, und wenn’s aufgeklärt wird – gut. Und wenn’s nicht aufgeklärt wird – auch gut. Weil ich hab dort keine Verwandten und wir haben unsere eigenen Fälle zu lösen und sowieso immer zu wenig Leut. Greifen S’ mich an und spüren S’, wie kalt mich das lasst, wenn ein so ein g’scherter Lackl einen anderen derschlagt.«
Der Erzherzog war groß und hager. Eigentlich knochig. In den letzten Jahren hatte sich eine leicht gebückte Haltung eingeschlichen. Wenn er es bemerkte, richtete er sich kerzengerade auf – wie zu seinen besten Zeiten. Aber auch gebückt flößte er genug Achtung ein. Einer der älteren Beamten hatte Stein und Bein geschworen, er habe vor ein paar Jahren erlebt, wie ein Zuhälter mit dem Messer auf Zauner losgegangen war. Der hätte plötzlich auch eines in der Hand gehabt und bald darauf war der blutüberströmte Zuhälter von einem Notarztwagen abgeholt worden.
»Jetzt haben uns aber die – wie sagt man? – ‚lieben Kollegen‘ um Hilfe gebeten, weil sie vier Fälle von öffentlichem Interesse gleichzeitig laufen haben. Laufen haben sie die! Aber Leute haben sie keine dafür. Und jetzt liegt in so einem Dorf im Waldviertel ein Mann in seiner Kreissäge und wundert sich, warum das wehtut. Und warm ist ihm auch geworden, weil der Kreissägenmotor überhitzt und sein halber Hof dadurch abgebrannt ist. Natürlich will es jetzt keiner gewesen sein. Aber ich sage: Das gibt es nicht, weil so ein Sachverständiger von der Feuerwehr und ein Polizeiarzt haben sich den Verkohlten ang’schaut und meinen, wenn er nicht ein kleines Kunststück gemacht hat und aus dem Stand einen Meter hoch und anderthalb vorgehüpft ist, dann muss jemand nachgeholfen haben, damit er es sich auf dem Sägetisch schön bequem hat machen können. Die Dorfgendarmen aus Waidhofen sind dort und passen auf, dass niemand was angreift, und die Spurensicherung kommt aus St. Pölten, aber sonst kommt niemand. Also: Aus der Traum vom langen Wochenende! Nehmen S’ den Schierhuber unter den Arm und fahren S’ ins schöne Waldviertel, weil Sie kommen alle zwei von dort und verstehen die Bräuche von den Eingeborenen besser als der Schütz oder der Nimmervoll.«
Widerstand zwecklos. Wenn der Erzherzog befahl, zogen hartgesottene Prügelbullen und karrieregeile Jungoffiziere ebenso den Schwanz ein wie bürokratiegeschulte Ministerialbeamte und kämpferische Polizeigewerkschafter.
»Fahren S’ hin in das Nest, klären S’ den Fall auf und kommen S’ gesund wieder heim. Wenn’s sein muss, mitsamt dem Schierhuber. Wie sagt man? Wir wünschen gute Reise!«
Damit war die Befehlsausgabe beendet und Hawelka verließ die Kanzlei genannte Kommandozentrale des Erzherzogs, um das Auskunftsbüro Berlakovic anzusteuern.
Auf dem Weg dorthin rief er seinen Partner an. Es dauerte eine Weile, bis dieser abhob.
»Ja?«
»Ja, eh. Ich bin’s.«
»Ah, du.«
»Wo bist du?«
»Weitra«, sagte Schierhuber. In Weitra lebte sein Ex-Schwager, der Schnaps brannte. Schierhuber besuchte ihn öfters.
»Der Erzherzog hat uns gerade in den Dienst gestellt.«
»Aha.« Mit einem emotionalen Ausbruch dieser Art war zu rechnen gewesen. Jeder andere, der seinen Kurzurlaub abbrechen musste, hätte genauso reagiert. Schierhuber war schließlich auch nur ein Mensch.
»Wir sind nach Niederösterreich abkommandiert.«
»Hm.«
»Waidhofen.«
»Ybbs oder Thaya?«
»Thaya.«
»Liegt am Weg.«
»Ich weiß. Da bist du vor mir dort.«
»Okay.« Der andere legte auf. Zweiundvierzig Sekunden. Hawelka war sicher, dass Schierhuber in weniger als einer Stunde bei der Polizeistation in Waidhofen eintreffen würde.
Das »Auskunftsbüro Berlakovic« war die effizienteste Einheit der Wiener Kriminalpolizei, wenn nicht sogar der gesamten österreichischen Polizei. Getarnt als gewöhnliches Administrationsbüro mit typischen Verwaltungsaufgaben, war hier in Wahrheit das Zentrum der Macht und des Wissens. Nach außen hin wurden Dienstpläne erstellt, Polizeidatenbanken gefüttert und abgefragt, Krankmeldungen entgegengenommen, Urlaubsanträge weitergeleitet und Kursplätze gebucht. Unter der harmlosen Oberfläche aber zeigte sich eine Kommandozentrale, von der jeder Generalstab nur träumen konnte. Braucht ein Kollege eine Wohnung? Auskunftsbüro Berlakovic. Versetzung nach Kitzbühel gewünscht? Auskunftsbüro Berlakovic. Namen aller registrierten Brandstifter nach 1945? Auskunftsbüro Berlakovic. Bester Zahnarzt? Auskunftsbüro Berlakovic. Momentaner Aufenthaltsort des untergetauchten Georg Kusztrich? Auskunftsbü… und so weiter.
Gründerin, Namensgeberin und unumstrittene Herrscherin dieser Institution war Herta Berlakovic. Ende fünfzig, zweimal geschieden5, gutmütig, aber scharfzüngig, nach eigenen Angaben nicht übergewichtig, sondern untergroß, mit wechselnden Haarfarben und einem großen Herz für ihre Kollegen. Diese Frau hatte ausreichend Lebenserfahrung, war desillusioniert, abgebrüht und fürchtete sich vor niemandem. Außer … vor dem Erzherzog. Aber das war normal, vor dem fürchteten sich alle – also zählte es nicht wirklich. Ihr legendärer Telefonmeldesatz »Auskunftsbüro Berlakovic – die Herta is’!« erklang nun schon seit über fünfundzwanzig Jahren. Von der Berlakovic konnte man alles haben, und sie hätte ihr Leben für ihre Kollegen gegeben. Fiel man allerdings in Ungnade, so war man den dunklen Seiten ihrer Seele ausgeliefert, und es war besser, um Versetzung oder Pensionierung anzusuchen, als sich Tag für Tag dem subtilen Kleinkrieg auszusetzen, der einen schließlich an den Rand des Nervenzusammenbruches brachte. Hawelka und Schierhuber waren da nicht in Gefahr. Sie zählten zu den ausgemachten Lieblingen der Berlakovic. Das lag am Außenseiterstatus, den die beiden von Anfang an im Haus hatten. Sie waren beide spätberufene Ermittler, die vorher als brave Gendarmeriebeamte am Land Dienst geschoben hatten. Sie kamen beide aus dem Waldviertel. Beide hatten sie die Fünfzig bereits überschritten. Sie hießen beide Josef. Sie waren beide … na ja, nicht unbedingt … schön im eigentlichen Sinn des Wortes. Schierhuber war groß und hatte einen gewaltigen Bierbauch. Hawelka war klein und … hatte einen Bierbauch, der nicht ganz so gewaltig war. Schierhuber hatte einen massigen Schädel mit einem Boxergesicht, unschuldigen Kinderaugen und schütterem Haar. Hawelka hatte ein Vollmondgesicht und noch weniger Haare. Eigentlich nur noch einen Haarkranz, ähnlich wie ein Mönch, oder ein Landeshauptmann. Kurzum, eine Modelkarriere würden sie beide nicht mehr machen. Somit waren sie die idealen Schützlinge für Herta Berlakovic, die Rächerin der Schwachen und Bedrängten.
Ihre Mitstreiterinnen im Auskunftsbüro hießen Forstner, Frischauf und Sommer. Die Forstner war ein wenig … herb. Manche meinten, dass sie Männer hasste, aber das war ungerecht – zu Frauen war sie genau so. Ihr Mund war stets ein wenig verkniffen, ihre Stimme klang immer ein wenig gepresst und den direkten Blickkontakt mit Gesprächspartnern vermied sie ohnehin konsequent. Dafür war sie die Großmeisterin des Tippens. Es gab eine unausgesprochene Vereinbarung mit ihren Kolleginnen: Diese übernahmen alle Kommunikationsaufgaben, soll heißen: Sie telefonierten, erledigten Botengänge im Haus, erteilten Auskunft, nahmen an Besprechungen teil, hielten die Kollegen teils durch harmlose Flirts (die Frischauf), teils durch deftige Zoten (die Berlakovic) und teils durch ihren bloßen Anblick (die Sommer) bei Laune. All das ersparte man der Forstner, dafür erledigte sie quasi alles Schriftliche. Meist für die ganze Abteilung. Das war zwar Schreibarbeit für vier, die Forstner schrieb aber auch viermal so schnell wie herkömmliche Angestellte. Über ihr Privatleben wusste niemand Bescheid, und eigentlich wollte das auch niemand wissen. Zwar war sie unverheiratet, unter vierzig und hatte eine ganz gute Figur, dennoch verzichteten sogar die testosterongeschwängertsten Kollegen auf die sonst üblichen Annäherungsversuche. Sie war eben … herb.
Ganz anders die Frischauf! Diese war immer gut aufgelegt, summte, sang und pfiff vor sich hin, konnte herzlich lachen und hatte für jeden ein gutes Wort. Wie die Berlakovic selbst war auch sie ein nie enden wollender Quell des Wissens und der Auskunftsbereitschaft. Auch sie schaffte es mühelos, sechstausend Silben in der Minute an den Mann zu bringen. Mitte zwanzig, war sie außerdem im idealen Beutealter für die kriminalpolizeiliche Schürzenjägerschaft. Dummerweise war sie verheiratet. Und noch dümmererweise war diese Ehe vor etwas über einem Jahr durch ein prächtiges Mädchen veredelt worden. Erst seit Kurzem war die Frischauf von der Karenz an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt und führte seither das übliche stressige Leben einer berufstätigen Mutter mit Kleinkind.
Und dann war da Bettina Sommer. Die anerkannt schönste Frau der Wiener Kriminalpolizei, wenn nicht sogar der gesamten österreichischen Polizei. Trotz ihrer zarten achtundzwanzig Lenze war sie bereits verheiratet gewesen, und zwar mit dem anerkannt größten Arschloch der Wiener Kriminalpolizei, wenn nicht sogar der gesamten österreichischen Polizei. Seit ihr Mann vor drei Jahren von einem Waffennarren erschossen worden war, drückten sich wieder Kollegen aller Altersgruppen unter den fadenscheinigsten Gründen im Auskunftsbüro herum. Von Zeit zu Zeit gönnte sich die Berlakovic den Spaß und schleuderte eintretenden Testosteronjunkies ein »Ihr könnt’s eure Rohre wieder einfahren, die Betti ist heut nicht da« entgegen. Dann weidete sich das gesamte Auskunftsbüro an den hochroten Köpfen der harten Burschen und der Tag war gleich ein bisschen schöner. Angeblich hatte sogar die Forstner bei solchen Gelegenheiten die Mundwinkel ein wenig nach oben gezogen und ein kurzes Schnaufen hören lassen, das bei großzügiger Auslegung durchaus als Lachen zu interpretieren war.
Das Spezialgebiet von Bettina Sommer war nicht das Tippen und nicht das Telefonieren und nicht das Recherchieren und auch nicht das Kombinieren. Zum Leidwesen der fantasiebegabten männlichen Kollegen lag ihr Spezialgebiet auch nicht dort, wo diese es gerne angesiedelt hätten. Nein, das Talent von Bettina Sommer lag in der Kommunikation. Beziehungsweise in der Motivation. Sie konnte zwar nicht besser formulieren als die Berlakovic oder die Frischauf, aber die Botschaften kamen deutlich besser an. Meist bezauberte sie alleine durch ihre Anwesenheit und ihr Lächeln. Dieses Lächeln! Hawelka hatte lange gebraucht, bis er sich endlich eingestand, dass sie alle anderen Männer auch so anlächelte. Zuerst wollte er sich einreden, dass dieses Lächeln nur ihm galt. Aber das redeten sich die anderen auch ein. Sie lächelte alle an. Gesehen hatte er das schon nach ein paar Tagen, eingestanden hatte er es sich allerdings erst nach Jahren. Nach Jahren, in denen die Sommer etliche Kurzbeziehungen zu ebenso jungen wie feschen Kollegen unterhielt. Irgendwann hatte Hawelka beschlossen, dass es jetzt genug sei, und hatte sich der Sommer entsagt. Er hatte genug von halberotischen Tagträumen diese Frau betreffend. Und auch von den Träumen in der Nacht, die sich dann nicht mehr mit der Hälfte zufrieden gaben. Schluss! Er würde sie mit der gleichen distanzierten und kollegialen Professionalität sehen wie … wie … die Forstner. Diesen Vorsatz hatte er vor gut einem Jahr gefasst. Seither ging es ihm besser.
Als er vom Erzherzog kam, um im Auskunftsbüro die Formalitäten zu erledigen und seine Dienstzuteilung quasi amtlich zu machen, war die Erste, die er traf, Bettina Sommer. Hawelka schauderte. Sie trug ein leichtes Sommerkleid und sah bezaubernd aus. Der halberotische Tagtraum kickte den Erzherzog aus dem Hawelkakopf. Dann lächelte sie, und Hawelka schmolz. Leider war das nicht neu. Der vorhin erwähnte Vorsatz hielt nämlich immer nur so lange an, bis sie in seine Nähe kam.
»Hab schon gehört, ihr müsst’s in die Prärie, ihr Armen«, seufzte sie und sah Hawelka mitfühlend an. »Na ja, wir sind Helden, die müssen auch einmal dorthin, wo’s finster ist«, entgegnete er und freute sich über ihr Lachen.
»Na dann, du Held«, mischte sich die Berlakovic lautstark ein, »da ist die Dienstzuteilung, da hab ich die Handynummer vom Postenkommandanten von Waidhofen, und da hab ich dir die wichtigsten Fakten aus der Meldung ausgedruckt, damit du dich vorbereiten kannst. Wenn du willst, reservier ich euch noch Zimmer dort in der Nähe. Der eigentliche Tatort ist in einem kleinen Ort, der Vestenötting heißt. Dort gibt’s auch ein Wirtshaus mit Gästezimmern. Ob ihr die Zimmer wollt, oder lieber doch welche in Waidhofen, müsst ihr selbst entscheiden. Meistens sind die Zimmer in den kleinen Dorfwirtshäusern noch aus den Neunzehnhundertsiebzigerjahren, zumindest sehen sie so aus, auch wenn sie erst vor zehn Jahren eingerichtet worden sind.«
»Danke, ich … weiß noch nicht, ich … ruf dich an, wenn wir erst einmal dort sind, keine Ahnung, was wir …«, stammelte Hawelka, der sich durch die Informationen leicht überfordert fühlte. Vor einer Stunde war er noch im langen Wochenende gewesen, in Urlaubsstimmung sozusagen, und jetzt sollte er der Berlakovic sagen, ob er lieber in einem Neunzehnhundertsiebzigerjahrezimmer beim Tatort schlafen wollte, oder in einem Zimmer in Waidhofen. Hawelka war nicht der Mann der schnellen Entscheidungen. Manche behaupteten auch, dass er zu viel dachte. Jetzt, zum Beispiel, dachte er an die Krokobar in Waidhofen. Die Krokobar war ein Gasthaus mit Diskothek und Pizzeria gewesen. In seiner Jugend. In den Neunzehnhundertsiebzigerjahren. Aber er hatte das Lokal erst in den Neunzehnhundertachtzigerjahren kennengelernt. Das Besondere waren Glaskäfige mit Riesenschlangen, Alligatoren und allerlei anderen Reptilien. Dazu an den Wänden Felle, Speere und Schrumpfköpfe – der reinste Dschungel. Ein paar Jahre lang war die Krokobar die Attraktion im Nachtleben des Waldviertels gewesen. Auch als Hawelka schon Gendarm in Horn war, fuhr er gelegentlich die dreißig Kilometer nach Waidhofen, um sich in der Bar nach weiblicher Bekanntschaft umzusehen6. Herausgekommen war dabei meistens nichts.
»Also? Pepi, du musst dich entscheiden, ich hab auch noch was anderes zu tun«, drängte die Berlakovic. Heute war sie ein wenig streng. Normalerweise sagte sie zu ihm Josef, und Sepp zu Schierhuber (wie sich die beiden auch gegenseitig ansprachen). Aber wenn sie Pepi zu ihm sagte, klang es ein wenig nach ungeduldiger Mutter, die ihr trödelndes Kind ermahnte. Das konnte Hawelka, der tragische Held eines abgebrochenen langen Wochenendes, jetzt gerade überhaupt nicht brauchen.
»Ich ruf dich an, wenn ich unterwegs bin, ich mach mir das mit dem Sepp aus«, antwortete Hawelka und ging raus. Am Gang begann er bereits wieder zu denken, aber diesmal nicht an die Krokobar. »Am meisten erfährt man, wenn man das Vertrauen der Leute hat«, überlegte er. »Beim Wirten wird es sicher nicht gut ankommen, wenn er erfährt, dass wir uns in Waidhofen einquartieren, wo er doch selber so schöne Zimmer hat.« Also ging er wieder rein und bat das Auskunftsbüro um Reservierung von zwei Einzelzimmern im Grand Hotel von Vestenötting. »Ich kann ja fragen, ob die Fürstensuite noch frei ist«, gluckste die Berlakovic, während sie schon wählte, »für unsere Helden darf dem Papa Staat nichts zu teuer sein …«
Auch Hawelkas nächster Versuch, endlich loszufahren, wurde vereitelt. Diesmal auf dem Parkplatz, und zwar von höchster Stelle.
»Hawelka!« Der Erzherzog stand wie aus dem Boden gewachsen neben ihm. »Machen S’ uns keine Schande da oben, bei die G’scherten7. Weil: Der Wind hat mir ein Lied erzählt. Die wollen eine zusätzliche Gruppe schaffen, und wenn es gar nicht anders geht, könnten wir ein paar zusätzliche Mittel ins Budget kriegen. Das ist zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber – wie heißt es so schön? Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Wenn aber in diese Budgetsitzungen was durchsickert, dass unsere Leut nicht einmal am Land die Mörder fangen, dann können wir uns das Geld in die Haare schmieren, oder an eine andere Stelle unserer Wahl. Also, hüten Sie sich Ihnen vor diese Grobheiten! Weil wenn das passiert, dann reden wir zwei ein deutsches Wort miteinander.«
Hawelka versuchte sich vorzustellen, wie er mit dem Erzherzog gemeinsam ein deutsches Wort reden würde. Mussten sie proben, damit das deutsche Wort auch genau gleichzeitig über ihre Lippen kam? Und welches deutsche Wort würde das sein? Schließlich gab es ja mehrere.
»Also, überlegen S’ Ihnen gut, ob S’ da oben einen Lenz haben wollen, oder lieber die G’schicht aufklären, dass die Niederösterreicher nur so schau’n. Ich geb Ihnen einen Tipp: Der Lenz im Dienst ist nicht meine Manier. Das sollten S’ beherzigen. Und dem Schierhuber buchstabieren Sie das auch. Oder zeichnen S’ es ihm auf.« Damit stapfte der Alte davon. Hawelka seufzte.
Dann fuhr er los.
Jauner
Eine Woche später
»Das Kind«, flüsterte der Dorfsäufer, »war gar nicht von ihm. Das war ganz klar. Das konnte jeder sehen, kaum dass die Zwettlerin damit aus dem Spital kam. Keiner in Terschs Familie hat jemals Locken gehabt, und er selbst am allerwenigsten. Auch die Haarfarbe, die Augen und die Backenknochen – nichts deutete auf Tersch hin. Und die Zwettlerin selbst hat überhaupt ganz anders ausgesehen. Es musste also jedem klar sein, dass das Kind unmöglich von ihm sein konnte, und ihm selbst musste das am allerklarsten sein. Der Mann ist zwar ungebildet und hat keine Manieren, er ist Nebenerwerbsbauer und Fabrikarbeiter, aber das musste ihm klar sein.« Er wandte den Kopf vorsichtig dem Stammtisch zu, wo Tersch ins Gespräch vertieft saß. Nichts deutete darauf hin, dass dieser bemerkt hatte, von wem die Rede war.
»Er hat es nie erwähnt, und sogar die Stammtischbrüder, die ja jedem alles unter die Nase reiben, haben sich zunächst einmal jeden Kommentar verkniffen, was ihnen schwer genug gefallen sein dürfte. Zunächst herrschte also Ruhe. Sicher, wäre die Zwettlerin zur Kirche gegangen und hätte ihr Kind herumgereicht, wie es die Hiesigen tun, dann hätten die Weiber des Dorfes es ihr mit Sicherheit unter die Nase gerieben, man kennt das ja: Sie stehen nach der Kirche herum und tratschen, und dabei führen sie die Jungmutter vor. Unabsichtlich und mit der unschuldigsten Miene der Welt, wie sie es immer tun. Meist beginnen sie mit einer lange andauernden Lobhudelei über den prächtig geratenen Nachwuchs, zu dem sie von ganzem Herzen gratulieren. Sie loben Gewicht, Größe und Schönheit des Kindes, die kräftige Stimme beim Weinen, den festen Griff der kleinen Hände, wenn sie nach einem hingehaltenen Finger greifen, und so weiter. Dann sagen sie etwas in der Art von ‚Ganz der Papa‘, oder so ähnlich, und eine andere, die daneben steht, widerspricht sofort und sagt ‚Aber nein, das ist doch ganz die Mama, seht nur die Augen‘. Dann wird eine Weile über die Bedeutung diverser Leberflecken, Feuermale und sonstiger Besonderheiten bei Kindern geredet und endlich, wenn sie es kaum noch aushalten, bereitet eine von ihnen den Boden für die Saat. Mit einem nachdenklichen ‚Aber die dunklen Locken, die hat es nicht vom Papa, bei den Terschen haben alle in der Familie blonde Haare gehabt und keiner hat schwarze Locken gehabt. Die schwarzen Locken muss es von der Mama haben.‘ Dann schauen alle der Mutter auf den Kopf. Im Falle der Zwettlerin hätten sie glatte, dunkelblonde Haare gesehen – weit entfernt also von dunklen Locken. So hätten sie es gemacht, die Weiber, aber wie gesagt, die Zwettlerin ging ja nicht zur Kirche. Das hat sie natürlich zusätzlich aus der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen. Sie verstehen, was ich meine?«
Hawelka nickte.
»Ein paar Wochen später war sie verschwunden. Mitsamt dem Kind verschwunden. Sie wurden beide nie wieder gesehen. Nie wieder.«
Er machte eine Kunstpause, als wartete er auf Applaus. Als keiner kam, fuhr er etwas gekränkt fort: »Das können Sie glauben, oder auch nicht. Die einen meinen bis heute, sie sei von selbst gegangen, die anderen sagen, dass Tersch sie fortgejagt hat, und nicht wenige behaupten, dass sie und das Kind längst nicht mehr am Leben sind. Tersch ist ein unberechenbarer Mann. Bald sitzt er am Stammtisch, lacht und scherzt, bald zieht er grußlos durchs Dorf und setzt eine so finstere Miene auf, dass die Schulkinder die Straßenseite wechseln, wenn sie ihn kommen sehen.«
Er betonte jede Silbe extra, sprach jedes Wort überdeutlich aus. Die gespreizten Formulierungen taten ein Übriges, um seine Erzählungen unfreiwillig komisch wirken zu lassen.
»Bei denen, die, so wie ich, der festen Überzeugung sind, dass sie nicht mehr am Leben ist, gibt es wiederum zwei Lager. Das eine Lager vertritt die Theorie der stückweisen Leichenentsorgung in verschiedenen Karpfenteichen, das andere neigt zu der Annahme, dass er Mutter und Kind im Heidenreichsteiner Moor versenkt hat.«
Eine plötzlich entstandene Gesprächspause am Stammtisch ließ auch ihn verstummen und nach Tersch schielen. Tatsächlich schaute dieser geradewegs in seine Richtung. Dann erhob er sich.
»Die genaue Ursache für die zunehmende Verlandung der Waldviertler Moore«, beeilte sich Hawelkas Tischnachbar jetzt laut zu sagen, »ist natürlich umstritten. Einig ist man sich hingegen bei den Maßnahmen dagegen. Die Stabilisierung des Grundwasserspiegels ist …«
Tersch, der zunächst wirklich auf ihren Tisch zugesteuert war, machte unerwartet einen Schwenk und verschwand auf die Toilette.
»Selbst die Stammtischbrüder des Dorfes, wahrlich keine Chorknaben, haben es bisher vermieden, ihn auf das Verschwinden der Frau und des Kindes anzusprechen. Selbst jetzt, nach Jahren, redet man nicht darüber. Zumindest nicht, wenn er dabei ist. Aber was mir in diesem Zusammenhang bedeutsam erscheint, ist die hohe Zahl an Katzen, die Tersch hält. Nun gibt es hier auf jedem Hof Katzen, das ist noch nicht das Besondere, das ist überall so am Land. Versuchen Sie einmal, die Tiere loszuwerden, es wird Ihnen nicht gelingen. Tersch allerdings hatte immer schon außergewöhnlich viele Katzen auf seinem Hof. Nach dem Verschwinden von Frau und Kind nahm deren Anzahl aber rapide zu, und heute ist es ein Wunder, dass die Gesundheitsbehörde noch nicht eingeschritten ist.«
Tersch kam vom Klo zurück, ohne ihren Tisch eines Blickes zu würdigen. Der Erzähler rauchte eine neue Zigarette an der alten an und winkte der Kellnerin mit dem Glas. Zum siebten Mal an diesem Abend.
»Ich persönlich glaube also weder an die Fischteichgerüchte noch an die Moorsagen. Ich bin Individualist und werde es immer bleiben. Lachen Sie mich aus, oder stecken Sie mich in den Narrenturm, aber ich sage: Die Katzen auf Terschs Hof haben in den Wochen und Monaten nach dem Verschwinden von Frau und Kind besonders wohlgenährt ausgesehen. Verstehen Sie, was ich meine?«
Hawelka nickte. Mittlerweile hasste er den anderen.
»Vielleicht kommt Ihnen das weit hergeholt vor, aber es ist nichts unmöglich, auch wenn man es für unmöglich hält. Sie sitzen in Ihrem Reihenhäuschen, und fünfzig Meter Luftlinie von Ihnen entfernt wird eine ganze Familie über Jahre hinweg im Keller gefangen gehalten. Sie genießen Ihr Eis, und zehn Meter Luftlinie von Ihnen entfernt hat die freundliche Kellnerin die Extremitäten ihrer Ex-Liebhaber einbetoniert. Sie begegnen einem unauffällig aussehenden Mann, und nur zwei Tage später erfahren Sie, dass er ein paar Leute mit der Hacke erschlagen hat. Diese Vorkommnisse passieren nicht irgendwo, sondern in unserer unmittelbaren Umgebung. Sie verstehen?«
Hawelka saß schon den siebten Abend bei ihm. Der Typ hieß Jauner. Er starrte ihn an. Hawelka nickte.
»Ich kann nicht beschwören, dass Tersch seine nächtlichen Streifzüge sofort nach dem Verschwinden von Frau und Kind wieder aufgenommen hat, das kann ich wirklich nicht. Tatsache ist, dass er, nachdem er ebendiese Streifzüge seit Bekanntwerden der Schwangerschaft seiner Frau völlig eingestellt hatte, nach ihrem Verschwinden wieder durch das Dorf strich wie eh und je. Wer nach Mitternacht einen Blick aus dem Fenster warf, sah unweigerlich Tersch durch das Dorf wandern. Sie wissen, was ich meine?«
Was Hawelka am meisten hasste, war die unerträgliche Angewohnheit des anderen, seinen Monolog mit dieser Frage zu unterbrechen und einem dann mit wässrigem Blick in die Augen zu starren, bis man sich genötigt sah, ein Zeichen der Zustimmung zu geben. Es war kurz nach zehn. Sperrstunde war erst um eins. Jauner starrte ihn an. Hawelka nickte.
»Vielleicht ist er Birnstingl begegnet, vielleicht auch nicht. Ich gehe davon aus, dass Birnstingl die Begegnung aus gutem Grund vermieden hat, die Möglichkeit, eine solche Begegnung zu vermeiden, hatte er auf jeden Fall. Tersch ging ja sozusagen offiziell herum, versteckte sich vor niemandem, tat, als ginge er spazieren. Es war ihm gleichgültig, wenn man ihn sah. Birnstingl hingegen war heimlich unterwegs. Zu Frauen dürfte er immer schon ein problematisches Verhältnis gehabt haben, jedenfalls war er alleinstehend. Im Grunde genommen kein schlechter Kerl, eigentlich ein armer Mensch. In den Sommernächten schlich er durchs Dorf und spähte durch die Fenster. Auch im Herbst und im Frühjahr war er unterwegs, im Winter nicht – er vermied die verräterischen Spuren im Schnee, und wahrscheinlich war es ihm auch zu kalt. Mit entblößtem Unterleib holt man sich bei den tiefen Temperaturen leicht eine Blasenentzündung. Sie verstehen?«
Hawelka nickte. Vor einer Woche hatte er noch gedacht: »In solchen Dörfern weiß jeder die Wahrheit. Jeder. Weil in den Dörfern nichts unbemerkt bleibt. Aber einem Fremden sagt keiner was. So funktioniert ein Dorf. Jeder hält dicht. Bis auf einen. Den Dorfsäufer. An den muss ich mich halten.« Das bereute er jetzt.
»Es ist schon eine ganze Zeit her, dass Birnstingl sich vor dem Fenster der Eisenbahnertochter Erleichterung verschafft hat.« Jauner machte eine Pause und unterstrich das Gesagte durch eine eindeutige Handbewegung. »Dabei ergab es sich«, fuhr er dann fort, »dass ihn jemand dabei beobachtete. Ein Nichtsnutz. Ein Kretin! Also – ich. Ich beobachtete Birnstingl schon lange. Es musste so … warten Sie, in den späten Neunzigern gewesen sein, da machte er sich mir einmal verdächtig und – Segen oder Fluch – wer mir einmal verdächtig ist, den lasse ich nicht mehr aus den Augen. Außerdem«, lächelte er seinen Zuhörer verschmitzt an, »gibt es nichts Amüsanteres, als einen Voyeur bei seinen … Neigungen zu beobachten. Als Supervoyeur, sozusagen. Nicht?«
Im Dorf wurde er »der Gelbe« genannt. Ob es eine Anspielung auf seinen Namen war, oder ob er den Spitznamen wegen seiner nikotingelben Finger und Lippen hatte, wusste niemand mehr. Wieder unterbrach er seine gespreizte Rede und starrte seinen Zuhörer abwartend an. Hawelka ballte die Fäuste unter dem Tisch. »Ich schlag ihn tot«, dachte er. »Ich schlag ihn tot, wenn er sein blödes Geschwätz noch einmal unterbricht und mich anglotzt, bis ich nicke.« Aber er schlug nicht zu. Er nickte nur.
»Tersch hingegen musste ich nicht überprüfen. Seine Wanderungen waren vorhersehbar wie die Schläge der Kirchenuhr. Dadurch war es nicht nur mir, sondern vermutlich auch Birnstingl ein Leichtes, ihm auszuweichen und ungesehen zu bleiben. Ungesehen zu bleiben und auszuweichen war ja Birnstingls Meisterschaft. Er konnte dem ganzen Dorf ausweichen und ungesehen bleiben, wenn er wollte. Nicht nur nachts, bei seinen … Vergnügungen. Nein, auch tagsüber konnte er von einem Ende des Dorfes zum anderen gelangen, ohne dass ihn irgendjemand gesehen hätte. Verstehen Sie?«
Hawelka kam es vor, als sei er schon Monate hier. Schierhuber war gleich gegen die Dorfsäufervariante gewesen.
»Die Allgegenwart ist eine Sache, die genaue Ortskenntnis eine andere. Wir dürfen nicht vergessen, wer Birnstingls Urgroßvater war!« Er leerte sein Glas. Es war mittlerweile das neunte. »Die Birnstingls waren nicht die armen Schlucker, auf die sein heruntergekommener Hof heute schließen lassen könnte. Im Gegenteil. Sein Urgroßvater war Ortsvorsteher, Feuerwehrkommandant, Oberjäger und nebenbei der größte Bauer im Ort.«
Normalerweise redeten Hawelkas Gesprächspartner zu wenig. In Wien hieß es: »Ich war’s nicht, Herr Polizei, ich kenn ihm überhaupt nicht, da können Sie alle fragen, und im Prater war ich sowieso schon seit fünf Jahr nicht mehr, ich schwöre dir bei meiner Mutter!« Dann Schweigen. Hier aber hörte er vom Gelben nie enden wollende Monologe, aus denen es unmöglich war, das Wesentliche vom vollkommen Nebensächlichen zu trennen. Wahrheit und Fiktion wurden im ewigen Schwafeln zu einem untrennbaren Brei. Erzählungen, Gerüchte, Verleumdungen, Wünsche und Wirklichkeit. Alles eins.
»Während Birnstingls Urgroßvater also aus einer kleinen Landwirtschaft eine große machte, so machte sein ältester Sohn, der Großvater von Birnstingl, diese große Landwirtschaft zu einem regelrechten Betrieb. Er hatte in den besten Zeiten eine Rinderzucht, die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt war. Angestellte. Maschinen! Maschinen, als alle anderen noch mit der Hand droschen und mit der Hand molken. Dann kam der Krieg, und er fiel. Seine Frau war mit der Führung des Betriebes überfordert. Die Bauern haben sie ordentlich übers Ohr gehauen und alles von Wert um einen Spottpreis bekommen. Nun stand sie da mit ihrem Kind und hat wieder ganz von vorne angefangen.
Schierhuber hatte ihn gewarnt. Aber sein Alternativvorschlag war auch nicht besser. So hatte sich Hawelka also gleich am ersten Abend zum Gelben gesetzt. Gebracht hatte es gar nichts.
»Birnstingl! Wie gesagt – ein armer Mensch. Aber ich traute ihm trotzdem nicht. Auch die armen Kreaturen können falsch und schlecht und böse sein. Ich weiß, wovon ich rede. Ich selbst bin auch so. Vielleicht war ich schon immer so, vielleicht auch nicht, wer kann das schon mit absoluter Gewissheit sagen. Ich neige zu der Annahme, ja, ich bin geradezu überzeugt, dass mich das Dorf so gemacht hat. Sie wissen, was ich meine?«
Schon am ersten Abend hatte Hawelka festgestellt, dass es nichts brachte, Jauner konkrete Fragen zu stellen. Der Gelbe bestimmte Thema und Tempo seiner Monologe. Fragen beantwortete er nie. Sie gaben ihm nur Anlass, weit auszuholen und eine neue Tirade gegen irgendjemand aus dem Dorf loszulassen. Sein Tisch war nahe dem Eingang, von dort aus konnte er die ganze Gaststube überblicken, hatte die Theke im Auge, den Stammtisch und den Ausgang zum Klo. Der Tisch war groß, dennoch saß er immer alleine. Hawelka wusste jetzt, warum.