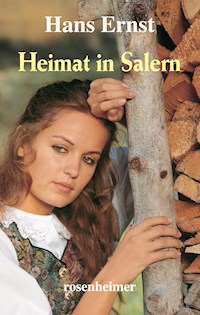
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lisa Schormayer wächst in äußerst bescheidenen Verhältnissen auf. Als sie dreizehn ist, stirbt ihre Mutter – ein Ereignis, über das der Vater nicht hinwegkommt und das ihn ganz den Boden unter den Füßen verlieren lässt. Aber noch ein Schicksalsschlag trifft das Mädchen: Nach einer Krankheit kann sie nicht mehr sprechen. Ihre Lage bessert sich, als sie der Brunnegger auf seinen Hof holt, wo alle von ihrer Tüchtigkeit begeistert sind. Doch eines Tages tritt ein Mann in Lisas Leben, von dem sie sich die Erfüllung ihrer ständigen Sehnsucht nach Liebe erhofft … Hans Ernst erzählt in diesem lesenswerten Roman vom Schicksal einer Frau, die auf der Suche ist nach einer wirklichen Heimat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
LESEPROBE ZU
© 2018 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Titel der Originalausgabe: Heimat in Salern
Lektorat und Satz: Pro libris Verlagsdienstleistungen
Titelfoto: Wolfgang Ehn, Mittenwald
eISBN: 978-3-475-54801-7
Worum geht es im Buch?
Hans Ernst
Worum es geht „Heimat in Salern“
Lisa Schormayer wächst in äußerst bescheidenen Verhältnissen auf. Aber das Schicksal meint es nicht gut mit dem Mädchen: Nach einer Krankheit kann sie nicht mehr sprechen. Als sie fünfzehn ist, stirbt ihre Mutter – ein Ereignis, über das der Vater nicht hinwegkommt und das ihn ganz den Boden unter den Füßen verlieren lässt. Ihre Lage bessert sich, als sie der Brunnegger auf seinen Hof holt, wo alle von ihrer Tüchtigkeit begeistert sind. Doch eines Tages tritt ein Mann in Lisas Leben, von dem sie sich die Erfüllung ihrer ständigen Sehnsucht nach Liebe erhofft …
1
Die Glocke auf dem Kirchturm von Salern bimmelte hell in den Frühlingsmorgen hinein, als vom Moorwinkel her, von dem kleinen Anwesen des Markus Schormayer, ein Gruppe schwarz gekleideter Menschen zum Friedhof zog, der hinter den letzten Häusern des Dorfes auf einer Anhöhe lag. Hinter dem Sarg ging der Kleinbauer Markus Schormayer mit seiner fünfzehnjährigen Tochter Lisa.
Die Schormayerin war lange krank gewesen, und die Leute, die ihr jetzt das letzte Geleit gaben, sagten, dass der Tod für sie eine Erlösung gewesen sei. Der Pfarrer nannte sie eine tapfere Frau, die ihre Leiden mit christlicher Geduld ertragen habe. Als man den Sarg in die Grube hinunterließ, senkte Markus Schormayer ganz tief den Kopf, ohne dass er hätte weinen können.
Dem Mädchen aber liefen die Tränen lautlos die Wangen herab. Sie war schmal und groß. Ihre Haut war blass und sie hatte dunkle Ringe unter den Augen. Das kam wohl von den durchwachten Nächten, in denen sie am Bett der kranken Mutter gesessen hatte. Das brünette, leicht gewellte Haar war zu zwei dicken Zöpfen geflochten, die ihr, von einer breiten, schwarzen Schleife zusammengehalten, über den Rücken hingen. Sie trug ein schlichtes, graues Kleid. Die Füße steckten in derben, genagelten Schuhen.
Mitleidige Blicke streiften das Mädchen, und in diesem Augenblick am Grab mochte so mancher sich mit dem Gedanken an eine gute Tat an diesem armen Kind beschäftigen, aber kaum dass die Zeremonie im Friedhof vorüber war, erstarb das Mitleid wieder. Markus Schormayer sollte sich eben selber darüber klar werden, dass er nun allein für seine Tochter zu sorgen habe.
Ja, sorgen wollte er schon für sein Kind, der Markus Schormayer. Das gelobte er sich während des Seelengottesdienstes, und als sie danach beim Sternwirt einkehrten, bestellte er ihr gleich drei Weißwürste und zu Mittag dann eine gefüllte Kalbsbrust. Nur mit Mühe brachte das Mädchen das reichliche Essen hinunter. Und immerzu musste es denken: ›Warum hat Gott nicht mich zu sich geholt! Mich braucht der Vater nicht, aber die Mutter …‹
Ja, die verstorbene Walburga Schormayer war in ihren gesunden Tagen stark genug gewesen, ihren leichtsinnigen Mann zu lenken. Sie hatte sich nicht geniert, ihn notfalls auch aus dem Wirtshaus zu holen, wenn er über die Zeit dort sitzen geblieben war. Sie hatte ihm die Zügel angelegt und ihn zur Arbeit angehalten. Seit sie aber krank geworden war, schien Markus Schormayer jeden Halt verloren zu haben.
Vier Halbe hatte er jetzt bereits wieder. Und zu jedem Bier bestellte er einen Steinhäger.
»Dann schadet das kalte Bier dem Magen überhaupt nicht«, sagte er.
Lisa legte nur ihre Hand auf das Bierglas, als er zum fünften Mal einschenken lassen wollte, und sah ihn bittend an.
»Also, dann nicht«, gab der Schormayer nach. »Gehen wir halt heim, auch wenn’s daheim recht leer sein wird ohne die Mutter.«
Es war halb vier Uhr nachmittags, als sie durch das Dorf nach Hause gingen. Der Schormayer hatte die Schultern eingezogen, den schwarzen Hut hatte er in der Hand. Sein Haar war schütter, aber noch von keiner grauen Strähne durchzogen. Das Mädchen hielt sich sehr gerade und die Haltung ihres Kopfes verriet Trotz und Stolz. Bei jedem Schritt tanzten die Zöpfe auf ihrem Rücken.
So kamen sie auf das Haus zu. Es lag inmitten eines ziemlich verwilderten Obstgartens und war ganz aus Holz gebaut, bis auf das Untergeschoss des Stalles. Das Stadeltor hing schief in den Angeln, und auf dem Dach fehlten ein paar Schindeln. Aus dem offenen Stallfenster hörte man das Muhen einer Kuh.
»Sie hätte nicht so viel arbeiten dürfen«, haderte der Schormayer, während er die Haustüre aufschloss. »Andauernd habe ich ihr gesagt: Walburga, hab ich gesagt, lass dir Zeit. Morgen ist auch noch ein Tag. Aber du weißt ja, wie sie gewesen ist, die Mutter.«
Und ob das Mädchen es wusste, und wie gerne hätte sie dem Vater antworten und ihn daran erinnern mögen, wie doch alles anders gewesen war, als die Mutter noch gesund gewesen war und das Heft fest in der Hand gehabt hatte. Erst als die Mutter in die Klinik musste, begann es, immer weiter bergab zu gehen. Damals hatte Markus Schormayer immer mehr zu trinken begonnen. Nicht mehr, weil es so lustig und gemütlich war am Wirtshaustisch, was früher der Grund gewesen war, wenn er über die Zeit dort hockengeblieben war, sondern aus Verzweiflung, weil er wusste, dass die Frau und Mutter niemals mehr gesund würde. Hart traf ihn dann die Erkenntnis, dass man sie zum Sterben heimgeschickt hatte, als das Krankenhaus seine Frau endlich doch entließ.
Vater und Tochter saßen sich am Tisch gegenüber. Die sinkende Sonne warf breite Lichtstreifen durch die Fenster, die den spärlich eingerichteten Raum beleuchteten, den hohen Kachelofen, an dem oberhalb der Durchsicht zwei von den grünen Kacheln herausgefallen waren. Daneben stand ein Küchenschrank mit bleigefassten Butzenscheiben. Rechts davon war ein altes, schon ziemlich mitgenommenes Lederkanapee. Darüber hing ein großformatiger Nachdruck eines Ölgemäldes, der einen See zeigte, über den ein Wildschütz mit seiner Beute ruderte, während ein flammender Blitz aus der dunklen Wolkenwand über den Bergen herausschoss.
Plötzlich fuhr der Mann auf, ging auf die Türe im Hintergrund zu, besann sich dort wieder und kehrte um. »Jetzt habe ich gerade gedacht, die Mutter hätte gerufen.«
Das Mädchen sah ihn mit großen Augen an und schüttelte den Kopf. Nie mehr würde die Mutter rufen. Weder nach dem Mann noch nach dem Kind, so wie sie es in den letzten Wochen manchmal von ihrem Krankenlager aus getan hatte.
Als würde dies dem Mann erst jetzt unerbittlich klar, warf er plötzlich beide Arme über den Tisch, barg den Kopf darin und schluchzte laut auf.
Lisa starrte ihn an, denn sie hatte den Vater noch nie weinen gesehen. Langsam stand das Mädchen auf und legte ihm die Hand auf die Schulter. Viele Worte des Mitleids und des Trostes hätte sie ihm gerne sagen wollen, aber sie konnte sie nicht sagen.
Lisa konnte nicht mehr sprechen, seit sie vor zwei Jahren schwer krank gewesen war und als Folge die Sprache verloren hatte. »Stimmbandlähmung« hatte der Arzt es genannt, und er war zunächst recht zuversichtlich, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis Lisa wieder würde sprechen können. Doch er hatte sich geirrt: Sie brachte immer noch keinen einzigen Ton heraus. Inzwischen hatte sie sich damit abgefunden, nie mehr reden zu können.
Jetzt deutete sie ihrem Vater mit den Händen an, dass sie nun die Laura melken wolle, die letzte Kuh, die ihnen verblieben war, nachdem die beiden anderen während der monatelangen Krankheit der Mutter verkauft worden waren – dem Vater schien das Geld förmlich zwischen den Fingern zu zerrinnen, jetzt, wo niemand mehr da war, der ein Auge auf ihn hatte und ihn bremste.
Als sie im Stall fertig war, verzehrten sie ihre karge Mahlzeit: Gekochte Milch, in die sie Brot brockten. Die Sonne war mittlerweile gesunken. Nur auf den höchsten Bergspitzen war noch eine sanfte, rötliche Glut, die sich schnell ins Violette und dann in das Schwarz der aufsteigenden Nacht verlor.
Lisa ging noch ein wenig in den Obstgarten hinein, bis dorthin, wo man von dem alten Birnbaum ins Moor hinaussah, das sich in einer weiten Fläche nach Süden hinzog. Das Bergwerk des kleinen Mannes nannte man es, weil die Kleinbauern dort ihren Torf stachen, der als Heizmaterial verwendet wurde. Ein winziges Stückchen des Moorgeländes gehörte Schormayer, und morgen wollte Lisa mit dem Vater wieder hinausgehen, um die Torfstücke, die er aus der Tiefe herauswarf, aufzuschichten, damit sie an der Sonne trocknen konnten.
Weiß leuchteten die Stämme der jungen Birken in der Dämmerung. Man roch den Rauch aus dem Dorf, über das soeben die Abendglocke geklungen hatte. Die ersten Sterne leuchteten über dem Moor, von weither rief ein Nachtvogel, und manchmal rauschte der Wald in leisem Wind.
So stand Lisa lange unter dem alten Birnbaum, lauschte den Geräuschen aus der Nacht, sah zu den Sternen auf und dachte in einem kindlichen Moment, dass nun die Mutter auch so ein Stern sei und auf die Erde niederblinzelte.
Ja, viele Stimmen schienen in der tiefen Dämmerung zu hören zu sein. Nur eine blieb aus, die Stimme der Mutter. Und auch Reinhold rief nicht nach ihr, der jüngste Sohn des Schmiedemeisters Bichler, der vor kurzem in der Stadt ein Medizinstudium begonnen hatte. Die ganze Familie war schon jetzt überaus stolz auf den künftigen Herrn Doktor und nahm die Kosten der Unterbringung und Verpflegung gerne in Kauf.
Reinhold Bichler hatte ihr als einer der wenigen die Freundschaft auch gehalten, als sie die Sprache verloren hatte. Täglich war er damals gekommen und war, weil er sich ernsthaft darum bemühte, der Einzige, der aus der Bewegung ihres Mundes ablesen konnte, was sie ihm sagen wollte. Und einmal hatte er sich hinter einem Torfhaufen versteckt und war mit einem grässlichen Schrei aufgesprungen, als sie herangekommen war, weil er irgendwo gelesen hatte, dass sie durch ein heftiges Erschrecken vielleicht die Sprache wiederfinden könnte.
Eines Tages hatte sie ihm mit ihrer kleinen, zierlichen Schrift etwas auf einen Zettel geschrieben, weil sie gemeint hatte, dies müsse ihm auf alle Fälle gesagt – auf diese Weise eben gesagt werden.
»Wirst du mich auch nicht vergessen in der großen Stadt?«
Da hatten seine dunklen Augen unter dem hellen Haar geleuchtet, und er hatte ihre Hand in die seine genommen.
»Ich vergesse dich nicht, Lisa, denn dafür hab ich dich viel zu gern.«
Dabei war Reinhold fünf Jahre älter als sie. Ein schlank aufgeschossener Bursche mit einem mageren, etwas blassen Gesicht, das sich aber in den Sommerferien schnell bräunte.
›Ich müsste ihm eigentlich schreiben, dass die Mutter gestorben ist‹, dachte das Mädchen und fuhr abwehrend mit der Hand über den Kopf, weil ganz nahe an ihrem Gesicht eine Fledermaus vorbeigehuscht war.
Die Nacht war jetzt vollends hereingebrochen. Hell leuchteten die Sterne. Ein Hund bellte im Dorf, und durch die alten Bäume des Obstgartens schimmerte ein müdes Licht. Langsam ging sie zurück.
Der Vater saß auf dem Kanapee, mit eingesunkenen Schultern, die Hände im Schoß gefaltet. Er sah nicht auf, als er die Türe gehen hörte, blickte nur weiter in das Licht der Lampe, mit einer Falte der Bitterkeit zwischen den buschigen Brauen.
Lisa fuhr ein paar Mal mit der flachen Hand vor seinen Augen auf und nieder, als wolle sie ihn aus einem Traum in die Realität zurückholen. Ein müdes Lächeln zuckte um seinen Mund. Er stand auf und streckte ächzend den Rücken.
»Morgen werden wir noch einmal ausruhen«, sagte er, nahm seine Uhr aus der Westentasche und zog sie auf. Lisa aber schüttelte nachdrücklich den Kopf und nahm die Tafel vom Küchenkasten, die immer für solche Zwecke bereitlag, und schrieb darauf: »Morgen müssen wir Torf stechen.«
Der Schormayer las es und nickte verdrossen.
›In dieser Art schlägt sie ganz ihrer Mutter nach‹, dachte er. ›Keinen Tag Ruhe, außer am Sonntag. Als ob der Torf davonliefe! Aber bitte, wenn das Kind es so meinte.‹ Er war kein Mann heftigen Widerspruchs. Den Wünschen seiner Frau hatte er sich auch immer gefügt.
In ihrer Kammer saß Lisa dann noch auf dem Bettrand und flocht ihr Haar. Morgen würde also das Leben weiterlaufen ohne die Mutter. Lisa brauchte auf nichts zu warten und nichts zu erwarten. Sie konnte zusehen, wie Sommer und Winter kamen, wie die Blumen blühten und im Herbst die Wälder sich färbten. Aber sie konnte nie einem Menschen sagen, wie schön das alles war und was sie dabei empfand. Auch konnte sie nicht sagen, wie einsam sie sich fühlte. Die Leute würden darüber höchstens nur lächeln, weil man sie gar nicht für voll nahm. Denn ein Mensch, der nicht reden konnte, war nach ihrer Ansicht nach auch in geistiger Hinsicht nicht auf der Höhe. Das hatte sie schon oft genug von den Kindern des Dorfes zu spüren bekommen.
Vor ihrer Krankheit hatte sie viele Freunde gehabt. Von der Zeit an, aber als der Scharlach ihr die Sprache geraubt hatte, wurde sie links liegen gelassen, man sonderte sich von ihr ab, es lohnte sich nicht mehr, mit ihr zu spielen. Nur Reinhold Bichler hatte sich nicht von ihr abgewandt. Aber Reinhold war eben auch anders als die anderen.
Wenn er nur nicht so schrecklich weit weg wäre, und wenn ihn das Leben in der Stadt nur nicht verändern würde! Zu Weihnachten war er zwar noch so wie immer gewesen, auch wenn er schon wie ein junger Mann aussah, dem der erste Flaum um das Kinn sproß. Was aber würde in den großen Ferien sein, wenn er heimkam?
›Ja, früher oder später wird er mich eben vergessen‹, dachte Lisa, und ihr Gesicht versteinerte sich im Gram. Ihre Gedanken kreisten noch eine ganze Weile um den fernen Kindheitsfreund, und sie versuchte sich zu erinnern, was Reinhold ihr in den letzten Ferien alles erzählt hatte.
Wie ernst ihr Leben nun geworden war, das erfuhr Lisa bereits im Lauf des Sommers, der über das Pfarrdorf Salern hinzog, das Getreide reifen ließ und den Torf im Moor so austrocknete, dass die ehemals ziemlich großen Stücke ganz schmal und steinhart wurden, fast wie Kohle.
Sie bemerkte an ihrem Vater, der seit dem Tod der Mutter den inneren Halt noch mehr verlor und öfter am Wirtshaustisch als daheim zu finden war.
Die Hand seiner Frau war stark gewesen und hatte ihn zu führen gewusst. Jetzt, da sie nicht mehr da war, ließ er sich gar zu gerne von anderen Wirtshaushockern zum Bleiben überreden. Mit jedem Bier wurde er lustiger, und so war er eine geschätzte, unterhaltsame Gesellschaft.
»Bleib noch, Markus«, sagten sie, wenn er gehen wollte. »Ich spendier dir noch eine Halbe. Oder einen Schnaps.«
Der Markus ließ sich nur zu gerne aufhalten, trank das Bier, das sie ihm zahlten, redete und lachte bis der Wirt sie schließlich energisch hinauswarf, weil er endlich zu Bett gehen wollte.
Dann torkelte Markus durch die Nacht heim und schlich leise ins kleine Haus, damit Lisa ihn nicht hören sollte. Sie konnte ihm zwar mit Worten keine Vorhaltungen machen, aber sie konnte ihn mit ihren blauen Augen so vorwurfsvoll ansehen, dass ihm eine Gänsehaut über den Rücken lief und es ihm lieber gewesen wäre, wenn sie ihn hätte anschreien können.
Ach, er verstand sie ja eigentlich, und immer wieder riss er sich zusammen und schuftete dann einige Tage lang, als ob er alle Versäumnisse binnen Stunden wieder gut machen konnte, aber dann kam irgendwann wieder der Moment, in dem er dachte, nun hätte er sich doch ein bisschen Vergnügen verdient nach all der Arbeit, und es zog ihn wieder ins Wirtshaus. Immer öfter war er mit dem »Vergnügen« beschäftigt, und immer seltener mit der Arbeit. Oftmals war er inzwischen schon am hellichten Tag betrunken, so dass die Kinder hinter ihm herliefen und über sein Torkeln und seinen grölenden Gesang lachten.
Ja, das waren schwere Sorgen für Lisa, die sich nun gezwungenermaßen für sie beide, ihren Vater und sich selbst, verantwortlich fühlte. Wenn man sie sah, konnte man sich gar nicht vorstellen, dass sie noch zur Schule ging. Durch diese Aufgabe schien sie vor der Zeit reif zu werden, auch äußerlich wirkte sie schon wie eine Erwachsene.
Im letzten Schuljahr hatte sie jetzt den Lehrer Gruber als Klassenlehrer, einen stillen, versonnenen älteren Mann. Lisa brachte ihm jeden Morgen, wenn sie zur Schule kam, zwei Liter Milch mit. Natürlich hätte Frau Gruber die Milch auch in der Molkerei oder bei einem anderen Bauern kaufen können. Aber die brauchten das Geld nicht so nötig wie der Schormayer und seine Tochter.
Dieses Mädel aus dem Moorwinkel, so dachte der Lehrer, brauche für ihr Leben später doch etwas mehr als nur Rechnen, Lesen und Schreiben. Darum gab er sich besondere Mühe mit ihr.
Als die Mutter noch lebte, hatte Lisa die beiden Lehrerkinder manchmal spazieren gefahren. Aber jetzt hatte sie dazu keine Zeit mehr. Bevor sie morgens zur Schule ging, musste sie die Kuh melken, die Betten machen und die Stube aufräumen. Am Nachmittag war sie im Heu oder im Torfstich. Keines der anderen Kinder im Dorf musste so viel arbeiten wie sie. Aber sie tat es gern, denn sie dachte, dass es ihr von der Mutter als Vermächtnis aufgegeben worden sei, für den Erhalt des kleinen Anwesens zu sorgen.
Der Schormayer lobte seine Tochter und sagte ihr, dass sie das wohl von ihrer Mutter geerbt habe, und er brachte es fertig, sich selbst angesichts so viel offensichtlicher Tüchtigkeit von der Arbeit mehr und mehr zurückzuhalten und alles dem Mädchen zu überlassen. Bald fand er, dass er bei der Arbeit eigentlich nicht benötigt wurde, und war über alle Maßen erstaunt, als Lisa ihm eines schönen Tages auf die Tafel schrieb, dass er doch nebenbei eine Arbeit annehmen könnte. Im Forst würden Leute gesucht, oder er könne doch auch für andere Leute Torf stechen, so wie er es früher auch getan hatte, als die Mutter noch lebte.
Immer wieder las er, was Lisa ihm aufgeschrieben hatte, dann schüttelte er den Kopf.
»Du bist wie die Mutter. Die hat auch nie leiden können, wenn ich es mir einmal habe gut gehen lassen. Für andere Leute Torf stechen? Warum denn? Für uns zwei langt es so, wie es ist, leicht. Schau, Lisa, es geht ja nur noch um ein paar Jahre, dann wirst du einen Mann finden und Weggehen, und ich muss alleine zurechtkommen. Warum schaust du so? Irgendwo wird schon einer aufzugabeln sein, dem es nichts ausmacht, dass du stumm bist. Es wäre überhaupt gut, wenn die Weiber nicht so viel reden täten. Viel Unglück kommt in der Welt bloß daher, weil die Ratschweiber oft ihren Schnabel so weit aufreißen.«
Er unterbrach sich, und es dämmerte ihm, dass er das besser nicht hätte sagen sollen. »Schau mich doch nicht so an, Lisa, sonst krieg ich gleich wieder Durst. Ich rede halt manchmal dummes Zeug daher und meine es doch eigentlich gar nicht so. Wir zwei bleiben natürlich für immer zusammen, es geht dir doch nicht schlecht bei mir – oder?«
Ein müdes Lächeln zuckte um den Mund des Mädchens. Ach, sie hätte dem Vater so vieles sagen wollen. Er meinte es sicherlich gut in seiner Art, aber er war doch recht hilflos geworden, seit die Mutter nicht mehr da war. Sie sah in letzter Zeit so manches, und was sie nicht sah, das konnte sie erahnen.
Es wurde ihr immer mehr zur Gewissheit: Den früher so gleichmäßig fröhlichen und leichtsinnigen Vater hatte eine immer mehr um sich greifende Gemütsschwere erfasst, die er mit Alkohol wegzuschwemmen versuchte.
Früher hatte er stets eine gefüllte Schnapsflasche im Wandschränkchen stehen gehabt, jetzt trug er sie bereits ständig bei sich, um gleich einen tiefen Schluck nehmen zu können, wenn ihn ein trauriger Gedanke anfallen wollte.
Einmal begegnete ihm auf dem Pfad zwischen zwei wogenden Kornfeldern der Pfarrer. Der Schormayer hatte sich ein Sträußlein blauer Kornblumen auf den Hut gesteckt, pfiff ein Marschlied vor sich hin und schmiss die Beine locker nach vorne.
Als er den geistlichen Herrn daherkommen sah, richtete er sich kerzengerade auf und legte die Hand an den Hutrand.
Ein heftiger Zorn rötete die Stirn des Pfarrers. Aber er hatte in den langen Jahren seiner Seelsorgetätigkeit gelernt, dass Milde hier ein besseres Mittel sein würde als der Zorn.
»Schormayer«, sagte er mit leisem Vorwurf in der Stimme, »dass Sie sich nicht schämen, am hellichten Tag betrunken zu sein!«
»Andere sind es dafür in der Nacht, da sieht man’s nicht«, antwortete der Schormayer fröhlich und griff in seine Joppentasche. »Auch ein Schlückchen gefällig, Herr Pfarrer? Echter Zwetschgenschnaps! Der tut gut.«
»So weit ist es mit Ihnen schon gekommen! Und Sie waren einmal so ein ruhiger, anständiger Mann. Wenn das Ihre Frau wüßte! Schämen Sie sich denn nicht vor Ihrem Kind?«
Damit hatte er eine empfindliche Stelle getroffen. Beide Hände beschwörend aufhebend, rief der Schormayer: »Wer kann behaupten, dass es meiner Lisa an irgendetwas fehlt? Tu ich nicht alles für sie? Da soll mir nur ja keiner kommen und mir Vorwürfe machen!«
»Ich mache Ihnen keine Vorwürfe. Noch nicht. Aber wenn es einmal sein muss, werde ich mich nicht scheuen, alle Rechtsmittel in Bewegung zu setzen, dass das arme Kind Ihrem unheilvollen Einfluss entzogen wird.«
Der Schormayer riss den Mund weit auf, und eine scharfe Falte stand zwischen seinen Brauen. »Wie meinen Sie denn das?«
»Genauso, wie ich es sagte. Kommen Sie, Schormayer, setzen wir uns. Ich wollte schon lange einmal mit Ihnen reden, und es ist vielleicht ganz gut, dass wir uns hier begegnet sind.«
Der Boden war ausgetrocknet und zeigte schon Risse. Der Pfarrer schlang seine Hände um die angewinkelten Knie, und der Schormayer nahm den Schneidersitz ein. Das Korn war schon so hoch, dass es einen wenn auch dürftigen Schatten über die beiden warf.
»Also, jetzt raus mit der Sprache«, sagte der Markus. »Was wollen Sie mit Ihren Rechtsmitteln sagen?«
»Zunächst einmal«, begann der Pfarrer langsam, auf seine Hände herunterschauend, »zunächst einmal dürfte Ihnen doch wohl klar sein, dass es Mittel und Wege gibt, Ihnen das Erziehungs- und Sorgerecht wegzunehmen, wenn die Gefahr besteht, dass das Wohl des Kindes durch Ihr Verhalten beeinträchtigt wird.«
Der Markus Schormayer fuhr so heftig auf, dass ihm der Hut mit dem Kornblumenbüschl in den Nacken rutschte. »Wer kann so etwas behaupten? Lisas Wohl wird durch mich doch nicht gefährdet …«
»Auch dadurch nicht, dass Sie in letzter Zeit Tag und Nacht meist sinnlos betrunken sind?«, unterbrach ihn der Pfarrer scharf. »Schormayer, damit muss Schluss sein. Hören Sie auf, bevor es zu spät ist! Eines Tages können Sie es womöglich nicht mehr! Denken Sie doch auch daran, dass Sie im Begriff sind, das Erbe Ihres Kindes zu verschleudern, wenn Sie so weitermachen!«
Markus Schormayer war beleidigt. »Was ich mit meinem Geld mache, das geht niemanden etwas an. Für mich und Lisa reicht es allemal.«
Der Pfarrer seufzte und begann von Neuem: »Schormayer, ich rede nicht von dem Geld, das Sie ins Wirtshaus tragen. Das wäre zu verschmerzen. Aber Sie vernachlässigen Ihre Pflichten, und auf diese Art werden Sie sich und Ihre Tochter noch ruinieren. Kein Anwesen kann auf Dauer erhalten werden, wenn man so wirtschaftet wie Sie. Kehren Sie um, Schormayer! Noch ist es nicht zu spät! Denken Sie an Ihr Kind, das Sie noch lange braucht. Ich meine es doch nur gut mit Ihnen. Und damit Sie sehen, dass ich Ihnen gern helfen will, Schormayer: Ich hätte drei Klafter Holz zu schneiden und zu spalten. Gegen Bezahlung natürlich und – wenn Sie Zeit haben.«
Der Schormayer überlegte eine Weile, rechnete nach, wie viel dabei herausspränge, und kam dann zu dem Entschluss: »Zeit hab ich eigentlich recht wenig. Aber weil Sie es sind. Die Stunde zwanzig Mark und ein Mittagessen. Und was zu trinken natürlich. Das hätte ich fast vergessen.«
Der Pfarrer nickte. »Meinetwegen. Aber nur vormittags eine Maß und nachmittags eine. Und die Lisa kann auch mitessen.«
»Gut, dann komme ich morgen gleich.«
»Morgen ist Sonntag. Am Montag dann.« Der Pfarrer erhob sich und wollte gehen. Da schoss es dem Markus wie ein heißer Schreck durch alle Glieder.
»Aber nicht, dass Sie mir das Geld dann nicht in bar auszahlen!«
»Aber Schormayer! Wofür halten Sie mich denn?«
»Na ja«, meinte der Markus etwas bedrückt. »Gerade ist mir eingefallen, dass ich die Beerdigungskosten noch nicht bezahlt habe.«
»Habe ich Ihnen vielleicht eine Rechnung geschickt? Das ist vergessen, Schormayer. Machen Sie sich darum also keine Sorgen, und kommen Sie am Montag.«
Eine ganze Weile saß Markus Schormayer noch nachdenklich am Rande des Kornfeldes und grübelte vor sich hin. So ganz spurlos waren die Worte des Pfarrers doch nicht an ihm vorübergegangen. Sie hatten ihn nachdenklich gemacht. Es wäre doch das Schlimmste für ihn gewesen, wenn man ihm das Kind weggenommen hätte. War er denn wirklich schon in solchen Tiefen gelandet, dass der Pfarrer so mit ihm sprechen musste?
Kühler wurde jetzt der Wind. Die Sonne neigte sich schon stark gegen Westen. Die Schwalben huschten zwitschernd über das Kornfeld, und dahinter hörte man das Rattern eines Bauernfuhrwerkes auf der Dorfstraße. Vom Schwimmbad her hörte er Kinderlachen und Geschrei. Sicher war auch Lisa dort.
Und auf einmal hatte der Markus Schormayer eine Vision. Es war ihm, als erscheine aus dem Kornfeld heraus die Hand seiner Frau, lege sich ihm auf die Schulter, und Walburga spräche ganz eindringlich zu ihm: »Markus, sei vernünftig. Denk daran, wie viel Schweiß es gekostet hat, bis wir unseren Besitz ganz abbezahlt hatten. Willst du es denn jetzt mit Gewalt zerstören, was wir mühsam aufgebaut haben? Drei Kühe haben wir einmal gehabt und jetzt ist es nur noch eine.«
Der Markus wandte den Kopf und hob abwehrend die Hand. Aber er sah niemanden, dem er Schweigen hätte gebieten können. Doch die Stimme war wieder da, sie kam mit dem Wind durch die Halme, eindringlicher noch als zuvor: »Und wenn du schon nicht an dich denkst, Markus, so denk doch an unsere Lisa. Was soll aus ihr einmal werden? Wo soll sie hingehen, wenn du Haus und Hof hast hergeben müssen?«
»Wer sagt denn, dass ich das Anwesen verkaufen will? Das hab doch immer noch ich zu entscheiden!«, wehrte sich der Markus.
»Du willst nicht, aber man wird dich dazu zwingen, wenn du dich nicht zusammenreißt. Steckt denn gar kein Funken Ehrgeiz mehr in dir, Markus? Du bist nicht schlecht, nur schwach und willenlos. Wirf die Flasche weg, die du in deiner Tasche hast. Trink Wasser, wenn dich dürstet. Das ist gesünder und kostet nichts.«
Der Schormayer duckte den Kopf jetzt ganz tief.
›Bin ich denn wirklich so willenlos?‹, fragte er sich und warf dann die noch halbvolle Schnapsflasche in das Kornfeld hinein. Dreißig Meter, rechnete er sich aus, als er die Flasche aus der Luft herunterfallen sah, und war stolz auf diesen Wurf. Das sollte ihm erst mal einer nachmachen!
Wie befreit machte er sich nun auf den Weg ins Dorf, ging in den Friedhof, holte in dem Blechkübel, der hinter dem Grabstein stand, etwas Wasser und goss die Blumen auf dem Grab seiner Frau. Lisa hatte das zwar am frühen Morgen schon gemacht, als er noch seinen Rausch ausgeschlafen hatte, aber der Tag war drückend heiß, und die Erde saugte das Wasser gierig auf.
Markus setzte sich auf die Grabeinfassung und hielt eine recht melancholische Zwiesprache mit der Frau unter dem Hügel. Bis zur einfallenden Dämmerung blieb er so sitzen, dann machte er sich auf den Heimweg. Als er beim Sternwirt vorbeiging, drehte er den Kopf auf die andere Seite und verschloss die Ohren vor den Stimmen, die ihn riefen, als man seiner ansichtig wurde. Ja, da saßen wieder alle beieinander, im Garten, unter den schattigen Kastanienbäumen, und sie konnten es gar nicht glauben, dass der Markus heute vorbeiging und sich nicht zu ihnen setzte.
Als er am Laden vorbeikam, fiel ihm plötzlich ein, dass die Lisa doch so gern das bunte Kopftuch gehabt hätte, das man im Auslagefenster sehen konnte. Zweimal hatte sie es ihm schon gezeigt, als sie von der Kirche heimgegangen waren. Und immer hatte er sie getröstet. Heute aber, beschloss er, sollte Lisa das Kopftuch bekommen.
Die Bergmoserkramerin hatte schon Feierabend gemacht, saß in der Küche am Tisch und las gerade Zeitung. Unwillig hob sie das feiste Gesicht mit dem Doppelkinn, als der Markus durch die Hintertür eintrat.
»Was willst denn du heute noch?«, keifte sie ihn an.
Und als er diesmal gar keinen Schnaps, sondern das geblumte Kopftuch verlangte, legte sie die Zeitschrift weg und bekam ganz böse Augen.
»So? Das fängst du jetzt auch noch an? Das hätte ich nicht von dir erwartet, dass du einer anderen hinterherläufst, kaum dass deine Walburga richtig im Grab ist!«
»Ach was«, lächelte der Schormayer. »Was du schon wieder denkst! Ich möchte es doch für meine Lisa.«
Entweder hatte die Bergmoserin an diesem Abend eine besonders schlechte Laune, oder sie war doch eine bessere Rechnerin, als man ihr nachsagte.
»Wann willst denn du überhaupt einmal zahlen?«, fragte sie resolut. »Meinst denn du, dass ich bis in alle Ewigkeit aufschreibe?«
Der Schormayer schaute sie verdutzt an.
»Mach doch kein solches Theater wegen der paar Mark!«
Schneller, als man es ihren zwei Zentnern hätte Zutrauen können, surrte sie hinter dem Tisch hervor und nahm aus dem Küchenschrank ein blaues Heft, das sie aufschlug.
»Dir werde ich gleich ein paar Mark geben!«, sagte sie und fuhr mit ihrem Finger die ganze Zahlenskala herunter, die in dem blauen Heft stand. »Das sind jetzt zweihundertachtzig Mark, wenn du es genau wissen willst. Und bevor die nicht bezahlt sind, kriegst du von mir nichts mehr angeschrieben!«
»Zweihundertachtzig Mark?«, staunte der Markus. »Ja, wie gibt’s denn das?«
»Wie es das gibt? Jetzt erlaube einmal! Meinst du, dass ich was aufschreibe, was du nicht geholt hast? Da sind alleine schon sieben Liter Zwetschgenschnaps enthalten, Tabak, Kaffee …«
»Ja, ja«, unterbrach Markus Schormayer sie betroffen und machte eine abwehrende Handbewegung. »Ich glaub dir’s ja. Man möchte ja nicht für möglich halten, wie das immer gleich ins Geld geht! Aber wenn ich am Ersten des Monats mein Milchgeld krieg, zahl ich sofort.«
»Das hast das letzte Mal auch schon gesagt! Aber gesehen habe ich bis jetzt keinen Pfennig! Und das Milchgeld wird bei dir nicht recht viel ausmachen, befürchte ich. Übrigens ist ja am Montag bereits der Erste. Ich bin ja gespannt, ob du dann wirklich zahlst.«
»Einen Teil wenigstens«, sagte der Markus kleinlaut, denn inzwischen war ihm die Erkenntnis gekommen, dass er beim Wirt ja auch schon ziemlich viel hatte anschreiben lassen. Zögernd wandte er sich um. Es hatte ihm doch einen Schlag versetzt festzustellen, dass er plötzlich nicht mehr kreditwürdig war. Eine ganze Weile stand er mitten auf der Straße, unschlüssig und mit sich kämpfend, ob er jetzt heimgehen oder nicht doch beim Sternwirt einkehren sollte, um es darauf ankommen zu lassen, ob man ihm dort auch schon nichts mehr auf Pump gab.
Er zählte die Knöpfe seines Jankers ab und befragte auf diese Weise das Orakel. Es sagte ihm, dass er heimgehen sollte. Und er fügte sich der Entscheidung.
2
Reinhold kam in den großen Ferien nach Hause. Lisa hatte diese Zeit herbeigesehnt. Sie war zum Ende des Schuljahres aus der Schule entlassen worden, hatte fast in sämtlichen Fächern eine Eins und konnte doch herzlich wenig damit anfangen, denn das Wichtigste, was ein Mensch braucht, die Sprache, fehlte ihr.
Nun beginne der Ernst des Lebens, hatte der Lehrer den Kindern bei der Entlassung gesagt. Für manche traf dies sicherlich zu, für Lisa aber hatte er längst begonnen. Aber irgendwie musste sie diesem bedeutungsvollen Abschnitt noch äußerlich gerecht werden, deshalb steckte sie von diesem Tag ihre Haare hoch so wie die Großen. Das ließ sie größer erscheinen und reifer, und man hätte sie bei flüchtigem Hinschauen für eine erwachsene Frau halten können, obwohl sie erst knapp sechzehn war.
Oft stand sie in diesen Tagen vor dem Spiegel und betrachtete sich. Sie wusste nicht, ob sie schön war. Gesagt hatte es ihr wenigstens noch niemand. Aber sie wollte es sein, und wenn sie ganz tief in sich hineinhörte und genau darüber nachdachte, dann wollte sie eigentlich nur für den Studenten Reinhold Bichler schön sein.
Immer wieder trat sie in diesen Tagen vor die Tür und schaute den Hügel hinunter zum Dorf, ob sie Reinhold nicht schon den Weg heraufkommen sehe. Sonst war er doch immer schon am ersten, bestimmt aber am zweiten Tag seiner Ferien zu ihr in den Moorwinkel gekommen. Aber nun musste er doch schon mindestens eine Woche daheim sein, und hatte sich doch noch nicht blicken lassen. Dabei hätte sie jetzt so viel Zeit gehabt. Das Heu war daheim, der Torf trocken in der Hütte, der Vater viel unterwegs. Aber Reinhold kam nicht.
An einem sonnigen Nachmittag ging Lisa ins Schwimmbad, das um diese Zeit meist nur von Sommerfrischlern besucht wurde, weil die Dörfler an so einem schönen Tag nicht genug Zeit hatten, um baden zu gehen. Sie machte ein paar Sprünge vom Fünf-Meter-Turm ins Wasser, schwamm einige Bahnen im großen Becken und ließ sich dann auf der Wiese nieder. Die Hände hinter dem Kopf verschränkt, die Augen geschlossen, so lag sie da. Zuweilen seufzte sie schwer, obwohl sie den Grund dafür nicht hätte sagen können.
Plötzlich spürte sie, dass ein Schatten auf sie fiel, und als sie aufblickte, stand Reinhold Bichler neben ihr. Auch er war seit dem Winter noch gewachsen. Die Beine gespreizt, die Fäuste in die Hüften gestemmt, stand er da und schaute auf sie nieder, als sähe er sie zum ersten Mal.
»Dich hätte ich jetzt beinahe nicht mehr erkannt. So groß bist du geworden.«
Er ließ sich neben ihr nieder und sah sie immerzu an. Noch nie hatte Lisa ihre Stummheit so schmerzlich empfunden wie in diesem Augenblick, da sie ihm eine solche Menge von Fragen hätte stellen wollen: Warum hast du dich so lange vor mir verborgen?, hätte sie als erstes von ihm wissen wollen. Hast du noch an mich gedacht? Oder weißt du nicht mehr, wo der Moorwinkel liegt? Das alles hätte sie sagen mögen. Ihre Lippen bewegten sich langsam, widerstreitende Gefühle spiegelten sich ihren glänzenden Augen: Empörung und Freude zugleich.
»Die nächsten Tage wäre ich zu dir gekommen«, sagte er, als hätte er erraten, was sie sagen wollte.
Schüchtern, fast ängstlich strich sie mit den Fingerspitzen über seine Hand. Dann nickte sie und lächelte ihn nun still und zufrieden an.
»Du bist eine richtige Dame geworden«, meinte er dann. Sie lachte ganz hell auf und schüttelte dann den Kopf, so dass die Zöpfe hin- und herflogen. ›Wenn ich doch nur ein Blatt Papier und einen Bleistift hätte‹, dachte sie. Darauf hätte sie dann geschrieben: ›Hast du mich immer noch so gern, wie du es einmal gesagt hast?‹
Sie würde ihm das morgen auf die Tafel schreiben. Gleich darauf aber wusste sie, dass sie gerade das nicht aufschreiben könnte, denn – etwas war anders geworden, auch wenn er sich jetzt bemühte, wieder ganz so wie in alten Zeiten zu sein. Er stand auf, öffnete den Reißverschluss am Täschchen seiner Badehose und nahm ein paar Geldstücke heraus. Dann holte er am Kiosk zwei Flaschen Apfelsaft und setzte sich wieder zu ihr.
»Du wirst ja sicher auch Durst haben.« Er sah sie an. »Wie deine Augen sich verändert haben! Ich glaube, sie sind noch blauer geworden, noch dunkler.« Wie, um das genauer feststellen zu können, beugte er sich vor. Und plötzlich lehnte sich ihre Stirne gegen die seine. Erschrocken zuckte er zurück und sah sich um, ob niemand in der Nähe sei. Dann bemerkte er, dass ihr die hellen Tränen über die Wangen perlten.
»Aber Lisa, wer wird denn weinen?«, sagte er, und es war wieder der gute, tröstliche Klang in seiner Stimme wie in früheren Tagen, so dass sie die Tränen gleich energisch fortwischte und ihn anlächelte.
»Komm, gehen wir ins Wasser«, sagte er dann, zog sie an der Hand hoch und lief mit ihr zum Sprungbrett. Nebeneinander schwammen sie dann die Strecke einige Male hin und her und setzten sich anschließend wieder ins Gras. Reinhold schien nun seine anfängliche Scheu völlig überwunden zu haben, denn er redete jetzt unaufhörlich. Er erzählte, dass er viel lernen müsse, und dass er selbst schon ein wenig Geld verdiene, indem er Nachhilfestunden gäbe und auch hin und wieder in einem Kaufhaus Kurierdienste leiste. Das könne er ihr wohl sagen, meinte er. Denn Arbeit sei ja keine Schande, und er läge seinen Eltern ja noch lange genug auf der Tasche.
Unweit von ihnen ratterte ein Traktor mit einem hoch beladenen Wagen Grummet vorbei. Der Mann, der am Steuer saß, blickte in die Richtung, in der Lisa mit Reinhold saß, und rief der Frau, die neben ihm saß, etwas zu.
Das war Manfred Bichler, Reinholds ältester Bruder, der daheim das Anwesen übernommen hatte.
Das Gefährt verschwand jetzt zwischen ein paar Höfen, fuhr an der Kirche vorbei auf die Schmiede zu. Der alte Bichler stand in seinem Lederschurz, die Ärmel hochgekrempelt, unter dem Tor der Schmiede, griff, als das Fuhrwerk vorüberfuhr, in das Fuder, riss ein Büschel Grummet heraus und roch daran. Dann hielt der Wagen im Hof.
»Der Reinhold liegt mit der Stummen im Schwimmbad drüben«, erzählte die junge Frau dem Schwiegervater mit einem so düsteren Ton in der Stimme, als sei dies ein Verbrechen. Der Schmied lachte nur dazu und meinte: »Lass ihm doch die Freude! Aber dass es ihm nicht zu dumm ist, stundenlang zu reden, ohne eine Antwort zu kriegen? Ich wüsste mir schon ein anderes Vergnügen.«
»Aber ins Gerede bringt er sich und uns damit.«
Der Schmied sah seine Schwiegertochter Kathrin mit einem spöttischen Lächeln an. »Was heißt ›uns‹? Dir zupft er doch damit von deiner Ehre nichts ab. Was kann übrigens das arme Mädel dafür, dass ihr Vater so ein leichtsinniger Tagedieb geworden ist?«
»Ein Lump ist er!«, behauptete die Kathrin und ging ins Haus, weil sie wusste, dass sie bei der alten Schmiedin mehr Gehör mit ihren Klagen über den jungen Schwager Reinhold finden würde. Aber diese hatte im Augenblick nicht genug Zeit für ein Gespräch, denn für den Abend war eine Familienfeier angesetzt. Der Schmied wurde morgen siebzig Jahre alt, und für den Vorabend hatten all seine Kinder, Schwiegersöhne und Schwiegertöchter einschließlich der bereits vorhandenen Enkel sich zu einem Besuch angesagt. Darum stand die Schmiedin am Herd, hatte gerade ein ziemlich großes Spanferkel aus dem Rohr gezogen und wendete es mit einer zweizinkigen Gabel um, damit es auf der anderen Seite auch recht knusprig werde.
»Du kannst jetzt gleich die Kartoffeln schälen«, wies sie die Schwiegertochter an. »Dann holst du noch einen Salat vom Garten rein, den kann dann die Moni putzen, wenn sie kommt. – So, so, im Schwimmbad hast du ihn gesehen, den Reinhold? Ich hab ihm extra gesagt, er soll sich künftig zurückhalten mit ihr, weil sie schließlich kein Umgang für einen Studierten ist. – In der Stube müssen dann die Tische zusammengerückt werden, dass alle Platz haben. Soll dir der Manfred helfen, ich kann jetzt nicht weg vom Herd.«
»Und ich muss jetzt dann gleich in den Stall gehen«, klagte Kathrin. »Der Herr Student könnte schon auch ein bisschen mehr tun! Aber der hat ja nicht Zeit, der muss ja zum Baden gehen und neben der Stummen auf der Wiese liegen!«
»Ja, ja, ist schon recht«, sagte die Schmiedin und stieß das Spanferkel wieder ins Rohr zurück. »Ich werde es ihm schon sagen, wenn er heimkommt.«
Draußen fuhr ein Auto in den Hof. Die älteste Tochter kam mit ihrem Mann, dem Leitnerbauern, und ihren beiden Kindern.
»Ah, da kommt ja die Moni schon. Die kann gleich in der Stube alles herrichten. Und du sagst dem Vater, er soll jetzt Feierabend machen und sich waschen.«
Innerhalb einer weiteren Stunde trafen auch alle übrigen ein. Eine recht stattliche Zahl versammelte sich in der großen Stube, an die zwanzig Personen. Nur einer fehlte noch an dem festlich gedeckten Tisch. Man wartete noch, und wer auch von den Neuankommenden gefragt hatte, wo Reinhold stecke, hatte von der Kathrin recht spitz und mit einem Unterton von Anzüglichkeit zur Antwort bekommen: »Auf der Schwimmbadwiese liegt er mit der Stummen vom Moorwinkel.«
Um dreiviertel acht Uhr wollte man dann nicht mehr warten. Die beiden jüngsten Enkel sagten ein Gedicht für den Großvater auf, und dann setzte man sich zu Tisch.
Kaum hatte man zu essen begonnen, kam Reinhold auf das Haus zu. Er hatte es anscheinend gar nicht so eilig, denn er hatte die kleine Festlichkeit völlig vergessen. Umständlich hängte er seine Badehose an den Gartenzaun und fuhr sich mit dem Kamm, den er aus der Hosentasche zog, ein paar Mal durch das Haar. Dann erst ging er auf das Haus zu.
Als er die Stubentür öffnete, stutzte er. Dann schlug er sich mit der flachen Hand vor die Stirn.
»Ach, du meine Güte! Das hatte ich ja ganz vergessen! Alle Schwager und Schwägerinnen, Nichten und Neffen auf einem Haufen beisammen! Wann schon trifft man sich einmal so vollzählig!«
»Zu Allerheiligen«, sagte der Schmied. »Aber dann bist ja du nicht da.«
Mit beiden Händen winkte Reinhold allen zu und lachte: »Grüß euch alle miteinander! Wie mich das freut!« Er suchte sich seinen Platz zwischen seiner Schwester Silvia und dem Schwager Valentin. »Seid nicht böse, dass ich so spät gekommen bin. Ich habe einfach nicht mehr daran gedacht.«
»Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss essen, was übrig bleibt«, sagte die Mutter halb tadelnd, halb amüsiert. Ohnehin konnte er sehen, dass man ihn nicht würde hungern lassen.
Sein spätes Kommen empfand eigentlich niemand störend, nur die Schwägerin Kathrin musste ihre bissige Bemerkung losbringen: »Wenn man sich so köstlich amüsiert auf der Badewiese, vergisst halt der Rüssel auf die Schüssel, was, Reinhold?«
Reinhold hob die von der Sonne gerötete Stirn, an der das andere Erröten nicht erkennbar war.
»Hast du mich gesehen?«
»Ja, dich und die andere.«
»Die Lisa meinst du?«
»Wen denn sonst? Du findest ja nichts Besseres.«
»Ruhe jetzt!«, sagte der Vater mit jenem Nachdruck in der Stimme, den alle kannten und der jede weitere Stichelei verbot. Erst danach, als sie längst gegessen hatten, die Kinder sich noch draußen tummelten und der Schmied mit dreien seiner Schwiegersöhne den neuen Mähdrescher des Fuchsbauern anschaute, der zu einer Reparatur in seiner Werkstätte stand, wurde das Thema Lisa Schormayer nochmals aufgegriffen, diesmal von der Mutter selbst.
»Die Kathrin hat schon recht«, begann sie. »Gibst dich mit dem stummen Balg da ab, als ob du wirklich keine andere finden könntest. Denkst denn du nicht daran, dass du dadurch ins Gerede kommst? Ausgerechnet du, der einzige im Dorf, der studiert, gibst dich mit so einer ab!«
Reinhold sah seine Schwestern und Schwägerinnen der Reihe nach an, die alle bis auf Silvia der Mutter entweder durch Kopfnicken oder mit einer Bemerkung Recht gaben. Erst allmählich begriff er, was man ihm da vorwarf.
»Was ihr euch immer gleich denkt!«, sagte er. »Sie ist doch noch ein Kind.«
»Ja, aber das Kind von einem recht verkommenen Subjekt«, sagte seine Schwester Anni, die mit dem Zimmerermeister Schnabl verheiratet war und sich darauf allerhand einbildete. »Und was das Kind betrifft, sie ist fast sechzehn!«
»Na und?«, fragte Reinhold herausfordernd, weil er sich keines Unrechtes bewusst war und dem Mädchen aus dem Moorwinkel doch versprochen hatte, dass sie immer mit ihm und seiner Freundschaft rechnen könnte. Seine Schwester Anni scharf ansehend, sagte er: »Gerade du, Anni, hättest es am allerwenigsten nötig, über die kleine Schormayer herzufallen, die doch schließlich nichts dafür kann, dass ihr Vater seit dem Tod seiner Frau so liederlich geworden ist. Sie ist doch von allen im Dorf am ärmsten dran und hungert nach jedem guten Wort.«
»Das brauchst ja nicht ausgerechnet du ihr zu geben«, sagte die Mutter und stellte sich zwischen Bruder und Schwester, weil Anni drauf und dran war, auf ihren jüngeren Bruder loszugehen. »Es schickt sich ganz einfach nicht, dass du als angehender Doktor keinen anderen Umgang hast als die Lisa! Meinst du, dass sich die Leute nicht auch ihren Teil dabei denken?«
»Was sich andere Leute denken …« Reinhold sprach den Satz nicht zu Ende, machte nur eine wegwerfende Handbewegung und ging hinaus.
Es war ihm zu dumm, sich wegen einer Sache zu streiten, die es gar nicht wert war. Er kannte der Mutter geheimste Gedanken wohl, die immer damit liebäugelte, dass er sich in seinen Ferien mehr der hübschen Doris Schalleder widmen solle. Sie war die Tochter des gutsituierten Kaufmanns Schalleder, der am Kirchplatz das Kaufhaus hatte. Siebzehn Jahre war sie alt, besuchte ein Internat im Schwarzwald und war gegenwärtig auch auf Ferienbesuch daheim.
Natürlich konnte Lisa, was Herkommen und Bildung betraf, sich nicht mit Doris messen. Sie waren grundverschieden in ihrer Art. Doris ging auf hohen Stöckelschuhen, schminkte sich die Lippen und hatte einen reichen Vater. Lisa dagegen lief im Sommer barfuß und war arm und stumm, und ihr Vater … na ja, der Vorwurf der Liederlichkeit hatte schon seine Berechtigung.
Doch Reinhold wollte doch wirklich nichts anderes als nur die alte Verbundenheit aus den Kindertagen aufrechtzuerhalten, in denen dieses Mädchen aus dem Moorwinkel ihm mit ihrer hellen, sprudelnden Stimme alles erzählt hatte, was ihr kleines Herz berührte. Nichts hatte ihn jemals so erschüttert als jener Tag, als Lisa stumm vor ihm stand und ihm einen Zettel in die Hand drückte, auf dem stand: »Wirst du von mir nun auch nichts mehr wissen wollen wie alle anderen?«
Nun stand Reinhold hinter dem Haus bei den alten Ahornbäumen am Bach. Ganz still war es um ihn. Nur manchmal hörte man vom Haus her ein helles Lachen. Die Nacht lag schon über dem Dorf, und über den Bergen glänzten die Sterne.
Es fiel ihm ein, dass er der Lisa versprochen hatte, morgen zu ihr zu kommen. Aber nun hatte man so viele Worte darum verloren. Hässliche Anspielungen waren gefallen, und Reinhold war dadurch in einen Zwiespalt geraten. Ging er nicht hin, so würde er sich Lisa gegenüber schäbig Vorkommen. Aber nun hatten seine engsten Verwandten daran Anstoß genommen, sogar die Mutter. Er wusste nicht mehr, wie er sich verhalten sollte, und fühlte sich sehr unbehaglich.
Doris Schalleder merkte bald, dass Reinhold Bichler ihre Gesellschaft mied, und sie sah ihn auch manchmal am Abend vom Moorwinkel zurückkommen. Zunächst war ihr nicht recht klar, was er da hinten suchte. Aber dann sah sie ihn mit Lisa am Sonntag nach der Kirche an der Rampe der Genossenschaftsmolkerei stehen, und da kam ihr blitzartig eine Vermutung.
Sie stand am Fenster des großen Wohnzimmers, und sah, wie die beiden beieinander standen und das Mädchen etwas auf einen Zettel schrieb und ihn dem Burschen zusteckte, der ihn las und daraufhin hellauf lachte.
Eine ganze Weile ging das so, bis sie sich dann voneinander verabschiedeten. Lisa ging bei der Molkerei um die Ecke und erreichte dahinter gleich den Feldweg, der in den Moorwinkel führte. Reinhold aber musste über den Kirchplatz gehen, um in die Schmiede zu kommen. Dabei musste er am Schallederhaus vorbei.
Schnell fuhr Doris mit dem Stift ihre Lippen nach, ein Blick noch in den Spiegel, dann eilte sie hinaus und stand unter der Haustüre auf der obersten Stufe.
Sie war hübsch anzusehen, diese blonde Kaufmannstochter, die unter den langen Wimpern heraus dem Ankommenden entgegenblickte, in der Hoffnung, dass der Student den Kopf heben und sie grüßen würde. Reinhold aber hatte den Kopf gesenkt, als hätte er über etwas lebhaft nachzudenken. Vielleicht wäre Reinhold vorübergegangen, ohne sie zu bemerken. Dem Mädchen blieb wirklich nichts anderes übrig, als ihn selbst anzusprechen: »Hallo, Reinhold!«
Wie erschrocken blieb er stehen und blickte zu ihr auf.
»Was bist du denn so nachdenklich?«
»Ich? Nachdenklich?«, fragte er.
»Ja, natürlich. Ich hab schon gedacht, du hättest was verloren, so stur hast du zu Boden gesehen.«
Eine kleine Pause. »Was treibst denn heute Nachmittag?«, fragte Doris schließlich, denn sie begriff, dass es keinen Sinn hatte, darauf zu warten, dass Reinhold die Initiative ergriff.
Er zuckte mit den Schultern. Gegen fünf Uhr wollte er in den Moorwinkel gehen. Er sah zum Himmel auf, der wenig Licht zu bieten hatte an diesem Sonntag. Schwere Wolken zogen über ihn hin, und im Wind war ein Geruch von Regen.
»Hättest du nicht Lust, mit mir ins Waldcafé Enzian zu gehen? Oder hast schon eine andere Verabredung?«
Er wurde rot. »Wie kommst denn darauf?«
»Nur so halt.« Sie zwinkerte mit einem Auge. »Oder meinst du, dass man mit mir nicht ausgehen kann?«
Mit dieser Frage wollte sie von ihm nur bestätigt haben, dass sie gut aussehe. Aber Reinhold verstand die Anspielung nicht. Er hatte überhaupt noch kaum Erfahrung mit jungen Mädchen, am allerwenigsten mit Mädchen vom Schlage einer Doris Schalleder.
»Deinen Eltern wird es doch recht sein?«, fragte er.
Doris verzog wieder ihren Mund recht spöttisch.
»Was sollen die denn sagen? Die Mutter findet es gut, wenn ich ein bisschen Abwechslung habe, und der Vater …« Sie sprach den Satz nicht aus, aber ihrer Handbewegung und ihrem Gesichtsausdruck war zu entnehmen, dass Herr Schalleder in seinem Hause nicht viel zu sagen hatte.
»Um wieviel Uhr?«, fragte Reinhold schließlich.
»Sagen wir um zwei Uhr.«
»Es sei denn, es regnet«, antwortete er und sah zu den niedrig ziehenden Wolken auf. Er wünschte sich geradezu, dass es regnen möge, denn allzu große Lust hatte er nicht. Diese Doris war sehr verwöhnt, und es würde bei ihr wahrscheinlich nicht mit einer Portion Eis abgehen. Es blieb ihm also nichts anderes übrig, als die Mutter um ein paar Mark zu bitten, denn bei ihm war momentan ziemliche Ebbe in der Kasse.
Die Schmiedin stutzte auch gleich, als er zögernd seinen Wunsch vorbrachte, und sie wollte wissen, wozu er denn gleich zwanzig Mark brauche.
»Na ja, ich wollte heute Nachmittag ins Waldcafé gehen.«
»Ach, da schau her! Mit wem denn?« Die Mutter schloss die bereits geöffnete Geldbörse wieder. »Vielleicht gleich gar mit der Stummen?«
»Nein, mit der Schalleder Doris.«
Sofort hellte sich das Gesicht der Frau auf. Sie tat einen tiefen Seufzer der Erleichterung.
»Das ist ja ganz was anderes! Warum sagst du denn das nicht gleich? Aber was willst du denn da mit zwanzig Mark? Der Doris kannst du doch nicht bloß eine Tasse Kaffee hinstellen lassen und ein Stück Kuchen. Mit der musst du schon auch ein Glas Wein trinken. Und überhaupt, schau, Bub, so ein Mädel musst du dir warm halten. Da kannst du von einem großen Glück sagen, wenn sie mit dir ausgehen will. Da hast du fünfzig Mark, damit es auch sicher nicht zu wenig ist. Aber dass du dich getraut hast, sie einzuladen! Respekt, Bub! Alle Achtung!«
»Sie hat mich eingeladen, nicht ich sie«, berichtete Reinhold.
»Ja, dann ist es ja noch günstiger, Bub. Die wäre einmal eine Partie für dich! Was meinst du, dass es kostet, so eine Praxis einzurichten? Die Doris Schalleder bekommt einmal eine Menge mit, wenn sie heiratet …«
Reinhold war verblüfft, welch weitreichende Pläne seine Mutter aus einer simplen Verabredung im Waldcafé da entwickelte. »Wie weit du vorausdenkst, Mutter!«
»Mütter müssen immer vorausdenken. Und überhaupt, geh dich umziehen, in den Sachen da solltest du nicht gehen, wenn du mit Doris Schalleder ausgehst! Wie alt ist sie jetzt eigentlich?«
»Ich glaube, siebzehn ist sie.«
»Zwei Jahre jünger also als du. Das würde perfekt passen! Das darfst du dir jetzt nicht verpatzen, Reinhold, so ein Mädel musst du für dich gewinnen, die ist es wert.
« Reinhold ging in sein Zimmer, um sich umzuziehen, und konnte nur den Kopf schütteln über den Übereifer der Mutter. Freilich, sie meinte es gut und wusste es nicht besser. Und dass ihr als erstes das Geld einfiel, war verzeihlich. Immerhin, ohne die finanzielle Hilfe seiner Eltern, die für sie durchaus ein Opfer darstellte, wäre es ihm nicht möglich gewesen zu studieren. Begreiflich, dass sich die Mutter Gedanken machte, wovon er einmal eine Arztpraxis finanzieren sollte. Doch er selbst hatte beim Gedanken an seine Verabredung mit Doris natürlich ganz andere Dinge im Kopf.
»Ausgehen«, sagte er vor sich hin und lachte. Ich gehe heute zum ersten Mal mit einem Mädchen aus, sinnierte er weiter und wollte sich ausmalen, wie dieser Nachmittag wohl verlaufen würde. Aber er konnte sich eigentlich gar nichts darunter vorstellen. Auf alle Fälle würde er um fünf Uhr im Moorwinkel sein, weil er die Lisa, das »Moorhexerl«, wie sie im Dorf oft genannt wurde und er selbst sie, im Gegensatz zu den Leuten aber liebevoll, rief, nicht enttäuschen wollte.
Er sah zum Kirchturm hinüber. Es war zehn Minuten vor zwei Uhr. Als er die Treppe hinunterging, stand die Mutter im Flur mit freudig erregtem Gesicht.
»Lass dich anschauen«, sagte sie und begann an seiner Kleidung herumzuzupfen. »Gut siehst du aus! Und was ich dir noch sagen will: Du brauchst nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Bloß schön langsam die Fühler ausstrecken, weißt du. Du musst so tun, als ob das Geld, das sie einmal kriegt, dich gar nicht interessieren würde. Das macht einen guten Eindruck.«
»Ja, ja, ist schon recht«, antwortete Reinhold, trat unter die Haustüre und schaute wieder zum Himmel auf. Aber es wollte nicht regnen, das Gewölk war eher höher geworden, und da und dort sah man bereits wieder die Bergspitzen herausschimmern. Er würde seine Verabredung also einhalten müssen. Mit recht gemischten Gefühlen machte er sich auf den Weg zum Haus der Schalleders.
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com





























