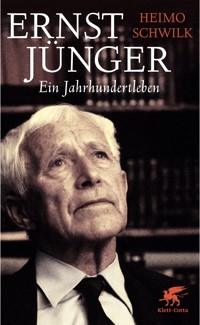11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Kein deutscher Autor des 20. Jahrhunderts hat mehr Leser begeistert als Hermann Hesse. Sein Werk zählt zur Weltliteratur. Der renommierter Journalist Heimo Schwilk legt die große Biografie eines Dichters vor, der ebenso exzessiv und widersprüchlich lebte wie die Helden seiner Romane. Ein Buch über die Abgründe einer zerrissenen Persönlichkeit, über Krisen und Triumphe, die Liebe und ihr Scheitern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für meine Mutter
Bildnachweis: Wir danken dem Deutschen Literaturarchiv Marbach für die freundliche Genehmigung zum Abdruck der Fotos im Bildteil. Dank gebührt auch dem Suhrkamp Verlag, der das Foto von Hermann Hesse und Ruth Wenger [*] zur Verfügung stellte.
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
3. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-95588-1
© Piper Verlag GmbH München, 2012
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagfoto: Martin Hesse/bpk
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
VORWORT
Als Hermann Hesse am 9. August 1962 im Alter von 85 Jahren starb, hinterließ er ein Werk von fast 40 Titeln, die inzwischen weltweit in geschätzten 125 Millionen Exemplaren verbreitet sind. Allein in den deutschsprachigen Ländern wurden annähernd 25 Millionen Bücher verkauft. Von rund 35 000 Briefen ist bislang ein Siebtel publiziert worden, Hesses Rezensionen füllen fünf Bände, die Sekundärliteratur zu Leben und Werk ganze Regale. Zahlreiche Materialienbände zu einzelnen Werken sind seit seinem Tod herausgekommen. Trotz dieser breiten Quellenbasis überrascht der Grundtenor der Urteilsbildung, der sich in den letzten Jahrzehnten kaum gewandelt hat. Wer sich mit Hermann Hesse beschäftigt, stößt sehr schnell auf eine Reihe von Allgemeinplätzen, mit denen man den irritierenden, geradezu unheimlichen Erfolg dieses Autors zu erklären versucht. Hesse sei der Dichter der Jugend und des Protests, ein Aufrührer gegen jede Autorität und Befürworter eines maximalen Individualismus. Sein phänomenaler Erfolg in den USA der Vietnamkriegsära habe mit dem zutiefst pazifistischen Charakter seines fernöstlich inspirierten Humanismus zu tun, die massenhafte Verbreitung seiner Bücher in Japan, China und Korea mit der Mittlerfunktion zwischen den Kulturen. Und in Deutschland teilt sich das Bild in den menschenscheuen, schizoiden Outsider (Steppenwolf) auf der einen und den aufgeklärten Kritiker einer »schwarzen Pädagogik« (Unterm Rad) auf der anderen Seite. Aber helfen solche Klischees wirklich, das Phänomen Hesse zu verstehen? Ist sein komplexes, spannungsvolles Werk tatsächlich Ausdruck einer durch und durch anarchischen Natur?
Es ist an der Zeit, das eigentlich Faszinierende an Hermann Hesse herauszustellen, das sich am besten in einer Doppelbegrifflichkeit ausdrücken lässt: Dichten und Dienen. Ein Bild, das für Leben und Werk gleichermaßen gilt. Die Helden seiner Erzählungen und Romane sind ja, wie ihr Autor selbst, nicht bindungsscheu, sondern bindungsbedürftig, nicht an Willkür interessiert, sondern an Selbstverwirklichung. Hesse hat ein ganz eigenes, gleichsam aristotelisches Verständnis von Individualität entwickelt. Für ihn ist der Mensch nicht »frei geboren«, sondern auf ein bestimmtes, sein ureigenes Wesen angelegt, dem er in seinem Wirken Gestalt zu verleihen, dem er zu dienen hat. Diese seelische Zielgerichtetheit hat Folgen für das Verhältnis des Individuums zur Gesellschaft: Der Einzelne setzt seinen Eigen-Sinn gegen den Herden-Sinn. Protest und Revolte entspringen bei Hesse nicht einer bestimmten ideologischen Weltsicht, sondern kommen aus dem Misstrauen gegenüber jeder Weltanschauung, gegenüber allem Normierten, gegenüber jeder für verbindlich erklärten »Wahrheit«, die vom eigenen Weg ablenkt. Der Mensch, lehrt Hesse, müsse sich der einzig wirklich tragfähigen Bindung versichern, die von Ideologen nicht auszubeuten ist: der Treue zu sich selbst.
Vermutlich haben die amerikanischen Leser genau diese radikale Subjektivität gespürt, die Hesses Protesten gegen Massenkultur, falsche Autoritäten, gegen Profit und Kriegstreiberei ihre besondere Authentizität verlieh. Die »Interior Journey« der Flower-Power-Generation war ja im Kern nicht nur psychedelischer Drogentrip und sexuelle Befreiung, sondern vor allem auch Meditation, Askese, Gemeinschaftserfahrung. Zu Hermann Hesses Echtheit gehört aber auch – eine Tatsache, die in der Forschung bislang eher verdrängt wurde – der Patriotismus, seine Liebe zu Deutschland und vor allem zur deutschen, idealistisch-romantischen Kultur, die er früh schon als das ihm Eigentümliche erkannt hatte und im Sommer 1914 für verteidigungswürdig erklärte. Hesse verstand sich zu keinem Zeitpunkt als Pazifist, er hatte drei Söhne, die ihren Wehrdienst in der Schweiz absolvierten, und hätte es für selbstverständlich gehalten, wenn sie ihre Heimat gegebenenfalls mit der Waffe in der Hand verteidigt hätten.
Hermann Hesse war aber ebenso wenig der gärtnernde Idylliker von Montagnola, wie ihn seine Kritiker in den Fünfzigerjahren polemisch beschrieben. Er hatte eine Mission, verstand sich als Sachwalter des europäischen Erbes. Den Geist zu verteidigen gegen die Barbarei ist die Absicht seines Hauptwerks Das Glasperlenspiel, das von Anfang an als Manifest gegen den Nationalsozialismus gedacht war. Den Dienst am Geist leistet Josef Knecht, dessen Lebensgeschichte das Buch im Wesentlichen erzählt. Den Namen seines Protagonisten hat Hesse mit Bedacht gewählt, denn Diener eines ihn selbst transzendierenden Ideals, der Vorstellung von der Einheit hinter den Gegensätzen, die sich am sinnfälligsten in der Musik ausdrückt, will Knecht in allen Phasen seines Lebens sein – bis in den Tod. Dienst und Opfer bestimmen Hermann Hesses späte Schriften, die auch eine behutsame Wiederannäherung an die Werte des eigenen Elternhauses und die Rehabilitierung der väterlichen Welt mit ihrer ethisch-religiösen Erfahrung erkennen lassen.
Wer den Weg des Eigensinns so konsequent geht wie Hermann Hesse, macht es auch seinen Weggefährten nicht leicht. Der dauernde, unabschließbare Prozess der Individuation hatte einen hohen Preis, nicht nur für den Suchenden und Zweifelnden selbst, sondern auch für jene, die ihn begleiteten, für die Eltern und Geschwister, die Freunde – vor allem aber für Hesses Frauen. Welchen Abgründen die »Heiterkeit« des Glasperlenspielers Hermann Hesse abgerungen ist, belegen nicht nur die autobiografischen Schriften, sondern auch die Tagebücher und die Korrespondenzen mit seinen Ehefrauen. Überhaupt die Frauen: Sie sind die wahren Heldinnen seines Lebens, und für den Biografen sind es gerade diese spannungsvollen Beziehungen zu Mia Bernoulli, Ruth Wenger und Ninon Dolbin, die Aufschluss geben über Hesses Versuch, die Freiheit des Schriftstellers mit der Fürsorge für die Familie zu verbinden. Dass er dabei zweimal scheiterte, gehört zur Tragik dieses alles in allem wunderbar gelungenen Lebens.
Bei der Arbeit an dieser Biografie, die mich noch einmal in meine eigene Schulzeit als Seminarist in Maulbronn zurückführte, habe ich vielerlei Anregungen empfangen. Ich danke besonders Rüdiger Safranski und Uwe Wolff für die Gespräche über das Wesen des Biografischen, die Wechselbeziehungen zwischen Leben und Werk des schöpferischen Menschen. Mein Dank gilt aber auch den Freunden Ulrich Schacht, Thomas Scheuffelen sowie Angelika und Martin Thoemmes, die mir wichtige Hinweise gaben. Hans-Eberhard Dentler, dem namhaften Cellisten und Kenner des Bachschen Œuvres, verdanke ich den musikphilosophischen Schlüssel zum Verständnis von Hesses zentralem Werk Das Glasperlenspiel. Nicht zuletzt danke ich den Lektorinnen des Piper Verlags Renate Dörner und Kristin Rotter, die das Buchprojekt mit viel Geduld und Sachverstand in all seinen Phasen begleiteten.
Heimo Schwilk
Berlin, im Januar 2012
ERSTES KAPITEL
Die Flucht: Von Maulbronn über Sternenfels nach Kürnbach. Der Club der toten Dichter. »Die Odyssee ist kein Kochbuch.« Die Nacht im Strohhaufen. Der verborgene Gott. Licht auf der Dornenkrone. Mit dem Landjäger zurück ins Kloster. »Kennst Du das Land, wo keine Blumen blühen.« Karzerstrafe. »Bitte liebt mich noch wie vorher.« Morddrohung. Hermann muss das Seminar verlassen. Absturz in den Wahnsinn? Zum Teufelsaustreiber nach Bad Boll
Nichts wird so sein wie vorher. Das Herz rast, heiße Wellen treiben ihn voran. Der junge Mann spürt, dass diese Entscheidung sein Leben verändern wird. Eben ist er durch die Mauerpforte an der Nordwestecke des Klosters geschlüpft, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Hinter den in blau-weißem Dunst schwimmenden Hügeln am Horizont ruft keine Glocke zum Aufstehen, zur Lektion, zum Mittagstisch. Auf dem Höhenweg über dem Kloster schwenkt er seine grüne Mütze, um sich einer Gruppe von Mitschülern bemerkbar zu machen, die am Brunnen vor dem Seminargebäude zur Mittagspause zusammensteht. Einer ruft etwas, winkt, aber sein Ruf verhallt zwischen den Mauern von Jagdschloss und Abtshaus. Niemand würde ihm folgen, das weiß er. Keiner hat wie er den Mut, frech die Seminarordnung zu durchbrechen, den Schritt ins Freie zu wagen. Man lästert gegen die Repetenten, reimt Spottverse, aber wenn einer der Lehrer das Zimmer betritt, verstummen die meisten, machen ihren Bückling und erweisen sich als dankbar-gefällige Stipendiaten.
Hermann Hesse aus dem Pietistenstädtchen Calw ist anders. Einen der Lehrer liebt er, die anderen sind ihm gleichgültig, nur einer ist ihm verhasst. Das Maulbronner Klosterseminar erscheint ihm als ein durchaus angenehmer Ort, keine »Knabenpresse«, in die ehrgeizige Eltern ihre Söhne zwingen, um sich Ausbildungskosten zu sparen – oder weil sie auf eine glanzvolle Karriere ihres Sprösslings hoffen. »Alles zusammen bildet ein festes, schönes Band zwischen Allen und nirgends findet man einen Zwang«1, hat er noch vor drei Wochen, am 14. Februar 1892, an seine Mutter geschrieben. Der Fünfzehnjährige ist nicht nur hier, weil der Besuch der württembergischen Eliteschule Familientradition ist. Sein Großvater, ein Onkel und sein Bruder Karl haben das evangelische Seminar höchst erfolgreich absolviert, und auch er selbst hat das berühmt-berüchtigte »Landexamen«, die Eingangsprüfung für die Klosterschulen Maulbronn, Blaubeuren, Schöntal und Urach, ohne Mühe bestanden. Doch nicht die Aussicht auf eine Pfarrstelle hat ihn beflügelt, sich in einer Göppinger Lateinschule auf das Landexamen vorbereiten zu lassen. Er wusste von Anfang an, wie hart die Paukerei für diese Prüfung sein würde, denn von mehreren Hundert hochbegabten Bewerbern werden nur fünfundvierzig ins Seminar aufgenommen. Hermann hat ganz andere Pläne, die er keineswegs verschweigt, die aber von seinen Eltern als Grille eines Pubertierenden aufgefasst werden: Hermann Hesse will Dichter werden – oder gar nichts. Diesen Traum glaubt er gerade hier in Maulbronn, wo auch sein Vorbild Hölderlin zur Schule ging, verwirklichen zu können.
Als Hermann den Tiefen See oberhalb des Klosters erreicht, kommt ihm das Gedicht in den Sinn, das er gestern noch seinen Stubenkameraden vorgetragen hat und das ihm als »ossianische Schwärmerei« eines Lebensmüden ausgelegt worden ist:
Ich steh allein auf dem Berge,
Allein mit all meinem Weh,
Und schaue hinab in die Weiten,
Hinein in den ruhigen See.
Der See ist so blau wie der Himmel
Da wird mir so eigen zumut,
Als sollt’ ich hinein in die Fluten,
Als wäre dann alles gut.2
Hermann schüttelt den Kopf, die Kerle wissen eben nicht, dass der Dichter seine Gedichte nicht wörtlich verstanden wissen möchte, nicht als Aufschrei oder Bekenntnis, sondern dass er einen menschlichen Seelenton treffen will, dessen Schmerzlichkeit im Versmaß zur Ruhe kommt.
Hermann lässt das in der Mittagssonne silbern aufblinkende Wasser hinter sich zurück und wandert hinauf zur Hügelkette im Norden Maulbronns, die vom Scheuelberg beherrscht wird. Dort ist er öfter schon mit Freunden gewesen, an milden Herbsttagen, um den freien Blick über den Kraichgau zu genießen, die Weinberge und bewaldeten Kämme von Stromberg und Heuchelberg, wo das Königreich Württemberg und das Herzogtum Baden zusammenstoßen. Dort oben lasen sie, heimliche Mitglieder im Club der toten Dichter, die himmelstürmenden Oden Klopstocks und Hölderlins, deklamierten Schiller, Shakespeare und Goethe mit verteilten Rollen. Hesse trumpfte auf mit eigenen Versen, die, an Heines zärtlichem Spott geschult, ihre Wirkung nicht verfehlten. Er fühlt sich in dem kleinen Kreis der Literaturbegeisterten als der eigentlich Berufene, er allein strebt wie hundert Jahre vor ihm Hölderlin »nach Klopstockgröße« und dem »sonnenbenachbarten Flug der Großen«.
Bereits in Calw und Göppingen hatten die Deutschlehrer einräumen müssen, dass sie an die Aufsätze dieses so anschaulich formulierenden Schülers selbst nicht heranreichen konnten, dass der immer ein wenig aufsässige Hermann Hesse etwas Genialisches hatte. Auch als Seminarist setzt er diese Tradition des besten Aufsatzschreibers fort, und beim Landexamen hatte er die Kühnheit, seine Arbeit in Hexametern abzufassen. Dass ihm dies von seinen Maulbronner Kameraden nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Neid, bisweilen sogar Häme und Spott einträgt, ist nur natürlich. Im Streit braust Hermann oft auf, ist jähzornig bis zur körperlichen Aggression, um von einem Moment zum anderen einzulenken oder einfach wortlos wegzugehen. Dann ist sein Blick voller Verachtung, die jedoch plötzlich wieder in Selbstmitleid umschlagen kann. Der Dichterhochmut ist gepaart mit Verletzlichkeit und tiefer, leicht ins Depressive kippender Unsicherheit.
Auch jetzt führt er ein Bändchen Schiller mit sich, dazu ein französisches Übungsbuch, da um 14 Uhr eigentlich die ungeliebte Sprachstunde beginnen soll, die er nun versäumen wird. In der Eile hat er ein einziges Brötchen in die dünne Leinenjacke gesteckt, aber als er bei strahlendem Sonnenschein über den Klosterberg und das freie Feld des Salzackers den Köbler erreicht, verspürt er keinen Hunger, dafür ist sein Gaumen wie ausgedörrt; jetzt vermisst er den Schoppen Bier, den die Seminaristen drei Mal die Woche trinken dürfen. Beim Eintritt in den Buchenwald erfasst ihn ein kalter Schauer, er bedauert, ohne Mantel und Handschuhe losgezogen zu sein. Die Schuhe sind längst durchnässt, die Hände klamm. In Wildschweinkuhlen leuchten vereiste Schneereste, herabgestürzte Äste und von Blitzeinschlägen ausgeglühte Baumruinen verstellen ihm den Weg.
Da fällt ihm ein, dass er diese winterlich-düstere Szenerie ja längst vorweggenommen hat in einem Gedicht, das ihm jetzt zu beweisen scheint, wie sehr es seine Berufung ist, Dichter zu sein und damit über die Gabe zu verfügen, der harten Realität auf den Flügeln der Poesie zu entkommen:
Ich bin in den Wald gegangen
Und habe lange geweint,
das Herz voll Weh und Verlangen,
Und einsam und ohne Freund.
Die Blätter haben gewimmert,
Der Sturmwind hat laut getost,
Ein einsamer Stern hat geschimmert –
Und das war mein ganzer Trost.3
Über die Straße nach Freudenstein gelangt Hesse wieder aufs freie Feld, an eine ausgedehnte, sanft ansteigende Lichtung, die auf den quer gelagerten Schulberg zuführt. Im Südwesten wird sie vom Höhenzug des Köbler zum Kloster hin abgeschlossen. Nun atmet er freiere Luft und marschiert wieder auf offenem Feld und in der hellen Sonne hoch zum Kamm des Scheuelbergs, rasch an einem einsamen Gehöft vorbei, um an der froschgrünen Mütze nicht als entlaufener Seminarist erkannt zu werden. Dann senkt sich der Waldweg wieder hinab ins Tal, Diefenbach lässt er rechts liegen und stolpert in der Dämmerung durch eine feuchte Tannenschonung, aus der gespenstisch das hohle Klopfen eines Spechts ertönt. Aus einem nahen Gehöft dringt bedrohliches Hundegebell – nur weiter, weiter.
Natürlich weiß er, dass diese Flucht irgendwann enden, dass auch ein Taugenichts irgendwo ankommen muss, wenn sein romantischer Ausbruch einen höheren Sinn haben soll. Doch der Sinn steckt nicht im Ziel, sondern im Aufbruch, nicht im Durchbrechen der Ordnung, sondern im Erzwingen des Eigenen. Das Eigene liegt für Hermann Hesse begraben unter all dem Wissen, das er im Seminar anhäufen muss, auch wenn er anfänglich von der Ernsthaftigkeit der Lehrenden begeistert war, die den Klosterzöglingen 41 Wochenstunden Unterricht auferlegen. Zusätzlich zu den schulischen Übungen in Metrik und Versgeschichte hat Hermann sich selbst ein Extrapensum auferlegt und das Handbuch der deutschen Prosa studiert, um sein Stilgefühl zu entwickeln. Doch Freunden gegenüber klagt er, im Griechischunterricht lese man Homer, als sei die Odyssee ein Kochbuch: »Zwei Verse in der Stunde, und dann wird Wort für Wort wiedergekäut, ekelhaft!« Wenn einer griechisch zu leben, wie die Griechen zu dichten versuche, werde er rausgeschmissen. Einen Aufsatz erhielt er zurück mit der kritischen Bemerkung: »Sie besitzen Phantasie!!«4 Das kannte Hermann ja schon aus Calw: Die Dichter werden von den Philistern hoch verehrt, ihre Werke gelesen und in den Bibliotheken aufgestellt, aber die eigenen Söhne dürfen auf gar keinen Fall den künstlerischen Weg einschlagen, sie sollen glaubensstarke Pfarrer, erfolgreiche Geschäftsleute oder tüchtige Beamte werden. Dichter, so die bürgerliche Vorstellung, kann man nicht werden, Dichter i s t man. Eine Ausbildung zum Dichter gibt es nicht, leider, das weiß er jetzt, auch nicht in einer so den Musen geweihten Bildungsanstalt wie dem Maulbronner Seminar, wo man sich unablässig mit Cicero, Homer, Livius, Ovid und Xenophon beschäftigt. Hermann kennt die Folgen solch einer Künstler-Anmaßung aus der eigenen Familie, denn sein Bruder Theodor wollte Opernsänger werden und brach dafür seine Apothekerlehre ab – am Ende kehrte er als gescheiterter Künstler reumütig zur Pharmazie zurück.
Er, Hermann Hesse, wird nirgendwohin reumütig zurückkehren! Seine Freiheitsliebe ist nicht nur durch die Lektüre von Schillers Dramen befeuert, die er geradezu schwärmerisch verehrt und deshalb immer wieder liest, sondern sie steckt tief in ihm, sie ist der innerste Kern seines Wesens. Die Rücksichtslosigkeit und Sturheit, mit der er seinen Eigen-Sinn durchsetzt, ist für alle, die mit ihm zu tun haben, eine ständige Herausforderung. Hermann weiß das, spürt aber, dass er gar nicht anders kann, auch wenn er, besonders gegenüber seinen Eltern, ein schlechtes Gewissen dabei empfindet und es immer auch den anderen recht machen will. Liebe und Freundschaft sind die einzigen Gefühle, die seinen unbändigen Durchsetzungswillen beschränken.
Als Hermann den stillen Weinort Sternenfels passiert, über dessen Rebhängen ein steinerner Wehrturm in den verblassenden Himmel ragt, kehren seine Gedanken zu den Kameraden der Stube »Hellas« zurück, mit denen er bis vor wenigen Stunden eine kleine, verschworene Gemeinschaft gebildet hat. Er hat den Raum mit dem schönen Blick auf Kreuzgang und Brunnenhaus lieb gewonnen; dort steht sein Arbeitspult, in dessen Holz frühere Schüler ihre Namen eingeritzt haben. Auf dem Pult in wildem Durcheinander Wörterbücher, Arbeitshefte, Zeichnungen, Zirkel, Tintenfässer und Stahlfedern. Im Schreibtischkasten hat er seine kleine Privatbibliothek mit Werken von Schiller, Eichendorff, Klopstock, Freiligrath, Mörike, Körner, Lenau, Uhland und den Werther verwahrt, dazwischen aber auch Gläser mit Marmelade und Honig und einen Ring geräucherter Wurst. Der ihm angenehmste Stubenkamerad ist Wilhelm Lang aus Nürtingen. »Arm in Arm mit Dir, so fordr’ ich mein Jahrhundert in die Schranken!« – den Schwur des Don Carlos hatten sie sich oft zugerufen, erhitzt vom Eilfingerwein, den man spät abends heimlich im Dorment trinkt, um sich in Stimmung zu bringen für die Debatten über Freiheit, Freundschaft und Demokratie. »All voll, keiner leer, Wein her!« skandieren sie die »Maulbronner Fuge« Joseph Victor von Scheffels, der das bekannte Trinklied bei einem Besuch des Klosters verfasst hatte. Einmal schlichen die »Hellenen« über die finstere »Höllentreppe« hinab in den Kreuzgang, um eine Papst-Prozession mit weißen Umhängen, ausgestopften Bäuchen und Papier-Mitra aufzuführen, ein Schabernack, der in einem protestantischen Internat nicht gerade als Sakrileg aufgefasst wird, aber doch als geschmackloser Unfug. Auch hier war Hermann der Rädelsführer, schnitt die schiefsten Grimassen und marschierte mit der Mitra vorneweg. Nur einmal hatte er es zu weit getrieben, als er sich nach einem heftigen Disput über das Phänomen des Geisterwesens von einem Mitschüler hypnotisieren ließ. Sein Zustand – starr im Bett liegend mit weit geöffneten Augen – hatte alle Beteiligten tief erschreckt, sodass man sich den Lehrern offenbarte, die den Spuk verboten.
Im Kreis seiner Kameraden fühlt sich Hermann geborgen, und wenn er den Drang verspürt, allein zu sein, spielt er auf seiner Geige. In der Freizeit malt er mit Hingabe Porträts historischer Persönlichkeiten, karikiert aber auch Mitschüler und Lehrer. Bisweilen zieht er sich in die Klosterbibliothek zurück, in der die Regale mit den schweinsledernen Bänden bis hinauf zum gotischen Gewölbe reichen. Die Aura des stillen Ortes erinnert ihn an des Großvaters Bibliothek. Als Kind durfte er dort spielen, und wenn er allein war, zog er manchmal eines der schweren Bücher aus dem Regal, um stundenlang die Zeichnungen zu betrachten und sich in den Bildern zu verlieren. Auch in der Maulbronner Klosterbibliothek scheint die Zeit stillzustehen, sogar sein Dichterehrgeiz löst sich in solch glücklichen Augenblicken auf, spielerisch kann er sich seiner Neugier überlassen, von Gedanke zu Gedanke, von Buch zu Buch springen. Wie erlösend muss es sein, als Mönch Teil einer Gemeinschaft zu sein, die den persönlichen Ehrgeiz in einem höheren Ganzen aufgehen lässt!
Nachts jedoch überfällt ihn nicht selten eine merkwürdige Beklommenheit, Zweifel melden sich, ob das Seminar wirklich der richtige Ort für ihn sei, da es ja als Vorschule gilt für das nachfolgende Theologiestudium am Tübinger Stift. Kopfweh und Schwindelanfälle quälen ihn; an solchen Tagen liegt Hermann lange wach und versucht sich in seine Kindheit zurückzuträumen, um die böse Stimmung zu vertreiben. Bilder von den Flussauen seiner Heimatstadt steigen vor seinem inneren Auge auf, er sieht sich beim Angeln am Ufer sitzen oder auf einem Floß die Nagold hinabtreiben. Fast schon im Traum läuft er durch blühende Wiesen, ein Röckchen weht vor ihm her durchs Grün, verschwindet und taucht plötzlich verlockend wieder auf. Hermann wälzt sich im Bett, stöhnt, drückt seinen Körper an die Matratze – das helle Gesicht eines Mädchens erscheint, ihr nackter Körper verstrickt ihn in ein verwirrendes, erregendes, nie gekanntes Spiel, dann verfließen ihre Gesichtszüge wieder, verwandeln sich in das Antlitz der Madonna, die ihm aus einer der Seitenkapellen des Klosters entgegenlächelt. Schließlich reißen ihn seine Dichterphantasien fort, leise spricht er Verse vor sich hin, bis sich aus dem Dämmer des Schlafsaals etwas Leuchtendes nähert: ein mit zarten Vignetten geschmücktes Bändchen, auf dem er seinen Namen erkennt und darunter den Titel »Romantische Lieder«.
Die Erinnerung an diese Vision lässt Hermann die Kälte vergessen, die langsam unter seine dünne Jacke kriecht. Er wandert bis in den späten Abend hinein, um in Bewegung zu bleiben, im Zickzack wie ein flüchtender Hase am Fuß des Strombergs entlang und im Schutz der Wälder, jede Begegnung mit Menschen meidend, bis er die Gemarkung von Kürnbach erreicht. Hier, in dem hessisch-badischen Ort, der ein kleines Schloss, ein stattliches Rathaus und mehrere Wirtshäuser besitzt, will er Rast machen, denn nun liegt Maulbronn bereits zwanzig Kilometer hinter ihm. Hermann verspürt großen Appetit auf Schweinebraten und Kartoffeln und würde sich auch gern einen Krug badischen Weins gönnen. Aber er hat nur ein paar Münzen dabei, die gerade für eine Metzelsuppe und einen Schoppen Bier reichen, die ihm die Wirtin mit misstrauischem Blick serviert. Übernachten könne er hier nicht, meint die unfreundliche Alte. So beschließt er, dieses Dorf rasch wieder zu verlassen.
An einem Bachlauf zwischen Kürnbach und Derdingen entdeckt er einen Strohhaufen, in den er hineinkriecht, um sich vor der feuchten Kälte zu schützen. Das knisternde Stroh, das Murmeln des Baches und der wie ein Schirm über ihm aufgespannte, in winterlicher Klarheit funkelnde Himmel lassen ihm seine Lage jetzt gar nicht mehr so unangenehm erscheinen, auch wenn er lieber im Wirtshaus säße bei einem Glas Wein und mit einem Buch in der Hand. Vor allem vermisst er seine Geige, seine treueste Gefährtin und Seelentrösterin, die ihn niemals im Stich lässt. Der schönste Ort für sein einsames Spiel ist der Rasen vor der klösterlichen Brunnenkapelle, da mischen sich die Geigentöne mit dem Plätschern des Wassers und dem Summen der Insekten, die aus den Hecken aufsteigen. Das Kloster, das ihm zuerst düster und abweisend erschienen war, entfaltete, je länger er dort war und je mehr er sich mit seinen Räumen und Winkeln vertraut machte, seinen ganzen Zauber. Nur dort, nicht in den enervierenden Bibelstunden spürt er, was eigentlich Religion bedeutet, dieses aus Ehrfurcht und Staunen gemischte Gefühl einer Bindung, die von etwas Umfassendem, die eigene Existenz Einschließendem hervorgerufen wird, auch wenn dieses Größere sich ihm immer wieder entzieht, wenn er sich eine genauere Vorstellung davon zu machen versucht. Im schulmäßigen Christentum findet er keinen Zugang zu dem, was ihn umtreibt, Bibelkritik empfindet er wie ein ätzendes Bleichmittel, das die Farbe aus den Bildern wäscht, die er sich von Jesus von Nazareth und seiner Welt gemacht hat. Ähnlich ergeht es ihm mit dem, was er die »Pietisterei« nennt, die ungeheure moralische Verschärfung des Religiösen, die den Menschen klein macht und ihn unter die »Pflichten« presst, die ein Christenmensch täglich zu erfüllen hat. Das hatte er zwar in seinem Calwer Elternhaus als nicht so niederdrückend empfunden, weil im Missionsverlag des Vaters ein weltbürgerlicher Geist herrscht, der die christliche Vorstellungswelt mit den Kulturen der missionierten Völker in China, Japan und Indien konfrontiert und den praktizierten Glauben damit beweglicher, geschmeidiger und am Ende auch maßvoller und toleranter macht. Doch die Rigorosität, mit der sein Vater das »Gute« in ihn, Hermann, hineinzuzüchten und das »Böse« zu eliminieren sucht, ruft in ihm das Gefühl hervor, nur ein halber Mensch sein zu dürfen, den seine doch auch von Gott gegebenen Triebe unrein machen, obwohl er ihnen viel, ja alles verdankt, die Lust an der Kunst nämlich, die das Helle und Dunkle, das Schöne und das Hässliche nach ihren ganz eigenen Gesetzen in sich vereint.
Als Kind hatte er seine Mutter einmal treuherzig und über sich selbst ein wenig erschrocken gefragt: »Gelt, ich singe so schön wie die Sirenen und bin auch so böse wie sie?«5 Wer ein Dichter sein wollte, der kann sich mit der amputierten bürgerlichen Welt nicht anfreunden, in der regelmäßig die Pflicht über die Neigung, die Moral über das Kunstwerk gestellt wird. Und ist nicht das Kloster selbst, mit seinem großartig-schlichten Kirchenschiff, dem kunstvoll geschnitzten Chorgestühl und dem aus einem einzigen Sandsteinblock gehauenen Kruzifix der beste Beweis dafür, dass am Ende die Kunst über die Askese siegt, wie sie sich die Erbauer der Anlage, die Zisterzienser, auferlegt hatten? Man musste nur durch die Gewölbe streifen, um zu sehen, welcher Reichtum an Blättern, Trauben, Rosen und Tierköpfen aus dem Stein der Kapitelle, Konsolen und der Schlusssteine wächst. Der Ort, der den größten Eindruck auf ihn machte, war das Chorgestühl. An den Reliefs, die an den Außenwangen des Holzgehäuses angebracht sind, kann er nur mit Ehrfurcht vorübergehen. Sie zeigen Szenen aus dem Alten Testament, wie Moses vor dem brennenden Dornbusch, den Wettstreit Kains und Abels, die Opferung Isaaks und den Kampf Samsons mit dem Löwen. Eine Welt, in der das eherne Gesetz Jahwes gilt und noch nicht die Menschenliebe Christi, auch wenn zwischen die alttestamentarischen Bilder christliche Motive wie das der Jungfrau mit dem Einhorn oder ein Porträt der Muttergottes eingeschoben sind, die den Blick auf das Neue, die Erlösungsbotschaft Jesu lenken. So fern ihm diese mythischen Bilder auch sind, so nahe geht ihm der Gedanke, dass die Gewalt- und Opferwelt der biblischen Stammväter und Propheten auch in ihn hineinreicht, ein Kain ebenso in ihm schlummert wie ein Abel, und dass im väterlichen Haus in Calw ebenfalls ein wenig von dieser Patriarchenluft weht, wie sie in diesen Darstellungen zum Ausdruck kommt.
Etwas abseits, an der Südwand des Chors, thront ein prächtiger Abtstuhl mit kunstvoll geschnitztem Baldachin. Als er die Klosteranlage zum ersten Mal erkundete, erregte das Relief an seiner Brüstung seine Aufmerksamkeit. Aus dem wie Flammen züngelnden Blättergewirr eines einzigen Rebstocks baut sich ein Paradiesgarten auf, eine Wildnis von Bäumen und Gekräute, mit Leibern und Köpfen von Tieren und allerlei Fabelwesen. Hinter dem Stamm des Weinstocks aber lauert ein Armbrustschütze, Sinnbild des Schmerzes, der jeden Augenblick in diese Idylle einbrechen kann. Dann bemerkte Hermann ein vogelartiges Wesen, das mit ausgebreiteten Schwingen über den Garten streicht, als sei dieses aus Lust und Schmerz zusammengefügte Reich eben erst aus seinem gewaltigen Ei geschlüpft. Ist dieser mysteriöse Vogel der eigentliche Schöpfer der Welt – und nicht der Allmächtige, den jeder Stein dieses Kirchenbaus zu verherrlichen sucht? Und was bedeutet die in die Rückenlehne des Abtstuhls geschnitzte Inschrift: »Vere Deus absconditus«? Hatte der Künstler erkannt, dass der wahre Gott im Verborgenen bleibt und es wenig hilft, sich ein Bild von ihm zu machen? Wie passt das aber zusammen mit dem herrlichen Kruzifix, das im vorderen Teil des Kirchenschiffs aufragt, wo einst die Laienmönche ihre Gebete verrichteten? Dort ist der Gekreuzigte im Augenblick des größten Leidens dargestellt: Der magere Brustkorb wölbt sich unter den Konvulsionen des Schmerzes mächtig auf, das Haupt ist zur Seite geneigt, der Mund halb geöffnet: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Man erzählt sich im Seminar, dass in den Tagen der Sommersonnenwende ein dünner Lichtstrahl aus einem der oberen Kirchenfenster auf das Haupt des Heilands fällt und dabei die Dornenkrone in hellem Glanz aufstrahlen lässt. Ist dieses Licht die Brücke, die zurück ins göttliche Geheimnis führt, wo Schmerz und Leiden aufgehoben sind?
Auch jetzt, beim Blick von seinem Strohlager hinauf in den von Sternen übersäten Himmel wird Hermann von der Macht der kosmischen Tiefe überwältigt, der Schwindel der Unendlichkeit greift ihm ans Herz, ein eisiges Todesgefühl, das nicht allein von der frühmorgendlichen Kälte herrührt, die vom Boden aufsteigt. Halb im Schlaf hört er hallende Schritte, sieht im Frühnebel eine Gestalt in einiger Entfernung auf der Straße vorbeigehen und im Dunkeln entschwinden – doch dann bricht die Sonne durch den Nebel und neuer Lebensmut durchströmt ihn. Hermann streckt seine klammen Glieder und klopft sich das Stroh aus den Kleidern. Jetzt muss er wieder in die Welt hinein, auch wenn er ratlos ist, wohin.
Er hat keine Ahnung davon, dass seine Kameraden am Vortag ausgeschwärmt sind, um den Ausreißer aufzuspüren. Bis tief in die Nacht hinein haben sie die Wälder um Maulbronn nach allen Himmelsrichtungen abgesucht, unablässig »Hesse!« rufend. Schon am Nachmittag des 7. März 1892, »um 4 Uhr 40«, hatte Professor Paulus ein Telegramm an Johannes Hesse, Hermanns Vater, aufgegeben: »Hermann fehlt seit 2 Uhr. Bitte um etwaige Auskunft.«6 »Missionar Hesse« antwortet noch am Abend, er wisse nichts: »Bitte Beruhigung telegraphieren.«7 In Calw verbringt Hermanns Mutter Marie eine schreckliche Nacht am Bett ihrer fiebernden Tochter Marulla. Zur Angst um das Kind kommt jetzt die Sorge um den Sohn, der irgendwo in der kalten Nacht unterwegs ist. Marie Hesse steigert sich in ihrer Verzweiflung in die Vorstellung, Hermann könnte in einem der Seen um Maulbronn ertrunken sein, was für die Pietistin offenbar leichter zu ertragen ist als der Gedanke, ihr Sohn habe der Familie durch seine Flucht Schande gemacht. Am Morgen des 8. März bittet Marie Hesse ihren Bruder Friedrich, nach Maulbronn zu reisen, um eigene Nachforschungen anzustellen, doch schon um 12 Uhr 15 trifft ein Telegramm mit der Nachricht ein, Hermann sei »wohlbehalten zurück«8.
Erschöpft und fast erfroren hat Hermann sich auf den Rückweg gemacht. Über Freudenstein und Diefenbach kommt er ins nördlich von Maulbronn gelegene Dörfchen Zaisersweiher; dort trifft er auf einen Gendarmen, den er fragt, wohin es denn nach Maulbronn geht? Als der Mann ihm den Weg nach Süden weist, dreht Hermann sich trotzig auf dem Absatz um und marschiert in die entgegengesetzte Richtung. Doch der erfahrene Polizist hat gleich bemerkt, dass es sich bei diesem seltsamen Wandersmann um den entlaufenen Seminaristen handeln muss, über dessen Verschwinden die Gendarmerien der Umgebung schon seit dem Vorabend informiert sind. Höflich, aber bestimmt bietet ihm der Beamte an, ihn nach dem gesuchten Ort zu begleiten, und Hermann willigt ein. Als die beiden das Klostertor erreichen, kommt ihnen bereits Repetent Mettler entgegen, um den Ausreißer in Empfang zu nehmen. Inzwischen ist auch Hermanns Onkel Friedrich im Seminar eingetroffen und findet einen vor Kälte zitternden, schweigsamen Neffen vor. Hermann weiß, dass er in den kommenden Tagen durch die Mühle gedreht werden wird, es warten Verhöre, Zurechtweisungen, Strafen, vielleicht sogar die Relegation von der Schule auf ihn. Aber er wird nichts widerrufen, denn es gibt nichts zu bereuen. Was er getan hat, musste er tun, und er würde es gegebenenfalls wieder tun, wenn ihm danach ist.
Schon am 9. März trifft ein langer Brief seines Vaters ein. Er hat den eigentlichen Grund für das Abenteuer seines Sohnes sofort begriffen: »Du hast so viel privatim gelesen, seit Du in Maulbronn bist, soviel mit deutscher Literatur und auch mit eigenem Dichten Dich beschäftigt, daß wir nicht glauben können, es sei Dir genug Zeit und innere Kraft geblieben für die eigentliche Arbeit.«9 Für Johannes Hesse ist das Schreiben von Poesie eine Form der Selbstherrlichkeit, die Hermann von seiner eigentlichen Bestimmung, dem Pfarrberuf, ablenkt. Er legt ihm nahe, vor allem die zehn Gebote an sich zu prüfen und dabei besonders das erste zu beachten, das den »Götzendienst« um das eigene Ich verbiete. Er trifft damit ins Herz seines Sohnes, der eben begonnen hat, dem Eigenen, seinem Selbst auf die Spur zu kommen. Hermann müsse sich prüfen, so der Vater weiter, ob er sich selbst tatsächlich für das Wichtigste halte, denn das gehe auf Kosten seiner Mitmenschen. Noch deutlicher ist sein Verweis auf das Gebot, Vater und Mutter zu ehren, denn hier drohe der Verlust des Heils. Der Brief endet mit dem biblisch anmutenden Satz: »Ich sage Dir: Beim Heiland hat mans gut. Probier es mit Ihm.«10
Die freundliche Diktion kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier die Autorität mit der Macht des Gesetzes droht. Doch Hermann lenkt erst einmal ein und dankt seinem Vater dafür, dass man ihm trotz seines Vergehens Verständnis entgegenbringt. »Bitte liebt mich noch wie vorher«11, schreibt er in seinem kleinlauten Antwortbriefchen. Er spürt, dass dieser Konflikt noch nicht ausgestanden ist. Nur zwei Tage später erhält Hermann einen weiteren Brief, in dem Johannes Hesse ihm seine Lesart elterlicher Liebe mitteilt: »Liebe ist Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Übereinstimmung. Uns verlangt danach, mit Dir eins zu werden.« Dieses Einswerden sei aber an Bedingungen geknüpft, die Hermann erfüllen müsse, um dieser Liebe teilhaftig zu werden: »Unser höchster Lebenszweck ist, Gott zu gefallen und Ihm in Seinem Reich zu dienen. Wenn das auch Dein Lebenszweck geworden ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander, dann ist alles Licht, Liebe und Freiheit.«12 Nur durch »Selbstüberwindung« könne Hermann »ein gehorsamer Sohn sein«.
Verfehlt diese pietistisch verengte Auffassung nicht das Wesen wahrer Liebe, die den anderen auch in seiner Andersartigkeit annimmt und gerade in diesem Hinnehmen des Gegensätzlichen ihre Selbstlosigkeit beweist? Hermann täuscht sich nicht über die Kompromisslosigkeit dieser Haltung, die nur die engen Grenzen christlicher Tugend gelten lässt und in der kein Platz ist für die Freiheit der Anschauung und der Kunst; aber noch ist er zu schwach und erschöpft, um sich dagegen aufzulehnen. Dafür lobt er dem Vater gegenüber die verständnisvolle Art, mit der die Schulleitung auf den Fluchtversuch reagiert hat: Trotz der Schwere des Verstoßes ist ihm die eher milde Strafe von acht Stunden Karzer bei Wasser und Brot auferlegt worden. Man habe ihm auch die verhassten Geigenstunden bei Musiklehrer Haasis erlassen, berichtet er mit einem Anflug von Schadenfreude, denn kurz zuvor hatte Johannes Hesse seinen Sohn noch brieflich ermahnt, auch Unangenehmes zu ertragen, weil es »Gott will«13. Hermann darf in seiner beheizten Zelle Homer lesen und schreibt in einem erstaunlich gefassten, fast kühlen Brief am 12. März an seine Eltern: »Professor Paulus und auch die beiden Herrn Repetenten behandeln mich sehr schonend und rücksichtsvoll.« In einem Gedicht, das er im Karzer zu Papier bringt, klingt das allerdings viel melodramatischer:
Kennst Du das Land, wo keine Blumen blühen,
Den finstern Kerker, den kein Gott besucht?
O wehe dem, der dahin musste ziehen,
O Hundeloch, sei tausendmal verflucht!14
Die Parodie auf Goethes Mignon-Lied ist natürlich mit Blick auf die Kameraden geschrieben, die sehen sollen, über welch literarischen Witz er noch immer verfügt.
Die Tage in Maulbronn sind für Hermann gezählt. Trotz ihres Wohlwollens sind die Lehrer zu der Überzeugung gelangt, dass dem Seminaristen Hesse die »Fähigkeit fehlt, sich selbst in Zucht zu halten und seinen Geist und sein Gemüt in die Schranken einzufügen, welche für sein Alter und für eine erfolgreiche Erziehung in einem Seminar notwendig sind«. Mit seinen »überspannten Gedanken« und »übertriebenen Gefühlen« könne er leicht zur Gefahr für seine Kameraden werden, heißt es im Protokoll des Lehrerkonvents.15 Wenige Tage später erschreckt Hermann seine Eltern mit einem Bericht, der tiefe Depression, ja Lebensmüdigkeit ausdrückt. Auslöser ist der Rückzug seines Freundes Wilhelm Lang, dem seine Eltern den Kontakt zu ihm verbieten. Er habe den Menschen verloren, schreibt Hermann nach Hause, den er mehr liebe als alle. Er wisse nun nicht, wofür es sich noch zu leben lohne.
Dass der Verlust des besten Freundes das endgültige Ende seiner Maulbronner Schulzeit ankündigt, wird Hermann erst Wochen später begreifen, als ein neuerlicher Vorfall die Schulleitung alarmiert. Inzwischen ist er von einem vierwöchigen Zwangsurlaub ins Seminar zurückgekehrt. Auch in Calw fühlte er sich elend; bei der Explosion eines selbst gebastelten Feuerwerkskörpers hat er sich an den Augen verletzt und kehrt am 23. April wenig motiviert nach Maulbronn zurück. Wieder machen ihm rasende Kopfschmerzen zu schaffen, und in Briefen redet er seine Eltern überraschend mit »Sie« an. Fast täglich gerät er jetzt mit seinen Kameraden aneinander. Seit seinem »Geniereisle«, wie Großvater Gundert die Eskapade seines Enkels ironisch nennt, fühlt er sich seinen Mitschülern haushoch überlegen. Auch wenn er ins Kloster zurückgekehrt ist, so hat er in diesen 23 Stunden Abwesenheit doch auch eine Art Initiation erfahren, einen Sprung gewagt, seinen Willen erprobt und tief in den Abgrund der Einsamkeit geschaut, die ihn keineswegs erschreckt. So kommt ihm der Biedersinn seiner angepassten, verbissen um die schulische Rangordnung kämpfenden Kameraden immer lächerlicher vor. Schnell werden aus harmlosen Unterhaltungen aggressive Streitgespräche, die bedrohlich eskalieren. Hermann stellt alles infrage, was zur religiösen Welt des evangelischen Seminars gehört: Es gebe keinen Himmel und keine Hölle, das Jenseits sei ein Ort glücklicher Geister, eine Art Elysium, wo die Seelen der Verstorbenen ohne Zwang miteinander verkehrten. Zwar glaube er an das Göttliche, aber es gebe kein echtes Verhältnis zwischen Gott und den Menschen. Beten, die Zwiesprache mit Gott, sei sinnlos. Hermann stellt den Selbstmord als legitimes Freiheitsrecht dar und will nicht einsehen, dass ein Geschöpf Gottes damit eine schwere Sünde begeht. Seinem Tisch- und Bettnachbarn, dem Stuttgarter Professorensohn Otto Hartmann, droht er sogar mit Mord, denn nur solch eine radikale Tat könne ihn von seiner lähmenden Schwermut befreien, trumpft er in pubertärem, provozierendem Überschwang auf. Eine ganze Reihe von Vätern äußert dem Ephorus, dem Maulbronner Seminarleiter, und der Familie Hesse gegenüber die Sorge, Hermanns Geisteszustand könne auch ihren Söhnen Schaden zufügen. Tatsächlich fürchten sie, der aufsässige Mitschüler könnte über kurz oder lang auch ihre Sprösslinge mit seinem Freiheitsfuror infizieren.
Kurzentschlossen fährt Marie Hesse am 7. Mai nach Maulbronn, um ihren Sohn abzuholen und zur Behandlung zu dem befreundeten Pfarrer Blumhardt in den Kurort Bad Boll zu bringen. Christoph Blumhardt, Sohn des bekannten schwäbischen Heilers und Teufelsaustreibers Johann Christoph Blumhardt, kuriert seelische Störungen durch Gebete und strenge Exerzitien. In ihrem Tagebuch notiert Marie Hesse, nicht nur Hermanns Mitschüler hielten ihn inzwischen für geisteskrank, auch der Hausarzt Doktor Zahn habe eine Einweisung in die Irrenanstalt empfohlen. Aus Hermann Hesses Geniereise ist ein Absturz in den Wahnsinn geworden, der Dichtertraum scheint ausgeträumt.
ZWEITES KAPITEL
In der Privatheilanstalt von Pfarrer Blumhardt. Großvater Gundert. Verschmähte Liebe. Hermann kauft sich einen Revolver. »In das Gefängnis wollt Ihr mich sperren?« Verlegung in das Irrenhaus von Stetten. Briefe an den Vater: »Ich gehorche nicht und werde nicht gehorchen.« Nach Basel zu Pfarrer Pfisterer. »Gänzlich verkommen an Leib und Seele«: Im Cannstatter Gymnasium. Buchhandelslehrling in Eßlingen. Erneute Flucht
Marie Hesse bleibt drei Tage in Bad Boll, um ihrem Sohn den Übergang in die ungewohnte Umgebung zu erleichtern. Und tatsächlich fühlt sich Hermann in dem früheren Schwefelbad in der Nähe von Göppingen, wo er sich vor zwei Jahren auf das Landexamen vorbereitet hatte, rasch heimisch. Er bekommt ein eigenes Zimmer und kann dort in einem Lehnstuhl stundenlang lesen. Über seine Lektüre berichtet er brav nach Hause. Zwar wird Hermann ständig zum Gebet angehalten, darf aber auch Billard spielen, kegeln, musizieren, Spaziergänge machen und sogar nach Göppingen wandern, um frühere Freunde zu besuchen.
Auch Pfarrer Blumhardt gefällt ihm. Christoph Blumhardt profitiert nicht nur vom Ruhm seines Vaters, der durch Handauflegung zu heilen verstand und an einem jungen Mädchen sogar erfolgreich eine Teufelsaustreibung vorgenommen hatte. Als bekennender Sozialist und als Kopf einer pietistischen Bußbewegung ist er ebenfalls weit über Württemberg hinaus bekannt. Sein Heim bezeichnet er als »Vorposten des Reiches Gottes«. Christoph Blumhardt gilt als feuriger Prediger, der seinen Schäfchen von der Kanzel herab gern die Leviten liest. Doch gegenüber Hermann setzt er zunächst auf Einfühlung und Verständnis. Die Eltern sollten, schreibt er am 5. Mai 1892 aus Bad Boll, ihren Sohn selbst entscheiden lassen, ob er in das christliche Erholungs- und Kurhaus kommen wolle: »Vielleicht erkennt er selbst an, daß etwas Krankhaftes ihn umtreibt, daß er gerne etwas für seine Gesundheit tut.«16
Die volkstümliche Ausdrucksweise von Pfarrer Blumhardt imponiert Hermann, wie er seinen Eltern schreibt: »Neulich sagte er: Es ist ein Unsinn, eine Lüge zu sagen, das Christentum ist gut, schön, edel etc. Nix ischs, der ganze Lumpenpack hat von einem Christus aber auch von Moral keinen Geschmack.«17 Trotz seiner Abwehrhaltung ist Hermann bereit, das Neue, auch die neue Autorität des Heimleiters, erst einmal anzuerkennen, sich ein- und unterzuordnen. Denn er sehnt sich nach Zugehörigkeit, Anteilnahme, Liebe. Hermann ist hilfsbereit und hört geduldig zu, wenn man ihn belehrt. Er gibt sich gesellig und singt im Chor mit. Aber er hält diese Rolle nicht lange durch, immer wieder drängt es ihn, die aufkommende Nähe, die wachsende Gemeinsamkeit zu zerstören. Marie Hesse ahnt, dass dieser Frieden in Bad Boll nicht lange vorhalten wird. »Ich bin wie vernichtet«, schreibt sie nach ihrer Rückkehr ins Tagebuch, »wund an Gemüt und Nerven, Tag und Nacht muss ich denken: Was treibt H. jetzt?«18
Nach kurzer Zeit schon regt sich Hermanns Widerspruchsgeist. Er fühlt sich durch die Selbstsicherheit Christoph Blumhardts herausgefordert. Was die Familie Hesse mit Pfarrer Blumhardt verbindet, ist der Pietismus, sind die gemeinsamen Erfahrungen im Baseler Missionshaus. So ist Hermanns Kampf mit dem schwäbischen Heiler auch ein Aufstand gegen das religiöse Milieu des Elternhauses. Beide Eltern entstammen protestantischen Missionsfamilien, die Mutter Marie ist sogar in Indien geboren, wo ihr Vater Hermann Gundert christliche Aufbauarbeit leistete, bis er 1859 schwer erkrankte und in seine schwäbische Heimat zurückkehren musste. 1862 übernahm er in Calw die Leitung des dortigen Missionsverlages.
Hermann Hesses Vater Johannes wurde 1847 in Weißenstein in Estland geboren, wohin die Vorfahren der Familie, Lübecker Kaufleute, ausgewandert waren. Als er vier Jahre alt war, starb seine Mutter, mit sieben verlor er seine Stiefmutter. Er litt unter Ängsten und neigte zu Schwermut und Jähzorn. Deshalb gaben seine überforderten Eltern ihn mit elf Jahren außer Haus. Nach einer Ausbildung im Basler Missionshaus wurde er 1869 nach Indien geschickt; von dort kehrte er vier Jahre später mit einem unheilbaren Kopf- und Darmleiden zurück. Als der sechsundzwanzigjährige Deutschbalte im November 1873 nach Calw kam, um an der Seite von Hermann Gundert evangelische Missionsliteratur herauszugeben, traf er dort auf Marie, die 31-jährige Tochter des Verlagsleiters. Die mit ihren streng nach hinten gekämmten Haaren und den zusammengepressten Lippen auf den ersten Blick eher abweisend wirkende Witwe hatte zwei Kinder, Karl und Theodor. Ihren verstorbenen Mann, den Missionar Charles Isenberg, hatte sie in Indien kennengelernt. Er war, wie viele Missionare, schon bald einer tropischen Krankheit erlegen. Dem ernsten, blassen, immer etwas kränklich wirkenden Gehilfen ihres Vaters gegenüber empfand Marie Isenberg von Anfang an eher Respekt als Liebe; an einen Bekannten schrieb sie, man müsse den »feinen, frommen, intellektuellen Mann« achten, er mache auf sie den Eindruck, als sei er »für eine bessere Welt geschaffen«19. Sie erkannte sofort das Idealistische, aber auch Weltflüchtige seines Charakters. Marie selbst ist zwar eine »erweckte« Christin, die sich mit Leidenschaft, ja Rigorosität in den Dienst des Glaubens stellt, aber sie hat auch Sinn für das Künstlerische, für Poesie und Musik, kann hinreißend erzählen und ist trotz aller Strenge eine liebevolle und verständnisvolle Mutter.
Wie Julie Dubois, ihre zupackende, praktisch orientierte Mutter, die aus der französischen Schweiz stammt, sieht sie in der Ehe vor allem eine religiöse Verpflichtung, einen Dienst an der christlichen Gemeinschaft. Diese Haltung ist umso erstaunlicher, als Marie das Missionarsleben immer als Entbehrung und Opfer erlebt hatte und von ihren Eltern als Kind in ein Heim nach Basel abgeschoben worden war. Dieses Trauma, das von einer unglücklichen frühen Liebe noch vertieft wurde, verfolgte sie ein Leben lang, ohne sie jedoch an ihren christlichen Überzeugungen irre werden zu lassen. In Briefen an ihren Bruder Hermann und im Tagebuch gesteht sie, dass sie oft am Leben verzweifelt sei. Nur das Gebet und der feste Glaube an die Liebe Christi halte sie aufrecht. Die Konflikte, die Marie Hesse in sich auszutragen hat, der Zwiespalt zwischen dem Wunsch nach Unterordnung, Hingabe und Dienst und dem Drang, die eigene Emotionalität auszuleben und in Worten auszudrücken, kehren bei ihrem Sohn Hermann wieder, der aber, anders als seine sehr viel strenger erzogene und duldsame Mutter, von Anfang an gegen die Vereinnahmungen revoltiert.
Der überaus höfliche, gebildete und schon durch sein makelloses Hochdeutsch in der schwäbischen Kleinstadt auffallende Johannes Hesse wuchs der empfindsamen Marie rasch ans Herz. Als Witwe mit zwei minderjährigen Söhnen hatte sie es in der kleinbürgerlichen Calwer Gesellschaft nicht leicht, sodass die beiden am 22. November 1874 heirateten. Am 15. August 1875 wurde das erste gemeinsame Kind geboren, Adele. Nur zwei Jahre später kam Hermann Hesse zur Welt, ein freudiges Ereignis, das Marie Hesse im Tagebuch enthusiastisch kommentierte: »Am Montag, 2. Juli 1877, nach schwerem Tag, schenkt Gott in seiner Gnade abends halb sieben Uhr das heiß ersehnte Kind, unsern Hermann, ein sehr großes, schweres, schönes Kind, das gleich Hunger hat, die hellen, blauen Augen nach der Helle dreht und den Kopf selbständig dem Licht zuwendet, ein Prachtexemplar von einem gesunden, kräftigen Burschen.«20
Getauft wird das »Hermännle« von Großvater Hermann Gundert, dem unangefochtenen Patriarchen des Hauses. Unter Theologen gilt er wegen seiner überragenden Bildung, seiner Pionierarbeit als pietistischer Missionar in Indien, seiner Vielsprachigkeit und wissenschaftlich fundierten Bibelkenntnis als Ausnahmeerscheinung. Für Hermann Hesse wird der Großvater zum »Zauberer« seiner Kindheit, eine fast ins Mythische entrückte Gestalt, die Güte ausstrahlt und trotz aller Gelehrsamkeit durch Witz und Schlagfertigkeit imponiert. Eigentlich hatte Hermann Gundert Soldat werden wollen, später begeisterte sich der Maulbronner Seminarist für die Pariser Julirevolution und geriet beim Theologiestudium in Tübingen unter den Einfluss des Bibelkritikers und Junghegelianers David Friedrich Strauß. Als es ihm durch Beten gelang, einen Kommilitonen vor dem Selbstmord zu bewahren, verstand er dies als Zeichen seiner Erweckung. 1835 ließ er sich für den Missionsdienst in Ostindien anwerben und lernte dort ohne große Mühe mehrere indische Sprachen, um in den Landessprachen predigen zu können. Im Calwer Verlagshaus gibt er nun indisch-englische Grammatiken, Wörterbücher, Lexika und Bibelübersetzungen heraus.
Die mit Büchern und allerlei exotischen Gegenständen vollgestopfte Gelehrtenstube des Großvaters zog Hermann magisch an, viel mehr als das Büro des Vaters, das nüchterner war und kein Geheimnis hatte. Er schaute hinauf zum tanzenden Gott Shiwa im Glasschrank des Großvaters, und bereits da fühlte er, dass in der kleinen Skulptur eine Lösung seiner Probleme, seiner inneren Kämpfe verborgen sein könnte. Um die steinernen und metallenen Götzen herum lag noch vieles andere, Ketten aus Holzperlen, Rollen mit indischer Schrift, Schildkröten aus Speckstein, kleine Götterbilder aus Holz, Glas und Quarz, gestickte seidene Decken, Messingbecher und Schalen aus Indien und Ceylon, aus China, Siam und Burma – eine Rätselwelt, die nur von Großvater Gundert, dem hünenhaften Alten mit dem weißen Bart, verstanden wurde. Er sprach alle Sprachen, kannte alle Götter und Religionen, konnte fremde Lieder singen und beherrschte mühelos die Gebetsübungen der Buddhisten und Muslime, obwohl er Christ war und an den dreieinigen Gott glaubte.
Wenn fremde Besucher in das Verlagshaus kamen, in den großen, von hallenden Korridoren durchzogenen Fachwerkbau am Rand des Calwer Talkessels, sprachen der Großvater und die Mutter indisch, malayisch, italienisch, französisch, dänisch, holländisch oder englisch. Die Sprache des Vaters war demgegenüber geheimnislos, er sprach mit Hermann deutsch, mit seiner Frau, die ihn »Johnny« nannte, immer wieder auch englisch, mehr nicht. Er litt ständig unter Kopfweh, neigte zur Schwermut und verzweifelte über den enormen Aufgaben, die ihm sein Schwiegervater aufbürdete, dem alles so leicht von der Hand ging, der eine robuste Natur hatte und ein viel heitereres Gemüt. Hermann liebte seinen stillen, leidenden, noblen Vater, der sich nicht nur als Verlagsmann verstand, sondern auch als Wissenschaftler und Autor. Er verdankte ihm die sprachlichen Feinheiten, das Gespür für Satzbau und Satzmelodie. Aber er erkannte auch, dass sich der Vater das Leben selbst schwer machte mit seinem stark entwickelten Sinn für Moral und Gerechtigkeit, seinem unablässigen Streben nach Harmonie. Insgesamt fünfzehn Bücher erschienen unter seinem Namen, darunter selbst verfasste »Missionsgeschichten«, die Erzählungen »Salma, das Santalmädchen«, »Des Trappers Bekehrung«, »Der Gebetsbund« und ein Moraltraktat, das sich unter dem suggestiven Titel »Warum bist du nicht glücklich?« an »die Sklaven der Onanie oder Selbstbefleckung« richtete.
Sexuelle Enthaltsamkeit gehörte ganz selbstverständlich zur christlichen Wertewelt des Vaters, der sich die geheimen Wünsche seines pubertierenden Sohnes nicht einmal vorstellen wollte. Undenkbar, darüber ein aufklärendes Gespräch zu führen! Die Moral der Selbstbeherrschung und der Selbstaufopferung ist eines der Zentralanliegen des Pietismus. Ihm hatte sich Johannes Hesse bereits als Achtzehnjähriger unterworfen. In einem Bewerbungsschreiben an die Basler Missionsgesellschaft aus dem Jahr 1865 klingt schon die Haltung an, die er seinem aus dem Seminar entlaufenen Sohn Hermann knapp dreißig Jahre später vermitteln wird: »Mein Sehnen ging nach einer korporativen Gemeinschaft, in welcher mein Ich verschwinden würde – denn es war mir längst zu stark geworden.«21 Jeder individuelle Impuls sollte umgelenkt und fruchtbar gemacht werden für die christliche Gemeinschaft und ihre Werte.
Ohne das Vorbild seines strenggläubigen Vaters, des baltischen Arztes Carl Hermann Hesse, der in Weißenstein ein christliches Waisenhaus geführt hatte, wäre diese »Erweckung« sicher nicht so früh und so nachdrücklich erfolgt. Wie bei der Mutter Marie machte sich auch im Falle von Johannes Hesse der Einfluss der Familie und des damit verbundenen pietistischen Milieus geltend. Im Baltikum und in Schwaben formierte sich die Erweckungsbewegung am radikalsten, die schwäbischen Seminare und das Tübinger Stift brachten mit Schelling und Hegel, Mörike und Hölderlin, Strauß und Vischer herausragende Köpfe hervor, die von diesem religiösen Milieu nachhaltig geprägt sind. Gerade im ländlich-konservativen Württemberg wurde der Pietismus zur Volksfrömmigkeit, die oft sektiererische Formen annahm. Die schwäbischen Pietisten setzten dem modernen Lebensgefühl mit ihren Brüdergemeinden eine Art neuer Urkirche entgegen. Das irdische Leben habe keinen Zweck in sich selbst, wurde gepredigt, es dürfe nur als Prüfung und Vorstufe zum ewigen Leben verstanden werden. Zu dieser Prüfung gehört die »Seelenarbeit«, eine andauernde, ehrliche Selbstbefragung, um die eigenen Antriebe erst zu durchschauen und sie dann auf Gott auszurichten. Denn in der Selbstprüfung, so das pietistische Credo, prüft mich auch Gott selbst, der alle meine Motive, Gedanken und Absichten kennt. Nicht die Lehre oder das kirchliche Amt, sondern die Ergriffenheit, die persönliche Bekehrung macht den Einzelnen zu einem neuen Menschen in der Nachfolge Christi.
Schon äußerlich ist Christoph Blumhardt in Bad Boll eine ähnlich eindrucksvolle Erscheinung wie Hermann Gundert, mit weißem Backenbart und kräftigen Händen, die heilen, aber auch strafen können. Der redegewaltige Pfarrer versteht sich als Neuerer, als Modernist, der den modernen Wissenschaften gegenüber aufgeschlossen ist. Der Mensch, fordert er, dürfe sich nicht in der überkommenen Ordnung einrichten, Stehen bleiben bedeute die Trennung vom göttlichen Geist, der den Menschen immer neue Wandlungen abverlange. Wer sich der Wahrheit Jesu mit Haut und Haaren verschreibe, finde im Diesseits letztlich keine Befriedigung, keine letzte Befriedigung. Auch der schönste Sozialismus sei unüberbrückbar weit entfernt vom Reich Gottes. Alles nur Menschliche, Selbstbezügliche, so Blumhardt, müsse abgeworfen werden, um Jesus dienen zu können: »Denn erst, wenn der Mensch sich beugt in ganz neuer und vollkommenerer Weise, wird der Sieg kommen, welcher die Barmherzigkeit Gottes für alle Kreatur ermöglicht.«22
Sich beugen, das strenge Pflichtethos zu akzeptieren, das den Geist von Bad Boll bestimmt, ist Hermanns Sache nicht. Die Besuche seines Halbbruders Theodor, der in einer Apotheke in Waiblingen bei Stuttgart arbeitet, bestärken ihn in seinem Widerwillen. Der elf Jahre ältere Theodor ist Atheist und ermuntert seinen Bruder, zu Pfarrer Blumhardt auf Distanz zu gehen. Auch nimmt er ihn mit nach Waiblingen, wo er in Untermiete bei einer Frau Kolb wohnt, in deren hübsche Tochter Eugenie sich Hermann sofort verliebt. Sie ist zwanzig Jahre älter, aber gibt sich so aufgeschlossen, dass Hermann glaubt, sie würde seine Liebe erwidern. Er verbringt lange Abende mit Mutter und Tochter und rezitiert dabei Gedichte, die er für Eugenie geschrieben hat. Wenigstens sie soll den jungen Dichter verstehen, die Reinheit seiner Gefühle:
Wenn du’s verstehst, was ich in Lust und Scherz,
Was ich im Weh als Heiligstes empfunden,
Wenn Du im Lied erkennst mein junges Herz,
So hab’ ich den ersehnten Lohn gefunden.23
Doch seine Liebeserklärung wird sanft, aber unmissverständlich abgewiesen: »Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage: Die erste Liebe ist nie und nimmer die richtige.«24
Nun entschließt sich Hermann zu einer besonders spektakulären Maßnahme und kauft sich einen Revolver. Dass er sich dafür von einem Wirt 25 Mark leiht und seine Eltern brieflich auffordert, das Geld zurückzuzahlen, empört sie sehr. Die Ankündigung des Selbstmords schlägt in der Heilanstalt wie ein Blitz ein. Pfarrer Blumhardt ist außer sich. Dieser junge Mann hat den Teufel im Leib! Nun steht seine Reputation auf dem Spiel. Er schreibt unverzüglich an Marie Hesse und schlägt vor, Hermann, der ganz offenbar sein Vertrauen missbraucht hat, zu einem Kollegen nach Göppingen abzuschieben. Das Erlebte erinnert ihn fatal an die Krankheitsgeschichte der besessenen Gottliebin Dittus aus dem schwäbischen Möttlingen, die sein Vater als junger Pastor durch Gebete geheilt hatte. Die Achtundzwanzigjährige war als Kind mit okkulten Praktiken in Berührung gekommen und hatte Johann Christoph Blumhardt offenbart, sie sei von bösen Geistern befallen. Sie hatte auch mehrmals versucht, sich umzubringen. Der Bericht des evangelischen Pastors an die Oberkirchenbehörde25 enthielt schauerliche Details über Krämpfe, Blutungen und unerklärliche Wunden, zudem war der Körper der Besessenen von einem Tag auf den anderen mit metallenen Gegenständen gespickt, die zum Kopf hochwanderten, wo sie unter grässlichen Schmerzen ausgespien wurden. Pastor Blumhardt zog, wie er in seinem Protokoll berichtete, Nähnadeln und Drahtstücke aus Augenlidern und Kiefern hervor, die der Kranken einen rasenden Kopfschmerz verursacht hatten. Christoph Blumhardt kannte diesen Fall der Besessenheit zu genau, um nicht Parallelen zu Hermann Hesse zu ziehen, wusste er doch von dessen Maulbronner Hypnose-Erlebnis und hatte selbst erlebt, wie stark der Junge unter andauerndem Kopf- und Zahnschmerz litt. Könnte nicht auch dieser widerspenstige junge Mann ein Opfer finsterer Mächte geworden sein?
Am 21. Juni 1892 reist Marie Hesse zusammen mit ihrem Bruder David Gundert nach Göppingen, wo Christoph Blumhardt sie bereits erwartet. Er sieht keinen anderen Ausweg mehr, als Hermann in eine Irrenanstalt einzuliefern. Seine Therapien sind wirkungslos verpufft, er weiß, dass der junge Kranke den Kampf gegen ihn, den prominenten Heiler, gewonnen hat. Blumhardt schimpft über Bosheit und Teufelei und ist froh, dass Mutter und Sohn schließlich nach Stetten abreisen, wo sich ein anderer Geistlicher um den Gemütskranken kümmern soll. Dem Pietisten-Bruder Johannes Hesse schreibt er, der Verstand von Hermann sei »unterentwickelt« und er selbst sei froh, »mit dem Schrecken davongekommen zu sein«26. Nun muss er nicht mehr fürchten, dass die Dämonen auch auf die anderen Patienten überspringen.
Marie Hesse ist tief getroffen vom abweisenden Auftreten ihres Sohnes, der sie bei ihrem Besuch nicht einmal grüßt und finster vor sich hinstarrt. Doch sie kennt diese Stimmungsschwankungen und hat in ihrem Tagebuch lange schon darüber Buch geführt. »Lebhaft« und »verwegen«27 nennt sie dort Hermanns Temperament und seinen Eigensinn und Trotz »oft geradezu großartig«28. Früh schon macht sich sein Bedürfnis nach Autonomie geltend, das sich nicht einmal vom Tod schrecken lässt. »Wenn i ins Gräble runter sterb, so nemm i halt a paar Bilderbücher mit!«29, sagt der Vierjährige zu seiner Schwester Adele. Als seine Schwester Gertrud wenige Monate nach ihrer Geburt stirbt, sitzt er lange an ihrem Totenbett und wünscht, auch selbst bald »zum lieben Heiland« zu kommen. Dann wieder bittet der kleine Hermann seine Mutter, mit ihm zu beten, dass der Herrgott ihn »arg lieb mache«, als spüre er, wie sehr seine Aufsässigkeit seine Familie belastet. Beim Spielen mit den Kameraden will er immer der Erste, Beste, Mächtigste sein, möchte auch seine Geschwister beherrschen, die er manchmal aus einer Laune heraus drangsaliert, um sie gleich darauf wieder zu herzen und zu küssen. Mal spielt er den Missionar, dann wieder predigt er wie ein Pfarrer oder erzählt aus dem Stegreif Geschichten. Der »hohe Tyrannengeist« ihres Sohnes setze ihr immer mehr zu, notierte Marie Hesse am 2. August 1881: »Gott muss diesen stolzen Sinn in Arbeit nehmen, dann wird was Edles und Prächtiges draus, aber ich schaudere beim Gedanken, was bei falscher oder schwacher Erziehung aus diesem passionierten Menschen werden könnte.«30 Das Pflichtbewusstsein der Pietistin lässt den Gedanken nicht zu, dass es vielleicht doch nicht ihr Versagen ist, wenn der Sohn Schwierigkeiten macht, sondern das Ergebnis seiner komplexen, widersprüchlichen Anlagen.
Am Tag nach seinem inszenierten Selbstmordversuch wird Hermann Hesse bei Pfarrer Gottlob Schall, dem Inspekteur der Nervenheilanstalt Stetten, untergebracht. Die Familie bezahlt dafür 1200 Mark; das Krankenblatt vermerkt als Diagnose »Melancholie« – ein eher harmloser Befund. Später wird man ihm »moral insanity« bescheinigen: moralischen Schwachsinn. Die weitläufige Anstalt im Remstal bei Stuttgart, ein ehemaliges Schloss, beherbergt Geistesgestörte und epileptische Kinder. Als die Mutter mit ihm über den Hof der Anstalt geht, ruft Hermann: »In das Gefängnis wollt ihr mich stecken? Lieber spring ich in den Brunnen dort.«31 Erst als Pfarrer Schall auf ihn einredet, beruhigt er sich. Wieder fügt Hermann sich äußerlich in sein Schicksal, dramatisiert aber noch am Tag seiner Einlieferung seine Lage in einem Gedicht:
Auch ich hab einst nach dem Glücke gestrebt.
Auch ich bin nicht lächelnd durchs Leben geschwebt,
Doch alles ist lange verflogen,
Verflogen der Traum von Freude und Scherz,
Erfroren, erstarrt das glühend Herz,
Und die kindliche Unschuld betrogen …
Das Leben, es war so hell und so süß
und die blühende Erde ein Paradies,
Und jetzt ist alles verdorben,
das Spiel und der Scherz und der Erde Tand
Und der wagende Mut erlosch, entschwand
O wär ich doch lange gestorben!32
Dass seine Kindheit unwiderruflich zu Ende ist, ohne dass sich eine annehmbare Zukunft auftut, wird Hermann Hesse in diesen Tagen schmerzlich bewusst. Die routinierte Todeslüsternheit des Gedichts erweist sich als dichterische Pointe, die er öfter schon erprobt hat. Seine Ausnahmesituation empfindet er als Herausforderung, jetzt will er erst einmal das fremde Terrain sondieren, um dann seine Kräfte mit den Autoritäten neu zu messen. Eben noch ein potenzieller Selbstmörder, schickt er nun wie schon zuvor in Maulbronn und Bad Boll detaillierte Berichte über seinen Tagesablauf nach Calw und rühmt sich seines guten Verhältnisses zu Inspektor Schall. Sogar zu einer Entschuldigung gegenüber seinen Eltern ringt er sich durch. Der Anstaltsleiter stellt ihm in Aussicht, den Kindern Unterricht im Lesen und Rechnen erteilen zu dürfen, um sich nützlich zu machen. Hermann darf im Anstaltsgarten arbeiten und liest in seinem Zimmer bis spät in die Nacht.
Hermanns Vater ist erst einmal beruhigt und schreibt seinem Sohn in mitfühlendem Ton, auch er trage schwer am Leben und »empfinde die tiefe Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit beständig auf das Schmerzlichste«. Als Heilmittel kann er aber nur wieder auf Gottes Hilfe verweisen, die nicht ausbleibe, wenn man »den Willen zur Pflicht und zum Guten«33 ausbilde. Hermann aber liebäugelt insgeheim mit dem Gymnasium in Cannstatt, denn er hofft, dort Eugenie Kolb wiederzusehen.
Nur wenige Wochen dauert dieser Waffenstillstand, dann explodiert Hermanns Gemüt in einem gewaltigen Wutausbruch gegen den Vater und dessen christliche Gewissheiten. Johannes Hesse hatte seinen Sohn auf dessen Drängen am 5. August von Stetten nach Calw zurückgeholt, ihn aber schon nach zwei Wochen wieder zurückgeschickt. Hermann verschafft sich Luft mit einem Gedicht, das er in Calw zurücklässt, um seinen Eltern ein schlechtes Gewissen zu machen:
Leb wohl, du altes Elternhaus,
Ihr werft mit Schande mich hinaus,
Ade, ihr Lieben (?) groß und klein,
Von neuem bin ich jetzt allein! …
Zum Teufel geht die Freiheit auch,
Sie war ja immer höchstens Rauch,
Ich werd’ ins Irrenhaus geschickt,
Wer weiß – ich bin wohl gar verrückt.34
Wie schon nach seiner Flucht aus dem Seminar spricht Hermann seine Eltern im Brief mit Sie an, schreibt »Verehrte Eltern!« oder »Sehr geehrter Herr Hesse!« und unterzeichnet mit »Achtungsvoll H. Hesse Nihilist (haha!)«. Er habe nun endgültig alles verloren, klagt er, »Heimat, Eltern, Liebe, Glaube, Hoffnung und mich selbst«. Stetten sei ihm die Hölle, aber eigentlich sei der Irrsinn doch etwas Erstrebenswertes, weil man dann alles vergessen könne. Abwechselnd nimmt er die pathetische Schiller-Pose ein, dann wieder will er ein Turgenjewscher Nihilist sein, weil er gerade dessen Romane, darunter auch Väter und Söhne, liest. Schall nimmt ihm den Turgenjew-Roman Dunst weg, den er wegen der dort beschriebenen amourösen Verwicklungen für schädlich hält, wie er Johannes Hesse mitteilt: »Ob zu seinen Verirrungen nicht auch das Romanlesen beigetragen hat, wodurch er in eine ganz andere Welt versetzt wurde und mit der Wirklichkeit nicht mehr rechnete, vielleicht auch die Lust am angestrengten Lernen verlor? Er hat eine ziemliche Lesewut, welche ich zügeln muß.«35
Pfarrer Schall kann sich über Hermanns Verhalten nicht beklagen, dem strengen Heimleiter gegenüber zeigt er sich kooperativ, lässt sich sogar ins Gewissen reden wegen des ungebührlichen Verhaltens gegenüber seinen Eltern. Deren sorgende Liebe dagegen empfindet Hermann – das zeigt die krude Art, wie er auf ihre hilflosen Briefe reagiert – als Schwäche. Der Pubertierende testet die Grenzen ihrer Toleranz aus, die er bei Pfarrer Schall nie überschreiten würde. Der im Umgang mit schwierigen Jugendlichen erfahrene Anstaltsleiter weiß seine Zuwendung genau zu kalkulieren, sie wechselt zwischen einfühlsamer Zuwendung und harter Sanktion.
Die Briefe, die Hermann zwischen dem 30. August und dem 22. September 1892 an seine Eltern schreibt, schwanken zwischen virtuos vorgetragenem Weltschmerz, höhnischer Aggressivität und devotem Betteln um Verständnis. Es handelt sich nicht um Briefe eines verzweifelten Schülers, es sind literarische Selbstinszenierungen, geschult an Schiller, Heine und Hölderlin – sorgfältig komponierte Rollenprosa, mit der ein hochbegabter, aber sich verkannt fühlender Sohn seinem Vater imponieren will: »Wenn das Leben des Wegwerfens überhaupt wert wäre, wäre das ganze Leben nicht bald ein heiterer, bald schwarzer Wahn – ich möchte mir den Schädel an diesen Mauern einrennen, die mich von mir selber trennen. Und dazu dieser trübe Herbst und der nahe schwarze Winter. Ja, ja, es ist Herbst, Herbst in der Natur und im Herzen: Die Blüten fallen, ah, das Schöne flieht und eisige Kälte bleibt zurück. Und ich bin der Einzige unter einigen Hunderten von entmenschten Irren, der dies fühlt. Fast wünsche ich mir den Irrsinn, es muß unendlich süß sein, alles, alles verschlafen, vergessen zu können, Lust und Leid, Leben und Schmerz, und Liebe und Haß!«36