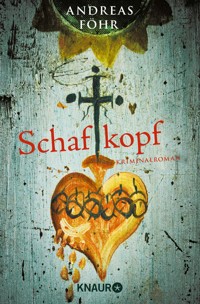9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Wallner & Kreuthner Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine neue Chefin für Kommissar Wallner, Polizeiobermeister Kreuthner unter Mordverdacht - der Haussegen bei der Kripo Miesbach hängt schief... Frauenpower am Tegernsee: Der 10. humorvolle Bayern-Krimi um die Kult-Ermittler Wallner&Kreuthner hat es ordentlich in sich. Ein frischer Wind weht durch die Polizeiinspektion Miesbach – oder wohl eher eine steife Brise: Clemens Wallners neue Chefin Karla Tiedemann ist nicht nur 10 Jahre jünger als der Kommissar und mit einem Sinn für beißende Ironie gesegnet; sie scheint auch mindestens so sehr an ihrer Karriere interessiert wie an Gerechtigkeit. Als der Abgeordnete Gansel in seinem eigenen Haus ermordet wird, gerät Kommissar Wallner von zwei Seiten unter Druck: Karla drängt auf einen raschen Abschluss des Falls – und der Hauptverdächtige ist ausgerechnet Polizeihauptmeister Leonhardt Kreuthner! Denn Gansel war mit Kreuthners Jugendliebe Philomena verheiratet und hat sie offenbar geschlagen. Das wiederum hatte Kreuthner herausbekommen und wollte es in der ihm eigenen unkonventionellen Art unterbinden … Bestseller-Autor Andreas Föhr garantiert humorvolle Spannung, die klug unterhält. Lebendige, facettenreich gezeichnete Charaktere, ein vielschichtiger Plot und eine gute Portion schwarzer Humor zeichnen seine Bayern-Krimis um Wallner & Kreuthner aus. Andreas Föhrs kultige Krimi-Reihe um den prinzipientreuen Kommissar Wallner und den schlitzohrigen Polizeihauptmeister Kreuthner ist in folgender Reihenfolge erschienen: - Prinzessinnenmörder - Schafkopf - Karwoche - Schwarze Piste - Totensonntag - Wolfsschlucht - Schwarzwasser - Tote Hand - Unterm Schinder - Herzschuss
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
ANDREASFÖHR
Herzschuss
Jedes Verbrechen hat seine GeschichteKRIMINALROMAN
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein frischer Wind weht durch die Polizeiinspektion Miesbach – oder wohl eher eine steife Brise: Clemens Wallners neue Chefin Franka Tiedemann ist nicht nur 10 Jahre jünger als der Kommissar und mit einem Sinn für beißende Ironie gesegnet; sie scheint auch mindestens so sehr an ihrer Karriere interessiert wie an Gerechtigkeit.
Als der Abgeordnete Gansel in seinem eigenen Haus ermordet wird, gerät Kommissar Wallner von zwei Seiten unter Druck: Franka drängt auf einen raschen Abschluss des Falls – und der Hauptverdächtige ist ausgerechnet Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthner! Denn Gansel war mit Kreuthners Jugendliebe Philomena verheiratet und hat sie offenbar geschlagen. Das wiederum hatte Kreuthner herausbekommen und wollte es in der ihm eigenen unkonventionellen Art unterbinden …
Bestseller-Autor Andreas Föhr garantiert humorvolle Spannung, die klug unterhält. Lebendige, facettenreich gezeichnete Charaktere, ein vielschichtiger Plot und eine gute Portion schwarzer Humor zeichnen seine Bayern-Krimis um Wallner & Kreuthner aus.
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
Danksagung
Für Monika Pech
1
Auf Wallberg und Fockenstein schien das Licht der letzten Sonne, als ein warmer Herbsttag im Voralpenland seinem Ende zuging. Die Almen lagen ruhig und verlassen, denn das Vieh war schon im Tal, nur der Schrei einer Bergdohle hallte ab und an durch die Stille. Drunten der Tegernsee, dessen Wasser vorbei an Riederstein und Neureuth, am ehemaligen Kloster und der Kapelle des heiligen Quirin nach Norden strebte, um als Mangfall in Gmund das liebliche Tal zu verlassen und durch ein anderes, dunkles Tal zu fließen. Hier unten, weit ab vom Rest der Welt, stand das Wirtshaus zur Mangfallmühle, wo sich Menschen zusammenfanden, denen die schattigen Niederungen gerade recht waren, denn viele von ihnen scheuten das Licht und hielten sich lieber an die dunklen Orte des Lebens.
An diesem Abend führte einer von ihnen, der Schrottplatzbesitzer und mehrfach vorbestrafte Hehler Johann Lintinger, das Wort vor seinen Kameraden, denn was er gerade gehört hatte, erboste ihn.
»Mei – manchmal geht’s net anders. Da muaßt einfach hing’langa. Sonst wirst bled.« Johann Lintinger nahm einen kräftigen Schluck Bier, um sich für seine weiteren Ausführungen zu stärken. »Weil, die hören net auf. Die – hören – nicht – auf. Des geht ewig so weiter, wennst nix machst. Wiwiwiwiwiwi…« Lintinger imitierte mit der ihm verbliebenen Hand einen auf- und zugehenden Schnabel. »Ohne Ende. In so am Fall sag ich: A Trum Schell’n und guat is. Aber a Frau grundlos zum schlagen – des geht ja gar net.«
Lintinger erntete zustimmendes Nicken von seinen Zuhörern. Mit solchen Ansichten galt man in seinen Kreisen schon als ziemlich woke – hätte man in diesen Kreisen gewusst, was das bedeutet.
Sie standen zu dritt zusammen vor dem Tresen des Wirtshauses zur Mangfallmühle. Der alte Lintinger, der sich vor ein paar Jahren seine rechte Hand mit der Schrottschere amputiert hatte, denn sie war ihm seit seiner Kindheit fremd gewesen. Ferner Sennleitner und Leonhardt Kreuthner, beide Polizisten, heute Abend in Zivil. Hinter dem Tresen: Harry Lintinger, Johann Lintingers Sohn und Wirt der Mangfallmühle.
»Ich tät sagen, da braucht’s amal wieder ein zünftiges Haberfeldtreiben«, schlug Sennleitner vor und löste eine Welle lautstarken Zuspruchs aus. Das Haberfeldtreiben war ein alter Brauch, bei dem man sich nachts vor dem Haus einer missliebigen Person versammelte und ihre diversen Verfehlungen verlas. Nach jedem Anklagepunkt fragte der verlesende Haberer: »Manna – is wahr?«, worauf alle zusammen: »Wahr is!« zu antworten hatten, ehe der erste Haberer ein: »Nachad treibt’s zua!« in die Nacht rief. Es folgte ohrenbetäubender Lärm, den die Haberer mit Ketten, Peitschen, Ratschen, Kuhglocken und dergleichen Gerät vollführten.
Auslöser der Wirtshausdiskussion war ein Mann namens Philipp Gansel, der, das hatte Kreuthner berichtet, nicht nur Abgeordneter des Bayerischen Landtags war, sondern auch noch seine Frau schlug. Nicht dass die Anwesenden jeden, der seine Frau schlug, mit einem Femegericht überzogen. Da hätten sie bei ihrem Bekanntenkreis viel zu tun gehabt. Nein, aus häuslichen Streitigkeiten hielt man sich eher raus. Aber der Fall Gansel war etwas Spezielles, denn die geschlagene Frau war eine – oder man könnte sogar sagen: die – Jugendliebe von Kreuthner und hatte ihren Platz in seinem Herzen noch nicht ganz geräumt, auch wenn sie sich fast dreißig Jahre nicht gesehen hatten.
»Haberfeldtreiben ist net schlecht«, sagte Kreuthner. »Ich hab aber mehr an a Gerichtsverhandlung gedacht. Wie damals beim Scheffler Flori.«
»Is des der, wo des net überlebt hat?«, fragte einer am Tresen, der davon gehört hatte, aber nicht dabei gewesen war. Damals hatten sie dem Bestatter Florian Scheffler hier in der Mangfallmühle den Prozess gemacht, weil er seit Jahren jeden im Gasthaus mit seinen öden Geschichten zu Tode gelangweilt hatte. Am folgenden Tag war der Bestatter dann selbst tot gewesen.
»Des hat ja nix mit dem Prozess zum tun g’habt«, wandte Kreuthner ein. Damit hatte er im Prinzip recht. Aber die Sache war ordentlich kompliziert gewesen, und bis man genau ermittelt hatte, was wirklich passiert war an dem Abend, hatten sie einiges an kriminalistischem Scharfsinn aufbieten müssen.
»Der Gansel kommt doch net freiwillig her«, gab Lintinger zu bedenken.
»Dann laden mir ihn halt vor.« Kreuthner lächelte verschmitzt, und seine Kumpane ahnten, dass er, wie das so seine Art war, wieder etwas Abgefeimtes ausgeheckt hatte.
»Erzähl!«, sagte Sennleitner, und freudige Erwartung wuchs in der Runde.
Einige Autominuten von der Mangfallmühle entfernt lag, von Wäldern vor unliebsamen Beobachtern geschützt, eine alte Villa, errichtet im Heimatstil der Kaiserzeit. Kreuthner hatte mithilfe eines verbotenen Peilsenders an Philipp Gansels Wagen herausgefunden, dass sich der Abgeordnete jeden Mittwoch gegen achtzehn Uhr dorthin begab, ein bis zwei Stunden verweilte und anschließend nach München zurückfuhr. Was Gansel in der alten Villa zu schaffen hatte, wusste Kreuthner nicht. Konnte ihm auch egal sein. Wichtiger für seine Überlegungen war, dass die Straße zur Villa kaum befahren wurde, vor allem abends nicht. Nach neunzehn Uhr, er hatte eine Kamera mit Bewegungsmelder an der Strecke installiert, war bei seiner letzten Kontrolle abgesehen von Gansel kein einziger Wagen vorbeigekommen. Der Ort eignete sich folglich bestens für eine Straßensperre. Sie würden Gansels Wagen durch einen quer über der Straße liegenden Baum zum Anhalten zwingen, aus dem Wagen zerren und ihm einen Sack über den Kopf stülpen. Dann würde der Mann mit den gegen ihn erhobenen Vorwürfen konfrontiert werden und Gelegenheit erhalten, etwas zu seiner Verteidigung vorzubringen – schließlich war das hier ein Rechtsstaat. Sollte Gansel freilich die Stirn haben, die Anschuldigungen abzustreiten, würde man das als strafverschärfend bewerten. Anschließend wollte man dem Herrn Abgeordneten etwas von seiner eigenen Medizin verabreichen. Kreuthner hatte hierfür einige alte Dreschflegel besorgt. Den Gedanken, in der Mangfallmühle eine Gerichtsverhandlung durchzuführen, hatte man letztlich und nach heftigem innerlichen Ringen wieder fallen gelassen. Der Spaß, der einem dadurch entging, wäre natürlich exorbitant. Andererseits – irgendein Idiot hätte vermutlich ein Video davon ins Internet gestellt, und dann wäre die Hölle über das Wirtshaus und seine Besucher hereingebrochen. Immerhin handelte es sich bei Gansel um einen Abgeordneten des Bayerischen Landtags. Und nicht wenige der Mangfallmühlen-Stammgäste hatten noch eine Bewährung am Laufen.
An einem Mittwoch Anfang November war es so weit. Kreuthner und Sennleitner hatten einen mittelstarken Baum ausgewählt, den man umhauen und als Straßensperre nutzen wollte. Außer den beiden war noch der alte Lintinger mit von der Partie. Er sollte den Baum nach getaner Feme-Arbeit mit einem der Greifbagger, die er auf seinem Schrottplatz benutzte, wieder von der Straße befördern. Da Lintinger nur über eine Hand verfügte, hatte Kreuthner ihn für den Strafvollzug eigentlich nicht vorgesehen, denn der Dreschflegel wurde üblicherweise mit zwei Händen bedient. Aber Lintinger war empört gewesen, dass er beim eigentlichen Spaß nicht dabei sein sollte, und hielt dagegen, dass er mit seiner verbliebenen Hand mindestens so dreschen konnte wie Kreuthner und Sennleitner mit zweien. Betrachtete man Lintingers meist ölverschmierte Pranke, die einem Baggerarm nicht unähnlich war, wollte man’s glauben.
Kurz nach siebzehn Uhr, es dämmerte bereits, kam Philipp Gansels BMW-Limousine durch den Wald gefahren, wo drei Männer mit geschwärzten Gesichtern, Schlapphüten und alten Lodenkotzen schon eine Weile ausharrten. Man hätte sie für Wilderer aus einer anderen Zeit halten können, wären sie statt mit Dreschflegeln mit Stutzen bewaffnet gewesen. Die Männer huschten beim Herannahen des Wagens hinter mächtige Bäume, wo man sie von der Straße aus nicht sehen konnte. Ohne dass Gansel etwas Verdächtiges bemerkt hätte, schwebte sein Wagen an ihnen vorbei, der geheimnisvollen Villa entgegen. Der Mann bemerkte auch den Greifbagger nicht, der nur wenige Meter vom Straßenrand entfernt im Halbdunkel stand. Ebenso wenig die zwei Kästen Bier, die hinter dem Bagger abgestellt waren.
Nachdem Gansels Wagen in Richtung Villa verschwunden war, machten sich Kreuthner und Sennleitner daran, den ausgewählten Baum zu präparieren, während Lintinger einen Spähposten bezog. In die der Straße zugewandte Seite hieben sie mit Äxten eine Kerbe. Den Gebrauch von Motorsägen hatte man verworfen, es wäre zu laut gewesen. Das Schwingen der Äxte freilich war anstrengend und trieb Kreuthner und Sennleitner den Schweiß aus den Poren. Um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen, musste man sich immer wieder aus den mitgebrachten Bierkästen bedienen. Vor allem Sennleitner achtete so penibel auf seinen Flüssigkeitshaushalt, dass er den Baum öfter verfehlte und die Axt wild in der Gegend herumschleuderte. Ein ums andere Mal endete der Schwung mit anschließender Pirouette auf dem Hosenboden, wo Sennleitner dann albern vor sich hin kicherte.
»Jetzt mach amal langsam mit dem Bier«, mahnte ihn Kreuthner.
»Des verschtehst du falsch.« Sennleitner torkelte zu seiner Flasche. »Ich hab einfach zu wenig Zielwasser intus, verschtehst?«
Nachdem sie die Fallkerbe in den Baum gehauen hatten, wurde auf der Rückseite der Fällschnitt angebracht. Diese Arbeit verrichteten Kreuthner und Sennleitner mit einer altertümlichen Zugsäge, jeder auf einer Seite. Da Sennleitner kaum noch Herr seiner Motorik war, zog sich das hin. Am Ende schlug Kreuthner einen Keil so tief in den Fällschnitt, dass der Baum gerade noch stehen blieb. Sie wollten ihn erst im letzten Moment auf die Straße stürzen lassen – nicht, dass vor Gansel doch noch ein anderes Fahrzeug auftauchte.
Es ging auf sieben zu, und Gansel musste demnächst vorbeikommen. Lintinger bestieg den Greifbagger, und Kreuthner begab sich zu einer Stelle, von wo aus er die Straße weit in Richtung Villa einsehen konnte. Wenn Gansels Wagen auftauchte, würde er Sennleitner, der am Baum wartete, den Befehl zurufen, den Keil weiter in den Stamm zu treiben und ihn dadurch zu Fall zu bringen. Aus Gansels Sicht würde er hinter einer Kurve liegen, sodass er ihn erst relativ spät zu sehen bekam. Der Abstand von Kurve zu Baum war allerdings so bemessen, dass Gansel noch würde bremsen können.
»Hau rein, er kommt!«, rief Kreuthner dem etwa fünfzig Meter entfernten Sennleitner zu. Eigentlich erwartete er, alsbald das metallische Geräusch zu vernehmen, das der Vorschlaghammer erzeugte, wenn er auf den Keil traf. Aber nichts dergleichen war zu hören. »Was is? Er kommt!«, rief Kreuthner.
»Jaja, bin dabei«, kam es von Sennleitner zurück.
Dann hallte tatsächlich ein Geräusch durch den finsteren Wald. Es war aber nicht metallisch, sondern dumpf-hölzern. Beunruhigt machte Kreuthner seine Handytaschenlampe an. Was er jetzt sah, bestätigte seine schlimmsten Befürchtungen. Sennleitner torkelte wie Rumpelstilzchen von rechts nach links und schwang dabei den Hammer wie das Rotorblatt eines Hubschraubers. Zwar hieb er in Richtung Baumstamm, verfehlte ihn aber, und die Energie verpuffte ins Leere.
»Ja Kruzifix! Hau auf den Keil!«
Sennleitner setzte noch ein letztes Mal an, zog durch und traf mit einem gewaltigen Ping! tatsächlich den stählernen Keil im Stamm. Die Fichte begann zu ächzen, dann neigte sie sich langsam, aber stetig in die durch die Fallkerbe vorgegebene Richtung. Inzwischen war Gansels Wagen, wie man an den Lichtern sehen konnte, bereits vor der Kurve angelangt. Kreuthner sah wieder zum Baum, dessen Fall jetzt Fahrt aufnahm. Die drei Männer mit den geschwärzten Gesichtern blickten mit Sorge und Hoffnung auf den sich neigenden Stamm. Was jetzt passierte, lag nicht mehr in ihren Händen. Und es passierte Folgendes:
Während der Baum seine letzten Meter zur Straßenoberfläche zurücklegte, quietschten Reifen. Das konnte keine Bremsung sein, denn blockierende Räder waren mit ABS nicht mehr möglich. Offenbar hatte der Fahrer das Lenkrad scharf eingeschlagen. Dann hallten die Geräusche von zerdrücktem Metall und splitterndem Glas durch die Nacht und den Bruchteil einer Sekunde später das Ganze noch einmal, nämlich als der Baum seinen Fall beendete. Die drei Männer standen mit aufgerissenen Augen im Wald und rührten sich nicht. Selbst Sennleitner schien mit einem Mal auf wundersame Weise ernüchtert.
Nach langem Schweigen fragte Kreuthner: »Wer schaut nach?«
2
Der Schnee war so früh gekommen, dass die Lifte schon Anfang Dezember in Betrieb gingen. An diesem frostigen Montag war der Himmel wolkenlos und tiefblau, die Sonne von verschwenderischer Helligkeit und die Hänge dort, wo man sie nicht frisch gewalzt hatte, mit einer jungfräulichen, vierzig Zentimeter hohen Schicht Pulverschnee von letzter Nacht bedeckt. Sogar Menschen, die für ihre Selbstdisziplin bekannt waren, wurden heute schwach. Einer von ihnen: Kriminalhauptkommissar Clemens Wallner, Leiter der Kripo Miesbach. Er hatte sich einen Tag freigenommen und war mit Tina, einer Kollegin von der Spurensicherung, zum Sudelfeld gefahren. Das Skigebiet war nicht sehr groß, aber einen Vormittag lang konnte man seinen Spaß haben, und für den anspruchsvollen Fahrer gab es ein paar schwarze Pisten und jede Menge Tiefschnee.
Sie genossen gerade die eisige Luft, die ihnen im Sessellift um den Kopf wehte, samt Aussicht auf die verschneiten Alpen, als der Lift anhielt. Wallner drehte sich um und schaute nach hinten, den Berg hinab.
»Ist dir dieser Snowboarder mit dem neongrünen Helm aufgefallen?«, fragte er, als er sich wieder nach vorn gedreht hatte.
Tina dachte kurz nach. »Leuchtend grüner Helm … ja, hab ich vorhin schon mal gesehen. Warum?«
»Weiß nicht. Ich hab irgendwie den Eindruck, der ist immer hinter uns.«
»Echt?«
»Zum Beispiel schon ein paarmal im Lift. Unten an der Geier Wally kam er gerade an, als wir eingestiegen sind. Und dann meine ich, ich hätte ihn immer mal wieder in unserer Nähe auf der Piste gesehen. Jetzt sitzt er schon wieder ein paar Gondeln hinter uns.«
»Du meinst, der verfolgt uns?«
Wallner zuckte mit den Schultern. »Sieht fast so aus. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum er das tun sollte.«
»Eben. Der fährt halt zufällig dieselben Pisten wie wir. So viele Lifte gibt es hier nicht.«
»Ich wollt’s auch nur gesagt haben. Nicht dass du mir hinterher Vorwürfe machst, wenn …«
»Wenn was …?«
»Na, wenn dann doch was passiert.«
»Nein«, sagte Tina. »Mach ich dir nicht. Hast es jetzt ja gesagt.«
In diesem Moment fuhr der Sessellift wieder an.
»Wie geht’s Katja?«
Katja war Wallners Tochter, die mit ihrer Mutter Vera in Würzburg lebte.
»Gut. Ist jetzt im Gymnasium.«
»Das gibt’s doch nicht! Als ich sie das letzte Mal getroffen habe, hat sie gerade Zähne bekommen.« Tina blickte versonnen zur Seite, an dieser Stelle konnte man bis Bayrischzell hinunterschauen. »Ist wirklich schade. Für mich wart ihr das ideale Paar. Es hat viel harmoniert, und trotzdem war da diese gewisse Spannung, die eine Beziehung interessant hält. Ich hab nie ganz verstanden, warum ihr euch getrennt habt.«
»Ich auch nicht. Aber ich hab mich ja auch nicht getrennt.«
»Ja, hast du mal gesagt.« Tina überlegte. »Warum ist sie eigentlich gegangen? Weil du wieder mal zu stur warst?«
Wallner brauchte einen Moment für seine Antwort. »Möglicherweise hat sie es so oder so ähnlich begründet.«
Tina sah ihn fragend an.
»Ich wollte einfach nicht weg aus Miesbach.«
»Wegen deinem Großvater?«
»Hauptsächlich. Aber das war natürlich mein Problem, nicht ihres. Ich kann ja schlecht verlangen, dass sie auf ihre Karriere verzichtet, weil ich Manfred nicht allein lassen will. Früher war das üblich, heute eben nicht mehr. Was ja auch gut ist.«
»Aber eigentlich liebt ihr euch noch?«
Wallner legte seine Hand auf Tinas Arm. »Du bist eine gute und romantische Seele. Aber man muss einfach akzeptieren, wenn’s vorbei ist.«
»Vielleicht ist es ja noch nicht vorbei. Und ihr wisst es nicht, weil keiner es angesprochen hat.«
»Wie meinst du das?«
»Hast du Vera jemals gefragt, ob sie sich einen Neuanfang vorstellen kann?«
Wallners stummer Geste zufolge wäre das anscheinend ein völlig unsinniges Unterfangen gewesen.
»Da haben wir es: Im Grunde weißt du gar nicht, ob es wirklich vorbei ist.« Wallner wollte etwas sagen, aber Tina würgte es ab. »Nein, nein. Du hörst mir jetzt mal gut zu: Wenn du Vera das nächste Mal triffst, fragst du sie. Du fragst, ob sie sich vorstellen kann, dass ihr noch mal zusammenkommt. Einfach nur fragen.«
Wallner deutete nach oben.
»Wir müssen gleich aussteigen.«
»Lenk nicht ab. Fragst du sie?«
»Ja, okay. Nächste Woche treff ich sie eh.«
»Schön! Was macht ihr?«
Wallner klappte den Bügel hoch.
»Da ist unser Scheidungstermin bei Gericht.«
»Oh …«, sagte Tina, während sie sich aus dem Sessellift gleiten ließen.
Wallner wandte sich talwärts. Dort schwebte dreißig Meter entfernt der Mann mit dem neongrünen Helm im Lift heran. Tina folgte Wallners Blick.
»Starrt der uns an?« Wallner sah zu Tina.
»Schwer zu sagen, wenn einer Helm und Skibrille aufhat. Kannst ihn ja gleich fragen, ob er was von uns will.«
»Dafür sind mir die Hinweise zu dünn. Wahrscheinlich hast du recht, und es ist Zufall.« Der Neonkopf war noch wenige Meter vom Ausstieg entfernt. Wallner sah die Skipiste hinunter. »Fahr mir hinterher.«
In weiten Bögen carvte Wallner den Hang hinunter. Nach zweihundert Metern blieb er stehen und schaute zum Liftausstieg hoch. Dort setzte sich gerade der Snowboarder mit dem grünen Helm in Bewegung, genau in ihre Richtung. Tina schwang neben Wallner ab. »Und jetzt?«
»Jetzt fahren wir da runter und dann ein Stück den Hang hoch.« Wallner wies auf einen Streckenabschnitt, auf dem die Piste schräg am Hang verlief. Der untere, etwas ebenere Teil war gewalzt, seitlich darüber gab es einen Tiefschneehang, in dem einzelne Fahrer bereits Spuren hinterlassen hatten. Wenn man den Tiefschneeteil überwunden hatte, gelangte man weiter oben wieder auf eine präparierte Piste. Wallner stieß sich ab.
Als er am Schräghang anlangte, nahm er noch einmal Geschwindigkeit auf, um dann nach rechts zu ziehen in den Tiefschneehang hinein. Da es hier bergauf ging und der Pulverschnee bremste, kam er nach kurzer Strecke zum Stehen. Tina schaffte es gerade noch bis auf seine Höhe.
»Und jetzt marschieren wir ganz oldschoolmäßig nach oben.«
Wallner begann seitlich den Hang hinaufzustapfen. Es waren nur wenige Höhenmeter bis zu der Kante, wo die präparierte Piste anfing. Nach einem Blick zurück wusste Wallner, dass ihr vermeintlicher Verfolger sich gerade aufs Board stellte und Anlauf nahm. Kurz bevor Tina und Wallner die kleine Anhöhe überwunden hatten, sahen sie den grünen Helm auf sich zuschießen. Er schwenkte etwa an der gleichen Stelle nach rechts oben in den Tiefschneehang wie zuvor Wallner und Tina. Wallner war gerade dabei, präparierten Schnee zu betreten, und konnte die Stelle, wo der Tiefschnee sie ausgebremst hatte, nicht mehr einsehen, als ein weithin vernehmliches »Scheiße!« zu hören war. Offenbar hatte auch die Geschwindigkeit des Snowboarders nicht bis zur Kante gereicht.
»Das ist halt der Nachteil beim Snowboarden«, sagte Wallner, und sein sonnenbeschienenes Gesicht zeigte hinterhältige Zufriedenheit, als er die Skispitzen nach unten richtete und davonfuhr. Im Gegensatz zu ihm und Tina konnte der Snowboarder nicht einfach den Hang hinaufsteigen. Er musste erst sein Board ablegen und dann in den Snowboardstiefeln bergauf stapfen, was im Tiefschnee eine zeitraubende Quälerei war. Wallner vermutete, dass er es gar nicht versuchen würde, denn sie hatten jetzt einen uneinholbaren Vorsprung.
»Ist der wirklich hinter uns her?« Tina konnte es immer noch nicht recht glauben, als sie unten am Lifteinstieg wieder Gelegenheit hatten, miteinander zu reden. Aber dem Wutschrei des Snowboarders nach zu urteilen, hatten sie tatsächlich gerade einen Verfolger abgehängt. Wallner zuckte mit den Schultern.
»Interessiert dich gar nicht, was der Bursche von uns will?«, fragte Tina.
»Brennend. Aber vielleicht hat es damit zu tun, dass wir Polizisten sind. Und da ich gerade meinen freien Tag genieße, habe ich keine Lust auf Dienstliches.«
Eine halbe Stunde später hatten sie ihre Skier abgeschnallt, saßen an der Schirmbar Geier Wally in der Sonne und gönnten sich einen Kaffee.
»Nicht umdrehen«, flüsterte Tina mit einem Mal.
Wallner widerstand der Versuchung.
»Der Neon-Helm?«
»Ja.«
»Hat er uns gesehen?«
»Er glotzt her, würde ich sagen.« Tina wandte den Kopf kurz in eine andere Richtung, um so zu tun, als hätte sie den Mann mit dem Helm nicht bemerkt.
»Und? Kommt er?«, fragte Wallner.
»Keine Ahnung. Ich kann nicht die ganze Zeit hinstarren.«
»Wieso? Er starrt uns doch auch an.«
»Ja – und wir finden’s scheiße.«
»Du treibst mich in den Wahnsinn.« Wallner war kurz davor, sich selbst umzudrehen. »Kommt er?«
Tinas Blick flackerte in der Gegend herum.
»Ich seh ihn nicht mehr.«
Jetzt war es Wallner zu viel. Er wandte sich um.
»Da ist er doch!«
»Wo?«
Wallner deutete Richtung Berg. »Na da, im Lift.«
Tatsächlich. Der Snowboarder war auf dem Weg nach oben.
Wallner und Tina stießen unwillkürlich beide einen erleichterten Seufzer aus.
»Und wir haben uns eine Stunde lang verrückt gemacht.« Tina schüttelte lachend den Kopf.
»Es war schon ein seltsamer Zufall, dass wir ihn ständig gesehen haben«, sagte Wallner. »Da darf man sich doch mal Fragen stellen.«
Zehn Minuten später saßen sie in demselben Lift, mit dem der Snowboarder gerade nach oben gefahren war.
»Ich seh ihn wieder«, sagte Tina und deutete zum Liftausstieg.
»Stimmt.« Wallner war erstaunt. »Dann steht er da aber schon ziemlich lange. Warum fährt er nicht los?«
Sie kamen dem Ende ihrer Fahrt langsam näher und konnten erkennen, dass der Snowboarder einen Fuß noch nicht in der Bindung hatte. Das änderte sich jetzt – anscheinend, nachdem er sie im Lift ausgemacht hatte.
»Verfolgen wir jetzt ihn?«, wunderte sich Wallner.
Doch der Snowboarder machte keine Anstalten, sich fortzubewegen. Stattdessen schien er auf die Ankunft von Tina und Wallner zu warten. Als sie ausstiegen, sah Wallner, wie der Mann einen Handschuh auszog und etwas aus seiner Jacke holte, was wie ein Stück Papier aussah.
»Wir tun einfach so, als wäre nichts«, sagte Wallner. »Mal sehen, was passiert.«
Sie schlüpften in die Schlaufen ihrer Skistöcke und begaben sich zu der Stelle, wo man in den Hang einfuhr. Der Snowboarder fuhr ihnen ein kurzes Stück entgegen und stellte sich ihnen in den Weg. Einen Augenblick lang blieben sie stumm voreinander stehen.
»Können wir was für Sie tun?«, brach Wallner das Schweigen.
Der Snowboarder näherte sich jetzt auf Handschlagdistanz und hielt Wallner das Stück Papier entgegen.
»Wallner?«
Wallner nickte.
»Ich soll Ihnen das hier geben.«
Wallner nahm den Zettel entgegen und musste seinerseits einen Handschuh ausziehen, um ihn zu entfalten. Es war ein schlichter Ausdruck in Arial 12 Punkt, wie Wallner schätzte, auf dem zwei Zahlen standen. Die eine begann mit 47, dann ein Komma und sechs Dezimalstellen, die andere war eine 12, gefolgt von einem Komma und ebenfalls sechs Dezimalstellen.
»Koordinaten«, stellte Tina fest.
Wallner hätte sich gern bei dem Snowboarder erkundigt, von wem er das Papier bekommen hatte. Aber der Mann war bereits weit unten im Hang unterwegs, als Wallner wieder aufsah.
Er fingerte sein Handy aus der Daunenjacke und rief Google Maps auf, um die Zahlen einzugeben. Als er auf Suchen drückte, verfinsterte sich sein Blick.
»Ich kenn diesen Blick bei Männern«, sagte Tina mild-spöttisch lächelnd. »Macht sich der Computer wieder lustig über dich?«
»Angeblich kann er an dieser Stelle nichts finden. Das ist Unsinn. Es gibt diese Koordinaten. Irgendwas muss da sein.«
»Vielleicht was Geheimes, was Google uns nicht verraten darf. Area 51 oder so?«
»Versuch bitte, konstruktiv zu bleiben. Muss ich da noch Nord und Ost eingeben oder N und O oder E?« Wallner hielt Tina sein Handy vor die Nase.
»Nein, Zahlen reichen eigentlich. Lass mal sehen.« Tina studierte das Display. »Du hast Kommas getippt. Du musst Punkte eingeben.«
»Aber da stehen Kommas.« Wallner verwies auf den Zettel.
»Tja – hat vermutlich ein Mann geschrieben.«
Wallner sagte nichts mehr und korrigierte die Schreibweise.
»Und?« Tina versuchte auf den Bildschirm zu sehen, aber Wallner hatte sich etwas zur Seite gedreht. »Funktioniert’s?«
»Wie?«
»Ob es jetzt funktioniert?«
»Ja, es funktioniert.« Wallner wirkte ein klein bisschen genervt, gab Tina dann jedoch das Handy. »Da ist tatsächlich nichts. Berglandschaft, Wiese mit Forststraße.«
Sie betrachtete angestrengt das Display. »Vielleicht sieht es jetzt anders aus als zu der Zeit, wo sie das Foto aufgenommen haben.«
»Mit Sicherheit. Da ist jetzt nämlich alles verschneit.«
Tina gab Wallner das Handy zurück. »Das ist nicht weit von hier. Willst du es dir nicht wenigstens ansehen?«
»Natürlich sehe ich mir das an. Was für eine Frage!«, sagte Wallner und bereitete sich für die Abfahrt vor.
3
Es dauerte mit dem Wagen nur wenige Minuten, um in die Nähe der von den Koordinaten beschriebenen Stelle zu gelangen. Sie standen mitten in sonnendurchfluteter, winterlicher Berglandschaft. Die Zufahrt zu dem Forstweg, den man auf dem Satellitenfoto gesehen hatte, war allerdings blockiert. Der Pflug hatte heute Morgen über einen halben Meter Schneeabraum am Straßenrand abgeladen. Hinter dem schmutzig-eisigen Wall war der Weg unter dem Neuschnee nur zu erahnen. Wallner stellte den Wagen schräg gegenüber in eine Parkbucht.
Als sie über den Schneewall stiegen, bemerkte Wallner verschneite Baumaterialien, die dort gelagert waren. Er checkte sein Handy.
»Also, da oben ist es.« Wallner deutete in die entsprechende Richtung. Dort sah man aber nicht weit, denn Wald versperrte den Blick. »Mir schleierhaft, was wir unter dem Schnee finden sollen.«
Er machte sich dennoch auf den Weg durch den Tiefschnee. Tina folgte ihm. Nach etwa zweihundert Metern blieb Wallner stehen und hielt sich die Hand über die Augen, denn die Sonne blendete.
»Schau an – das Satellitenfoto ist wohl nicht mehr ganz up to date.«
Etwa hundert Meter entfernt stand ein Haus. Genauer gesagt der Rohbau eines größeren Gebäudes, umgeben von einem Bauzaun.
Die Bautafel informierte Vorbeikommende darüber, dass an dieser Stelle ein Hotel errichtet wurde. Neben der Tafel gab ein kleines gelbes Schild darüber Auskunft, dass das Betreten der Baustelle verboten sei und Eltern angeblich für ihre Kinder hafteten. Wallner und Tina standen fast bis zu den Knien im Schnee und sahen sich nach irgendetwas Bemerkenswertem um.
»Das sind die Koordinaten der Baustelle.« Wallner hielt Tina das Handy hin, aber Tina glaubte es auch so.
»Dann ist vielleicht irgendetwas mit diesem Rohbau«, sagte sie. »Von hier kann ich nichts sehen.«
»Vielleicht ist trotzdem was hier draußen«, gab Wallner zu bedenken. »Etwas, das nur zu erkennen ist, wenn kein halber Meter Schnee drauf liegt.«
Tina übernahm das Handy und sah auf die Uhr. »Halb eins. Die Sonne steht da.« Sie deutete in die entsprechende Richtung und glich die Originalkoordinaten auf dem Zettel mit der Position auf dem Handy ab. »Nein, wir sind noch ein Stück zu weit südlich. Dieser Ort …«, Tina hielt den Zettel hoch, »… befindet sich im Gebäude.«
»Da können wir aber leider nicht rein, weil das Privateigentum ist und wir weder einen Durchsuchungsbeschluss haben noch auf Grundlage dieses Zettels einen bekommen würden.«
»Für mich ist das Gefahr im Verzug«, sagte Tina.
»Ach ja? Gefahr, dass was passiert?«
»Keine Ahnung. Aber die Art und Weise, wie wir an diesen Zettel gekommen sind, war höchst verdächtig.«
»Ein bisschen vage, oder?«
»Come on! Warum drückt uns jemand einen Zettel mit Koordinaten in die Hand? Damit wir diese wunderbare Bauruine bestaunen?«
»Ein Scherz?«
»Unsinn. Der Mann mit dem grünen Helm wollte, dass diese Information«, Tina hielt den Zettel hoch, »an den Chef der Kripo Miesbach gelangt. Und das hier«, ihre Hand wies zum Rohbau, »ist der ideale Ort, um Rauschgift, Leichen, Flüchtlinge oder sonst was Illegales zu verstecken. Da muss man doch nur zwei und zwei zusammenzählen.«
Wallner nickte, nicht vollständig überzeugt. »Na gut, lassen wir das mal gelten.«
Er blickte sich um, aber außer großartiger Winterlandschaft war wenig zu sehen. Dann stapfte er ein paar Meter durch den Schnee, bis er an eine Lücke im Bauzaun kam, die er mit etwas Geruckel zu einem Durchschlupf erweitern konnte.
Das Gebäude war in den Hang hineingebaut und blickte nach Süden. Es besaß ein Satteldach – das, soweit man erkennen konnte, bereits fertiggestellt war –, Decken aus Beton und gemauerte Ziegelwände. Fenster und Putz fehlten noch. Auch innen war noch nicht allzu viel passiert. Ein paar Kabel ragten aus nackten Ziegelwänden, und offene Rohre zeigten an, wo künftig Abflüsse gebraucht wurden. Treppen existierten noch nicht. Der Zugang zum nächsthöheren Stockwerk wurde durch eine Leiter ermöglicht.
»Lauf bitte nicht überall herum«, bat Tina.
»Möchtest du schon mal provisorisch einen Trampelpfad anlegen?« In Wallners Anfrage lag durchaus ein wenig Ironie. Ein sogenannter Trampelpfad wurde an Tatorten vorgegeben, damit sich die anwesenden Beamten auf exakt definierten Wegen bewegten und den Tatort so wenig wie möglich kontaminierten.
»Ja, da denke ich gerade drüber nach. Pass auf, ich seh mich hier unten um, du kannst ja mal die Leiter hochsteigen.«
Wallner nickte und begab sich zu der Leiter. Er hatte jetzt Latexhandschuhe an. Seine Schuhe steckten in Plastikfüßlingen. Beides hatte Wallner stets im Auto dabei, denn er hasste es, in fremden Häusern seine Schuhe auszuziehen.
Die Aussicht war überwältigend, als Wallner seinen Kopf durch die rechteckige Aussparung steckte, die einmal ein Treppenabgang werden sollte. Der Blick ging nach Süden auf Winterberge in gleißendem Licht. In die offene Wand würde später wohl ein gewaltiges Panoramafenster gesetzt werden. Ansonsten war hier nur der Betonboden zu sehen. Während Wallner weiter nach oben stieg, beschlich ihn das Gefühl, jemand würde ihn beobachten. Noch auf der Leiter schaute er sich um – und blickte in das Gesicht eines Mannes. Er lag auf der Seite, die Augen offen, den unteren Arm nach vorn gestreckt, den anderen auf dem Boden aufgestützt, als wollte er sich jeden Moment erheben. Aber das tat er nicht. Er lag einfach da und sah durch Wallner hindurch. Der Tote trug einen kamelhaarfarbenen Wintermantel, darunter konnte man ein weißes Hemd und eine Krawatte erkennen. Die dunkle Bügelfaltenhose ließ auf einen Anzug unter dem Mantel schließen, zu dem allerdings die Winterstiefel an den Füßen nicht ganz passten. Da hatten praktische Überlegungen wohl schwerer gewogen.
»Tina, du kannst aufhören zu suchen. Wir haben einen Tatort.« Wallner beugte sich nach vorn, um die Leiche näher zu inspizieren. Blut war nicht zu sehen, aber mehrere Löcher im Mantel.
»Was hast du?« Tina war an die Leiter getreten, konnte von unten aber nichts von dem Mann im oberen Stockwerk sehen.
»Männliche Leiche. Also, vermutlich. Darf ich sie anfassen?«
»Aber vorsichtig!«
»Ich habe nicht gefragt, damit du mich wie ein Kleinkind behandelst. Ich wollte nur wissen, ob irgendwas dagegenspricht, dass …«
»Nein. Wir müssen natürlich erst mal wissen, ob er wirklich tot ist.«
Mit spitzen Fingern nahm Wallner die Hand, die der Tote ihm entgegenstreckte, und versuchte, die Finger zu verbiegen. Sie waren steif, ebenso wie die Hand und der gesamte Arm.
»Würde sagen, die Totenstarre ist voll ausgeprägt. Oder er ist steif gefroren. In beiden Fällen müssen wir, fürchte ich, vom Ableben des Mannes ausgehen.«
»Okay …« Tina führte im Kopf ein paar Kalkulationen durch. »Totenstarre dauert bei diesen Temperaturen um einiges länger.«
»Heißt was?«
»Todeszeitpunkt, sehr grob, gestern Nachmittag oder am frühen Abend. Spuren von Fremdeinwirkung?«
»Da sind mehrere Löcher im Mantel. Könnten Einschüsse sein. Blut seh ich nicht. Aber den Löchern nach könnte der Schütze das Herz getroffen haben. Dann hätte das Opfer kaum geblutet.«
»Gut so weit. Und jetzt muss ich dich bitten, meinen Tatort zu verlassen.«
Wallner kam nach unten. Selbst als Leiter der Ermittlungen und Tinas Chef musste er sich vom Tatort fernhalten, solange die Spurensicherung ihre Arbeit noch nicht gemacht hatte. Er wandte sich gerade der Eingangstür zu, als man von draußen eine Stimme hörte.
»Clemens? Bist du da drin?«
Vor dem Haus stand Polizeihauptmeister Leonhardt Kreuthner in Anorak und Jeans. Auch er hatte heute frei.
»Tja, mein Freund«, sagte Wallner. »Diesmal war ich früher dran.«
»Was meinst du?«
Wallner spürte, dass Kreuthner durchaus eine Ahnung hatte, was er meinte. Denn Kreuthner hatte einen so ausgeprägten und nicht wirklich erklärbaren Riecher für Opfer von Kapitalverbrechen, dass man ihm polizeiintern den Spitznamen »Leichen-Leo« verliehen hatte.
»Dadrin liegt ein Toter. Vermutlich erschossen.«
»Echt?« Kreuthner schien, wenn nicht enttäuscht, so doch zumindest verwundert, dass Wallner die Leiche vor ihm gefunden hatte.
»Was machst du überhaupt hier?« Erst jetzt begann sich Wallner darüber zu wundern, dass mit einem Mal Kreuthner aufgetaucht war.
»Ich hab deinen Wagen unten g’sehen. Und dann bin ich euern Fußspuren nach.«
»Und was machst du hier in der Gegend?«
»Weiß auch net«, sagte Kreuthner. »Aber ich hab mir heut denkt: fahrst amal zum Tatzelwurm. Der Wasserfall schaut im Winter sicher super aus. War so a Eingebung.«
»Irgendwie hast du das gerochen mit der Leiche, oder?« Wallner sah zum Haus.
Kreuthner zuckte mit den Schultern.
Wallner lachte in sich hinein. Auf Kreuthners Instinkt war Verlass. »Unfassbar.«
4
Eine halbe Stunde später herrschte reges Treiben am Tatort. Beamte der Spurensicherung in weißen Schutzanzügen untersuchten den Rohbau und dessen Umgebung auf alles, was irgendwelche Hinweise auf den Täter und das Tatgeschehen hätte geben können.
Der Bau gehörte einer Firma namens Tegernsee Resort Hotels AG. Der Vorstandsvorsitzende war ein Mann namens Marius Fitschauer. Er erteilte zwar ohne Weiteres die Einwilligung für das Betreten des Grundstücks, wozu man ihn beziehungsweise seine Firma natürlich ohnehin hätte zwingen können, nachdem dort eine Leiche gefunden worden war. Allerdings wollte Fitschauer schon wissen, wer die Leiche wie auf der Baustelle entdeckt hatte, da Letztere doch eingezäunt gewesen sei. Ihm wurde, ohne dass man ins Detail ging, gesagt, es habe einen anonymen Hinweis auf den Toten in dem Rohbau gegeben. Mehr musste die Polizei auch nicht offenlegen, denn das gehörte zu den Ermittlungsfakten und war vertraulicher Natur.
Eineinhalb Stunden nach Entdeckung der Leiche erreichte Staatsanwalt Jobst Tischler vom Landgericht München II den Tatort. Tischler stand vor der Beförderung zum Oberstaatsanwalt. Das wurde zumindest in den einschlägigen Kreisen kolportiert. Vor ein paar Wochen hatte Wallner bei einem Symposium Gelegenheit, mit jemandem aus dem Justizministerium zu reden, der mit diesen Dingen befasst war. Die Chance hatte Wallner genutzt und Tischlers Befähigung in leuchtenden Farben beschrieben. Was auch nicht direkt gelogen war. Tischler hatte unbestritten seine Qualitäten. Allerdings ging er Wallner auch auf die Nerven mit seiner quengeligen, ungeduldigen Art und seiner ständigen Suche nach Schuldigen für Dinge, für die niemand etwas konnte oder die er selbst verbockt hatte. Nach einer Beförderung wäre man ihn jedenfalls los.
Wallner saß gerade in einem Campingstuhl und telefonierte zwecks Einrichtung einer SoKo mit dem Polizeipräsidium in Rosenheim, als Tischler mit seinem Audi A6 auftauchte und sich mitten in die Einfahrt zur Baustelle stellen wollte. Inzwischen hatte man die Zufahrt durch einen Schneepflug räumen lassen. Der Polizist, der eigentlich für Ordnung und den reibungslosen Verkehr zum Tatort sorgen sollte, schien etwas eingeschüchtert, als ihm Tischler offenbarte, wer er war. Wallner beendete sein Telefonat und begab sich zu Tischlers Fahrzeug.
»Hallo, Herr Tischler – wie geht’s?«
»Ihr Kollege scheint mich nicht zu kennen«, sagte Tischler, und seine Stimme klang gepresst, was sie immer tat, wenn er verärgert war. Dass sich Tischler darüber beschwerte, nicht erkannt zu werden, entbehrte nicht einer gewissen Ironie. Denn er selbst behielt außer Wallner absolut niemanden aus der Miesbacher Polizeitruppe in Erinnerung, auch wenn er schon in einem Dutzend Fälle mit jemandem von dort gearbeitet hatte.
»Du sei doch so nett«, wandte sich Wallner an den Polizisten, »und park den Wagen vom Herrn Staatsanwalt.« Wallner beugte sich zum Wagenfenster. »Der Kollege kümmert sich um Ihren Wagen. Und wir reden ein bisschen.«
Tischler stieg mürrisch aus dem Auto, das, wie er den Polizeibeamten informierte, einen Neuwert von 60 000 Euro sowie eine empfindliche Lackierung besaß. Es sei also äußerste Vorsicht im Umgang damit geboten.
»Das geht ja gleich spektakulär los für Ihre neue Chefin«, sagte er dann, während sie sich auf zwei Campingstühle in die Sonne setzten. »Wann fängt sie an?«
»Morgen«, sagte Wallner. »Ja, Frau Tiedemann hat anscheinend Sinn für Timing. Kennen Sie sie?«
Für die Polizeiinspektion Miesbach war vor Kurzem eine neue Leiterin bestimmt worden, die am folgenden Tag ihren Dienst antreten sollte. Die Frau hieß Karla Tiedemann, war Ministerialjuristin und vierzig Jahre alt.
»Ich bin ihr ein paarmal bei Tagungen begegnet. Macht einen recht zielstrebigen Eindruck. Deswegen hat es mich auch ein bisschen gewundert.«
»Was … hat Sie gewundert?« Wallner war leicht irritiert.
»Nun ja – verstehen Sie’s nicht falsch, aber die PI Miesbach ist jetzt nicht gerade ein Karrieresprungbrett.«
»Oh, da irren Sie. Hier ist noch jeder durchgekommen, der im Justizdienst Karriere gemacht hat.«
»Tatsächlich? Wer denn?«
»Jetzt, wo Sie konkret fragen, fällt mir gerade keiner ein. Aber reden wir doch über unseren Fall.«
Tischler lächelte. Fast hätte er Wallner geglaubt. Aber nein, die PI Miesbach war wirklich nicht der Karriere-Booster.
»Gut«, sagte er. »Fangen wir beim Opfer an. Wissen wir, wer es ist?«
»Nein, wissen wir noch nicht. Das Opfer hatte, soweit wir bis jetzt feststellen konnten, keine Papiere dabei. Es handelt sich um einen Mann um die vierzig, wertige Kleidung, Anzug und Krawatte und Kamelhaarmantel. Sieht alles ziemlich teuer aus. Meine Kollegen von der Spurensicherung vermuten, dass er gestern Nachmittag oder am frühen Abend gestorben ist.«
»Todesursache?«
»Der Rechtsmediziner ist vor einer halben Stunde eingetroffen. Warten Sie kurz.« Wallner wählte Tinas Nummer auf dem Handy. »Könnt ihr schon was sagen? … Aha … Okay, danke.« Er drückte das Gespräch weg. »Mindestens fünf Einschüsse, einer davon vermutlich ins Herz. Hülsen haben wir bis jetzt nicht gefunden. Der Täter hat sie also mitgenommen oder einen Revolver benutzt.«
»Falls der Mann hier erschossen wurde.«
»Dafür spricht eigentlich alles. Es gibt an der Kleidung keine Spuren, die auf einen Transport der Leiche hinweisen. Sie liegt im ersten Stock. Da kommt man nur über eine Leiter hoch. Ich schätze das Opfer auf mindestens neunzig Kilo. Warum – beziehungsweise wie – sollte der Täter so ein Gewicht über eine Leiter in den ersten Stock tragen? Außerdem ist das hier der ideale Tatort. Er ist von der Straße nicht einsehbar, und das nächste Haus ist über einen Kilometer entfernt.«
»Haben Sie ein Foto vom Opfer?«
Hatte Wallner. Er holte es auf das Display seines Smartphones und zeigte es Tischler.
Der starrte das Bild eine ganze Weile an.
»Kennen Sie den Mann?«, fragte Wallner schließlich.
»Er kommt mir vage bekannt vor. Aber mit Fotos ist das immer so eine Sache. Ich würde ihn mir gern in natura ansehen. Geht das?«
Wallner nahm das Smartphone zur Hand. »Schwierig«, sagte er und wählte erneut Tinas Nummer.
»Was heißt schwierig? Ich leite die Ermittlungen. Sagen Sie Ihren Leuten …«
Wallner bedeutete Tischler mit einer Handbewegung, dass er sich beruhigen solle. »Hallo, Tina. Wann können wir das Opfer in Augenschein nehmen? … Ah ja, okay. Dann bis gleich.« Er drückte das Gespräch weg. »Der Rechtsmediziner ist ohnehin fertig mit der Leiche. Sie kommt gleich vorbei. Also meine Kollegin – und die Leiche.«
Kurz darauf durfte Tischler das sonnenbeschienene Antlitz des Mordopfers in einem Blechsarg betrachten. Er schwieg und nickte bedeutsam.
»Und?«, half Wallner ihm auf die Sprünge.
»Das wird ein interessanter Fall werden«, sagte der Staatsanwalt und schenkte Wallner ein Lächeln. »Der Mann heißt Philipp Gansel und ist Landtagsabgeordneter.«
»Muss man den kennen?«, fragte Wallner.
»Er is der Vorsitzende vom Wirtschaftsausschuss«, sagte Kreuthner, der dazugekommen war.
Sowohl Wallner als auch Tischler starrten ihn mehr als überrascht an. Kreuthner kannte vermutlich nicht einmal den Namen des Wirtschaftsministers.
»Du kennst den Mann?«, fragte schließlich Wallner.
»Nur seine Frau. Die Philomena.«
Erneutes Erstaunen aufseiten von Kripo und Staatsanwaltschaft.
»Was gibt’s da zum schauen? Ich hab amal was mit der g’habt. Is aber lange her.«
Die Köpfe der beiden anderen Männer nickten, ihre Gesichter zeigten weiterhin Ungläubigkeit.
Wallner gab den Sargträgern ein Zeichen, dass sie den Toten wegschaffen konnten. Dann stellte er Kreuthner dem Staatsanwalt vor. Tischler machte ein Gesicht, als hätte er den Namen schon mal gehört, könnte sich aber beim besten Willen nicht erinnern. »Kreuthner? Hatten wir schon mal miteinander zu tun?«
»Herr Kreuthner hat vor zwei Jahren die Leiche in dem Bauernhof entdeckt. In Festenbach. Carmen Skriba.«
»Carmen Skriba …« Damit konnte Tischler mehr anfangen, was aber nicht bedeutete, dass er sich an Kreuthner erinnerte.
Wallner wandte sich an Kreuthner. »Also, du hast mal ein Verhältnis mit der Frau eines Abgeordneten gehabt?«
»Ich kann sie anrufen und ihr sagen, was passiert ist. Wenn du nichts dagegen hast.«
Wallner überlegte kurz. »Ist vielleicht besser, wenn sie es von jemandem erfährt, den sie kennt. Mach das.« Dann wandte er sich Tischler zu. »Und woher kennen Sie das Opfer?«
»Hauptsächlich, weil er bei den Rotariern ist.«
»Der Miesbacher Abgeordnete ist es aber nicht. Den kenne ich.«
»Nein, sein Wahlkreis ist in München.«
»Er war noch relativ jung für einen Ausschussvorsitzenden, oder?«
»Gansel ist vor Kurzem siebenunddreißig geworden. Ich weiß das, weil er seinen Geburtstag in einem Hotel am Tegernsee gefeiert hat.«
»Waren Sie dabei?«
»Gott, nein! So wichtig bin ich auch wieder nicht.« Tischler versuchte, erheitert zu wirken, aber Wallners Frage schien ihm einen Stich gegeben zu haben, und er konnte diese Prise Verletztheit nicht ganz aus seinem Lachen heraushalten.
»Sie haben keine Vermutung, warum jemand Herrn Gansel ermorden würde?«
»Nicht wirklich. Aber der Mann hat verdammt schnell Karriere gemacht. Vielleicht hat er sich mit den falschen Leuten eingelassen.«
5
Wirtschaftsminister Mangold reichte seinem Assistenten Philipp Gansel einen Fünfhunderteuroschein und deutete auf die Glasplatte des Couchtisches. Dort waren vier Lines Kokain aufgereiht. Gansel betrachtete den ungewohnten Schein etwas verwundert.
»Dass des Ganze an Stil hat. Auf geht’s!« Der Minister lachte aufgeräumt und gemütlich.
Philipp Gansel blickte sich unwillkürlich um. Hatte irgendwer die Kameralinse seines Handys auf sie gerichtet? Schwer auszumachen bei der schummrigen Beleuchtung. Die Frau, die auf der Bühne tanzte, war in Rot getaucht, und im Rest des Clubs war es so dunkel, dass man keine Zeitung hätte lesen können. Das wollte hier auch niemand. Gansel rollte den Fünfhunderter zu einer Röhre und sog das weiße Pulver in die Nase. Allzu vertraut war er nicht mit Kokain. Es schoss ihm unangenehm scharf in die Nebenhöhlen.
Wirtschaftsminister Jürgen Mangold inhalierte ebenfalls eine Line und sagte: »Gemma! Auf einem Bein steht man schlecht«, gefolgt von herzhaftem Lachen, gefolgt von Husten, denn anscheinend war ein wenig Kokain in die Luftröhre geraten, gefolgt von weiterem Lachen, bis ihm die Tränen kamen. Gansel konsumierte gehorsam die zweite Portion, worauf sich auch Mangold noch einmal bediente.
Eine junge Frau in Netzstrümpfen und hochhackigen Schuhen kam an den Tisch und stellte einen Champagnerkühler und zwei Gläser ab. Als sie einschenken wollte, steckte ihr Mangold einen Geldschein in die Hand und sagte: »Danke. Des mach ma selber. Passt schon.« Er blickte dem Mädchen verträumt hinterher, dann goss er den Sekt ein. »Is schon was anderes wie zu Haus, was?« Er gab Gansel ein Glas. »Also, wie bei mir daheim jedenfalls. Prost!«
Ein Mann von etwa fünfzig Jahren setzte sich zu den beiden und zog die Flasche aus dem Champagnerkühler.
»Und, Jürgen – geht’s euch gut?«, fragte der Mann. Die Bedienung brachte hastig ein drittes Glas.
Mangold lümmelte sich in seinen Sessel und verschränkte die Hände über dem Bauch. Er trug Trachtenanzug, weil es am späten Nachmittag noch einen Empfang beim Sparkassenverband gegeben hatte, und da war Raiffeisen-Smoking für jeden Politiker Pflicht. »Ich glaub, des wird a netter Abend«, sagte er.
»Aber sicher. Wenn ihr was braucht …«
»Mir rühren uns.«
»Sie sind das erste Mal dabei?«, wandte sich der Mann an Gansel.
Der nickte und war etwas enttäuscht, dass er mit Sie angesprochen wurde. Aber das Du verdiente man sich anscheinend nicht am ersten Abend.
Philipp Gansel hatte vor einem halben Jahr das zweite juristische Staatsexamen abgelegt, solide, aber nicht mit Prädikat. Eine Karriere im Staatsdienst war ihm damit eigentlich verwehrt – ganz zu schweigen von der Anstellung in einem Ministerium. Hier schuf eine Fügung des Schicksals Abhilfe: Gansels Vater und der Wirtschaftsminister stammten aus demselben Dorf. Und im Dorf, da half man sich gegenseitig. Das hatte Jürgen Mangold auch als Minister nicht vergessen. Eine Stelle als Verwaltungsjurist war nicht drin, denn die Einstellungsvoraussetzungen konnte auch ein Minister nicht aushebeln. Aber der Zufall wollte es, dass Mangold zu der Zeit einen neuen Assistenten suchte, und der musste, was seine Ausbildung betraf, keine besonderen Voraussetzungen erfüllen. Nur von einer gewissen Wendigkeit sollte er sein, sonst hätte er im Haifischbecken der Politik nicht lange überlebt. Und diese Anlage schien Mangold in dem jungen Gansel durchaus zu erkennen. Den Rest würde er ihm schon beibringen.
»Warst schon mal mit dem Glaubert unterwegs?«, hatte er Gansel gestern gefragt und dann nachgeschickt: »Na, Schmarrn. Des müsst ich ja wissen.«
Nein, Gansel hatte noch nichts mit Kajetan Glaubert zu tun gehabt. Aber er hatte von den Nächten mit ihm gehört. Auf den Fluren des Ministeriums erzählten sie davon. Die freilich, die erzählten, waren nicht dabei gewesen, sondern hatten es auch nur gehört. Und wenn einer dabei gewesen war, dann höchstens bis zu dem Punkt, an dem Glaubert und der Minister sich verabschiedet hatten – mit unfassbar scharfen Frauen im Schlepptau, wenn man den Gerüchten glauben wollte. Keiner wusste, wohin sie dann fuhren. Denn das war ein gut bewahrtes Geheimnis und trug sehr zum Mythos der Glaubert-Nächte bei. Vielleicht würde Gansel es heute erfahren.
Kajetan Glaubert war Lobbyist. Keiner der vielen Klinkenputzer, die für irgendeinen Verband unterwegs waren, sondern Freelancer. Er verkaufte seine Kontakte projektweise an eine zahlungskräftige Klientel und stand in dem Ruf, absolut jeden zu kennen, der wichtig war im Politgetriebe.
Gansel sah sich um. Die Tabledance-Bar war edel und die Mädchen allesamt hübsch. Getränkekarten gab es, aber ohne Preise. Gansel hatte gehört, dass die Flasche Roederer Cristal über zweitausend Euro kosten sollte. Der Champagner in ihrem Kühler war kein Roederer, also vielleicht schon für fünfhundert zu haben. War letztlich egal. Glaubert bezahlte. Und wahrscheinlich war er an dem Laden hier beteiligt. Gansel fühlte sich gut, fast euphorisch. Das kam vom Kokain. Und von der Aussicht auf eine rapide Karriere als Politiker. Denn er war jetzt dabei. Dabei in einer Glaubert-Nacht. Die Frage war: Würden sie ihn mitnehmen, wenn sie diesen Club verließen? Wirtschaftsminister Mangold orderte soeben die nächste Flasche Champagner und plauderte mit dem Mädchen, das er auf dem Schoß hatte. Gansel hatte kein Mädchen auf dem Schoß, sondern musste sich mit den Darbietungen der Pole-Tänzerinnen zufriedengeben. So wichtig war er noch nicht, dass Glaubert für ihn in Mädchen investierte
Eine weitere Flasche später war der Wirtschaftsminister mit Glaubert im Gespräch über irgendein Gesetzesvorhaben, das der bayerischen Getränkeindustrie zugutekommen sollte. Aber Mangold war schon etwas unkonzentriert. Vor allem die Frau auf der Bühne schien ihn abzulenken.
»Schau dir des Madl an«, sagte er verträumt zu Gansel. Und dann flüsterte er Glaubert etwas ins Ohr, worauf Glaubert nickte, Mangold lächelnd auf die Schulter klopfte, aufstand und der Frau auf der Bühne winkte. Sie kniete sich neben ihn an den Bühnenrand. Glaubert sprach zu ihr und deutete auf Mangold. Das Mädchen sah verunsichert aus. Ein anderes kam dazu und wechselte ein paar Worte mit der Tänzerin. Gansel hatte den Eindruck, dass es eine Freundin war, mit der sie sich jetzt kurz beriet. Schließlich sagte Glaubert noch etwas zu den beiden, worauf die Tänzerin nickte und noch weitgehend bekleidet die Bühne verließ.
»Geht in Ordnung«, sagte Glaubert, als er an den Tisch zurückkam. »Abfahrt in fünf Minuten. Wir sehen uns am Wagen.«
»Er kommt mit«, sagte Mangold und deutete auf Gansel.
Glaubert schien etwas überrascht.
Vierzig Minuten später saßen sie im Salon einer im Heimatstil errichteten Villa irgendwo südlich von München. Sie hatten Glauberts Wagen genommen. Mangolds Fahrer war in den Feierabend verabschiedet worden. Nach einem Begrüßungsdrink hatten Glaubert und Gansel den Wirtschaftsminister und die Tänzerin, die, wie man inzwischen wusste, aus Moldawien stammte, allein gelassen und sich in den nebenan liegenden Salon begeben. Ein Mann im Butler-Outfit, der sich Herr Sommerfeld nannte, schenkte Rotwein in Glauberts Glas. Glaubert probierte, schien zufrieden und nickte, worauf Herr Sommerfeld zwei Fingerbreit Wein in jedes Glas gab und Gansel darüber aufklärte, dass es sich bei dem Getränk um einen 2008er Sassicaia handelte. Gansel sagte »Ah, ja!«, hatte aber nicht die geringste Ahnung, dass sich etwa fünfzig Euro in seinem Glas befanden. Aus dem Nebenzimmer klang Black Velvet durch die geschlossene Tür, und Gansel hatte ein Bild vor Augen, wie das Mädchen aus Moldawien sich an der Stange entblätterte. Er wischte den Gedanken schnell beiseite und beschloss, das Beste aus dem Abend herauszuholen.
»Sagen Sie – wie macht man Karriere in der Politik?«, fragte er den Gastgeber, nachdem sie sich zugeprostet und einen Schluck getrunken hatten. Der Wein war wirklich eine Geschmacksbombe.
Glaubert sah Gansel von der Seite an. »Sie wollen richtig nach oben?«
Gansel machte eine unbestimmte Geste, die man ohne Weiteres als Zustimmung verstehen konnte. Glaubert nickte amüsiert und schien nachzudenken, ob er sein kostbares Wissen mit dem jungen Mann teilen sollte. Dann sah er Gansel an – oder besser gesagt, er begutachtete ihn. Schließlich sagte er: »Sie müssen mit einigen Leuten Leichen im Keller haben.«
»Verstehe.« Gansel pausierte kurz, um seine Erkenntnis zu Ende zu denken. »Wird man nicht selber erpressbar, wenn man Leichen herumliegen hat?«
»Nicht, wenn die Leiche für den anderen ein größeres Problem ist als für einen selbst.«
Gansel suchte im Geiste nach Beispielen, und die Tabledance-Bar kam ihm in den Sinn. »So wie das Koks, das Sie uns in dem Club besorgt haben. Es kann ja für alle Beteiligten unangenehm werden, wenn das rauskommt.«
»Ich habe Ihnen kein Koks besorgt. Das haben Sie von einem Mädchen im Club bekommen.«
Gansel machte eine Geste, die in etwa besagt: Das kann man so oder so sehen.
»Aber angenommen …« Glaubert verstummte mit einem Mal und lauschte. Von nebenan hörte man die Stimme des moldawischen Mädchens. Was genau sie sagte, war nicht zu verstehen, aber es war laut, es war englisch und schloss mit einem »No, no, no!«. Glaubert und Gansel tauschten Blicke und warteten, aber es kam nichts mehr. Inzwischen lief Je t’aime hinter der Tür.
»Nehmen wir also an, ich hätte Ihnen das Kokain besorgt«, griff Glaubert den Gesprächsfaden wieder auf. »Dann wäre das in der Tat eine – man könnte sagen: ›asymmetrische Leiche‹. Strafbar machen wir uns alle drei, aber nur der koksende Wirtschaftsminister ist wirklich erledigt, wenn’s rauskommt.« Er grinste Gansel an. »Da haben Sie ja schon die erste gemeinsame Leiche.«
Auch Gansel fand den Gedanken nicht übel, musste die Sache dann aber doch etwas weiterdenken. »Wenn ich mal selber Minister bin und unser gemeinsamer Freund ist Rentner, dann verschieben sich die Dinge allerdings wieder.«
»Richtig. Dann ist das Koks für Sie das größere Problem. Aber das gilt ganz allgemein. Gemeinsame Leichen werden für einen selbst immer unvorteilhafter, je höher man aufsteigt. Deshalb sollte man es nicht übertreiben.«
Glaubert nahm den Dekantierer mit der Weinflasche und schenkte Gansel nach. In diesem Augenblick wurde es wieder laut hinter der Tür. Neben der Stimme des Mädchens hörte man auch Mangold reden. Sie stritten über etwas.
»Kann es sein«, sagte Gansel, »dass das Mädchen nicht verstanden hat, warum sie mitkommen sollte?«
»Schwer vorstellbar. Dass es für tausend Euro nicht ums Tanzen geht, dürfte ja wohl klar sein.«
Es wurde noch lauter im Nebenraum, und ein Stuhl oder etwas Ähnliches wurde umgestoßen. Dann wieder lautes Reden des Mädchens. Schließlich hörte man Mangolds alkoholverwaschene Stimme »Jetzt stell dich net so an!« schreien.
Gansel versteifte sich. »Sollten wir vielleicht mal nachsehen, ob …«
In diesem Augenblick stieß das Mädchen einen spitzen Schrei aus, dann folgte ein dumpfes, hölzernes Geräusch. Etwas wie ein Schlag. Dann – nichts mehr.
Glaubert und Gansel starrten auf die Tür. Es war still. Fast still. Denn im Hintergrund lief immer noch leise Je t’aime. Glaubert stand zögerlich auf und setzte sich in Richtung Tür in Bewegung. Als er zwei Schritte weit gekommen war, wurde die Klinke nach unten gedrückt, und die Tür öffnete sich. Sehr langsam wurde der Türspalt breiter, bis endlich Mangold zum Vorschein kam. Ohne Jackett, das Gesicht rot, die Augen verschwommen, der Mund offen. Gansel stand auf und ging zu seinem Chef.
»Alles klar?«
Mangold atmete schwer, sein Unterkiefer zitterte. Schließlich schüttelte er langsam den Kopf.
6
Wallner kam am Nachmittag nach Hause, um sich umzuziehen. Er hatte immer noch seine Skihose und Funktionsunterwäsche an. Die blaue Daunenjacke allerdings trug er sowohl beim Skifahren als auch sonst immer in der kalten Jahreszeit, die für Wallner von Mitte September bis Mitte Mai dauerte.
Sein Großvater Manfred, der inzwischen die neunzig überschritten hatte, war ein wenig überrascht, ihn zu sehen, als er in die Küche kam.
»Hast keine Lust mehr auf Skifahren?«
»Doch. Aber wir haben eine Leiche gefunden, und jetzt muss ich arbeiten.«
»A Leich? Beim Skifahren? Wie des?«
»Kann ich dir nicht sagen. Dienstgeheimnis.«
»Schon klar.« Manfred war es gewohnt, dass sein Enkel ihn nur spärlich über Berufliches in Kenntnis setzte. »Hättst halt angerufen, dann hätt ich dir was zu essen gemacht.«
Wallner legte ein paar Briefe auf den Küchentisch, die er vom Briefkasten mitgebracht hatte. »Ich hab angerufen. Ist aber keiner drangegangen. Wo ist denn das Telefon?«
»Im Flur. Wo es immer is.«
»Nein. Draußen ist es nicht.«
Manfred sah sich in der Küche um, entdeckte aber offenbar kein Telefon. Wallner zog sein Handy aus der Daunenjacke und wählte eine Nummer.
»Hörst du das?«
Ein leises Telefongeräusch kam von irgendwoher.
»Ich hör nix«, sagte Manfred. »Is vielleicht oben im Schlafzimmer.«
»Nein, ich glaube, es ist hier in der Nähe.«
Wallner lauschte, es klingelte wieder. Er ging zum Kühlschrank und öffnete ihn. Neben der Gelbwurst lag das klingelnde Telefon.
»Auweh«, sagte Manfred und strich sich übers Kinn, während Wallner den Anruf beendete und das Handy aus dem Kühlschrank nahm.
»Ist vielleicht ganz gut für den Akku, wenn er kühl bleibt.«
Manfred fand das anscheinend gar nicht witzig, denn er sah bedrückt aus.
»Jetzt is es so weit, oder? Jetzt kommt er, der Alzheimer.«