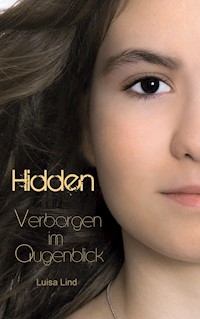
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Hidden
- Sprache: Deutsch
Lea Körners Leben wird von einem Augenblick auf den nächsten auf den Kopf gestellt, als sie nach einem Fund eigenartige Fähigkeiten an sich entdeckt. Sie dachte, ein gewöhnliches Mädchen zu sein, doch dann ändert sich alles und sie weiß nichts mehr mit Sicherheit. Niemandem kann sie anvertrauen, dass sie seltsame Kräfte entwickelt, über die sie jedoch bald die Kontrolle verliert. Lea merkt schnell, dass sie selbst nicht das einzig Merkwürdige in ihrem Leben ist. Sie wird beobachtet, doch weshalb? Gibt es jemanden, der mehr weiß, als er zugibt? Möglicherweise kann ihr dieser Jemand helfen, ihre Kräfte zu verstehen. Das Netz aus Lügen zieht sich jedoch weiter durch Leas Leben, als sie vermutet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luisa Lind ist ein Pseudonym, hinter dem eine 15-jährige Autorin aus Österreich steckt. „Hidden – Verborgen im Augenblick“ ist der Auftakt einer 4-teiligen Fantasy-Reihe und gleichzeitig der Debütroman der Autorin. Die Idee zu diesem ersten Buch hatte Luisa bereits sehr früh mit etwa acht oder neun Jahren. Schon damals stand für sie fest: Sie will Autorin werden und niemand wird sie davon abhalten können.
Für alle, die an sich glauben. Die nicht aufgeben, ganz gleich wie steinig der Weg erscheinen mag. Dieses Buch ist für euch! Auf dass ihr weiterhin einen Fuß vor den anderen setzt.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Epilog
Prolog:
Aristine schritt eilig durch den Schnee, ihren Mantel fest an sich gepresst. Ihre Füße waren fast taub, aber sie musste weiter. In ihren schwarzen Haaren glänzten die weißen Schneeflocken, bevor sie schmolzen. Sie blieb fröstelnd stehen, die Arme um ihren Körper geschlungen, der immer so zierlich und zerbrechlich gewesen war.
Ihre grauen Augen wanderten aufmerksam über die Winterlandschaft, während die junge Frau ihre kalten Zehen bewegte. Aristines Winterstiefel waren völlig durchnässt, aber sie konnte nicht umdrehen. Es war nicht mehr weit bis zu der konkreten Stelle im großen Wald. Sie war verabredet, wie so oft in den letzten zwei Jahren, doch diesmal hatte sie kein glückliches Lächeln in ihrem blassen Gesicht. An diesem Tag war alles anders als an den unzähligen Malen davor, als sie sich mit ihm getroffen hatte.
Bitte, flehte sie insgeheim, bitte lass ihn da sein! Aristine eilte verzweifelt weiter, ohne auf ihren zitternden Leib zu hören, der es sich lieber zu Hause vor dem Kamin bequem gemacht hätte. Zu Hause, wo eine Tasse Kakao und eine warme Decke warteten – und ihr Mann. Nein, ausgeschlossen, sie konnte nicht dorthin zurück, Aristine musste handeln.
Erschöpft lehnte sie sich an den Baum, der ihren Treffpunkt kennzeichnete, und schloss die Augen. Wäre ihr doch nur nicht so schlecht gewesen. Sofort wanderten ihre kalten Hände zu ihrem runden Bauch. Das alles war einfach die falsche Zeit, es war Dezember, aber daran lag es nicht.
„Aristine?“, hörte sie eine vertraute Stimme verwundert fragen.
Liam kam näher und fragte: „Was tust du denn hier? Du solltest nicht hier sein!“
Besorgt sah er sich um, bevor seine blauen Augen sich wieder auf die Frau richteten, die er immer so gerne sah. Doch nicht hier, und schon gar nicht jetzt – in dieser Zeit.
„Ich … ich musste dich sehen“, stammelte sie und kam auf ihn zu. Misstrauisch sah Liam sie an und erwiderte: „Ist etwas passiert?“ Einen Moment blieben seine Augen an ihrem rundlichen Bauch hängen.
„Nein, nein“, wehrte Aristine schnell ab. „Uns geht es gut. Ich mache mir einfach Sorgen, um dich und um Maila.“
Maila. Ja, so würde das Mädchen heißen, da würde Aristine nicht verhandeln, mit niemandem.
„Aristine“, hatte ihre Mutter oft zu ihr gesagt, als sie noch klein gewesen war. „Namen haben eine Bedeutung – eine sehr große.
Also gib stets Acht, wie du Menschen nennst.“
Maila bedeutet „kleine Schönheit“ oder auch „das Kind, welches Wasser liebt“. Ja, so würde das kleine Mädchen heißen, das in ihrem Bauch heranwuchs. Aristine hoffte nur, es würde mehr Glück im Leben haben als sie selbst.
Liam nahm sie in den Arm und drückte sie sanft an sich. Wie zerbrechlich sie nur wirkte.
„Wir hatten doch gesagt, dass wir uns nicht mehr treffen können“, sagte er leise. Ja, das war wahr, so hatten sie es abgemacht. Die beiden hofften, dass es so leichter und vor allem ungefährlicher sein würde. Aber dennoch war sie zurückgekehrt.
Was für ein Feigling sie doch war.
„Du bist stark, Aristine!“, hatte das ihre nicht Mutter immer gesagt? „Auch, wenn es dir manchmal nicht so vorkommt. Eines Tages wirst du allen anderen zeigen, was in dir steckt, wenn sie versuchen, dich klein zu machen. Aber dann erinnere dich: Du bist so stark!“ Ja, das hatte sie gesagt, mehrfach.
Liam löste sich aus der Umarmung und hielt sie ein Stück von sich weg, um ihr tief in die grauen Augen zu sehen.
„Du wirst hierbleiben, in Margeriten, mit Maila und deiner Mutter. Bleibt zusammen, dann seid ihr in Sicherheit, ich verspreche es“, sagte er ernst, wie immer, wenn sie über dieses Thema sprachen.
„Nein“, hatte Aristine anfangs immer protestiert: „Ich will bei dir sein, ich komme mit!“
Aber er hatte immer nur den Kopf geschüttelt und gesagt, sie solle für Maila da sein, denn sie brauche ihre Mutter, so wie Aristine selbst sie auch brauchte.
Diesmal nickte die junge Frau nur schwach, ihr war alles zu viel.
Warum hatte sie in ihrem Leben nur immer so ein Pech? Alles passierte immer zur falschen Zeit.
„Bleib noch, nur zwei oder drei Monate, nur bis Maila geboren ist. Ich will, dass ihr euch kennenlernt, bitte“, meinte sie flehend.
Aber Liam blickte sie mit seinen schönen blauen Augen traurig an und erwiderte: „Es geht nicht, ich kann nicht länger hierbleiben.
Wenn die anderen von dem Verrat erfahren, was zweifellos passieren wird, dann werden wir alle bestraft werden. Aber so, ihr werdet zurechtkommen, ich verspreche es.“
Liam strich ihr über die pechschwarzen Haare und küsste die schwangere Frau, die so verloren im Schnee stand. Dann musste Aristine es sagen, die schwersten Worte, die ihr je über die Lippen gekommen waren, und ihr Herz schmerzhaft zusammenzogen:
„Leb wohl.“
Kapitel 1
Samstag, 21.09.
Wasser prasselt auf meine nackte Haut und ich schließe die Augen, damit mir kein Schaum hineinrinnt. Der Strahl läuft mir über das Gesicht und den Rücken hinunter. Seufzend taste ich nach dem Wasserhahn und als ich das Metall endlich zu fassen bekomme, stoppe ich das Wasser, das aus dem Duschkopf fließt.
Früher, als ich noch klein war und mit meinen Eltern zusammen in New York wohnte, schimpften sie immer mit mir, wenn ich zu lange unter der Dusche blieb. „Das ist Verschwendung, Schatz“, meinten sie ärgerlich, „Wasser ist sehr, sehr wertvoll.“
Meine Eltern haben mir angewöhnt, sparsam mit allen Ressourcen umzugehen, wofür ich ihnen überaus dankbar bin.
Generell führe ich die meisten ihrer Regeln weiter, seit sie fort sind. Meine Großeltern legten darauf besonderen Wert, als ich zu ihnen kam.
Das ist mittlerweile zwei Jahre her. Und obwohl Margeriten das exakte Gegenteil von dem großen, lauten New York ist, ist es in dieser Zeit zu meiner Heimat geworden. Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, war es nicht leicht für mich, mit dreizehn Jahren plötzlich aus meiner Welt herausgerissen worden zu sein.
Wir waren zuvor schon viel umgezogen, meine Eltern und ich.
Meine ersten Lebensjahre verbrachte ich in Österreich. Dort kommt meine Mom her. Eine Zeit lang lebten wir in der Nähe meiner Grandma in Großbritannien. Zwischendurch für einige wenige Monate in anderen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, Spanien und sogar kurz Italien. In New York blieben wir dann am längsten. Doch letztendlich bin ich wieder hier, in Österreich.
Ein Umzug war also nichts Neues für mich. Sehr wohl jedoch, dass ich ihn diesmal allein antrat. Anfangs hatte ich mich dagegen gesträubt und gewehrt. „Mom, all meine friends sind doch hier! Ich möchte nicht zu Oma und Opa! Dort am Land ist es total boring!“, beschwerte ich mich.
Doch Mom ließ sich nicht erweichen. Und ich verstand sie. Es wäre keine gute Idee, mit ihr nach Australien zu gehen. Oder mit Dad nach Schweden. Bei Oma und Opa war ich am besten aufgehoben. Ich kannte dort alles schon ein wenig, da wir die Ferien des Öfteren in Margeriten verbracht hatten.
Ich steige aus der Dusche und wickle ein Badetuch fest um meinen Körper. Wasser tropft aus meinen Haaren und hinterlässt eine nasse Spur am Boden. Ich betrachte mein Gesicht im Badezimmerspiegel. Braune Augen sehen mir aufmerksam entgegen.
Jedes Mal, wenn meine Eltern zu Besuch kommen, wundern sie sich, wie erwachsen ich geworden bin.
„Ein richtiges Fräulein!“, rief Dad aus, als wir uns in den Sommerferien sahen. Wir verbrachten beinahe die ganzen neun Wochen zusammen.
Auch zu Weihnachten, Ostern, an Geburtstagen oder zu anderen Feierlichkeiten kommen meine Eltern nach Margeriten und bleiben, solange es ihre Arbeit zulässt. Für meinen Geschmack also immer zu kurz.
Aus diesem Grund freue mich schon riesig auf meinen Geburtstag. Seufzend winde ich das Wasser aus meinen Haaren, sodass es über meine Hände fließt. Acht Tage und ein Monat noch.
Dann bin ich fünfzehn und sie sind wieder hier.
Wir telefonieren beinahe jeden Abend. Das wurde gleich zu Beginn Tradition. Immerhin sind wir drei nun alle kilometerweit voneinander getrennt. Auch meine Eltern wollen einander sehen und reden.
Ich schlüpfe in meine Hose und streife mir meinen BH über.
Lächelnd ziehe ich das T-Shirt darüber, das ich mit meiner besten Freundin gekauft habe. In Margeriten gibt es nicht sonderlich viele Läden, nur kleine Shops, wenn man spontan etwas benötigt. Für gewöhnlich fahren Feli und ich in die nächstgelegene größere Stadt.
Wir beide kannten einander bereits, bevor ich übersiedelte, jedoch eher flüchtig. Immerhin sahen wir uns jedes Jahr ein paarmal. Das war nicht gerade die beste Voraussetzung für eine sehr engen Freundschaft. Vor zwei Jahren aber war sie eine der wenigen Gleichaltrigen, die ich überhaupt kannte. Feli hieß mich gleich willkommen und von da an machten wir ziemlich alles gemeinsam.
Mit meinen Freundinnen aus New York habe ich auch noch etwas Kontakt, aber nicht so sehr. Ab und an telefonieren wir, doch bei mir gibt es wenig zu erzählen. Zumindest ihrer Meinung nach.
In der Großstadt passiert einfach mehr.
Das könnte man zumindest annehmen.
„Lea!“, ruft meine Oma die Treppe hinauf, „Frühstück ist fertig!“
„Ja, ich komme!“, antworte ich und kurz darauf mache ich mich auf den Weg, denn ich bin tatsächlich schon ziemlich hungrig.
Wenig später stehe ich wie versprochen vor dem Esstisch in der Stube unten und betrachte das frisch gekochte Essen und die drei Teller darum herum, sowie den duftenden Kakao.
„Mmh, lecker!“, schwärme ich und hole geschwind das Besteck aus der Schublade.
Schon stürze ich mich wie ein hungriger Wolf auf das Essen.
Auch meine Großeltern fangen an, wenn auch wesentlich gemächlicher als ich. Aber ich kann mich nicht beherrschen, mein Magen hat schon geknurrt, als ich noch im Bett lag.
Jedenfalls vermute ich stark, dass es das war, was mich geweckt hat, denn was soll es sonst gewesen sein? An das Schlagen der Standuhr in der Stube habe ich mich so gewöhnt, dass ich es überhaupt nicht mehr wahrnehme, selbst in wachem Zustand.
„Lea, kannst du mir helfen, die Mäusefallen auf dem Dachboden zu verteilen?“, fragt Opa mich nach dem Frühstück. „Ich habe den Käse als Köder schon hineingelegt.“
Wir sind sehr tierfreundlich, weshalb diese Fallen Lebendfallen sind. Das bedeutet, dass die Maus in einem kleinen Käfig gefangen wird und wir sie dann irgendwo, wo es ihr gut geht und sie überleben kann, aussetzen. Das ist immer lustig, denn die Maus springt dann in hohem Bogen aus ihrem Gefängnis, was sehr komisch aussieht.
„Natürlich helfe ich dir gerne, aber ich kann sie auch schon alleine aufstellen, Opa“, schlage ich vor, denn ich fühle mich fast ein wenig gekränkt.
Warum denken meine Großeltern immer noch, ich sei ein kleines Mädchen? Trauen sie mir denn gar nichts zu?
„Also gut, du bist ja schon groß“, stimmt Opa schließlich mit ein und ist zum Glück zu sehr damit beschäftigt, meiner Katze Luna argwöhnisch mit den Augen zu folgen, denn sie wiederum fixiert den Wurstteller, den Opa gerade in die Küche trägt. So sieht er mein Augenrollen nicht. Oma schon, aber die schmunzelt nur.
„Hier sind die Fallen. Hole mich, wenn du Hilfe brauchst“, redet Opa unbekümmert weiter. Er hat es bis in die Küche geschafft und den Teller abgestellt.
Mit diesen Worten gibt Opa mir eine Schachtel mit Mäusefallen.
Ich bin mir aber sicher, dass, auch wenn ich Hilfe brauchen sollte, was nicht eintreten wird, ich das Opa ganz bestimmt nicht mitteilen werde. Das ist doch selbstverständlich, oder?
„Da ist es aber staubig!“, denke ich wenig später, als ich auf dem Dachboden stehe. Hier oben sind viele alte Möbelstücke und Sachen gelagert, die wir nicht mehr brauchen. In dem spärlichen Licht, das die Glühbirne erzeugt, die so alleine von der Holzdecke baumelt, sehe ich die Staubkörnchen durch die Luft fliegen und es kitzelt sofort in meiner Nase.
Einige Zeit und viele Nieser später sind alle Fallen endlich auf dem richtigen Platz. Wurde aber auch wirklich Zeit. Irgendwie ist mir das kürzer und weniger staubig in Erinnerung geblieben. Das nächste Mal lass ich das doch wieder Opa machen.
Andererseits ist er ja auch schon alt und abgesehen davon, dass es ewig lange dauern würde, hätte er hinterher bestimmt Rückenschmerzen.
Warum überlässt er das eigentlich nicht Luna, unserer Katze?
Die hätte garantiert mehr Spaß dabei.
Ich betrachte noch einmal meine Arbeit und will dann wieder nach unten gehen, doch... halt! Was ist das? In einer Ecke sehe ich Umrisse von, ja, wovon eigentlich?
Es sieht groß aus, liegt jedoch im Schatten, weshalb ich nicht erkennen kann, worum es sich bei dem Objekt handelt. Obwohl hier eine Menge altes Gerümpel herumsteht, möchte ich eben dieses näher erforschen, als würde es mich magisch anziehen.
Als ich darauf zugehe, erkenne ich eine Truhe, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Sie ist aus Holz und sieht alt und schwer aus.
Außerdem liegt so eine dicke Schicht Staub darauf, dass ich mir sicher bin, niemand hat sie in den letzten Jahrzehnten auch nur angefasst.
Alte Sachen interessieren mich immer schon. Es ist spannend, zu wissen, dass jemand die Sachen einmal besessen hat, der vielleicht sogar schon gestorben ist. Naja, bei der Truhe könnten es allerhöchstens meine Urgroßeltern gewesen sein, oder?
Aber es ist doch trotzdem interessant. Vielleicht sind alte Fotos darin? Einmal bin ich auf alte Puppenkleidung gestoßen, die meine Mom als junges Mädchen selbst gemacht hat. Sie erzählte mir, ihre eigene Oma habe ihr dabei geholfen.
„Opa hat bestimmt nichts dagegen, wenn ich einmal hineinschaue“, überlege ich leise, während ich bereits meine Hände über das Holz bis zu dem kleinen Schloss wandern lasse.
Der Schlüssel steckt darin und klemmt ein bisschen, als ich ihn langsam umdrehe. Mit einiger Mühe öffne ich den schweren Deckel aus Holz.
Staub wirbelt umher und ich befürchte, schon wieder niesen zu müssen. Doch dann legt sich der Staub allmählich wieder und ein Stapel Bücher ist in einer Ecke zu erkennen.
Ich greife hinein und ziehe einen Wälzer nach dem anderen heraus. „Meerestiere, Pflanzenwelt, In den Alpen, Universum, Unterwasser …“, lese ich ein bisschen gelangweilt die Titel herunter.
Natürlich, hätte ich mir ja denken können, warum sollte auch etwas Interessantes darin sein? Was habe ich erwartet? Einen Goldschatz? Nein, gewiss nicht, aber eine Enttäuschung ist es trotzdem.
Plötzlich sticht mir noch ein Buch ins Auge. Es ist sehr dick und sieht ziemlich abgegriffen aus. Ich nehme den Band hoch und weil mich der Einband neugierig gemacht hat, puste ich den Staub weg, um den Titel besser lesen zu können, was ich sofort wieder bereue.
Ich unterdrücke ein Niesen und streiche den restlichen Staub vorsichtig mit der Hand fort, um nicht noch mehr davon aufzuwühlen.
Zu meiner Überraschung fällt aus dem Buch plötzlich ein zartes Silberkettchen heraus. Staunend hebe ich es auf und betrachte es genauer, was auf dem düsteren Dachboden gar nicht so einfach ist.
Der Anhänger ist sehr aufwendig gearbeitet, das fällt mir sogar hier oben sofort auf. Beeindruckt mustere ich das Symbol, es ist ein Kreis mit einem vierblättrigen Kleeblatt. Auf jedem Blatt ist ein winziges Zeichen zu sehen, doch hier oben ist es zu dunkel, um sagen zu können, was genau es darstellt. Dort, wo die vier Blätter zusammentreffen, befindet sich ein kleines Herz.
Seltsamerweise wirkt das Schmuckstück auf eine gewisse Art magisch auf mich. Denn selbst auf dem düsteren Dachboden scheint es geheimnisvoll zu strahlen, was aber vermutlich damit zusammenhängt, dass der Anhänger mit winzig kleinen Steinchen besetzt und verziert ist.
Auch die Buchstaben des Buchtitels sind in einer altmodischen und verschnörkelten Schrift gemalt, die mir golden vorkommt.
Aber ist es einfach zu dunkel, ähnlich wie im Dämmerlicht.
Ich brauche eine ganze Weile, um die Buchstaben zu entziffern, doch schließlich gelingt es mir doch. Der Titel lautet: „Die Natur – ein Geheimnis“.
Dennoch interessiert mich das Silberkettchen im Augenblick etwas mehr. Ich lege es mir um den Hals. Jetzt fehlt nur noch ein Spiegel, um mich darin zu betrachten.
„Lea, was treibst du denn hier auf dem Dachboden? Willst du etwa Mäuse fangen? Das ist doch mein Job!“, höre ich plötzlich eine mir unbekannte Stimme sagen. Ich zucke zusammen und drehe mich erschrocken um.
Ich erblicke meine Katze Luna, die wohl heraufgeschlichen sein muss, sonst niemanden. Sie ist noch eine junge Katze und hat schwarzweißes, seidiges Fell.
Geboren wurde Luna am Bauernhof der Baumgartners gleich in der Nähe. Dort wohnt meine beste Freundin Feli, die mir Luna zum Geburtstag schenkte.
Meine Katze ist die Tochter einer der Katzen der Baumgartners, allerdings starb Lunas Mutter letztes Jahr. Wir waren schrecklich traurig, vor allem, da wir vermuten, dass der Fuchs aus dem Wald sie sich geholt hat.
„Wer hat gerade gesprochen?“, frage ich verwundert, denn ich bin sicher, diese Stimme noch nie zuvor gehört zu haben. Ich frage mich, ob ich mir das vielleicht alles nur eingebildet habe. Ich meine, das könnte doch durchaus möglich sein. So abwegig ist das gar nicht, das ist mir schon öfter passiert.
Alles völlig gewöhnli-
„Ich! Kennst du mich etwa nicht mehr? Luna!“
Eine Weile lang schauen wir uns ungläubig an. Nein, wir starren uns an! Lunas Katzenaugen leuchten gelb grün im düsteren Raum, ihre Pupillen sind riesengroß und ihr kleiner Kopf etwas schief gelegt. Ihr Blick ist fragend, meiner allerdings, wie ich stark vermute, erschrocken.
Jetzt bin ich aber vollkommen verrückt geworden! Bilde ich mir etwa schon ein, Katzen sprechen zu hören?! Du meine Güte!
Langsam zweifle ich wirklich an meinem Verstand.
„Ähh… alles in Ordnung? Du schaust, als wäre ein Hund hinter dir her!“, kommt es, jetzt eindeutig, von Luna.
Natürlich, alles in bester Ordnung. Meine Katze spricht zu mir und ich komme mir vor wie der letzte Idiot. Alles bestens. Sag ich doch.
Mein Mund ist auf einmal trocken und ich öffne und schließe ihn wie ein Fisch an Land, doch ein Ton kommt dennoch nicht heraus.
Meine Gedanken fahren Karussell, aber ich kann keinen einzigen von ihnen fassen.
Ich komme mir vor wie in einem dieser verrückten Träume, die man manchmal hat. Einer dieser Art, nach dem man nur völlig irritiert den Kopf schütteln kann und ein unsicheres Lachen von sich gibt.
Als ich nach einigen Minuten meine Sprache wiederfinde, frage ich Luna skeptisch: „Seit wann sprichst du wie ein Mensch? Oder träume ich?“
Das ist anscheinend nicht korrekt gewesen, denn Luna verzieht empört ihr kleines Katzengesicht, falls das denn möglich ist.
„Ich habe schon immer mit dir gesprochen, aber du hast mich nie verstanden. Warte, hast du gesagt wie ein Mensch?! Das ist Diskriminierung!“, entgegnet die Katze beleidigt und ich frage mich, woher eine Katze einen solch… gebildeten Ausdruck kennt.
Dafür hätte sie gleich erneut „Diskriminierung!“ schreien müssen.
Doch im nächsten Augenblick kommt sie neugierig auf mich zu.
Besonders nachtragend ist sie wohl nicht – zum Glück! Da bücke ich mich hinunter und kraule ihr zärtlich das flauschige Köpfchen.
Auf einmal bin ich sehr glücklich darüber, mich mit Luna unterhalten zu können, auch wenn diese Unterhaltung nur in meinem Kopf existiert und nur für kurze Zeit, denn das ist schlicht un-mög-lich!
War das alles nur ein Zufall? Oder besser gesagt Einbildung?
Da holt mich plötzlich Omas Stimme aus meinen Gedanken:
„Lea, dein Handy klingelt!“
„Ich komme!“, antworte ich zerstreut. Geschwind räume ich alle Bücher zurück und verschließe die Truhe wieder. Dann mache ich mich mit Luna im Schlepptau auf den Weg in die Stube.
Doch als ich die Nummer meiner besten Freundin Feli auf dem Display meines Handys entdecke, fällt mir ein, dass sie diese Neuigkeit mit Luna sofort erfahren muss. Wem, wenn nicht ihr, kann ich sonst so etwas Verrücktes erzählen? Da kommt sonst ganz klar niemand in Frage!
Ich will Feli gerade begrüßen, als ich Lunas eindringliche Stimme vernehme: „Du verrätst doch etwa nicht unser Geheimnis, Lea!?“
In diesem Augenblick bin ich so auf die Worte meiner Katze konzentriert, dass ich die Frage meiner Freundin nach einem Treffen überhöre.
„Nein, natürlich nicht!“, antworte ich Luna, als wäre dies kompletter Unsinn und als würde ich das niemals in Erwägung ziehen.
„Warum nicht?!“, tönt es verwirrt aus dem Handy.
Erst da wird mir mit einem Mal bewusst, dass ich mit meinem merkwürdigen Geheimnis wirklich vorsichtig umgehen muss, um nicht großes Chaos zu verursachen. Die Situation ist ungewohnt und überfordert mich. Wie soll ich verstehen, was hier vorgeht?
Doch im Augenblick muss ich mich auf Feli konzentrieren, denn sie wartet schließlich immer noch auf eine Antwort.
„Entschuldigung, ich meinte nicht dich. Ich habe gerade mit meiner Oma gesprochen. Aber natürlich kannst du zu mir kommen“, sage ich schnell. „In einer halben Stunde bei mir?“
Feli ist sofort einverstanden, wir verabschieden uns und beenden das Telefonat.
Fünf Minuten später sitze ich auf dem Boden in meinem Zimmer im ersten Stock. Ich bin gerade dabei, meine vielen Bücher im Bücherregal zu verstauen, als ich Lunas Tatzen über unsere hölzerne Stiege laufen höre. Ich drehe mich um und da erscheint auch schon das schwarz-weiße Katzenköpfchen in der Türe.
„Wollen wir spielen?“, will Luna wissen und ich könnte schwören, dass sie dabei schelmisch grinst.
„Tut mir leid, ich will noch mein Zimmer aufräumen, bevor Feli kommt“, entgegne ich und stehe auf um die Kissen auf meinem türkisblauen Sofa zurecht zu schütteln.
„Magst du auch nicht Detektiv spielen? Wir könnten herausfinden, warum du mich plötzlich verstehen kannst“, meint Luna mit vor Freude leuchtenden Augen.
Diesen Vorschlag finde ich nicht einmal so schlecht.
Wir setzen uns aufs Sofa und überlegen eine Weile lang, wie es passiert sein könnte.
„Was hast du zuvor gemacht?“, fragt meine Katze schließlich.
Ich sehe ihr an, dass sie Feuer und Flamme ist, das Rätsel zu lösen.
Das finde ich toll, wenn auch etwas verwirrend.
„Ich habe Hausaufgaben gemacht, habe mein Frühstück gegessen und anschließend bin ich auf den Dachboden gegangen. Ich habe Mäusefallen für meinen Opa aufgestellt“, zähle ich nachdenklich auf.
„Mäusefallen? Sagtest du gerade ernsthaft Mäusefallen?“, unterbricht mich Luna skeptisch. Mit gerunzelter Stirn sehe ich auf meine Katzendame hinab und nicke ernst.
„Menschen sind echt ein komisches Volk, weißt du das? Ach herrje“, meint diese und ich kann vor meinem inneren Auge sehen, wie sie ihr schwarz-weißes Köpfchen missbilligend schüttelt.
Die Lippen zusammengepresst, sodass ich nicht grinsen muss, das wäre wirklich unpassend, sitze ich auf dem Sofa und höre meiner Katze zu, was sie zu erzählen hat – Verrückt, oder?
„Das sagst du aber nicht Molly, oder? Dass ich das gesagt habe, meine ich“, hakt Luna besorgt nach. Molly, so heißt eine der Katzen der Familie meiner besten Freundin.
„Sie ist so gutgläubig und korrekt“, fährt meine Katze unbeirrt fort. Das glaube ich ihr aufs Wort, denn die orange getigerte Molly von nebenan ist tatsächlich sehr zutraulich und passt perfekt auf diese Beschreibung.
Als ich nicke, redet Luna schon weiter: „Die Menschen kümmern sich sehr gut um uns, sie geben uns Futter, ein Heim und – am wichtigsten natürlich – Liebe und Zuneigung. Das musst du zu schätzen lernen, Luna.“
Nun muss ich wirklich grinsen, so lustig hört es sich an, wie meine Katze die der Nachbarn nachahmt. Das macht sie allerdings nicht wirklich spöttisch, denn ich weiß, dass Luna Molly sehr gerne hat.
Früher war sie schließlich auch dort zu Hause, bevor sie vor zwei Jahren zu mir kam. Ich habe sie zu meinem dreizehnten Geburtstag bekommen und kann mich daran erinnern als wäre es gestern gewesen.
„Als ob ich das nicht ohnehin wüsste, ehrlich, Menschen sind ja ganz okay, zumindest die meisten“, redet Luna weiter wie ein Wasserfall. Anscheinend bin ich nicht die Einzige, die total übergeschnappt ist, auch sie wirkt ein wenig überdreht und aufgeregt.
Plötzlich schaut sie auf, als würde ihr erst gerade wieder einfallen, mit wem sie überhaupt spricht.
„Oh, Entschuldigung. Es ist einfach toll, dass ich jetzt mit dir quatschen kann“, sagt meine Katze zerknirscht.
„Du glaubst also, dass ich auch Molly verstehen kann?“, erkundige ich mich nachdenklich. Luna bejaht ohne nachzudenken.
„Warum auch nicht? Klingt doch logisch, du verstehst jetzt unsere Sprache.“
Im nächsten Augenblick fährt sie plötzlich wieder aufgeregt fort:
„Also, kommen wir zum eigentlichen Problem zurück: Sonst noch etwas, das ich wissen sollte?“
Ich brauche einen Moment, bis ich verstehe, dass sie wieder bei dem „Was-ist-zuvor-passiert-Thema“ ist.
Sie mustert mich wie eine Lehrerin und ich muss lachen.
Ich lege die Hände um ihren Bauch und hebe sie hoch. Luna streckt die vier Beinchen von sich weg, um sich kurz darauf an meinem T-Shirt festzuklammern. Ihre Krallen zerren am Shirt und bohren sich unsanft in meine Haut.
Ich hebe meine Katze auf meinen Schoß, wo sie sofort zu schnurren beginnt. Lächelnd kraule ich sie und als ich mich zu ihr hinunterbeuge, stupst Luna mich mit ihrer kleinen, feuchten Nase an der Wange an.
Ich kichere kurz, weil mich ihre Schnurrbartharre am Hals kitzeln, was meine Katze dazu veranlasst, sich noch enger an mich zu schmiegen, sodass ich spüre, wie ihr Kehlkopf beim Schnurren vibriert.
Ach, wie lieb ich dieses kleine Fellknäuel habe! Tiere können einem ja so ans Herz wachsen. Ich könnte es mir überhaupt nicht mehr ohne Luna vorstellen. Aber das denkt sich vermutlich jeder Besitzer eines Haustieres, bis es eben nicht mehr jeden Tag vor einem sitzt und einem mit großen, süßen Augen ansieht.
„Sie gehören einfach zur Familie, man muss Katzen einfach gerne haben“, sagt meine Oma des Öfteren und ich stimme ihr voll und ganz zu.
Ich vergrabe meine Nase in Lunas weichem Fell und atme tief ein, sie riecht nach Heu und ein kleines bisschen auch nach Waschpulver. Das kommt vermutlich von den frisch gewaschenen Polstern, auf denen sie es sich so gerne gemütlich macht.
„Also?“, erkundigt sich meine Katze neugierig. „Was war sonst noch so los? Etwas total Merkwürdiges, das du mit mir teilen möchtest, weil dir sonst keine Maus zuhören würde, ohne dich nachher als verrückt zu bezeichnen?“
Gerade als ich Luna von dem Silberkettchen, das am Dachboden aus dem Buch gefallen war, erzählen möchte, klingelt es an der Haustüre.
Das muss Feli sein! „Ist es tatsächlich schon so spät?“, geht es mir durch den Kopf, als ich meine Katze wieder zurück auf das hellblaue Sofa mit den vielen Kissen hebe. Eilig gehe ich zu meiner Zimmertüre, nicht ohne Luna vorher noch einen entschuldigenden Blick zuzuwerfen.
Das Rätsel aber ist immer noch nicht gelöst …
An die vielen Fragezeichen in meinem Kopf werde ich mich wohl oder übel noch gewöhnen müssen …
Kapitel 2
Eigentlich heißt Feli Ophelia, aber wir nennen sie immer Feli, oder meine Oma manchmal Felia. Nur selten rutscht Lehrern oder Leuten im Geschäft und in der Ortschaft ihr ganzer Name heraus.
Nur mein Opa sagt manchmal Ophelia, weil er den Namen schön findet. So passiert es auch meiner Oma ab und an.
Aber obwohl Feli ihren vollständigen Namen nicht unbedingt gerne hört, sagt sie zu meinen Großeltern nie etwas, denn hier in Margeriten ist es üblich, vor allem älteren Leuten gegenüber stets respektvoll zu sein.
Normalerweise aber sagt Feli immer, was sie denkt, ganz gleich, was es ist. Das ist eine der Eigenschaften, die ich an meiner besten Freundin bewundere. Feli ist ehrlich und das braucht schon manchmal auch Mut und Selbstvertrauen.
Außerdem achtet sie darauf, trotz ihrer Direktheit überlegt zu sprechen und nicht unhöflich zu wirken, obwohl das nicht immer so einfach ist.
Im Gegensatz zu meinem glatten Haar, dessen Farbe man am ehesten als Hellbraun bezeichnen kann, und meinen dunklen Augen, hat Feli honigblonde Locken und freche, meerblaue Augen.
Ihre Nase ist spitz und klein und sie grinst oft schelmisch, was mich ebenfalls immer zum Lächeln bringt.
Felis Lachen und ihre gute Laune wirken beinahe auf jeden in der Umgebung ansteckend. Mit niemandem kann man so gut scherzen und lachen wie mit ihr. Denn Feli macht bei allem mit, was man vorschlägt, obwohl ich anmerken muss, dass es meist umgekehrt ist und sie den Unsinn zuerst im Kopf hat.
Jetzt fällt mir meine Freundin zur Begrüßung um den Hals und drückt mich kurz an sich.
Kurz darauf machen wir uns auf den Weg nach oben in mein Zimmer, wo Luna es sich inzwischen auf meiner Bettdecke gemütlich gemacht hat. Ihre Augen sind geschlossen und sie scheint zu dösen, was ich mit einem erleichterten Aufatmen quittiere.
So kann sie sich nicht einmischen, was bei Luna zu befürchten wäre. Dann kann nichts mehr schiefgehen. Und wenn ich Glück habe, regelt sich das mit der Katzensprache von selbst wieder. Wer weiß das schon.
Bald sind Feli und ich in ein Spiel vertieft, dessen Regeln wir laufend selbst angepasst und geändert haben. Es kommt vor, dass wir die neuste Abwandlung vergessen, dann unternehmen wir die nächste Korrektur.
Doch diese Verbesserungen sind das Beste an dem Spiel, selbst wenn es mittlerweile nicht mehr annähernd an das Original erinnert.
Ein Nachteil ist, dass wir beide, Feli und ich, die einzigen sind, die das Spiel noch spielen können. Wir haben mehrmals versucht, meiner Oma oder Felis Bruder Max die Regeln zu erklären, aber sind jedes Mal kläglich gescheitert.
„Eure tolle Kreation ist unspielbar“, meint Max dann immer ironisch und Oma erklärt es sich damit, dass sie es nicht verstehen kann, weil wir die Regeln immer noch während des Spieles wieder ändern. Das stimmt natürlich nicht, aber Oma will uns das nicht abnehmen.
Also spielen wir unser Spiel alleine, auch nicht schlecht, finden Feli und ich. Auch wenn wir uns von Zeit zu Zeit selbst nicht mehr ganz auskennen.
Doch diesmal habe ich keine Lust, die Regeln zu korrigieren, meine Gedanken gelten dem seltsamen Morgen und der Tatsache, dass ich meine Katze sprechen hören kann.
Was ist los mit mir? Das kann nicht echt sein, aber was ist es sonst?
„Du wirkst nachdenklich“, findet Feli plötzlich. Oje! Das auch noch! „Jetzt muss mir schleunigst etwas einfallen“, denke ich insgeheim.
„Warum muss ich zwei Karten abheben, ich habe genügend und eine würde auch reichen, findest du nicht?“, werfe ich eilig ein.
Feli nickt, mustert mich aber weiter nachdenklich, fast prüfend.
Ob sie ahnt, dass etwas anders ist? Sie ist immerhin Feli!
„Lea, Ophelia! Kommt bitte, es gibt Mittagessen. Felia isst heute wieder einmal bei uns“, ruft Oma in diesem Moment.
„Es gibt Marillenknödel!“, fügt sie hinzu und ich kann ihr Lächeln fast hören, denn das ist Felis Lieblingsessen, wenn sie bei uns ist. Das wissen wir alle nur zu gut.
Wir grinsen uns verschwörerisch an und laufen geschwind nach unten, wobei wir einen bösen Blick von Opa einfangen, der gerade dabei ist, aufzudecken. Wir verlangsamen unser Tempo und helfen ihm.
Dabei sieht Feli mich immer wieder nachdenklich von der Seite an, so als würde sie überlegen, was wohl gerade in mir vorgeht.
Das kann man ihr nicht verdenken, mittlerweile kennt sie mich besser, als jeder andere und sie weiß, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Aber zumindest sagt sie nichts von all dem vor meinen Großeltern.
Wir holen Gläser aus den Schränken, richten Getränke für alle her und tragen sie in die Stube. Meine Gedanken schweifen immer wieder ab.
Was geht hier nur vor? Vielleicht halluziniere ich wieder? Aber warum sollte ich mir eine sprechende Katze einbilden?
Andererseits war ich mir auch damals ganz sicher, dass es so passiert ist, genau wie jetzt.
Nein, es passiert dennoch in meinem Kopf. Luna mauzt wie eh und je und ich denke, Worte zu hören, die nicht da sind. Das ist nicht so schlimm, dass ich in eine Psychiatrie müsste, oder?
Nein, ich habe nur eine lebendige Fantasie, sonst nichts. Daran ist nichts schlimm oder ungewöhnlich, diesmal muss ich es nur für mich behalten und einfach niemandem davon erzählen.
Niemandem wird es auffallen und es wird vergehen, alles wird wieder normal. Luna hat nicht gerade vor sich hingemurmelt, dass sie viel schneller sei als alle Mäuse auf der ganzen Welt. Sie kann nämlich nicht sprechen.
„Lea, findest du nicht, dass du schon genug Löcher in die Luft gestarrt hast? Felia ist schon fast mit ihrer zweiten Portion fertig und du hast noch nicht einmal angefangen! Am Ende müssen wir wieder alle auf dich warten! Oder hast du etwa keinen Hunger?
Ach Lea, Schatz, du fällst uns noch vom Fleisch!“, reißt mich meine Oma aus meinen Gedanken.
„Schon gut, schon gut! Ich esse ja schon“, sage ich beschwichtigend und lächle.
Gesagt, getan. Ich schneide meine Knödel auseinander und fange an, so schnell alles zu verschlingen, dass Opa nur sagt: „Lea, das Essen läuft dir schon nicht davon! Irgendwann erstickst du noch, schneide die Bissen doch kleiner!“
Also verlangsame ich mein Tempo. So müssen am Ende doch alle auf mich warten, aber das ist ja nicht meine Schuld.
Danach decken wir alle zusammen den Tisch ab und Feli und ich helfen Oma beim Geschirrwaschen, was zu dritt ruckzuck gemacht ist.
Ja, wir haben keinen Geschirrspüler, meine Großeltern sind nicht auf dem neusten Stand und ich bin noch dabei, sie zu überreden, dass Geschirrspüler und Fernseher heutzutage zur Grundausstattung eines Haushalts gehören.
Aber meine Oma meint, solange es möglich ist, wolle sie darauf verzichten.
Dann überlegen Feli und ich, was wir als Nächstes machen wollen.
Opa meint, wir sollen ein bisschen in den Garten gehen, weil das Wetter so schön ist und frische Luft uns bestimmt guttut. Dabei wirft er mir einen kleinen Seitenblick zu.
Brav wie wir sind, gehen wir hinaus und überlegen dort weiter.
Nach einiger Zeit hat Feli den genialen Einfall, hinter unserem Haus Federball zu spielen. Wir sind nicht unbedingt gut, aber es ist fast windstill und wir schaffen es, den Ball oft hin und her zu spielen.
Wir jagen dem Ball hinterher, wenn wir zu stark schießen, hechten vor, wenn er zu kurz ist, und springen, wenn er zu hoch ist.
Jeder, der schon einmal Federball gespielt hat, kann sich vermutlich vorstellen, zu welchem Lachanfall es führen kann, wenn der Spielgegner ins Gras fällt bei dem Versuch, den Ball noch ein letztes Mal zurückzuschießen.
Nach einer Weile steht plötzlich Georg, ein 16-jähriger Bauernjunge aus der Umgebung, am Zaun und sieht uns zu.
Aber nicht lange, da beginnt er zu lachen und ruft: „Mensch Lea, so triff den Ball doch einmal! So groß kann das Loch in deinem Schläger nicht sein!“
„Shut up“, denke ich verärgert, lasse mir aber nichts anmerken.
Er wird schon wieder gehen.
Am Anfang ignorieren wir den nervigen Jungen, aber bald wird es uns zu viel und Feli, die ihr Temperament nicht mehr zügeln kann, ruft: „Verschwinde doch, du Blödmann!“
Doch der antwortet nur frech: „Ach, es ist euch ja nur peinlich, weil ihr nichts könnt!“
Ich merke, dass Feli langsam richtig böse wird und sage schnell:
„Du hast recht, ich kann das nicht besonders gut. Komm rein und spiele an meiner Stelle, wenn du willst.“
Beide sehen mich verwirrt an. Kein Wunder. Auch ich bin überrascht, das aus meinem Mund zu hören. Dabei bin eigentlich ziemlich wütend auf Georg.
Jetzt klettert er über unseren Holzzaun und geht auf mich zu. Ich halte ihm den Schläger hin und er nimmt ihn herablassend. Feli spielt ihm dem Ball geschickt zu, aber Georg schießt immer hinterhältiger zurück.
Ich merke sofort, dass er Feli nur ärgern will. Was denn auch sonst? Georg sieht man recht selten, obwohl er der Nachbar der Baumgartners ist, also sehr nahe wohnt.
Doch wenn er doch mal herunterkommt, dann sehnt man sich sogleich wieder nach seiner Abwesenheit. Georg ist eine furchtbare Nervensäge und ein neugieriger Besserwisser.
Feli schlägt sich gut, aber die Bälle fliegen einmal nach links und dann wieder weit nach rechts und sie hat Stress, dem Ball hinterherzujagen und ihn dann auch noch möglichst gemein zurückzuspielen.
Doch bei Georg sieht das sehr gelassen aus, was Feli bestimmt zur Weißglut treibt. Meine Freundin so verzweifelt und wütend zu sehen, ärgert mich, dabei wollte ich dem Fiesling doch nur eins auswischen.
Was kann ich machen? Feli wird nicht mehr lange durchhalten.
Wenn ein Ball so gemein zu Georg kommen würde, dass er ihn nicht erreichen kann.
Aber Feli ist schon am Ende ihrer Kräfte und müht sich nur noch ab, den Ball zu erreichen und ihn halbwegs zurückzuschießen.
Ich überlege, wie ich ihr helfen könnte. Was wäre, wenn das Wetter ein bisschen mitspielen würde.
Plötzlich wünsche ich mir eine kleine Brise Wind, um den Ball aus der Bahn zu blasen. Ich schließe lächelnd die Augen und male mir aus, wie Georg sich blamiert und dem Federball nachjagt.
Im nächsten Moment spüre ich, wie der Wind mir durch die Haare fährt und sie zerzaust. Ich öffne die Augen und sehe gerade noch, wie Georg so hoch springt wie er kann, aber ihm der Ball entwischt ihm und weiter fliegt.
Und schon hüpft er so ähnlich wie ich es mir vorgestellt habe hin und her, immer dem Ball nach. Er versucht, den Federball zu fangen, aber es ist wie verhext. Georg trifft weder mit seinem Schläger, noch erreicht er ihn mit der Hand.
Das sieht so lustig aus, dass Feli und ich lauthals zu lachen anfangen. Georgs Gesichtsfarbe färbt sich dunkelrot, als er beschließt, sich nicht noch weiter zu blamieren. Er bleibt stehen und erklärt, er müsse nun nach Hause gehen.
Kaum hat er das Grundstück verlassen, fällt der Federball ins Gras und bleibt dort liegen.
Nun liegt es an uns, boshaft zu sein, also rufen wir ihm hinterher:
„Kommst du morgen wieder zum Ballfangen, Herr Weltmeister?“
Feli und ich rollen uns am Boden vor Lachen. Das war doch eine sehr unerwartete und rasante Wendung.
Nach einer Weile haben wir uns wieder beruhigt und fangen an, die Sachen zurück in die Scheune zu räumen.
Da werde ich wieder einmal nachdenklich. Aber was soll ich denn dagegen machen, wenn nicht einmal Ablenkung funktioniert, wie man sieht?
Habe ich gerade wirklich das Spiel beeinflusst, oder war das bloß ein Zufall? Ist das möglich, dass ich dem Wind aufgetragen habe, den Federball von Georg wegzublasen? Nun, nein, eigentlich nicht, wenn aber doch …?
Feli hat natürlich sofort gemerkt, dass ich ein weiteres Mal in meinen Gedanken versunken bin, und sieht mich schon wieder von der Seite an.
Also spreche ich die Frage aus, die mir schon die ganze Zeit im Kopf herumschwirrt. „Feli, glaubst du eigentlich an Zufall oder an Schicksal?“
Einen Moment lang schaut mich Feli mit ihren blauen Augen nachdenklich an, bevor sie erklärt: „Weißt du, ich glaube an Schicksal, alles muss kommen, wie es kommt. Deshalb braucht man keine Angst vor der Zukunft zu haben, oder vor der Wahrheit.
Vielleicht kann man das Schicksal auch ändern, das weiß ich nicht.
Aber ich weiß, dass jeder so sein soll, wie er ist, und jeder andere das zu akzeptieren hat, weil man sich nicht komplett ändern kann.
Jedes Lebewesen ist anders. Also sei, wie du bist, sei ehrlich und hab keine Angst vor der Zukunft. Oder auch nicht vor der Vergangenheit, die kann man nicht ändern, nur wieder gut machen.
Wenn das manchmal auch kompliziert und nicht zu schaffen scheint. Nichts ist unmöglich, es kommt, wie es kommen muss.
Zufall gibt es meiner Meinung nach nicht, auch wenn es manchmal so wirkt.“
Schwer beeindruckt muss ich Felis Worte erst einmal auf mich wirken lassen und darüber nachdenken, bevor ich reagiere.
Unglaublich, Feli kann sich so gut mit Worten ausdrücken. Und wenn ich es mir recht überlege, dann hat sie recht. Ich sollte sie öfter zu merkwürdigen Dingen befragen.














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














