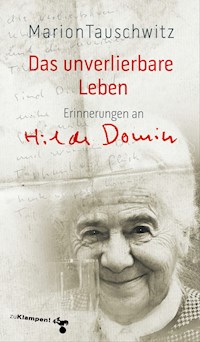Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: zu Klampen Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
In Marion Tauschwitz’ Standardwerk fließen ihre weltweiten Recherchen aus bis dahin unbekannten Quellen sowie aus mehr als tausend Briefen ein. Sie kommt zu u¨berraschenden neuen Erkenntnissen u¨ber Leben und Persönlichkeit Domins, ihre literarische Bedeutung und den männerdominierten Literaturbetrieb. Besonders ergreifend schildert sie Hilde Domins unkonventionelle und äußerst konfliktreiche Ehe mit dem Kunsthistoriker Erwin Walter Palm und wie sich in diesem 56 Jahre währenden geistig stimulierenden, aber auch quälenden 'Lebensgespräch' Hilde Domins Kreativität freisetzte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 888
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marion Tauschwitz
HILDE DOMIN
Dass ich sein kann, wie ich bin
Biografie
© 2015 zu Klampen Verlag · Röse 21 · 31832 Springe
www.zuklampen.de
Umschlaggestaltung: HildenDesign, München
Umschlagmotive: Foto Taube: Privatarchiv Marion Tauschwitz,
Foto Hilde Domin: Privatarchiv Hilde Domin,
Hintergrund: shutterstock.com
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2019
Das »Privatarchiv Hilde Domin« ist in den Nachlass des Literaturarchivs Marbach eingegangen.
Dieses Buch ist zuerst 2009 im Palmyra Verlag erschienen.
Eine überarbeitete und aktualisierte Fassung, der diese Ausgabe folgt, erschien 2010 im VAT Verlag.
ISBN 978-3-86674-448-6
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.
INHALTSVERZEICHNIS
Cover
Titel
Impressum
Editorische Notiz
Einleitung
Prolog
1. Kapitel: Kindheit und Jugend, 1909–1929
2. Kapitel: Heidelberg, 1929–1930
3. Kapitel: Berlin, 1930–1931
4. Kapitel: Heidelberg, 1931–1932
5. Kapitel: Italien, 1932–1939
6. Kapitel: England, 1939–1940
7. Kapitel: Fluchtweg, Sommer 1940
8. Kapitel: Santo Domingo, 1940–1951
9. Kapitel: Santo Domingo, 1951–1952
10. Kapitel: New York, 1953–1954
11. Kapitel: Rückkehr nach Deutschland, 1954–1955
12. Kapitel: Spanien, 1955–1957
13. Kapitel: Deutschland, 1957–1959
14. Kapitel: Astano, Januar-Mai 1959
15. Kapitel: Spanien, 1959–1961
16. Kapitel: Heidelberg, 1961–1963
17. Kapitel: Heidelberg, 1964–1968
18. Kapitel: Heidelberg/Preisverleihungen, 1968–1992
19. Kapitel: Heidelberg, 1969–1974
20. Kapitel: Heidelberg, 1974–1988
21. Kapitel: Heidelberg, Juli-Oktober 1988
22. Kapitel: Heidelberg, 1988–1995
23. Kapitel: Heidelberg, 1995–2006
Anhang
Quellen- und Archivangaben
Anmerkungen
Zeittafel
Lesereisen im Ausland
Auszeichnungen und Preise
Werkverzeichnis
Literaturverzeichnis
Primärliteratur
Weiterführende Literatur
Danksagung
Register
Für
(für die verlierbaren Lebendenund die unverlierbaren Toten)
Klaus, Moritz und Lukas,Ulla, Reinhard und Edeltraud,
Hanno,meine Mutter,meine Schwiegerelternund Hilde
EDITORISCHE NOTIZ
Zu Beginn meiner Arbeit war der umfangreiche Nachlass Hilde Domins noch nicht gesichtet. Als ich im Deutschen Literaturarchiv Marbach mit der Recherche und der Auswertung der Ehebriefe beginnen durfte, lagen noch keinerlei Transkriptionen von Briefen vor.
Viele hundert Briefe sind in Sütterlin-Schrift verfasst, das »minuscule« Schriftbild der Briefe von Hilde Domin und Erwin Walter Palm erschwert oft die Auswertung.
Emigranten, die wie Hilde Domin die Sprache so oft gewechselt haben, nehmen linguistische Besonderheiten in ihren Sprachgebrauch auf, Ausdrucksformen vermischen sich: die – häufig fremdsprachigen – Zitate wurden deshalb originalgetreu mit ihren orthografischen Besonderheiten und mit einzelnen Fehlern übernommen, die unsystematische Zeichensetzung nicht korrigiert. Dies gilt auch für die Beibehaltung der alten Rechtschreibung, wo sie im Original verwendet wird.
EINLEITUNG
»Mein Leben wird einmal ein hübscher Gegenstand für die Literaturgeschichtler werden. Zunächst jedoch ist es mein Gegenstand.« – Mit diesen Worten machte Hilde Domin 1966 dem Literaturwissenschaftler Hugo Friedrich unmissverständlich klar, dass die Zeit noch nicht gekommen war, um über das Leid und die Leidenschaft zu sprechen, die ihr Leben prägten.
40 Jahre sollte es noch dauern, bis Hilde Domin Forschungsgegenstand werden konnte: eine brisante »Zeitkapsel«, versteckt im obersten Fach ihres Kleiderschranks, von ihrer Madrider Holztaube gleichsam apotropäisch bewacht, öffnet den Blick auf ein exemplarisches Exilantenschicksal und auf das außergewöhnliche Lebensgespräch mit ihrem Mann Erwin Walter Palm. Mehrere tausend sorgsam gebündelter Briefe dokumentieren fast ein Jahrhundert gelebtes Leben. Der Schatz im Wandschrank blättert ein Schicksal auf, dessen emotionale Fülle und politische Dramatik Stoff für mehrere Leben bereithielte. In einem Maße, das sich nicht erahnen ließ.
Die Dokumente reisten seit 1932 mit Hilde Domin durch ihre Exilländer und über die Ozeane. Sie dienten ihr beim Verfassen ihrer autobiografischen Schriften in den siebziger Jahren als Erinnerungshilfe, wanderten dann aber wieder in das Dunkel des Wandschranks, wo sie erst nach ihrem Tod am 22. Februar 2006 ans Licht kamen.
Der Briefwechsel zwischen den Ehepartnern dokumentiert eindrucksvoll ihre geistig stimulierende, intellektuelle Auseinandersetzung, doch offenbart zugleich, wie einsam und gefangen beide in sich selbst waren.
Warum schreibt sich ein Ehepaar so viele Briefe? Weil das Sechsundfünfzig Jahre währende Lebensgespräch auch über große Distanzen geführt wurde. Durch Ferne fanden Erwin Walter Palm und Hilde Domin die Nähe, um einander zugewandt zu bleiben. Diesem »weglosen Mitteilungsbedürfnis« konnte Hilde Domin in Santo Domingo nur entrinnen, indem sie sich ihre Qualen in Gedichten von der Seele schrieb. Schreiben war Selbstrettung und führte zu höchster Kreativität. »Poetry Therapy« nennen Psychologen heute die Schmerzbewältigung in Bildern der Poesie.
»Des Herzens Woge schäumte nicht so schön empor, und würde Geist, wenn nicht der alte stumme Fels, das Schicksal, ihr entgegenstünde.«1
Dieses Hölderlinzitat, das Hilde Domin ihrer Dankesrede bei der Verleihung des Hölderlinpreises als Motto vorangestellt hatte, unterstreicht nicht nur die geistige und lyrische Verwandtschaft zwischen den beiden Dichtern.
Dass Hilde Domin den Tiefen ihres Lebens »immer versehrter und immer heiler«2 entstieg, verdankte sie ihrem Elternhaus, in dem sie Vertrauen und Bindungssicherheit erfahren hatte – Werte, die ihr nicht zu nehmen waren und ihr die Kraft gaben, Flucht und Exil zu ertragen. Vor allem, solange Liebe und Vertrauen zu Erwin Walter Palm Hand in Hand gingen. Als beides wegbrach, wog dieser Verlust schwerer als das Trauma der Verfolgung durch die Nationalsozialisten.
Hilde Domin besann sich immer wieder auf ihre selbstheilenden Kräfte, um die Widerstände auf ihrem Weg zur Schriftstellerin zu überwinden: nicht nur den ihres Mannes, der durch die poetische Potenz seiner Frau »Musenabfang« bei sich fürchtete, sondern auch die der männerdominierten Literaturwelt im Deutschland der Sechzigerjahre, die geprägt war durch »Gehetze, mieses Getue«, wie Heinrich Böll an Domin schrieb.3
Bei »der Bestandsaufnahme der deutschen Lyrik bei der jeder Pinscher erwähnt war«4, figurierte Domin lange nicht. Und auch Domins literaturanalytische theoretische Schriften blieben unterbewertet; doch stammten sie »aus der Feder eines männlichen Theoretikers, wäre ihnen längst die Beachtung gezollt worden, die der Theoretikerin leider erst mit der zeitlichen Verzögerung zukommen wird.«5
Weil der »Falke [ihres] Verstandes« lange genug für Erwin Walter Palm auf die Jagd gegangen war, entschloss sich Hilde Domin nach ihrer Rückkehr nach Deutschland, ihren analytischen Intellekt künftig für ihre eigenen Interessen einzusetzen.
Domin war ihrer Zeit oft voraus: unkonventionell, souverän, intellektuell – Eigenschaften, die nicht nur ihrer Liebesbeziehung, sondern auch ihrer Akzeptanz in der Literaturszene hinderlich waren.
Recherchen im Archivio di stato di Firenze, in den deutschen Landes- und Universitätsarchiven Berlin, im Stadt- und Universitätsarchiv Heidelberg sowie im Archivo General de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ungezählte Gespräche mit Freunden und Zeitzeugen, vor allem aber die intensive Auswertung der Domin-Korrespondenz, darunter mehr als zweitausend Ehebriefe, im Literaturarchiv Marbach und ebenso zahlreiche Briefwechsel im Historischem Archiv der Stadt Köln, dem Universitätsarchiv der Humboldt-Universität Berlin und dem Universitätsarchiv Heidelberg haben ein neues Licht auf viele bislang unbeleuchtete oder unbekannte biografische Zusammenhänge und Details von Hilde Domins Leben geworfen.
Als unermesslichen Verlust empfinde ich das Unglück von Köln vom 3. März 2009, bei dem das Historische Archiv der Stadt Köln vom Erdboden verschluckt wurde und damit neben zahllosen historischen Dokumenten auch die umfangreiche Korrespondenz von Hilde Domin mit Hans Mayer und Marierose Steinbüchel-Fuchs möglicherweise für immer verloren ist. Gerade diese Briefwechsel aus der frühesten Zeit Hilde Domins bargen eine Fülle von Informationen, die für eine biografische Einordnung unerlässlich waren – die ich 2007 und 2008 aber alle noch auswerten konnte.
Aus Hilde Domins umfangreicher Korrespondenz lassen sich ihre Lebensstationen wie Puzzleteile zu einem großen, rekonstruierbaren Ganzen fügen. Dabei liefern die Briefe nicht nur faktische Details, sondern reflektieren auch die seelischen Befindlichkeiten der dargestellten Personen, die unerlässlich sind, um ihre Handlungsmotivationen nachvollziehbar zu machen.
»Authentische Information« wünschte sich Virginia Woolf von einer Biografie und wollte wissen, ob die Person »Schnürstiefel trug, oder solche mit elastischem Seitenteil, […] wie putzte sie sich die Nase, wen liebte sie und wie?«6 Faktische Details nehmen deshalb Atmosphärisches und Emotionales auf, die gewählte Erzählform ermöglicht szenische Lebendigkeit, so dass sich das facettenreiche Leben Hilde Domins wie ein Roman lesen lässt, der die Protagonistin lebendig werden und den Leser die Entwicklung miterleben lässt, die die politisch wachsame Studentin Hilde Löwenstein, die sich ihrem Partner Erwin unterwerfende Frau Palm schließlich zur souveränen Schriftstellerin Hilde Domin genommen hat.
In Hilde Domins Lebensweg bündeln sich Liebe, Leid und Leidenschaft mit der politischen Dramatik eines unsanften Jahrhunderts, dem sie sich mit Mut und Entschlossenheit entgegengestellt hat.
PROLOG
MEIN HERZE WIR SIND VERREIST
Der 22. Februar 2006
»Und was machst Du heute Morgen?« – »Ich gehe in die Stadt und kaufe Handschuhe.« – »Wer geht denn mit?« – »Ich gehe alleine, das kann ich gut genug!« – »Oh, Hilde, dann nimm doch den Stock mit, überall liegen noch tückische Eisplatten auf den Gehwegen.« – »Du kannst mich nicht älter machen, als ich bin, ich gehe recht gut ohne Stock!« – »Dann pass gut auf dich auf, Liebe.«
Der 22. Februar 2006 ist ein klirrend kalter Wintertag. Ein Taxi fährt Hilde Domin vom Graimbergweg zum Heidelberger Bismarckplatz. Sie wird in zwei großen Kaufhäusern gesehen, wie sie sich energisch nach Handschuhen erkundigt – doch man hat bereits die Frühjahrskollektion ausgestellt, die Winterware ist rar. Hilde Domin begibt sich auf den Heimweg, ohne Handschuhe gekauft zu haben.
Kurz vor ein Uhr mittags klingelt mein Telefon: »Liebste, ich bin in der Uniklinik, mach dir keine Sorgen, vielleicht ist das Bein verstaucht, aber ich gebe dir mal den Arzt, der soll dir alles erklären. Bitte komm gleich, ach.«
Wie immer hat sich Hilde Domin am Telefon nicht mit ihrem Namen gemeldet, doch natürlich habe ich ihre Stimme sofort erkannt; sie klingt nicht so fest wie sonst. Der Arzt erklärt mir, dass Hilde Domin in der Stadt gestürzt ist, ein freundlicher Herr den Krankenwagen gerufen und sie in die Universitätsklinik begleitet hat.
Die Verletzung ist allerdings schwerwiegend, keine Verstauchung: Hilde Domin hat sich bei dem Sturz einen medialen Oberschenkelhalsbruch zugezogen und muss operiert werden.
Später in der Notfallambulanz klärt mich der Professor unter vier Augen über die Operation auf, die nicht nur wegen des hohen Alters der Patientin riskant ist. Auch die Zeit nach der Operation bleibt gefährlich, und körperliche Einschränkungen müssen in Kauf genommen werden.
Hilde Domin eingeschränkt beweglich und pflegebedürftig? Sie wird es nicht ertragen, ihre Unabhängigkeit aufzugeben.
Hilde Domin ist erleichtert, dass ich jetzt bei ihr bin. »Jetzt macht das alles meine jüngere Schwester für mich«, erklärt sie den Ärzten. »Jüngere Schwester« nannte sie mich immer, nicht etwa Tochter, denn »dann hättest du nicht nur mein Blut, sondern auch Erwins Blut in dir.«
Ich gebe den Ärzten Auskunft über Tabletten, Krankheiten, Befunde. Wie gesund Hilde Domin doch ist: Fast alle Medikamente sind pflanzlich – Gingko, Weißdorn, Ginseng –, dienen fast ausschließlich der Kräftigung von Geist und Körper.
In dem Maße wie Hilde Domin ruhiger wird, nehmen ihre Schmerzen zu, der Blutdruck steigt trotz der Medikamente stetig an. Die Ärzte entschließen sich, nun sofort zu operieren.
Hilde Domin hasst Krankheiten und Gebrechlichkeiten, ihre Unterschrift zur Einwilligung für die Operation ist ein großer Strich quer über das Papier, als ob sie damit alle Risiken eliminieren könnte. Diese Unterschrift wird nicht akzeptiert, nun muss ich für sie unterschreiben.
Mittlerweile liegt Hilde Domin quer im Bett, rutscht immer mehr an den Rand, sucht menschliche Nähe.
Quer im Bett zu liegen war ihre Eigenart: Jederzeit war sie bereit sofort aufzuspringen. Fluchttier.
Jetzt gibt sie dem Pflegepersonal mit energischer Stimme Anweisungen: »Nein, nicht schmerzhaft langsam ausziehen. Nehmen Sie eine große Schere und schneiden Sie das alles auf!«, fordert sie den zögernden jungen Pfleger auf, und der durchtrennt die gute Kleidung. Soll sie sich in dieser Situation um so etwas Unwesentliches wie Kleider sorgen?
»Sag dem Schoßhund Gegenstand ab.«1 Wie alltagstauglich die Worte aus Hilde Domins Gedichten sind.
Zwischen den Schmerzschüben besprechen wir, was zu erledigen ist: die morgige Lesung absagen, die Blumen gießen, die geplante Italienreise stornieren und ihren Kulturbeutel so packen, als ob wir verreisen.
»Mein Herze wir sind verreist« – die Zeilen aus dem Abschiedsgedicht für ihren Mann Erwin Walter Palm bewegen mich.
Ein junger Assistenzarzt tritt ans Bett: »Sind Sie nicht Hilde Domin?« – »Ach, Sie kennen meine Gedichte?« – »Nein, aber mein Vater ist der Künstler, der vor kurzem in Darmstadt die Büste von Ihnen angefertigt hat. Ich habe Sie wiedererkannt.«
Immer haben Hilde Domins Lebenswege Kreise gezogen.
Der Pfleger holt Hilde Domin ab, um sie zum Operationssaal zu fahren. Ich begleite sie, halte sie fest an ihrer Hand.
»Wir gehen jeder für sich den schmalen Weg über den Köpfen der Toten – fast ohne Angst – im Takt unseres Herzens, als seien wir beschützt.«2
An der Schleuse zum Operationssaal dann ihre Bitte: »Ach Liebste, komm doch mit rein. Ich habe Angst.« Wie kann ich sie trösten? Ich küsse sie zum Abschied auf die Stirn: »Liebes, bedenke doch, dass du in so guten Händen bist.« Hilde Domin schaut mich lange an: »Ja, ich bin in guten Händen.«
Ich ahne nicht, dass dies ihre letzten Worte an mich sind.
Mittlerweile ist es kurz nach fünf Uhr. Den Anruf des Arztes erwarte ich zu Hause, habe die engsten Freunde über den Unfall informiert, die Anweisungen erledigt. Mit den Freunden stelle ich schon einen Dienstplan für die Zeit der Rehabilitation auf.
Der Anruf des Professors kurz vor sieben Uhr besteht aus zwei Nachrichten. Der Chirurg ist zufrieden, die Operation ist optimal verlaufen. Er reicht den Hörer weiter. Der Anästhesist dagegen klingt besorgt, man hat Hilde Domin bereits einmal reanimiert. Auf dem Weg zum Wachraum hat das Herz kurzzeitig versagt.
Hat Hilde Domin das Unabänderliche, die Operation, mit Disziplin absolviert, doch jetzt verweigert sich der Körper einem pflegebedürftigen Leben?
Um sieben Uhr bin ich wieder in der Klinik. Hilde Domin liegt im Wachraum, an viele Geräte angeschlossen – als könnten die kleinen regelmäßigen Kurven ein Abbild ihres bewegten Lebens sein.
Zweimal hat man sie mittlerweile reanimiert. Jetzt schläft sie tief. Der Anästhesist ist zuversichtlich, der Zustand der Patientin scheint endlich stabil zu sein. »Im Laufe der Nacht wird sich wohl nichts mehr ändern. Sie sollten jetzt nach Hause gehen. Wir informieren Sie umgehend, wenn sich der Zustand der Patientin verändert.«
Um kurz nach neun Uhr verlasse ich die Klinik. Ich bin noch keine zehn Minuten unterwegs, als mein Mobiltelefon klingelt. »Vielleicht ist es doch besser, Sie kommen wieder, der Zustand der Patientin ist kritisch.« Um 21.29 Uhr eile ich in den Wachraum, über dem die großen Zeiger die Zeit weiterschieben. Die Schwestern halten mich auf. »Bitte warten Sie noch einen Moment.« Hilde Domin ist um 21.28 Uhr gestorben.
Sie scheint nur zu schlafen, noch warm, rosig, friedlich. Sie wird mich spüren, ich halte sie bis Mitternacht im Arm.
Mich ruft der Gärtner.Unter der Erde seine Blumensind blau.
Tief unter der Erdeseine Blumensind blau.
1. KAPITEL
KINDHEIT UND JUGEND
1909 – 1929
Unter den sorgsam ausgebreiteten Fittichen meiner Mutter
Hilde Löwenstein an ErwinWalter Palm, 29. 3. 1932
Der 27. Juli 1909 versprach kein Sommerwetter. Als sich der Kölner Rechtsanwalt Dr. Eugen Siegfried Löwenstein an jenem Dienstag früh morgens auf den Weg zur Redaktion der Kölnischen Zeitung machte, waren die Ausläufer des Tiefs der vergangenen Nacht noch spürbar. In der Pfalz hatte das Unwetter die gesamte Ernte von »Getreide-, Tabak-, Wein- und Hackfrüchte[n] total zerschlagen«.1 Die Luft war mit fünfzehn Grad eher frisch, und auch der Rhein schob sich mit nur mäßiger Wassertemperatur träge an den kaum bevölkerten Rheinufern vorbei. Sein sonst südlich anmutendes, opalisierendes Blau war an diesem Tag unaufregend grau.
Aufregung herrschte dagegen bei vielen Kölnern, die der bevorstehenden Ankunft des neuen, wiederhergestellten Zeppelin II entgegenfieberten, der, von Graf Zeppelin persönlich geführt, am kommenden Freitag in der Domstadt landen sollte.
Kaiserwetter herrschte nicht, doch kaiserlichen Geburtstag gab es zu feiern: den 21. Geburtstag von Kaisersohn Oskar. Tags zuvor war er unter feierlichen Würden von der Bonner Universität voller Lob exmatrikuliert worden; die Kaiserin war mit den Geschwistern Prinz Joachim und Prinzessin Viktoria Luise eigens per Automobil aus Berlin angereist.
Der Spaziergang in der klaren Luft tat Eugen Löwenstein nach einer aufregenden Nacht gut. In die Morgenausgabe der Kölnischen Zeitung hatte er wohl nur kurz geschaut. Neben Meldungen aus den deutschen Protektoraten – »Diamantfelder an der Spencerbucht in Deutsch-Südwestafrika erschlossen« – hatten Berichterstatter Artikel über die politischen Unruhen in Südeuropa und Nordafrika gekabelt: es ging um »das tatkräftige und unbeugsame Vorgehen der türkischen Regierung in Albanien und Mazedonien, um die dort lebenden Balkanvölker zur staatlichen Ordnung und Ruhe zu verpflichten«, vor allem aber um die »kriegerische Auseinandersetzung zwischen dem spanischen Militär und den marokkanischen Rifkabylen um die Festung Melilla an der nordafrikanischen Mittelmeerküste«2: Ereignisse, die eher Anlass zur Sorge gaben.
Doch es war ein anderes Ereignis, das Eugen Löwenstein an jenem Julitag bewegte: Er war Vater geworden. In den frühen Morgenstunden war sein erstes Kind, eine Tochter, in der heimischen Riehlerstraße 23 zur Welt gekommen, und nun hatte er es eilig, in die Redaktion der Kölnischen Zeitung zu gelangen. Freunde und Bekannte sollten noch am Tag der Geburt seiner prächtigen Tochter von dem freudigen Ereignis in Kenntnis gesetzt werden.
Bereits in der Mittagsausgabe war die Anzeige in der klassischen Diktion jener Tage gesetzt – zu Extravaganzen ließ sich der Jurist nie hinreißen.
Über den Namen schien man sich noch nicht geeinigt zu haben, doch er stand fest, als der Standesbeamte vier Tage später, am 31. Juli, in fein gesetzter deutscher Schrift die offizielle Eintragung in die Geburtsurkunde vornahm: Die Tochter von Eugen Siegfried und Paula Löwenstein sollte die Namen Hildegard Dina tragen; Dina nach der Großmutter väterlicherseits.
War der Vater aufgeregt oder der Standesbeamte unaufmerksam gewesen? Für Männer mag es nicht von Bedeutung sein, ob die kleine Hildegard »mittags um eineinhalb Uhr«3, wie man es in der Geburtsanzeige lesen würde, oder »morgens um 1.20 Min«4 ihren ersten Schrei hören ließ: Mutter Löwenstein hielt in ihrem Jugendstiltagebuch mit dunkelbraun-goldenem Ledereinband die frühe Morgenstunde als Geburtszeit fest.
Die kleine Hildegard war mit nur fünf Pfund und hundertsechzig Gramm Geburtsgewicht eher ein zartes Baby. Vielleicht kam auch deshalb ab dem 31. Juli eine Amme in die Riehlerstraße, die nun zweimal täglich, zusätzlich zu dem Fläschchen, das Baby nährte. Und hatte die Kleine bisher bedenklich wenig getrunken, so schien sie an der Brust der Amme begierig zu saugen: in dem eleganten, kleinen Tagebuch Paula Löwensteins liest man erfreut vom schnellen Gewichtszuwachs. Wie für jede Mutter bei ihrem ersten Kind waren auch für Paula Löwenstein die Entwicklungsschritte ihrer Tochter sensationell und der Dokumentation würdig – die Milchmischung: »500 Wasser 500 Milch 1 Löffel Zucker für das Siebenmonatige«, ebenso wie die ersten festen Mahlzeiten: »Kalbfleischsüppchen und abwechselnd Spinat und Möhrchen, abgeschabte Bananen und Apfelbrei«, oder die ersten Schritte am 8. Dezember 1910. Nur die ersten Worte hatte Paula Löwenstein verpasst: Da war sie auf Besuch bei ihrer Schwester in London gewesen.
Dass das Baby »Hille« – wie es die Mutter zärtlich nannte – einer Amme anvertraut und von ihr gestillt wurde, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter großbürgerlichen Familien durchaus verbreitet: Dem Kind wollte man das Beste bieten, nämlich Muttermilch, doch die Frau des Hauses sollte für die gesellschaftlichen Repräsentationspflichten nicht durch zu intensive Kinderbetreuung gebunden sein, sondern den Mann auf Reisen begleiten, Gesellschaften und den großen Dienstbotenhaushalt organisieren. Auch die Eltern Löwenstein waren oft ohne ihre Kinder unterwegs, die dann von dem Kindermädchen betreut wurden oder auch bei der Schwester Paula Löwensteins, Gretel Kolmar, in Mannheim unterkamen.
Der promovierte Rechtsanwalt konnte zufrieden sein: seine Tochter war durch seine wohlgestaltete Lebensplanung in ein wirtschaftlich gesichertes Elternhaus hineingeboren worden. Er war »so völlig untadelig«, dass man sich insgeheim vielleicht über den sensiblen kleinen Mann lustig machte, der stets auf sein korrektes Auftreten achtete.
Eugen Siegfried war am 7. Juni 1871 als zweiter Sohn des Privatiers Lehmann Löwenstein und dessen Frau Dina, geborene Alsberg, auf die Welt gekommen. Sein Vater hatte sich später dem Berufswunsch des Sohnes nicht widersetzt: Eugen Siegfried Löwenstein durfte wie sein Vetter Max Alsberg die juristische Laufbahn einschlagen.
Die Familie Löwenstein war bereits 1888 von Düsseldorf nach Köln übergesiedelt.5 Im Alter von siebzehn Jahren hatte sich Eugen zum Jurastudium entschlossen, während sein älterer Bruder Leo in Düsseldorf das Familienunternehmen weiterführen sollte. Emil, der jüngste Bruder, lebte mit Frau und den Kindern Franz und Edith in Berlin.
Eugen Löwensteins Jurastudium war geradlinig verlaufen. Er hatte in Köln und Genf studiert, am 28. Juni 1893 sein erstes Referendarexamen abgelegt und ein Jahr später promoviert. Nach der Ernennung zum Gerichtsassessor war er seit August 1899 als Rechtsanwalt am Amtsgericht und Landgericht zugelassen – doch »ein Rechtsanwalt beim Oberlandesgericht war mehr als einer beim Amts- und Landgericht.«6 Die Hürden, um zu dieser Instanz zugelassen zu werden, waren für jüdische Anwälte nahezu unüberwindbar. Eugen Löwenstein war kein Kämpfer, er ließ sich lieber mit einer eigenen Kanzlei nieder. Zum Zeitpunkt seiner Heirat hatte er bereits eine gutgehende Praxis, »hauptsächlich in Wirtschafts- und Handelssachen.«7 Er genoss mit seinem aufrichtigen, zurückhaltenden Wesen hohes Ansehen innerhalb der Anwaltschaft, denn er war »bei dem Schiedsgericht der Börse als Anwalt für große Parteien in großen Sachen« tätig.8 Sein ehemaliger Referendar Dr. Rudolf Callmann, der in die USA ausgewandert war, bestätigte die solide wirtschaftliche Situation der Anwaltskanzlei.9
Die Hochzeit Eugen Löwensteins mit der am 2. März 1882 geborenen Paula Trier aus Frankfurt am Main hatte seine Mutter nicht mehr erlebt; sie war einige Jahre zuvor gestorben. Am 24. Oktober 1908 gaben sich Eugen Siegfried und Paula in der Heimatstadt der Braut das Jawort. Die Einträge in der Heiratsurkunde – auch dort in den feinen Buchstaben der deutschen Schrift – belegen, dass sich beide Brautleute zur »israelitischen Religion« bekannten und dass Paula Trier »ohne Beruf« in den Stand der Ehe trat. Doch sicherlich nicht ohne Selbstbewusstsein: Mit ihrer zum ersten Mal offiziell gesetzten Unterschrift ihres neuen Familiennamens auf der Heiratsurkunde Nr. 971 überschrieb Paula Löwenstein unbekümmert und deutlich den markigen Abschlussbogen der Signatur ihres Ehemanns, der die ihr zugedachte Zeile im Stammbuch fast völlig vereinnahmt hatte.
Paula Triers Eltern, Alexander Trier, ein angesehener Kaufmann, und seine Frau Laura, geborene Mayer, wohnten in Frankfurt in der Eschersheimer Landstraße 32 – im heutigen Holzhausenviertel, das schon damals als eine der schönsten Wohngegenden Frankfurts galt. Wer hier wohnte, hatte es geschafft – eine Einschätzung, die auch heute noch ihre Gültigkeit besitzt. Allerdings ist die ländliche Beschaulichkeit der Jahrhundertwende längst flutendem Verkehrslärm gewichen.
Über die Umstände des Zusammentreffens zwischen der Tochter aus gutem Frankfurter Hause und dem Kölner Rechtsanwalt ist nichts Näheres bekannt. Die Vermutung liegt nahe, dass die Freundschaft innerhalb des damaligen Netzwerks jüdischer Kaufmannsfamilien zustande gekommen war, denn wie Eugen Löwenstein entstammte auch Paula Trier einer jüdischen Privatiersfamilie. Es könnte so gewesen sein, wie es in jüdischen Kreisen durchaus üblich war: »Damals gab es bei den Juden keine Liebesheiraten. Die Verhandlungen fanden zwischen den älteren Familienmitgliedern statt, und die Brautleute trafen sich erst, wenn die Geldfrage geregelt war.«10 Sowohl Paula mit siebenundzwanzig als auch Eugen Löwenstein mit achtunddreißig Jahren waren keine jungen Brautleute. Paula Trier hatte in ihrer Mädchenzeit mehrere Jahre in England verbracht11, wo ihre bildschöne Schwester Marie-Luise in eine sehr wohlhabende Familie eingeheiratet hatte. Ihre Schwester Gretel war in Mannheim verheiratet. 1938 sollten sich die Familienbande nach England schließlich als lebensrettend für die Familien Löwenstein und Palm erweisen.
Paula Löwensteins behinderter Bruder, Franz Trier, lebte bis zu seinem Tod im September 1931 bei seinen Eltern in Frankfurt. Und was die dreiundzwanzigjährige Nichte Hilde von seinem Leben in Erinnerung behielt, erschien ihr wenig lebenswert: »Traurig war das Leben meines Onkels, der seit einer Kinderkrankheit blind und kränkelnd die letzten Jahre dahinsiechte und dessen Seele längst gestorben ist.« Vielleicht hatte das Leiden des Onkels ihre Vorstellung vom Tod geprägt: Schnell, ohne lange Gebrechlichkeit sollte das Leben enden. Nie wollte sie »ein Etwas sein, das einen Platz im Dasein […] zum Leidwesen und zur Qual seiner Nächsten und nicht zur eigenen Freude hat, denn so ein Leben, an dem der Tod das Beste ist, ist eine Gemeinheit. Es ist besser, nicht an Gott zu glauben als ihm eine Schuld an dieser Sinnlosigkeit zu geben.«12 Durch seinen Tod wurde der Onkel »endlich erlöst«.13
Dass die junge Paula Trier ohne Beruf in den Stand der Ehe trat, war für Töchter aus gutem großbürgerlichen Elternhause durchaus üblich. Das jüdische Mädchen erhielt die Erziehung, die standesbewusste, wohlhabende Eltern ihrer Tochter angedeihen ließen: Haushaltsführung und Klavierspielen mit Gesang. »Meine Mutter war als Sängerin ausgebildet«14, idealisierte Hilde Domin in ihren Lebenserinnerungen den Bildungsstand der Mutter. Denn öffentlich aufgetreten war sie nur ein einziges Mal, in Frankfurt. Die Mutter hatte sich in ihr Schicksal gefügt und den Traum von der eigenen Selbstverwirklichung zurückgestellt. Auf den Lebensweg ihrer Tochter versuchte sie aber Einfluss zu nehmen. Sie selbst konnte ihr Leben frei und selbstbewusst innerhalb der großbürgerlichen Wände ausleben; sie führte unkonventionelle Turnübungen ein: »jeden Abend nach dem Grammophon Gymnastik und dito morgens eine Viertelstunde, denn dies mache gesund, gewandt und dünner.«15 Hilde Löwenstein war gewillt, bei jedem Hausbesuch »nach Noten« zu hungern und auch der Sohn, Pummelchen Hans, kam später nicht darum herum. Die Mutter hatte ein Temperament, »das war des Bombenwerfens fähig«16, und von der Mutter wurde ihr die Selbstverständlichkeit vermittelt, Wahrheiten zu benennen, selbst wenn sie für den Adressaten unangenehm sein mochten: »Du musst mir ja auch gestatten – außer Süßholz zu raspeln, ab u. zu meine Meinung […] zu sagen, ob die Worte grade nach Deinem Geschmack sind oder nicht.«17 Wenn auch nach außen die Stellung des Vaters als Autoritätsperson nicht in Frage gestellt wurde, so spürten die Kinder, dass die Mutter das Regiment führte. Sie umgab ihre Kinder mit einer Zärtlichkeit, die ihnen lebenslang eine schützende Hülle sein würde.
… als umhüllten mich Tücher,
von lange her
aus sanftem Zuhaus
von der Mutter gewoben18
Von Kindesbeinen an vermittelte die Mutter den kleinen Löwensteins durch ihre Erziehung aber auch, dass sie etwas ganz Besonderes seien: Sie förderte jede Extravaganz der Kinder, ließ sie ihren Individualismus ausleben und unterstützte es, dass sich ihre Sprösslinge von der Masse abhoben. Erst viele Jahre später beurteilte Hildes Bruder die elitäre Erziehung kritisch: »Wenn wir nicht beide so erzogen worden wären, dass wir uns für was Besonderes halten würden, so hättest Du Dich schon seit langem mit etwas weniger als dem besten zufrieden gegeben und ich wäre schon längst verheiratet.«19
Die junge Familie bewohnte in der Riehlerstraße 23 eine herrschaftliche Wohnung im großbürgerlichen Stil – das »Großbürgertum war es sich schuldig, ein Haus zu führen, das ihrem Range entsprach.«20
Die Riehlerstraße war eine breite, auf beiden Seiten von imposanten Ahornbäumen gesäumte Allee. Die Kanzlei des Vaters lag in Fußnähe zur Wohnung, doch die Kinder schätzten mehr, dass sich damals an die Riehlerstraße auch eine Schwimmanstalt sowie die Tennisplätze des »Schwarz-Weiß Clubs« anschlossen, in dem es Hilde und ihr Bruder Hans zu mannschaftsreifen Leistungen brachten. Der Vater ließ es sich in den Sommermonaten nicht nehmen, mit seiner Tochter noch vor der Arbeit zum Schwimmen zu gehen; schon früh wurde so die Begeisterung fürs Schwimmen geweckt, die sich Hilde Domin bis ins hohe Alter bewahrte.
Die Wohnung der Löwensteins lag in keinem typischen Judenviertel, Ghettos gab es in Köln nicht; und dennoch schienen unsichtbare Mauern einer Gleichberechtigung zwischen Juden und Nichtjuden entgegenzuwirken. Die Juden in Köln waren als Bürger geduldet, jedoch nicht integriert. Die Kölner blieben unter sich. Sie waren auf jüdische Bankhäuser oder Handelsmonopole der Juden nicht angewiesen, da es einflussreiche katholische Bankhäuser gab und das Kölner Patriziertum sich somit seine Unabhängigkeit bewahrte. »Das jüdische Kapital war in Banken investiert und in großen Handelshäusern, worunter die Warenhäuser, etwa solche der Dynastie Tietz besonders hervortraten. Die Kölner Industrie jedoch gehörte dem uralten ›Kölner Klüngel‹, besaß auch eigene Bankverbindungen. Da gab es nach 1933 kaum etwas zu arisieren. Aber die späteren ›Kaufhöfe‹ in deutschen Städten waren Produkte einer fröhlichen Entjudung.«21
Viele Juden ließen sich taufen, doch die erhoffte gesellschaftliche Gleichberechtigung blieb aus. Allenfalls von jüdischen Künstlern weiß man, dass sie Zugang zu den Häusern des nichtjüdischen Großbürgertums hatten; der Philosoph Max Scheler und der Komponist Otto Klemperer, beide aus Köln, waren zum Katholizismus konvertiert. Ein Jude würde immer wieder die Erfahrung machen: Assimiliert zu sein war nicht mit Gleichberechtigung zu verwechseln.
Die Familie Löwenstein gehörte zu den assimilierten Juden, wie Hilde Domin immer betonte; man feierte Weihnachten und suchte an Ostern Ostereier. Doch die Familie Löwenstein ließ sich nicht taufen, und der Anwalt Löwenstein beschäftigte als Urlaubsvertretung in seiner Kanzlei vorwiegend jüdische Kollegen.22 Jiddische Wörter fanden Eingang in die Alltagssprache der Löwensteins: »Von was für Lächerlichkeiten man doch abhängig ist […] nebbisch kann man das nur nennen. (Du weißt, dass ich auf dies miese jüd. Wort nicht verzichten mag. Übersieh es gnädigst.) […] Ich bin innerlich zutiefst zufrieden […] du hingegen bist (s.o.) ein Schlehmil«23, schrieb Hilde Löwenstein 1931 an Erwin Walter Palm, der bald alle jüdischen Wörter aus dem gemeinsamen Sprachgebrauch verbannte.
Die Wohnung der Löwensteins könnte stellvertretend für den Anspruch des jüdischen Großbürgertums stehen: Trat man in die Wohnung ein, so gelangte man zuerst in das große Esszimmer. Mit den wuchtigen, schwarzen Eichenmöbeln, »aus dem Nürnberger Deutschen Museum kopiert«24, war es »ganz und gar im Jugendstil eingerichtet, dieser … germanischen ›Neuen Kunst‹«.25 Eine wandbreite Schiebetür trennte es von der Bibliothek oder dem sogenannten Herrenzimmer ab, das den Eltern als Wohnzimmer diente. Die Bibliothek war üppig ausgestattet und breit gefächert (»Meyers Klassiker, meterweise und unersetzliche[] Ausgaben, wie Elsters Heine«26), und die kleine Tochter durfte schon frühzeitig lebhaft Gebrauch davon machen – abgeschlossen wurde der Bücherschrank nämlich nicht.
Hildegard begeisterte sich für die eindrücklich anschaulichen »Schönsten Tiergeschichten« von Ernest Thompson Seton27, las später dann mit Leidenschaft Felix Dahns »Ein Kampf um Rom« und »natürlich Winnetou. Schwabs Sagen des klass. Altertums kannte [sie] z.T. auswendig. Sehr bald schon kam der junge Goethe.«28 Auch Theodor Storms Gedicht »Von Katzen« liebte sie und kannte alle Strophen auswendig. »Auf die Dauer kommt eben doch heraus, was man als Kind am Bett stehen gehabt hat, unweigerlich. […] Da stand eben Goethe, und auch Heine nachher. Und dann Rilke. Und eben nicht diese gestrengen Horaze und Vergile …«29
An das Esszimmer schloss sich der großzügige Salon an, in dem der wertvolle Stutz-Flügel der Mutter bei großen Empfängen repräsentative Zwecke für die elegante Gästeschar erfüllte: In Abendkleidern und Smoking oder Frack pflegte man gemeinsam im »Salon« der Mutter und anderen Sängern und Sängerinnen oder Pianisten zuzuhören.
Die Kinderzimmer lagen beide zur Straße hinaus, und das kleine Mädchen vergaß die Welt um sich, wenn sie stundenlang die Geschehnisse auf der Straße beobachtete, »besonders im Winter, um die dicken Kohlenpferde nicht zu versäumen, die mit viel Ächzen in die richtige Position gebracht wurden, wo der Wagen umkippen und die Kohle in den Keller geschaufelt werden konnte.«30 Auf der dem Hof zugewandten Seite befanden sich das elterliche Schlafzimmer, das Bad, die Küche und die Vorratskammer. In den zur Wohnung gehörenden zwei Mansardenzimmern war das Hauspersonal untergebracht.
Paula Löwenstein stand dem Haushalt vor, kontrollierte Haushaltsführung und Hausverwaltung und verwahrte den Schlüsselkorb, damit das Silber und das Rosenthalporzellan unter Verschluss blieben. Den obligatorischen Schlüsselkorb, das Attribut einer großbürgerlichen Haushaltsführung, gab keine der wohlsituierten Hausfrauen in jenen Jahren aus der Hand. Frau Löwenstein legte den Tagesplan fest, für dessen Bewältigung ihr zwei Kindermädchen und eine Köchin zur Seite standen. Später sorgte sich dann nur noch ein Kindermädchen um den Nachwuchs. Das Leben der Ehefrau und Mutter war ganz auf das Wohlbefinden des männlichen Familienvorstands ausgerichtet. »Mein Vater war das Selbstverständliche. […] Es gab eine feste Routine, die er bestimmte.«31 Und so wurde das Essen aufgetragen, sobald der Vater klingelte.
Hilde und ihr Bruder Hans besuchten keine Volksschule, sondern wurden bis zum Eintritt in eine weiterführende Schule von Privatlehrern unterrichtet – auch das entsprach großbürgerlichen Gepflogenheiten. Das Kindermädchen im löwenstein’schen Haushalt war katholisch – in jüdischen Haushalten wurden oftmals bevorzugt katholische Mädchen eingestellt, denn die durften am Sabbat arbeiten. Die Eltern schienen dem Einfluss des katholischen Kindermädchens nicht entgegenzuwirken, konnten anderseits nicht absehen, wie traumatisch sich ein österlicher Kirchenbesuch im Heimatort des Mädchens auswirken sollte. In der katholischen Pfarrkirche »Heilige Drei Könige« in Ronsdorf schien der kindliche, vertrauensvolle Glaube der siebenjährigen Hilde an einen liebenden Gott so nachhaltig erschüttert worden zu sein, dass sie auch später noch von dem »Ronsdorfer Kinderschrecken« sprach: »In dieser Dorfkirche erfuhr ich, daß Judas oder die Juden, aber es war dasselbe, Jesus verraten hatten. Das war ein furchtbarer Schmerz für mich, eine unakzeptable Mitteilung. Schreiend stand ich auf und lief, laut heulend, […] den Mittelgang hinaus aus der Kirche, das entsetzte Mädchen hinter mir her.«32 »Von diesem Angstpol her weht[e] dauernd der kalte Wind der Furcht und des Misstrauens«,33 wenn man Hilde auf ihr Judentum ansprach.
Doch erst »nach dem Krieg, in diesem Falle, nach dem ersten«34, setzten die Kindheitserinnerungen Hilde Domins richtig ein. Da war sie neun Jahre alt und hatte einen kleinen Bruder, der drei Jahre jünger war als sie.
Hans Löwenstein war am 15. März 1912 auf die Welt gekommen und hatte von Anfang an eine schwierige Stellung als Bruder einer Schwester, die immer schon durch ihren Scharfsinn, ihre Wissbegierde und ihre originelle Lebensfreude im Mittelpunkt stand. Auch wenn Hilde Domin bis ins hohe Alter vehement dementierte, dass ihr Bruder wohl unter der Dominanz seiner älteren Schwester gelitten haben musste, so schien er lange nicht aus dem Schatten seiner Schwester heraustreten zu können.
Die kleine Hildegard wollte ihren Bruder zwar nicht »für ganz Köln hergeben«, eifersüchtig war sie dennoch. Sie wollte nicht, dass der Kleine auch Löwenstein heißt: »Er kann überhaupt froh sein, dass er Hans heißt.« Ein zweites Brüderchen sollte nicht mehr kommen: »erstens ist er zu klein und macht alles kaputt, ist er größer will er alles haben.« Besser wäre da schon ein kleiner Hund. Und Hilde fragte die Mutter, was sie dem Klapperstorch hinauslegen müsse, damit der ein Hündchen bringe.
Dem Tagebüchlein, das die Mutter für Hans anlegte, fehlte deshalb auch die Exklusivität des braunen Jugendstilbuchs. In einem kleinen blauen Vokabelheftchen kann man die Trinkmengen des Säuglings nachlesen und auch, dass er »überaus herzlich, und zärtlich und sehr musikalisch« war. Der kleine Hans sang schon bald die gängigen Kinderlieder: »die Vöglein im Walde sie sangen so wunderschön – ich hatt einen Kameraden – Gloria Victoria – Holla huh horch was kommt von draußen her – Stillille Nacht«.35 Doch über Hilde gab es mehr zu berichten. Schon früh war der Mutter an ihrer kleinen Tochter die scharfe Beobachtungsgabe für Details aufgefallen: Als Paula Löwenstein dem Kindermädchen eine abgetragene Bluse von sich schenken wollte, gab die Dreijährige zu bedenken, dass das gute Stück sowieso nicht passen würde, denn der Busen der Mutter sei doch viel größer als der des Mädchens.
Hilde war die Drolligere und Wortgewandtere – und außerdem von entwaffnender Offenheit: das »enfant terrible«, das der Tante mit den Worten des Onkels sagte, dass ihr Klavierspiel »alles andere als schön«36 sei. Hilde war die Niedliche: »um das Gesicht, das sehr rund und rosig war, hingen hellbraune Locken, die [ihre] Mutter jeden Morgen vor der Schule über einen Stock bürstete, was sehr lange aufhielt und auch sehr unangenehm war. Zwei hingen und je eine wurde quer darüber gesteckt.«37
In Hilde Domins Lebenserinnerungen spielt der kleine Bruder keine große Rolle. »Mein Bruder war nie dabei«38, erinnert sie sich in »Gesammelte autobiographische Schriften«, wenn sie vom gemeinsamen Schulweg mit dem Vater oder vom Schwimmen noch vor der Schule erzählt. An der Hand des katholischen Kindermädchens aber spazierten die Geschwister gemeinsam durch den Zoo, der sich in Köln, wie auch in anderen großen Städten, enormer Beliebtheit erfreute.
Das Elternhaus vermittelte familiäre Geborgenheit. Konnten beide Kinder so das Urvertrauen entwickeln, von dem sie lebenslang würden zehren können? Für Hilde Löwenstein schien das mehr zuzutreffen als für ihren Bruder, und vielleicht resultierte daraus der Wunsch des kleinen Hans, Kabarettist zu werden, weil er intellektuelle Anerkennung durch komödiantischen Witz kompensieren wollte. Sein Talent war so augenscheinlich, dass kinderlose Verwandte aus den USA ihn nach einem Besuch in Köln unbedingt mit in die Staaten nehmen wollten, um dort aus ihm einen Kinderstar zu machen.
Die Eltern waren zärtliche Eltern, was Respekt und Strenge nicht ausschloss. Solange die Kinder klein waren, siezten sie Mutter und Vater. Geduzt wurden nur die »Mädchen«.
Als der kleine Hans Löwenstein eine ödipale Phase durchlebte, wie viele Jungen in diesem Alter, schickten ihn seine Eltern zu dem Kölner Psychiater Dr. Mannheim, der ihn »gegen die eigenen Gefühle beeinflusst hat«, da die Eltern »inzestuöse Gefühle« befürchteten.39
Klein an Größe blieb Hans Löwenstein, und weder strenge Gymnastik noch eiserne Diäten änderten etwas an den stämmigen Beinen, die sowohl er als auch Hilde von der Mutter geerbt hatten. Selbstbewusstsein entwickelte er erst spät, noch 1948 sah sich die Mutter genötigt, Hilde zu versichern, dass »John’s personality has changed and he copes so much better with his situation.«40 Als ihn die politischen Ereignisse 1936 in die USA verschlugen, naturalisierte er seinen Namen, nannte sich John Lorden und warf mit dem deutschen Hans endgültig auch die Last der Jugend ab.
Für die umfassende kulturelle Bildung sorgte der Vater, der seine Kinder schon von klein auf ins Theater oder auch ins Gericht mitnahm. Gemeinsam besuchte Konzerte in Salzburg oder die sonntäglichen Besuche in der Kölner »Galerie« eröffneten den Kindern den Zugang zur Kunst – nicht nur zu ihrer Freude, denn der Anspruch, den der Vater damit verband, war oft alles andere als pures Vergnügen. Des Vaters Wissensproben: »Wer malte die weißen Pferde, Hans?«, ließen einen wütenden Sohn zurück, der es hasste, dergestalt auf seine kulturellen Wissenslücken hingewiesen zu werden. Dass der Maler »Wouwermann« hieß und bevorzugt Pferde malte, hat Hilde Löwenstein dagegen nie vergessen. Und doch nahm sie gerade bei den Museumsbesuchen die zarte, hochsensible Seite im Wesen des Bruders wahr. Als empfindsamer Beobachterin fiel der Schwester auf, dass der Bruder »ein unverdorbenes Gemüt und einen guten Blick« hatte, sich »ordentlich für ein paar gute Bilder« begeistern konnte: »seine sehr natürlichen und warmen Bemerkungen hoben vieles aufs vorteilhafteste von Vaters ständiger Pseudo-Gelehrsamkeit ab.«41 Von dieser Sensibilität profitierte sie immer wieder.
Hilde war zwölf, als sie einer außergewöhnlichen Gerichtssitzung des Vaters beiwohnte, die sie so nachhaltig beeindruckte, dass sie damals den Entschluss fasste, Anwältin zu werden: »Wenn ich also zurückgehe auf das entscheidende Erlebnis meiner Kindheit, auf den Prozeß, bei dem mein Vater einen unschuldig Angeklagten gegen den Vorwurf der Brandstiftung verteidigte – der Mann war Zwangsmieter bei einem reichen Kölner Bürger, und der Prozeß verlief sehr irregulär. […] Es wurden die corpora delicti […] nicht aufgefunden, sie verschwanden, und es gab viele Falschaussagen, und es kam zu Krächen zwischen meinem Vater und dem Staatsanwalt. […] Einmal verließ mein Vater ganz aufgeregt den Saal und […] die wehende schwarze Robe, in der er damals auftrat, die machte einen solchen Auftritt noch dramatischer.«42 Der Prozess zog sich über Jahre hin, schließlich wurde der Angeklagte auf Eingabe Eugen Löwensteins von Hindenburg begnadigt. Dass ausgerechnet dieser Mandant einer der ersten war, der den jüdischen Rechtsanwalt nicht mehr grüßte, erschütterte Hilde Löwensteins Bild von Gerechtigkeit sehr.
Ausflüge in die Eifel, nach Manderscheid, der Heimatstadt des Mädchens, zählten für die Kinder zu den besonderen Höhepunkten. Denn dort wurden Ziegen gehalten, die sie hüteten; sie durften Kühe melken und bewunderten den Vater des Kindermädchens, der ganz bodenständig den Beruf des Dorfschmieds ausübte. In dieser Kleinstadt im Herzen der Vulkaneifel wurde Hilde Löwensteins Sensibilität für die Natur schon früh geprägt. Manderscheid mit seinen zerklüfteten Vulkanfelsen und einer ansehnlichen Jugendherberge war auch das Ziel für Schulwanderungen des Merlo-Mevissen-Gymnasiums, der späteren Schule Hilde Löwensteins. Die Bilder aus der Natur verbanden sich lebenslang mit dem Gefühl von Heimat und Geborgenheit.
Auch die für die damalige Zeit typischen Ausflüge in das nahe Siebengebirge schrieben sich im Gedächtnis fest. Bis Königswinter benutzte man die Eisenbahn, die sich herrlich an den Schleifen des Rheins entlang windet. Den schroffen Drachenfels erklomm man als besonderen Höhepunkt auf dem Rücken »eines Eselchens«, wie Hilde Domin nie müde wurde sich zu erinnern, wenn man die linksrheinische Zugfahrt nach Köln unternahm. Reichte die Puste auf dem Rückweg nicht mehr aus, so trat man den Heimweg auf dem Motorboot an.
Als Hilde Domin bereits in einem fortgeschrittenen Alter war, wurden die Fahrkarten für die Zugreise nach Köln mehr als einmal wieder umgebucht, weil der umsichtige Schalterbeamte eigenmächtig die kürzere rechtsrheinische Route gewählt hatte.
Für Höhepunkte im Familienalltag sorgte der Vater, der Mutter verdankte man das Lebenshandwerk. Frau Löwenstein trainierte die Fahrradkünste der Tochter – mit Stil: Sie überwachte aus der Straßenbahn, ob ihre Tochter sich sicher auf dem Schulweg bewegte. Sie bestand auf dem Klavierunterricht, den Hilde jedoch hasste. Viel lieber lag sie unter dem Flügel und lauschte der Mutter, die ihren Gesang auf dem Klavier begleitete.
Unkonventionell für damalige Zeiten und gegen die Erziehungsziele des gehobenen Bürgertums ließ die Mutter ihren Sprösslingen viel Freiheit beim Spiel in der herrschaftlichen Wohnung: Mit ihren Schaukelpferden durften die Geschwister die langen Flure entlang galoppieren, auf ihren kleinen Autos donnerten sie gegen die schweren Jugendstilmöbel, an trüben Herbsttagen funktionierten sie den großen Esstisch kurzerhand zum Ping-Pong-Tisch um.
Meerschweinchen und Kaninchen bevölkerten die löwenstein’sche Wohnung, bis sie sich »selbst abschafften«. Wie zum Beispiel auch der kleine Kanarienvogel, der frei in der Wohnung fliegen durfte. Er fiel Hilde Löwensteins Leseleidenschaft zum Opfer: Gefangen von Felix Dahns »Ein Kampf um Rom« versank sie im großen Sessel – und erdrückte den kleinen Vogel, der dort gesessen hatte.
Tiere und Bücher – Das großzügige Geldgeschenk des wohlhabenden Großonkels aus den USA halbierte die Fünfzehnjährige: Hundertfünfzig Reichsmark investierte sie in den kleinen blonden Hund der Rasse »King Charles«, hundertfünfzig Reichsmark in die Insel-Ausgabe von Goethe, die sie um den halben Globus begleiten sollte.
Hund und Hilde waren fortan unzertrennlich und Hilde verzichtete lieber auf eine Sehenswürdigkeit, als sich von ihrem Tier zu trennen. So wie beim berühmten Glockenspiel in Salzburg, als sie den jammernden Hund viele Straßen weitertragen musste, weil sein Gejaule die Touristen störte.
Durch Hildes Tanzstundenbesuch erhoffte sich vor allem die Mutter, dass ihre ungestüme Tochter mädchenhafter werden würde. Hilde tanzte gern und mit Leidenschaft, schloss sich jedoch den öffentlichen Tanzabenden nicht an. In Ermangelung anderer männlicher Partner für das Tanztraining musste Bruder Hans herhalten. Den durchgetanzten, ehemals edlen Webteppich bewahrte Hilde Domin auf – er begleitete sie auf ihren Exilwegen und lag bis zu ihrem Lebensende im Wohnzimmer der Heidelberger Wohnung: kahlgetanzt durch die ausgelassenen Schritte der jugendlichen Geschwister.
Der spätere Literaturkritiker und Schriftsteller Hans Mayer gehörte zu Hildes Tanzpartnern – der Tanzstunde konnte er ebenfalls nichts abgewinnen. Die Erinnerung an Mayer blitzte in einem ganz und gar unerwarteten Moment wieder auf: Nur widerstrebend sah sich Hilde Domin 2005 auf Einladung der Dominikanischen Botschaft in Berlin den Dorotheenstädtischen Friedhof neben dem Wohnhaus Brechts an – sie mied im Alter Gespräche über den Tod und scheute infolgedessen Friedhöfe. Beim Grab Hans Mayers stutzte sie: »Ach, merkwürdig, wir haben zusammen Tanzstunde gemacht. Er konnte gut Foxtrott tanzen.«43
Den Kriegsausbruch und seine Folgen erlebte die fünfjährige Hilde Löwenstein in relativer Unbekümmertheit. Obwohl die ersten Bomben schon 1914 auf Köln fielen, traumatisierten die wiederholten Bombenalarme das Kind offensichtlich nicht. Unter den sorgsam ausgebreiteten Fittichen ihrer Mutter wusste sich das kleine Mädchen geborgen. Vom Krieg wurde zu Hause »nicht gesprochen, obwohl [Vater] im Krieg gewesen war und irgendwo in seinem Kleiderschrank ein Eisernes Kreuz lag.«44 Wohl aber erinnerte sich Hilde an die bunten Postkarten, die der Vater aus Belgien schickte, wo er stationiert war, und an die getrockneten Würste, die er beim Heimaturlaub auspackte.
Auch nach der Rationierung von Lebensmitteln 1915 mussten sich die Löwensteins nicht sonderlich einschränken. So hinterließen die Wirren des Krieges bei der kleinen Hilde wenig prägende Erinnerungen. Nur an die Besetzung des Rheinlandes erinnerte sich Hilde Domin, denn auch die Löwensteins hatten »Einquartierung« – der die resolute Mutter ein schnelles Ende setzte: Einem jungen Friseur mit seinem Hund war ein Zimmer in der großen Wohnung zugewiesen worden. Nie würde Hilde Domin vergessen, dass der Mitbewohner dem Hund im elterlichen Salon den Schwanz kupierte. Hans und Hilde hatten ab sofort Keuchhusten und mussten bedrohlich husten, sobald jemand die Wohnung betrat.
Trotz der belastenden Jahre zwischen 1919 und 1924, bis zur Stabilisierung der Wirtschaft durch die Rentenreform, gehörten die Löwensteins nicht zu den Familien, die unter dem Verlust der Kaufkraft des Geldes durch die Inflation zu leiden hatten. Allein die Tatsache, dass das kleine Mädchen auf einem Fahrrad zur Schule fahren konnte, zeugte von einem soliden Wohlstand, denn »ein gutes Fahrrad war heiß begehrt.«45
Hilde Löwenstein hatte keine Grundschule besucht – die »richtige Schulzeit« war lange herbeigesehnt worden, und die Freude groß, als sie 1920 in die Städtische Merlo-Mevissen-Schule, »Lyzeum mit Studienanstalt der Gymnasialen Richtung«, eingeschult wurde.
Die Gründerin Mathilde von Mevissen, die zu den historisch bedeutenden Persönlichkeiten Kölns zählt, sah ihre Lebensaufgabe im Kampf für die Gleichberechtigung der Frauen. Sie war von ihrem autoritären Vater wirtschaftlich und sozial unterdrückt worden, man hatte ihr eine Schulbildung verweigert, so dass sie nach seinem Tod mit dem geerbten Geld ein privates Mädchengymnasium gründete, dem 1903 probeweise auch ein humanistisches Mädchengymnasium angegliedert wurde. Die Gleichberechtigung von Mädchen in Bildungsfragen durchzusetzen, galt in jenen Jahren als revolutionär. 1909 übernahm die Stadt Köln das private Unternehmen und schloss es mit dem Merlo-Lyzeum zusammen. Die Schule zeichnete sich durch ein liberales, überkonfessionelles Profil aus, das den Erziehungszielen der Löwensteins entgegenkam. 1934 wurde die Schule durch die Nationalsozialisten geschlossen.
Für die Liberalität der Schule sprach, dass Hilde Löwenstein sich vom Handarbeitsunterricht befreien lassen konnte – Näharbeiten hasste sie lebenslang. Befreit wurde sie auch vom Hebräischunterricht – Englisch, Französisch, Latein und Griechisch erschienen dem Vater für eine solide Bildung ausreichend.
Der Wissensdurst des quicklebendigen, eloquenten Mädchens und der permanente Anspruch auf Beachtung wird so manchen Lehrer zur Verzweiflung getrieben haben; wie sie selbst bekannte, war sie »ein in der Schule gefürchtetes Kind«, weil sie »immer schon alles gelesen hatte«.46 Dennoch war sie offensichtlich keine typische Streberin, sondern gewann durch Unbekümmertheit und Witz die Sympathie der Klassenkameradinnen; nur schwerlich wäre sie sonst zur Klassensprecherin gewählt worden, »sobald dies Amt eingeführt wurde«.47 Sie war für jeden Spaß zu haben, experimentierte schon früh mit der Sprache: Aber Aufsätze in Reimen verärgerten die Deutschlehrerin. Beachtung über den Schulalltag hinaus fand ein Schulaufsatz der Tertianerin über eine »Beweinung«. Diese Darstellung hatten sich die Schülerinnen damals in dem Museum am Hansaring angesehen, in der sogenannten »Schnütgen Sammlung«. Der Aufsatz wurde dem Museumsdirektor Schäfer vorgelegt, der Hilde Löwenstein daraufhin ins Museum einlud. Offensichtlich war er von der Sensibilität beeindruckt, mit der die Dreizehnjährige die Trauer und den Schmerz beschrieben hatte.
Für den pickelgesichtigen Lateinlehrer dagegen musste Hilde ein Albtraum gewesen sein: Sie versah die langen Rockschöße des Leidgeprüften mit Stecknadeln – einem Lateinlehrer in einer pubertierenden Mädchenklasse raubte das sicherlich den letzten Rest des ohnehin spärlichen Selbstbewusstseins.
Hilde Löwenstein besuchte den jüdischen Religionsunterricht; dem Rabbi war bekannt, dass ihre Familie sich eher zum liberalen Judentum zählte. Er verhehlte nicht seine kritische Einstellung zu solch »christlicher Folklore: Du Heide, jetzt komm mal, und sieh dir eine Synagoge an«48, empfahl er seiner Schülerin.
Kess war sie, die junge Hilde Löwenstein, das Außergewöhnliche zog »Hille« an, und die Mutter gab den Launen der Kinder nach, wenn zum Beispiel Hildes Bruder Hans extravagante Kostüme entwarf, die die Mutter einer Schneiderin zur Umsetzung gab und Hilde Löwenstein stolz präsentierte.
Der Vater, »so unelastisch und so aufrichtig und des Bösen so unfähig«49, beschmunzelte im stillen Einvernehmen die weiblichen Aktivitäten. Extravaganzen und ein Auftreten, das gegen die Regeln war, reizten das Mädchen und auch später Hilde Domin immer.
Den kämpferischen Geist der Schulgründerin hatte sich auch Hilde Löwenstein auf die Fahnen geschrieben, der emanzipierten Mutter sichtlich nacheifernd. Als vom 26. bis 28. Juni 1928 in Köln der Deutsche Frauentag abgehalten wurde, war die Schülerschaft des Merlo-Mevissen-Gymnasiums durch Hilde Löwenstein vertreten.50
Die Bildungsanstalt garantierte für die zweihundert Reichsmark Schulgeld, »vierteljährlich im voraus zu zahlen«51, ein breit gefächertes außerschulisches Bildungsangebot. Regelmäßige Exkursionen und Wandertage wurden mit der Sorgfalt ausgewählt, die man dem bildungsbeflissenen Großbürgertum schuldig war: Die Klassenfahrt der Oberprima sollte den erinnerungswerten Abschluss der Schulzeit bilden und führte Hilde Löwensteins Klasse vom 15. bis zum 24. Juni 1928 zu den Schillerfestspielen nach Weimar; den Naumburger Dom und die Wartburg in Eisenach nahm man auf dem Rückweg noch als kulturellen Nachtisch in das Programm auf.
Am 6. März 1929 legten vierzehn junge Mädchen ihre Reifeprüfung am Merlo-Mevissen-Gymnasium unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters Dr. h.c. Adenauer ab, der dieses Amt seit 1917 innehatte. Von den Mitschülerinnen Hilde Löwensteins gehörten acht dem katholischen und zwei dem evangelischen Glauben an, mit ihr bekannten sich fünf Mädchen zur israelitischen Religion.52 Die Religionsvielfalt unter den Abiturientinnen belegt einmal mehr die liberale Haltung der Schule.
Die Themen, an denen sich die Oberprimanerinnen im Fach Deutsch beweisen sollten, bezeugen humanistische Bildungsinhalte, deren Zeitlosigkeit bis in unsere Tage reicht:
-Warum hat Goethe recht, wenn er sagt, die Wertherzeit gehört nicht dem Gang der Weltkultur an, sondern dem Lebensweg jedes einzelnen?
-Die staatsbürgerliche Stellung der Frau nach der Reichsverfassung vom 11. August 1918
-Was zwingt uns immer wieder zur Auseinandersetzung mit der Gestalt Sokrates?
-Die geographischen Grundlagen der Weltmachtstellung Englands53
Hilde Löwensteins politisches und frauenbewegtes Selbstbewusstsein konnte sich für jedes der Themen begeistern. Großen Einfluss hatte die Englischlehrerin, die ihre politische Sichtweise prägte. Deren Reisen nach Griechenland weckten bei den jungen Mädchen Sehnsüchte, während die Kollegen derweil die rechte nationale Gesinnung anzweifelten.
Wie wenig gefragt die Vision eines geeinten Europas war, erfuhr Hilde Löwenstein leidvoll bei der mündlichen Abiturprüfung in Geschichte, in der sie ihre progressiven Thesen zum »Paneuropa« verteidigen musste. Sie verzieh dem Schulrat nicht, dass er ihre Visionen über das Europa Coudenhove-Kalergis nicht teilte und die Endnote herabstufte. Die einhellige Ablehnung der Prüfungskommission empörte die Abiturientin derart, dass sie zu Hause voller Gram ihr kostbares taubenfarbenes Samtkleid zerriss.
Der attraktive Graf Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, der die paneuropäische Vision in seiner eigenen Vita verkörperte – in Japan geboren, in Österreich aufgewachsen, mit tschechischer Staatsbürgerschaft in Frankreich zu Hause –, hatte im Alter von nur achtundzwanzig Jahren die paneuropäische Idee als Alternative gegen künftige Weltkriege entwickelt und damit 1922 Aufsehen erregt. Ideelle Mitstreiter fand er in Albert Einstein, Franz Werfel, Aristide Briand und Konrad Adenauer. In mehreren großen Städten, in denen Coudenhove-Kalergi seine Vorträge hielt, wurden Paneuropa-Vereinigungen gegründet und Thomas Mann wurde in der Münchner Sektion zum Ehrenvorsitzenden gewählt.54 Im Sommer 1927 erreichte die Sympathiewelle für den blendend aussehenden jungen Mann ihren Höhepunkt. Der politisch interessierten Hilde Löwenstein sprachen die Ideale von Freiheit, Frieden, Kultur und Wohlstand eines geeinten Europas aus dem Herzen. Dass der Visionär die jüdische Rasse adelte, rief im nationalistisch aufgeladenen Deutschland viele Gegner auf den Plan.
Wäre das Urteil der Lehrerschaft weniger niederschmetternd gewesen, wenn sie sich erinnert hätte, dass 1913 bereits Walter Rathenau ähnliche Thesen formuliert hatte? Er tat dies allerdings weniger unter dem politischen als vielmehr unter dem ökonomischen Aspekt.
Das Resultat von Hilde Löwensteins Abiturprüfung entsprach einer eher durchschnittlichen Leistung: Zwar bekam sie in den Fächern Religion, Deutsch, Latein und Griechisch die Note »gut«, eine Note in »Kunst« wurde nicht erteilt. Da sie aber in allen anderen Fächern mit »befriedigend« abschloss, ist nicht anzunehmen, dass sie zu den Klassenbesten zählte.55 Dennoch billigte man ihr das Privileg zu, die Abschlussrede der Abiturienten zu halten. In ihres Vaters Amtsrobe rechnete sie wie in einer Anklage auf humorvoll-ironische Art mit der Schule ab – der Mutter gedenkend und kein »Süssholz raspelnd«. Die Schulleitung diskutierte daraufhin, ob man der Abiturientin das Abschlusszeugnis verweigern sollte. Dass der Vater für diesen Anlass seinen offiziellen Talar zur Verfügung gestellt hatte, dokumentierte einmal mehr die »lange Leine«, die die Löwensteins ihrer Tochter gelassen hatten. Die Eltern nahmen aber auch den Berufswunsch der jungen Frau ernst, der in der Statistik des Jahrbuches ihres Abiturjahrgangs festgehalten wurde: Jurisprudenz.
Nach den Erholungsferien mit ihren Freundinnen Alice Brandenstein und Ellen Sternberg wollten Hildegard mit dem Jura-, Alice und Ellen mit dem Medizinstudium beginnen – fünfzig Jahre später traf Hilde Domin Alice in der Schweiz und Ellen in Israel wieder.
Als sich Hilde Löwenstein im Juni 1929 mit ihrer Mutter auf den Weg nach Heidelberg machte, begann für sie ein neuer Lebensabschnitt.
2. KAPITEL
HEIDELBERG
1929 – 1930
Die Stadt bietet alles, was ein Student von einer Stadt erwarten kann
Golo Mann1
Im Juni zeigt sich Heidelberg von seiner mediterranen Seite: Der Neckar windet sich sanft an den bewaldeten Hängen entlang. Die blühenden Esskastanienbäume erscheinen wie leuchtende Inseln im Grün der Wälder. Auf den exponierten Terrassen des Philosophenwegs gedeihen Palmen und Zitronenbäume und verleihen der Stadt ein südliches Flair: sanft, singend, provençalisch.
In den Kreisen, in denen sich die Löwensteins bewegten, begab man sich nicht auf die übliche Zimmersuche. Es ist anzunehmen, dass auch Paula Löwenstein bereits von Köln und Frankfurt aus auf die verwandtschaftlichen Beziehungen zurückgegriffen und so das Zimmer bei der Witwe Georgine Eversmann in der »Anlage«, Leopoldstraße 49, angemietet hatte. Viele Witwen aus den sogenannten besseren Kreisen erzielten durch die Vermietung von Studentenzimmern eine willkommene Nebeneinkunft, nachdem die repräsentativen Räumlichkeiten nach dem Tod des Mannes nicht länger beansprucht wurden.
Die »Anlage« war zu Hilde Löwensteins Zeiten eine der besten Adressen in Heidelberg: »Großzügige Wohnhäuser von Professoren und Pensionären, vornehme Hotels und Fremdenpensionen charakterisierten das Straßenbild.«2 Hilde Löwenstein konnte sich in dieser Umgebung wohlfühlen.
Von den dreiundzwanzig Universitäten, die es in der Weimarer Republik gab, hatte Siegfried Löwenstein bewusst die traditionsreiche Ruprecht-Karls-Universität als Studienort für seine Tochter gewählt. In den Zwanzigerjahren galt Heidelberg als »akademische Hochburg des neuen Deutschland«3, als Musteruniversität der jungen Republik. Dem Studenten Carl Zuckmayer vermittelte die Universität den Eindruck der »fortschrittlichsten und geistig anspruchsvollsten Universität Deutschlands«.4
Fast ein Viertel der sechzig Lehrstuhlinhaber beteiligte sich an den »Kundgebungen und Manifesten zugunsten der Reichsverfassung und gegen rechtsextreme Radikalisierung«5, wenngleich sie eher »Vernunftrepublikaner« als überzeugte Anhänger der Republik waren. Neben dem Institut für Sozialwissenschaften mit seinem führenden Kopf Alfred Weber rekrutierten sich vor allem aus der Juristischen Fakultät demokratisch gesinnte Professoren: allen voran Gustav Radbruch, Sozialdemokrat und Rechtsphilosoph, und Gerhard Anschütz, Ordinarius für Öffentliches Recht und Mitbegründer des »Weimarer Kreises«, der die Universitäten für die neue Republik gewinnen wollte. Ihretwegen hatte Eugen Löwenstein seiner Tochter Heidelberg ans Herz gelegt. Wie sehr liberale Professoren die Ruprecht-Karls-Universität schätzten, zeigt Radbruchs Entscheidung, statt einer dritten Berufung ins Reichsjustizministerium (er war 1921 und 1923 Reichsminister gewesen), den Ruf nach Heidelberg anzunehmen.
Dem deutsch-jüdischen Professor für mathematische Statistik, Emil Gumbel, brachten die Heidelberger Professoren aufgrund seiner radikal-pazifistischen Haltung keine hohe Wertschätzung entgegen. Doch gerade er zeichnete sich durch die menschliche Wärme aus, die Hilde Löwenstein 1932 bewog, sich ihm als ratgebenden Mentor anzuvertrauen, als sie vor der Entscheidung eines Studienwechsels ins Ausland stand: »Mit Gumbel will ich wirklich mal die Sache sans gêne bereden. Er ist ein reizender Mensch und mir wohl gewogen.«6 Im August 1933 stand der Name Emil Gumbel bereits auf der ersten Liste der ausgebürgerten Juden.
Meinungsbildend mag für Vater Löwenstein auch gewesen sein, dass in der beschaulichen Stadt am Neckar der Anteil der jüdischen Studenten im Vergleich zu anderen Hochschulen überdurchschnittlich hoch war; und mit »19,1% weiblicher Studierender« lag »Heidelberg auf dem vierten Rang aller deutschen Hochschulen«.7 Allerdings war nur jede zehnte Frau in den Rechtswissenschaften eingeschrieben. Nicht unwesentlich für die Wahl des Studienorts wird auch die Nähe zur Frankfurter und Mannheimer Verwandtschaft gewesen sein. Auch Edith Löwenstein, Tochter von Eugen Siegfried Löwensteins Bruder Emil aus Berlin und damit Cousine väterlicherseits, studierte Jura in Heidelberg. Mutter Löwenstein legte die flügge werdende Tochter »nach gemeinsamer Zimmersuche« dieser »Cousine ans robuste Herz«8, wusste ihre Tochter gut aufgehoben und fuhr beruhigt wieder nach Köln zurück. Edith erhielt jedoch schon kurze Zeit später ein USA-Stipendium, blieb in den Staaten und konnte so in den Vierzigerjahren die lebensrettenden Bürgschaften für die Verwandten garantieren.
Die junge Studentin Hilde Löwenstein kam in den letzten Tagen der »gay twenties«9 nach Heidelberg und schrieb sich am 23. April 1929 zum ersten Mal an der juristischen Fakultät der Ruperto Carola ein; schon bald zeigte sich jedoch, dass sie »Jura, aus Begeisterung für [ihren] Vater«10 gewählt hatte, das Fach aber eher nicht ihren Neigungen entsprach. Der Anfangserfolg war deshalb mäßig; sie lieferte von den fünf geforderten Hausarbeiten bei Gustav Radbruch nur drei ab. Ihre Liebe galt der Politik und gesellschaftspolitischen Fragen, und konsequenterweise ließ sie sich schon im ersten Semester in die »Nationalökonomie« einführen und besuchte volkswirtschaftliche Seminare. Die Zweifel an der Fachwahl waren so erheblich, dass Hilde Löwenstein im Wintersemester 1929/30 von der Juristischen in die Philosophische Fakultät wechselte und sich im »Institut für Sozial- und Staatswissenschaften« einschrieb: aus stud.iur. wurde stud.rer.pol. Löwenstein, mit dem Ziel, das Studium als »Diplom-Volkswirt« abzuschließen. Freunde rieten ihr, sich politisch zu engagieren, denn in der Politik könne ihr klarer Verstand gebraucht werden. Die Studentin belegte Vorlesungen bei den Größen der Heidelberger Universität: Alfred Weber, Karl Mannheim, auch Karl Jaspers, bei dem sie den »Grundriss philosophischer Weltanschauung«11 hörte. Sie konnte in ihrem ersten Semester noch nicht ahnen, wie sehr Jaspers’ »Philosophie der Kommunikation« in ihr Leben eingreifen würde und sie sich nur drei Jahre später bereits vor die Wahl zwischen Notwendigkeit und bloßer Möglichkeit gestellt sah, als sie ihre Freundschaft zu Erwin Walter Palm bewerten musste.
In Heidelberg erhielt Hilde »das geistige Rüstzeug« und verinnerlichte Karl Mannheims These »Im Scheitern kommt der Mensch zu sich selbst.« Ein Satz, den »auszuprobieren [sie] Gelegenheit hatte«; auch Mannheims »Relativieren des eigenen Standorts« wurde zum Lehrsatz für ihr Leben.12 Sie hörte Vorlesungen bei Radbruch, Weber, Jellinek und Lederer, bei Arnold Bergsträsser die »Geschichte des deutschen politischen Nationalbewusstseins«.
Es war eine aufgewühlte Zeit: Kulturgeschichtlich betrachtet endeten die »Goldenen Zwanziger«, doch politisch war es die bittere Epoche »entre deux guerres«, eine »fiebrige Zwischenphase« in einer ungeliebten Republik.
Was machte die Stadt so attraktiv für Studenten? »Die Stadt bietet alles, was ein Student meines Schlages von einer Stadt erwarten kann: Universität, Bibliothek, häufige und berühmte Gäste, gute Buchhandlungen, gesellige Zirkel«13, erinnerte sich Golo – Gottfried Thomas – Mann. Er war wie Hilde Domin Jahrgang 1909 und setzte 1929 sein Studium der Philosophie in Heidelberg fort. »Golo Mann saß bei Jaspers in Seminar und Kolleg, und man zeigte mit dem Finger auf ihn und sagte: ›Da sitzt der Sohn von Thomas Mann‹.«14
Manns Jugenderinnerungen, die 1986 erschienen, korrespondierten in vielem mit denen von Hilde Domin. Wie sie gehörte auch Mann eher zu den privilegierten Kommilitonen, die jeden Monat einen großzügigen Wechsel von zu Hause erhielten. Das Privilegiertsein manifestierte sich durchaus in scheinbar banalen Annehmlichkeiten: Sowohl Golo Mann als auch Hilde Löwenstein erleichterten sich ihren Alltag, indem sie ihre Wäsche »in einem Schließkorb nach Hause«15 schickten.
Die besondere Lage der Universitätsstadt lud die Studenten ein, die Natur zu erkunden. Zwischen den Lernphasen paddelte man eine Neckarschleife lang nach Ziegelhausen und machte Rast im Biergarten des Gasthauses »Schwarzer Adler«, der damals noch direkt an den Fluss grenzte, oder erkundete die Umgebung bei ausgedehnten Wanderungen. Schließlich gab es »ein Gewirr von Pfaden […]. Hier, endlich, werde ich zum Wanderer […] und bin zufrieden damit«16, erinnerte sich Golo Mann.
Wenn mit Brechts 1929 uraufgeführter Dreigroschenoper die bürgerlich-kapitalistische Welt und ihre sozialen Ungerechtigkeiten mit Spott und Satire angeprangert wurden, so war davon im idyllischen Heidelberg – anders als im brodelnden Berlin oder Frankfurt – nichts zu spüren. »Das Studieren in Heidelberg muss auch Spaß gemacht haben, war immer noch ein bisschen ›wildschönes Märchen‹, die Professorenvillen den Neckar entlang, der Neckar selbst, […] – man konnte wahrhaft ins Träumen kommen.«17
Hilde Löwenstein schien bei ihrem ersten Heidelberg-Aufenthalt durch ihr traditionsgebundenes Elitedenken die wirklichen Dimensionen des erstarkenden Nationalsozialismus noch nicht zu erkennen. Und doch waren die bedrohlichen Anzeichen nicht zu übersehen: im März 1929 rief Hitler zur Unterwanderung der Reichswehr auf, im August marschierte die NSDAP in Nürnberg auf und zerstörte jüdische Geschäfte. Man tröstete sich damit, dass Thomas Mann am 10. Dezember der Literaturnobelpreis verliehen wurde. Doch 1929 zog eine nationalsozialistische Studentengruppe in das Studentenparlament ein: »[D]ie letzten Momente dieses Traums einer europäischen Zivilisation […] wurden im Elfenbeinturm der reinen Lehre geträumt, weit ab von der […] Vorbereitung der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten.«18
Auch andere junge jüdische Kommilitonen erlebten Heidelberg als romantische Insel, als »tröstliche große Welt«19, in der man »neugierig und gläubig zu den neuen Instrumenten der Erkenntnis« griff (Hegel, Freud, Jaspers), aber »diese Gespräche blieben sehr theoretisch und bewegten sich außerhalb der politischen Realität.«20
Der spätere Politikwissenschaftler und angesehene FAZ-Journalist Dolf Sternberger, zwei Jahre älter als Hilde Domin, erinnerte sich an flammende Vorlesungen von Karl Jaspers im alten Hörsaal 11 der Universität, in denen der Philosoph die existentielle Kommunikation zwischen zwei Menschen forderte: Im Miteinander muss man an den anderen die höchste Erwartung und den höchsten Anspruch stellen, vor allem in der Liebe.21