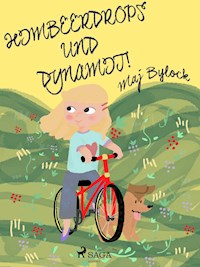
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Kajsa ist ein Wirbelwind und immer da, wo gerade die Post abgeht. Sie liebt ihr Fahrrad, den "Roten Blitz", Himbeerbonbons und ihren Freund Lasse, der immer die besten Ideen hat. Auf der Suche nach dem Schatz des Riesen stoßen Kajsa und der Hund Peggy auf ein Geheimnis...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maj Bylock
Himbeerdrops und Dynamit
SAGA Egmont
Himbeerdrops und Dynamit
Aus dem Schwedischem von Birgitta Kicherer nach
Dynamit och hallonbåtar
Copyright © 1995, 2018 Maj Bylock und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711791141
1. Ebook-Auflage, 2018
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Diese Geschichte ist die Fortsetzung eines Buches, das »Purzelbaum und Liebesbrief« heißt. Es ist ebenfalls im Erika Klopp Verlag erschienen. Wer es noch nicht gelesen hat, soll etwas über Kajsa, die Erzählerin, erfahren.
Kajsa ist fast 10 Jahre alt.
Sie hat
einen Vater, der Tierarzt ist,
eine Mutter, die Geige spielen kann,
einen großen Bruder, Gustav,
einen Hund, der Peggy heißt,
ein Fahrrad namens Roter Blitz,
einen sehr einfallsreichen Freund, Lasse,
und einen Großvater mit einem
weißen Schnauzbart.
Die Geschichte spielt im Jahr 1941. Fast überall in der Welt ist Krieg. Aber in dem kleinen Dorf auf der Insel Gotland in Schweden, wo Kajsa lebt, ist davon nicht allzuviel zu spüren.
Das Gebiß in den Preiselbeeren
Ich hatte viele Geheimnisse vor meiner Mutter. Die meisten fand sie schnell heraus, also mußte ich ganz schön vorsichtig sein.
Im Augenblick war mein größtes Geheimnis der Zahn. Eigentlich war es eher ein Loch. Von dem Zahn war nur eine Hülle mit scharfen Kanten übrig. Unglaublich, daß etwas, das fast nicht mehr vorhanden war, so weh tun konnte. Und wenn es gerade nicht weh tat, blieben alle möglichen Essensreste in dem tiefen Loch hängen. Meine Zunge war andauernd damit beschäftigt, Kuchenkrümel, Fleisch und Pfannkuchenreste rauszupulen. Ich steckte die Zungenspitze rein und saugte, bis es schmatz machte.
Auf Sahnebonbons, Kaugummi und Himbeerdrops verzichtete ich schon seit Wochen. Und dennoch war es ein Sahnebonbon, das mich zu Fall brachte.
Papa hatte Alpen-Sahnebonbons gekauft und bot mir eines davon an. Die Alpenbonbons schmeckten unbeschreiblich lecker. Es gab drei verschiedene Sorten: Vanille, Lakritze und Himbeer. Auf dem Einwickelpapier saß ein Junge mit einem Tirolerhut auf dem Kopf. Der Junge hieß Alpen-Olle. Ich starrte das Bonbon in Papas Hand an. Alpen-Olle lächelte mir freundlich zu. Ich konnte nicht widerstehen. Bald lag das süße Sahnebonbon auf meiner Zunge.
Sahnebonbons verteilen sich unglaublich schnell im Mund, daher war mein Genuß ziemlich kurz. Innerhalb von drei Sekunden hatte das Bonbon das Loch in meinem Zahn gefunden.
Zuerst glaubte Papa, mit dem Bonbon sei irgendwas nicht in Ordnung. Doch dann begriff er, daß ich diejenige war, die nicht in Ordnung war. Bisher hatte ich noch nie ein Bonbon im Mund und gleichzeitig Tränen in den Augen gehabt. Ich mußte den Mund aufsperren, und kurz darauf hatte er natürlich alles Mama verraten.
Mama rief sofort den Zahnarzt an. Der Zahnarzt wohnte in der Stadt. Weil der Zahn so sehr schmerzte, sollte ich gleich am nächsten Tag kommen.
Es gab drei Dinge, die ich mehr als alles andere auf der Welt fürchtete: den Zahnarzt, den Krieg und Back-August, der kleine Mädchen jagte. Der Krieg war noch in weiter Ferne, und vor Back-August konnte ich davonrennen. Mit dem Zahnarzt war es nicht so einfach. Ich sah ein, daß ich keine Wahl hatte. Nicht einmal Großvater konnte mich trösten.
Es wurde vereinbart, daß Mama und ich mit dem Zug in die Stadt fahren sollten. Sonst war eine Reise in die Stadt ein Fest. Jetzt lag ich hinterm Sofa und betete, daß der liebe Gott es mir ersparen möge. Könnte er die Sache mit dem Zahn denn nicht irgendwie anders regeln? Ich band einen Faden um den Zahn und versuchte, Gott beim Rausziehen zu helfen. Aber offensichtlich war Gott der Ansicht, daß dies die Aufgabe des Zahnarztes sei. Der elende Zahn saß nämlich fest wie ein Felsen.
Ich riß den Faden ab und krabbelte wieder hinters Sofa. Dort lag ich oft, wenn mir das Leben schwer erschien. Und so wurde es hinterm Sofa nie besonders staubig.
Im Laufe des letzten Jahres war ich tüchtig gewachsen, daher schauten meine Füße hinterm Sofa hervor. Als die Uhr in der Küche acht geschlagen hatte, sagte Mama zu meinen Beinen, es sei an der Zeit, ins Bett zu gehen.
»Unser Zug fährt morgen früh schon um sieben«, fügte sie hinzu.
Als ob ich das nicht gewußt hätte!
Eigentlich hätte ich am nächsten Tag Klavierstunde gehabt. Mama mußte anrufen und absagen. Wenigstens ein kleiner Lichtblick!
»Wie schade«, sagte die Klavierlehrerin. »Aber wenn ihr in die Stadt fahrt, könnt ihr vielleicht einen Topf Preiselbeerkompott für meine Schwester mitnehmen?«
In der Nacht bekam Mama Fieber und Halsschmerzen. Vielleicht hatte der liebe Gott meine Gebete doch noch erhört? Aber Großvater wußte nicht, worum ich gebetet hatte. Hilfsbereit bot er an, mit mir in die Stadt zu fahren.
Bald standen wir auf dem Bahnhof und warteten auf den Zug. Zwischen uns stand der Preiselbeertopf. Der Topf hatte keinen Deckel, bloß ein Stückchen Papier lag über dem Kompott.
Hinter mir hörte ich das Quietschen von Post-Olssons gelbem Karren. Er kam zu uns und wollte einen Schwatz halten, aber ich war noch saurer als das Kompott. Mit dem Tod im Herzen hörte ich den Zug heranschnaufen.
Am Ende eines jeden Wagens befand sich eine kleine Plattform mit einem Eisengeländer. Großvater öffnete eine der Türen und hob den Preiselbeertopf hinauf. In dem Augenblick, als er den Topf hinstellen wollte, machte der Zug einen Ruck.
»Herrje!« schrie Großvater. Er war von dem Kompott beinahe ertränkt worden.
Post-Olsson stieß ein schwaches Wimmern aus, dann plumpste er zu Boden. Er hatte geglaubt, es sei Blut, und war ohnmächtig geworden.
Auch nachdem der Stationsvorsteher ihn abgewaschen hatte, sah Großvater noch blutverschmiert aus. Doch das war nicht weiter schlimm. Viel schlimmer war, daß sein Gebiß verschwunden war.
Wir krochen auf dem Boden herum und snchten. War das Gebiß etwa unter dem Zug gelandet? Sogar Olsson half uns beim Suchen, nachdem er sich erholt hatte. Doch das Gebiß war und blieb verschwunden.
»Das Leben muß weitergehen und der Zug auch«, sagte der Stationsvorsteher.
Bald darauf saßen wir im Abteil und rollten der Stadt entgegen. Der Topf stand zwischen uns auf dem Boden, er war immerhin noch halbvoll.
Großvater lutschte noch ein paar Kompottreste, die in seinem Schnauzbart hängengeblieben waren. Sonst war alles still. Jeder von uns war tief in Gedanken versunken, aber beide dachten wir an Zähne. Und wenn man keine Zähne hat, ist es gar nicht so einfach, sich zu unterhalten.
Als wir ausstiegen, stand die Schwester meiner Klavierlehrerin auf dem Bahnsteig und wartete auf die Preiselbeeren. Zuerst schaute sie in den Topf, dann sah sie Großvater an.
Wir wußten beide, was sie dachte, daher sagte Großvater: »Ich hab mich ein bißchen beklekkert, als ich vom Kompott genascht habe.«
Dann verbeugte er sich höflich, und ich machte einen Knicks. Mein grünes Kleid wippte, als wir vom Bahnsteig wegspazierten.
Ich vergaß fast, wohin wir unterwegs waren. Aber nur fast! Der Weg zum Haus des Zahnarztes war viel zu kurz. Meine Hand lag wie ein klebriges Stückchen Eis in Großvaters warmer Pranke. Meine Zähne klapperten.
Großvater hielt meine Hand getreulich fest, bis der Zahnarzt ihn bat, beiseite zu treten. Und meine Zähne hörten erst auf zu klappern, als ich den Mund weit aufsperren mußte.
Nadelscharfe Blitze aus silbernem Licht stachen mir in die Augen. Bedrohliches Klirren schnitt mir in die Ohren. Meine Beine wanden sich umeinander, bis die Strümpfe wie Wursthäute an ihnen herabhingen. Mit angehaltenem Atem wartete ich auf das fürchterliche Ereignis.
»So, das wär’s«, sagte der Zahnarzt im selben Augenblick und hielt mir etwas Blutiges hin.
Dann preßte er einen Wattebausch an die Stelle, wo der Zahn gewesen war. Bevor ich überhaupt begriffen hatte, daß alles vorbei war, stand ich schon wieder auf wackeligen Beinen auf dem Boden.
Inzwischen hatte Großvater meinen Platz im Stuhl eingenommen. Da wir schon einmal da waren, konnte er sich gleich ein neues Gebiß anpassen lassen.
Erst als wir auf der Straße standen, wagte ich, meiner großen Freude Lauf zu lassen.
Wir setzten uns ein Weilchen zum Ausruhen in den Park. Dort plätscherte ein Springbrunnen in einem Ententeich. Das Wasser rieselte über eine grüne Statue, die ein kleines Mädchen darstellte. Das Mädchen lächelte. Ich lächelte zurück und dachte, daß das Leben trotz allem doch recht schön sei.
Großvater saß mit geschlossenen Augen still neben mir. Ich wollte ihn nicht stören. Wenn er erst einmal richtig eingenickt wäre, würde er anfangen zu schnarchen und sich selbst wecken.
Still und friedlich zeichnete ich ein Himmel-und-Hölle-Feld in den Kies und suchte mir einen Hüpfstein. Wenn man glücklich war, mußte man einfach hüpfen!
»Schnnnrrrchch!« Großvater stieß ein kurzes Brummen aus und reckte sich. Dann versuchte er so auszusehen, als ob er überhaupt nicht geschlafen hätte. Er stand auf und ging mit mir zum Marktplatz.
Papa hatte gesagt, wir sollten etwas Ordentliches essen. Am Marktplatz gab es eine Gaststätte. Wir standen lange davor und lasen die Speisekarte, die im Fenster lag.
»Schweinebraten mit Kartoffeln und Preiselbeerkompott. Nein, bestimmt nicht«, sagte Großvater.
»Blutwurst mit Soße.« Ich schauderte und sah Großvater an.
Dann überquerten wir den Marktplatz und gingen zu dem allerschönsten Stand der ganzen Stadt, wo eine dicke Frau große Waffeltüten voller Eis verkaufte.
Wir kauften zwei der allergrößten Tüten und schleckten das Eis. Die Waffeltüten bereiteten uns jedoch Schwierigkeiten, kauen konnten wir sie nicht. Also gaben wir sie den Enten im Teich.
Wir hatten es uns gerade im Zug gemütlich gemacht, um nach Hause zu fahren, als jemand heftig ans Fenster klopfte. Draußen auf dem Bahnsteig stand die Frau, der wir den Preiselbeertopf mitgebracht hatten.
Sie reichte uns eine Papiertüte hinauf. »Das Gebiß lag ganz unten im Topf«, sagte sie säuerlich.
Als der Zug davonrumpelte, lächelte Großvater mich an und klapperte eine fröhliche kleine Weise mit seinen wiedergefundenen Zähnen. Jetzt fanden wir beide, daß das Leben sehr schön war!
Der Schatz des Riesen
»Stacheldraht«, schimpfte Papa, »so was müßte verboten sein! Jetzt ist schon wieder eine Kuh daran hängengeblieben und hat sich das Euter aufgerissen. Ich muß hinfahren und es zusammennähen.«
Das kam häufig vor. Die Weiden waren überwiegend mit scharfem Stacheldraht eingezäunt. Zwar lernten die Tiere, nicht allzu nahe hinzugehen. Doch manchmal vergaßen sie, vorsichtig zu sein, und dann trugen sie schlimme Wunden davon.
Aber wahrscheinlich dachte Papa nicht nur an die Tiere, als er sich über den Stacheldraht aufregte. Stacheldraht war nämlich auch etwas, das zum Krieg gehörte. An vielen Stellen der schwedischen Grenzen gab es hohe Stacheldrahtzäune, damit der Feind nicht so leicht ins Land eindringen konnte.
So oft wie möglich begleitete ich Papa auf seinen Krankenbesuchen. Ich konnte ihm sogar ganz gut helfen. Als Papa diesmal zum Auto kam, stand ich schon bereit.
Die Sonne stach herab, es war heiß. Ich kurbelte ein Fenster herunter. Schade, daß es noch nicht richtig Sommer war. Dann könnte ich jetzt im Meer herumplanschen.
Die Kuh, die am Euter verletzt war, stand im Stall und ließ ihren schweren Kopf hängen. Das aufgerissene Euter tat bestimmt weh. Und vielleicht fühlte sie sich auch einsam. Die anderen Tiere waren ja alle draußen auf der Weide.
Ich durfte die blanke Schale halten, in der Papas Instrumente lagen. In der Schale waren lauwarmes Wasser, Watte, Nadeln und eine gekrümmte Schere. Papa konnte mindestens so gut nähen wie Mama.
Inzwischen spürte die Kuh nichts mehr. Sie war betäubt.
»Bald bist du wieder draußen auf der Wiese«, tröstete Papa sie und kraulte ihr braunes Ohr. »Jetzt habe ich deine Wunde nämlich vernäht. Es ist wunderschön geworden.«
Rasch raus zum Auto! Der Motor brummte los. Ich nahm an, daß wir jetzt nach Hause fahren würden.
Aber Papa hatte eine wunderbare Eigenschaft: Er bekam ziemlich oft Lust auf Süßigkeiten. Als wir an einem Laden vorbeikamen, bremste er, daß der Staub nur so hochwirbelte. Eine Wolke, weiß wie Weizenmehl, schwebte um das Auto.
So ein Pech! Die Tür des Ladens war verschlossen. Dann können wir ja gar nichts Gutes kaufen, dachte ich enttäuscht.
Aber Papa sagte, das spiele keine Rolle. An der Wand hing nämlich ein Schild, auf dem stand: Nehmen Sie, was Sie brauchen. Legen Sie das Geld in den Korb.
Im Korb lag der Türschlüssel, wir brauchten also bloß aufzuschließen und einzutreten.
Wir kauften Himbeerdrops, weil das meine Lieblingsbonbons waren. Papa zog Lakritzstangen vor, doch davon gab es keine mehr.
Papa wollte offensichtlich richtig feiern. Er bog nämlich auf den Weg ein, der zum Meer führte. Blank und glitzernd lag es vor uns. Der Weg zum Strand war fast schmaler als das Auto. Das Gras in der Mitte streifte raschelnd gegen den Boden des Autos. Aber wir kamen an unser Ziel, und das war die Hauptsache.
Schließlich mußten wir vor einem Gatter anhalten. Wir stiegen aus und kletterten hinüber. Auf der Strandwiese weideten Schafe. Sie blökten und guckten uns erstaunt an. Zum Glück interessierten sie sich nur fürs Gras. Selbst der Widder, der sonst so angriffslustig war, wandte seine gekrümmten Hörner in eine andere Richtung.
Erwartungsvoll sah ich Papa an.
»Jetzt ist es soweit!« schrie er. Die Jacke flog in die Luft, die Schuhe folgten. Gleich darauf wateten wir vorsichtig ins Meer. Hier gab es zwar keine Stacheldrahtzäune, aber dafür ragten an mehreren Stellen große Steine aus dem Wasser. Wir hoben die Füße so hoch wie möglich. Mutig versuchten wir so zu tun, als würde uns die Eiseskälte nichts ausmachen.
Mama verbot uns, vor Mittsommer im Meer zu baden. Wenn man vorher bade, werde man krank, behauptete sie. Aber Papa und ich waren uns einig, daß man früher anfangen mußte, weil der Sommer so schrecklich kurz war.
Während wir uns von der Sonne trocknen ließen, zeigte Papa auf einen Berg im Süden. Hoburgen hieß der Berg. Der oberste Felsblock erinnerte an einen Riesenkopf.
Der Kopf war das einzige, was man vom Hoburgs-Alten sehen konnte, dem Riesen, der im Bergesinneren wohnte.
»Hab ich dir schon mal die Sage von dem Riesen erzählt?« fragte Papa.
»Nein«, log ich und füllte den Mund mit Himbeerdrops.
Und obwohl er die Geschichte schon mindestens achtmal erzählt hatte, begann Papa ein weiteres Mal.
»Du weißt, daß der Hoburgs-Alte sehr reich war. Und er hortete seine Reichtümer. Die armen Bauern, die hier in der Gegend lebten, fürchteten ihn, denn es war nicht einfach, mit dem Riesen auszukommen.
Eines Tages kam auf einem der Höfe ein kleiner Junge zur Welt. Die Eltern luden die Nachbarn zur Taufe ein.
›Und was machen wir mit dem Hoburgs-Alten?‹ fragte der Bauer.
›Wenn der kommt, ißt er uns alles weg‹, seufzte seine Frau. ›Und wenn wir ihn nicht einladen, wird er böse.‹
›Überlaßt das mir‹, sagte der Knecht.
Daraufhin zog der Knecht seine Sonntagskleider an, begab sich zum Berg und hämmerte an die Pforte.
Als der Riese öffnete, machte der Knecht eine tiefe Verbeugung und sagte: ›Mein Herr hat mich gebeten, dich herzlich zur Taufe einzuladen.‹
Der Riese freute sich, wollte aber wissen, wer außer ihm noch eingeladen sei.
›Der heilige Michael und der heilige Petrus‹, antwortete der Knecht.
Da wurde der Riese blaß. Michael und Petrus waren immerhin Heilige. Und alles, was mit Gott zu tun hat, macht jenen Angst, die Böses im Sinn haben.
›Ich glaube, ich schicke lieber ein Taufgeschenk‹, sagte der Alte schließlich und häufte ein paar Hände voll Silbermünzen in einen Sack. ›Ob das wohl genügt?‹
›Ich kenne welche, die haben mehr gegeben‹, log der Knecht.
›Nun, als der Schlechteste will ich auch nicht dastehen‹, brummte der Riese und füllte fast den ganzen Sack mit Goldmünzen.
Der Knecht verneigte sich höflich und schleppte den Sack zu seinem Bauern nach Hause. Und das war doch wirklich ein schönes Taufgeschenk!« schloß Papa.
Ich sah die Sonne auf die große Nase des Hoburgs-Alten scheinen. »Glaubst du, daß er immer noch seine Schätze hütet?« fragte ich.
»Bestimmt.« Papa lachte. »Versuch ihm doch bei Gelegenheit ein paar Goldstücke abzuluchsen. Aber lieber nicht jetzt, wir müssen nämlich schleunigst nach Hause.«
Wir gaben uns fest die Hand darauf, Mama mit keiner Silbe etwas von unserem verfrühten Bad zu verraten. Und ich versprach mir gleichzeitig selbst, den Schatz des Alten irgendwie an mich zu bringen.
Ein Schwede schweigt
In Deutschland herrschte ein Mann namens Hitler. Aber mit einem Land gab er sich nicht zufrieden. Er wollte die ganze Welt beherrschen. Hitler ließ seine Soldaten in ein Land nach dem anderen einmarschieren. Als andere Länder ihn daran zu hindern versuchten, gab es Krieg. Bald waren so viele Länder darin verwikkelt, daß es ein Weltkrieg wurde.
Ich hatte mir immer eingebildet, der Krieg sei noch weit von Schweden entfernt. Doch das war er keineswegs. Nachdem ich gelernt hatte, eine Landkarte zu lesen, sah ich, daß der Krieg sehr nahe war. Hitlers Soldaten waren bereits in Dänemark und Norwegen einmarschiert.
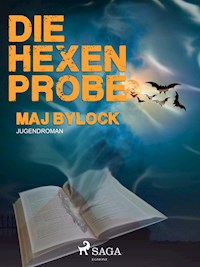

















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










