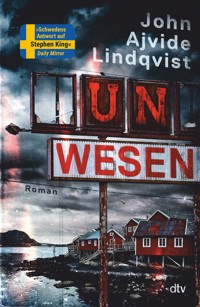9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Ein literarischer Horror-Roman aus Schweden: Zehn Menschen wachen in ihren Wohnwagen auf - und nichts ist wie am Abend zuvor. Was sie sehen, ist eine Grasfläche, die sich bis zum Horizont erstreckt, und einen blauen Himmel, an dem keine Sonne steht. Wo sind sie gelandet? Im Nichts? In der Unendlichkeit? Das Radio spielt nur Schlagermusik von Peter Himmelstrand, nichts anderes. Was bloß ist passiert? - Die Zehn begeben sich schließlich auf das Feld hinaus und begegnen dort ihren persönlichen Alpträumen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 670
Ähnliche
Inhalt
Aus dem Schwedischen von Thorsten Alms
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2014 by John Ajvide Lindqvist
Titel der schwedischen Originalausgabe: »Himmelstrand«
Originalverlag: Ordfront Förlag
Published by agreement with Ordfronts Förlag,Stockholm and Leonhardt & Høier Literary Agency A/S, Copenhagen.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Hanna Granz, Herzberg am Harz
Titelillustration © Arcangel Images: Jill Battaglia; © shutterstock: robert_s | Ursa Major | Nicholas 85 | Alexander Janson
Umschlaggestaltung: Jeannine Schmelzer
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-1500-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Zur Erinnerung an Peter Himmelstrand (1936–1999)»Wie wenig man doch versteht …«
An seinen Mängeln erkennt man einen Menschen.
Wir können uns ein Bild von einer Person machen, indem wir ihre Talente und Eigenschaften betrachten, die guten wie die schlechten. All das, was an der Oberfläche zu sehen ist. Aber wenn wir verstehen wollen, wer sie wirklich ist, müssen wir in die Dunkelheit hinabsteigen und uns mit ihren Mängeln vertraut machen.
Das fehlende Zahnrad definiert die Maschine. Das Gemälde wird nach dem falschen Pinselstrich beurteilt, und der dissonante Akkord zerstört den Gesang. Oder er macht ihn interessant. Das sind zwei Seiten einer Medaille.
Ohne unsere Mängel wären wir gut geölte Uhrwerke, und unsere Handlungen und Gedanken könnten mit Hilfe einer Simulation vorausgesehen werden, wenn wir genug Prozessorleistung hätten. Das wird jedoch nie geschehen. Unser Mangel ist eine Variable außerhalb der Gleichung, und er treibt uns zu Großtaten oder abscheulichen Verbrechen an.
Wenn man wollte, könnte man sagen, dass erst diese Mängel uns zu Menschen machen, diesen unvollkommenen, aber wundersam interessanten Wesen. Man könnte allerdings auch behaupten, sie machten uns zu Ungeziefer, das zwischen Himmel und Erde umherkriecht, immer auf der Suche nach etwas, das die Leerstelle füllen kann.
Aus welcher Perspektive man es auch betrachtet, der Mangel treibt uns an, ganz gleich, ob wir uns seiner bewusst sind oder nicht. Und genau wie alles andere kann er eine kritische Masse erreichen, einen Punkt, an dem er sein Wesen verwandelt und zu etwas anderem wird. Viele Phänomene, die uns unerklärlich erscheinen, können auf diese Weise erklärt werden. Hier folgt ein Beispiel.
Ich schalte ein.
»Mama, ich muss Pipi.«
»Dann geh auf die Toilette.«
»Die ist aber nicht da.«
»Doch, sie ist da. Im Servicegebäude, wo du gestern auch schon warst.«
»Das ist nicht da.«
»Kannst du Mama nicht ein Mal schlafen lassen?«
»Aber ich muss Pipi. Ich mach mir in die Hose.«
»Dann geh zum Servicegebäude. Es sind fünfzig Meter. Das wirst du doch hinkriegen, oder?«
»Es ist aber nicht da.«
»Doch es ist da. Geh durch die Tür, links um diesen ekligen Wohnwagen herum und dann geradeaus. Da ist es.«
»Was ist links?«
»Dann pinkel doch einfach ins Gras. Lass mich schlafen. Wenn du jemanden ärgern möchtest, dann kannst du ja Papa wecken.«
»Fast alles ist weg.«
»Was redest du denn da?«
»Guck doch.«
»Was soll ich gucken?«
»Aus dem Fenster. Ich habe Angst. Beinahe alles ist weg.«
Isabelle Sundberg stemmt sich auf den Ellenbogen. Ihre sechsjährige Tochter Molly kniet zu ihren Füßen. Isabelle schiebt sie zur Seite und zieht die Gardine zur Seite. Sie will zeigen, aber ihre Hand sinkt herab.
Ihr erster Gedanke ist: Kulisse. So eine, wie bei Micky Mouse im Weihnachtsprogramm. Etwas Künstliches, Unwirkliches. Aber die Details sind zu scharf, die drei Dimensionen erkennbar. Keine Kulisse.
»Pipi, Pipi, Pipi.«
Die Stimme ihrer Tochter tut ihr in den Ohren weh. Isabelle reibt sich die Augen. Will das Unbegreifliche wegwischen. Aber es bleibt, genau wie das Genöle ihrer Tochter. Sie dreht sich im Bett um und rammt das Knie in den Rücken ihres Mannes. Zieht die andere Gardine zur Seite.
Sie blinzelt, schüttelt den Kopf. Nichts davon hilft. Sie beißt die Zähne zusammen und gibt sich selbst eine Ohrfeige. Die Tochter verstummt. Die Wange wird heiß, und nichts hat sich geändert. Alles ist verändert. Sie greift nach der Schulter ihres Mannes und schüttelt sie kräftig.
»Peter, jetzt wach endlich auf, verdammt. Es ist etwas passiert.«
º
Eine halbe Minute später wird Stefan Larsson davon geweckt, dass irgendwo eine Tür zuknallt. Sein Pyjama klebt am Körper. Es ist warm im Wagen, sehr warm. Jetzt hat er aber wirklich genug. Alle anderen haben eine Klimaanlage. Wenn sie heute zum Großeinkauf fahren, wird er zumindest ein paar ordentliche Ventilatoren besorgen.
»Bim, bim, bim. Bom.«
Oben in seinem Alkoven plappert Emil leise vor sich hin, wie immer tief in einem Fantasiespiel versunken. Stefan runzelt die Stirn. Irgendetwas stimmt nicht. Er greift nach seiner Brille mit dem dicken, schwarzen Gestell, setzt sie auf und schaut sich um.
Ihr alter, treuer Wohnwagen sieht aus wie immer. Als Carina und er ihn vor fünfzehn Jahren gekauft hatten, hatte er schon ebenso viele Jahre auf dem Buckel. Aber nach unzähligen Urlaubsreisen und ornithologischen Ausflügen ist er zu einem Freund geworden, und einen Freund verkauft man nicht einfach so für ein paar Tausender im Internet. Die abgewetzten Oberflächen glänzen matt in dem Licht, das durch die dünnen Gardinen dringt. So weit alles normal.
Carina schläft, von ihm abgewandt. Sie hat das Laken weggestrampelt, und die Linie ihrer breiten Hüfte erinnert an ein altes Gemälde. Stefan beugt sich über sie und atmet ihren salzigen Geruch ein, sieht kleine Schweißperlen an ihrem Haaransatz. Tischventilatoren, wie gesagt. Sein Blick bleibt an der Tätowierung auf ihrer Schulter hängen. Zwei Ewigkeitssymbole. Die Sehnsucht nach einer Liebe, die bleibt. Aus ihrer Jugend. Er verehrt sie. Ein seltsames Wort, aber ihm fällt kein anderes ein.
Seine Augen weiten sich. Jetzt weiß er, was nicht stimmt. Die Stille. Abgesehen von Carinas Atem und Emils Geplapper ist es vollkommen still. Er wirft einen Blick auf die Uhr. Viertel vor sieben. Auf einem Campingplatz ist es niemals still. Ständig surren Klimaanlagen, und irgendwelche Maschinen laufen im Standby. Jetzt nicht. Der Ort hat aufgehört zu atmen.
Stefan steigt aus dem Bett und schaut zum Alkoven hinauf. »Hallo, Kleiner. Guten Morgen.«
Emil konzentriert sich auf die Kuscheltiere, die er vor sich hin und her schiebt, während er flüstert: »Und ich? Darf ich auch mal? Nein, Bengtson, du kümmerst die um die Kanonen.«
Stefan geht zur Spüle und füllt Wasser in die Kaffeekanne. Draußen sind Stimmen und Bewegungen zu erkennen. Der Fußballspieler und seine Frau sind auch schon aufgestanden. Und ihre Tochter. Das Mädchen klammert sich an die nackten Beine seiner Mutter, die zornig zu ihrem Mann hinübergestikuliert.
Stefan legt den Kopf schief. In einer parallelen Wirklichkeit müsste er diese Frau begehren. Sie trägt nichts als eine Unterhose und einen BH und sieht aus, als wäre sie einem Werbeplakat entstiegen. Jeder normale Mann musste hinter ihr her sein. Aber Stefan hat sich für etwas anderes entschieden, und daran hält er fest. Es ist unter anderem eine Frage der Würde.
Die Kaffeekanne ist voll. Stefan dreht den Hahn zu, füllt die Kaffeemaschine auf, und nachdem er das Kaffeepulver in den Filter gelöffelt hat, drückt er den Startknopf. Nichts passiert. Er kippt den Schalter ein paar Mal hin und her, überprüft den Stecker und denkt:
Stromausfall.
Was auch das Fehlen der elektrischen Geräusche erklärt. Er kippt das Wasser in einen Topf und stellt ihn auf den Herd. Hallo? Er klatscht sich auf die Stirn. Stromausfall. Dann funktioniert der elektrische Herd natürlich auch nicht.
Er bückt sich, um den Gaskocher anzuschließen, und wirft gleichzeitig einen Blick aus dem Fenster, schaut an dem streitenden Paar vorbei, um nach dem Wetter zu sehen. Der Himmel ist strahlend blau, man kann also auf einen schönen …
Stefan schnappt nach Luft und hält sich an der Spüle fest, als er sich näher zum Fenster beugt. Er versteht nicht, was er sieht. Der rostfreie Stahl unter seinen Händen ist kühl, er wird von Schwindel erfasst. Wenn er die Spüle losließe, würde er ins Nichts stürzen.
º
In der rechten Tasche seiner Shorts findet Peter ein Bonbonpapier. Es knistert leise, als er es in seiner geschlossenen Faust knetet. Isabelle schreit ihn an, und er fixiert den Punkt auf ihrer Wange, auf dem seine Hand landen würde, wenn sie nicht gerade mit dem Bonbonpapier beschäftigt wäre.
»Wie kann man bloß so dumm sein, die Schlüssel im Auto zu lassen, wenn man gesoffen hat wie ein Schwein. Da kann natürlich jeder Idiot kommen und uns wegschleppen. Und dann landen wir hier in dieser … in dieser …«
Er darf sie nicht schlagen. Wenn er es täte, würde sich die Machtbalance verschieben, vorübergehende Friedensverträge würden zerrissen und alles ins Chaos gezogen. Ein Mal hat er es getan. Die Befriedigung war enorm, die Folgen unerträglich. Beides hat ihn erschreckt. Der Genuss, sie körperlich zu züchtigen, und ihre Fähigkeit, ihn seelisch zu verletzen.
Er denkt: zehntausend. Nein. Zwanzigtausend. So viel wäre er bereit, für fünf Minuten Stille zu bezahlen. Um nachdenken zu können, um eine Erklärung zu finden. Isabelles Worte prallen auf seine Oberfläche, und darunter vibriert, wie eine zum Zerreißen gespannte Sehne, seine Selbstkontrolle. Er kann nichts anderes tun, als das Bonbonpapier auseinanderzufalten und wieder zu zerknüllen.
Molly klammert sich an die Beine ihrer Mutter und spielt das verschreckte Kind. Sie macht das gut, nur ein paar kleine Übertreibungen lassen Peter ihr Spiel durchschauen. Sie hat gar keine Angst. Auf eine Art, die Peter nicht nachvollziehen kann, scheint sie das Ganze sogar lustig zu finden.
Jemand räuspert sich. Der Mann mit den dicken Brillengläsern, die fleischgewordene Langeweile aus dem Wohnwagen nebenan, kommt auf sie zu. Isabelle verstummt, Molly starrt den Neuankömmling an.
»Entschuldigt bitte«, sagt der Mann, »aber wisst ihr, was hier passiert ist?«
»Nein«, sagt Isabelle. »Erzähl du es uns.«
»Ich weiß auch nicht mehr als ihr. Alles ist weg.«
Isabelle wirft den Kopf in den Nacken und faucht: »Jetzt fängst du auch damit an? Du meinst also, da ist jemand gekommen und hat die anderen Wohnwagen weggenommen? Den Kiosk, das Servicegebäude und was sonst noch hier rumstand? Klingt das etwa logisch? Wir sind natürlich weggeschleppt worden!«
Der Mann mit der Brille schaut auf die anderen Wohnwagen, die von Saluddens Campingplatz übriggeblieben sind, und sagt: »Dann haben sie anscheinend mehrere von uns weggeschleppt.«
Molly zieht am Saum von Isabelles Unterhose. »Wer sind die, Mama? Wer hat das getan?«
º
Vier Wohnwagen, vier Autos.
Die Wohnwagen unterscheiden sich in Alter, Größe und Bauart voneinander, aber sie sind alle weiß. Die Autos unterscheiden sich noch mehr, aber zwei von ihnen sind Volvos. Sie haben natürlich alle eine Anhängerkupplung. Zwei besitzen einen Dachgepäckträger.
Darüber hinaus: nichts als Menschen. Drei Erwachsene und ein Kind, die zwischen den Wagen und den Autos hin und her gehen, die anderen schlafen noch, unwissend, vielleicht träumend.
Außerhalb des kleinen Kreises von Fahrzeugen gibt es nur Gras. Eine Rasenfläche aus etwa drei Zentimeter hohen Halmen, die sich in alle Himmelsrichtungen erstreckt, so weit das Auge reicht.
Es ist ein leerer Ort.
Was sich hinter dem Horizont befindet, unter der Erde oder über dem Himmel, lässt sich nicht erahnen, aber im Augenblick ist es ein leerer Ort. Es gibt nichts. Außer Menschen. Und jeder Mensch ist eine Welt für sich.
º
Molly will von Isabelle hinter den Wohnwagen begleitet werden, um dort Pipi zu machen. Peter geht in die Hocke und seufzt, während er sich mit den Händen durchs Haar fährt.
»Wo sind wir bloß?«, fragt Stefan. »So etwas habe ich noch nie gesehen.«
Peters Mundwinkel zucken. »Aber ich. Ich habe mein halbes Leben auf so einem Rasen verbracht. Erst Fußball, dann Golf. Aber wie kann er so … gemäht aussehen?«
Soweit sie den Rasen überblicken können, sieht er wie ein gut gepflegter Gartenrasen oder wie ein Golfplatz aus. Stefan reißt ein Büschel Halme heraus und zerreibt sie zwischen den Fingern. Es ist echtes Gras, an den dünnen Wurzeln hängen Erdklumpen. Man bräuchte eine ganze Armee von Rasenmähern, um ihn so kurz zu halten. Oder gibt es Gras, das nur bis zu einer gewissen Länge wächst?
Isabelle und Molly kehren zurück. Die Mutter ist wunderschön und das Mädchen sieht süß aus. Lange, gewellte Haare rahmen ein rundes Gesicht mit großen, blauen Augen ein. Es trägt ein rosa Nachthemd mit dem Bild einer Märchenprinzessin, die ihm gar nicht unähnlich sieht. Und Peter selbst: kurze, blonde Haare und ein markantes Kinn. Schmale Hüften, aber breite Schultern, Armmuskeln, die sich unter der Haut abzeichnen.
Drei Menschen, die so perfekt sind, dass sie selbst in einem IKEA-Katalog kaum noch glaubwürdig wirken würden, geschweige denn auf einem heruntergekommenen Campingplatz. Die Veränderung der Umgebung hat ihre Anwesenheit weniger unnatürlich gemacht, die endlose Weite bietet Isabelle einen passenderen Hintergrund als eine verfallene Minigolfanlage. Trotzdem ist sie von allen die Aufgeregteste.
»Das ist doch sowas von krank«, sagt sie. »Wo zum Teufel sind wir bloß?«
Stefans Blick wandert über den Rasen, die Wohnwagen und die Autos. Bleibt an dem schwarzen SUV hängen, der neben dem Wohnwagen der perfekten Familie steht.
»Habt ihr ein Navi?«
Peter schlägt sich mit der Hand an die Stirn und läuft zum Auto. Die anderen folgen ihm. Molly starrt Stefan unverwandt an. Er lächelt sie an. Sie lächelt nicht zurück.
Peter öffnet die Autotür und gleitet hinter das glänzende Armaturenbrett. »Wartet kurz. Ich muss erstmal testen.«
Er drückt auf einen Knopf, und der Motor startet mit einem leisen Surren. Peters Haltung verändert sich. Sein Kopf, der vorher zwischen den Schultern versunken war, hebt sich, der Körper wird straffer. Jetzt ist er am Steuer.
Der Bildschirm des Navigationsgeräts wird violett, und das Programm startet. Anschließend erscheint eine Karte.
Etwas zieht an Stefans Hose. Als er hinunterschaut, begegnet er Mollys Blick, blaue Augen schauen ihn ohne zu blinzeln an. Sie fragt: »Warum schaust du nicht Mama an?«
º
Benny ist schon eine Weile wach. Er liegt in seinem Korb im Vorzelt und versucht zu verstehen.
Das Licht ist verkehrt. Die Gerüche sind verkehrt.
Seine Ohren zucken, als er Menschenstimmen hört. Die Nase zittert, versucht bekannte Düfte von draußen einzufangen. Es gibt keine.
Benny ist sieben Jahre alt und weiß schon eine ganze Menge. Er kennt das Prinzip der mechanischen Fortbewegung. Man steigt in Auto oder Wohnwagen, es brummt und schüttelt, man wird schnell transportiert. Dann befindet man sich an einem neuen Ort. Neue Gerüche, neue Geräusche, neues Licht.
Benny weiß, dass eine solche Fortbewegung nicht stattgefunden hat. Trotzdem befindet er sich nicht an demselben Ort, an dem er eingeschlafen ist. Das verunsichert ihn, und er bleibt bis auf Weiteres im Korb.
º
»Peter, kapier das doch, mit dem Scheißding stimmt etwas nicht.«
»Es hat immer funktioniert.«
»Jaja, aber jetzt funktioniert es eben nicht. Schau dich doch um. Hast du den Eindruck, dass wir wirklich dort sind, wo das Ding sagt, dass wir sind? Na?«
»Ich sage doch nur …«
»Mama, wo sind wir?«
»Das versucht Papa gerade mit seiner kleinen Maschine herauszufinden. Aber sie funktioniert nicht.«
»Natürlich funktioniert sie. Schau dir doch den Positionsanzeiger an …«
»Peter, ich scheiß auf diesen Positionsanzeiger. Er ist kaputt, kapierst du das nicht? Na klar, ha, ha, super Idee. So klappt es bestimmt. Einfach draufklopfen. Willst du vielleicht noch einen Zauberspruch aufsagen?«
»Okay, Isabelle. Okay. Kannst du jetzt bitte aufhören?«
»Mama, warum ist Papa traurig?«
»Weil sein männlicher Stolz verletzt ist und weil er nicht in den Schädel bekommt, dass wir woanders hingeschleppt worden sind. Er glaubt, dass wir immer noch am selben Ort sind wie gestern.«
»Aber das sind wir doch gar nicht.«
»Eben. Du verstehst das, und ich auch. Aber Papa nicht. Deswegen kommt er sich dumm vor und das macht ihn traurig.«
º
»Bom.«
Ein Laserstrahl trifft den einen Flügel des Raumschiffs.
»Bim, bim, bim.«
Meteore, jede Menge Meteore, knallen an die Fenster.
»Bam!«
Magnetschock! Die Meteore verwandeln sich in Schotter, aber …
»Bom, bom.«
Noch mehr Laser, Achtung, Achtung. Nichts zu machen. Wir sind verloren. Das Schiff fällt in die Sonne.
»Hilfeeee!«
Es ist warm im Alkoven. Unheimlich warm. Emil ist so durstig, dass seine Zunge am Gaumen klebt. Trotzdem klettert er nicht herunter, um zu trinken. Irgendetwas stimmt nicht. Mama schnarcht leise, Papa ist nach draußen gegangen. Die Stimmen von Erwachsenen dringen leise durch die Wand. Emil kann nicht verstehen, was sie sagen, aber er hört, dass sie besorgt sind.
Er möchte nicht wissen, warum sie sich Sorgen machen, er wartet lieber, bis das Problem gelöst ist. Emil sortiert die Kuscheltiere um seinen Kopf herum, ganz oben, direkt über seinem Scheitel, sitzt Bengtson, der Bär. Schildi, Bunte, Hipphopp und Säbelzahn an den Seiten. Emil lässt seine Augen hin und her wandern, begegnet ihren Blicken.
Wir sind hier. Wir mögen dich.
Emil leckt sich den Schweiß von der Oberlippe und nickt.
»Ich weiß. Ich mag euch auch.«
Wohin wollen wir fliegen?
»Zum Merkur, kommt ihr mit?«
Wir kommen mit.
»Gut. Bengtson, du bist Tschubacka. Wir heben ab.«
º
Peter hat eine Auszeit genommen.
Die Autotüren sind abgeschlossen, und er lehnt sich in seinem Sitz zurück. Durch das getönte Seitenfenster starrt Isabelle ihn wütend an. Er dreht das Gesicht zur Windschutzscheibe.
Vor ihm breitet sich ein leeres Feld aus. Es erstreckt sich, so weit das Auge reicht, der Horizont ist ein gebogener Schnitt zwischen dem getönten Grün und dem getönten Blau. Gebogen, tatsächlich. Die Welt ist nicht flach geworden. Immerhin etwas, auf das man sich verlassen kann.
Sein Blick fällt auf das Navi. Auf dem Bildschirm sieht es aus, als wäre alles ganz normal. Dort ist der Zufahrtsweg zum Campingplatz, der Positionsanzeiger sagt, dass das Auto steht, wo es stehen soll, fünfzig Meter vom See entfernt, der ebenfalls angezeigt wird. Peter schaut hoch. Es gibt keinen Weg, es gibt keinen See. Nur das Feld, das Feld, das Feld.
»Natürlich. Idiot.«
Es ist doch ganz einfach, das Navi zu testen.
Peter löst die Handbremse und tritt vorsichtig auf das Gaspedal. Das Auto rollt vorwärts. Isabelle hämmert an die Scheibe, sie läuft neben dem Auto her und brüllt: »Du verdammter Idiot! Was hast du vor?«
Peter grinst. Sie glaubt, dass er sie verlassen wird. Und wer weiß, vielleicht wird er das auch tun. Wie oft hat er sich diesen Augenblick nicht schon ausgemalt, vielleicht sollte er jetzt endlich mal ernst machen?
Er schielt zu Isabelle hinüber, die neben ihm herläuft, immer noch in Unterwäsche, und spürt, wie sein Penis steif wird. Während der ganzen Woche, die sie im Wohnwagen verbracht haben, hat sie ihn nicht an sich herangelassen, und auch davor schon zwei Wochen nicht. Sein sexueller Kummer ist so verzweifelt, dass er an Hass grenzt, und als Isabelle stürzt und aufschreit, wäre er fast gekommen.
Er blinzelt und konzentriert sich auf das Navigationsgerät.
Tatsächlich. Der Positionsanzeiger bewegt sich. Am Navi liegt es also nicht. In einer schönen, fließenden Bewegung nähert sich die Markierung dem See, und Peter bremst, bevor er das Ufer erreicht, obwohl kein Ufer zu sehen ist. Ein paar Sekunden bleibt er regungslos sitzen, betrachtet abwechselnd seinen Fuß auf der Bremse und den Bildschirm. Kann sich nicht überwinden, in den unsichtbaren See zu fahren.
Es klopft wieder an die Fensterscheibe, und er lässt sie herunter. Isabelle beugt sich hinein, fragt, was zum Teufel er hier treibe. Er erklärt es.
»Aha. Und?«
»Ich wollte es nur ausprobieren.«
Isabelle entdeckt die Erektion unter seinen Shorts, lächelt höhnisch und deutet mit einem Nicken auf die Ausbeulung. »Was hast du denn da?«
»Nichts, was dich interessieren würde.«
»Darauf kannst du einen lassen.«
Molly kommt angelaufen, und mit einer Stimme, die kleiner ist als ihre sechs Jahre, sagt sie: »Mama? Lässt Papa uns alleine?«
»Nein, Liebling, das macht er nicht«, antwortet Isabelle. »Er hatte einfach nur eine dumme Idee, die er direkt ausprobieren musste.« Sie beugt sich ins Auto hinein und holt das iPhone aus dem Handschuhfach. »Das hier hast du natürlich nicht ausprobiert, oder?«
Peter schüttelt den Kopf. Er ist sich ziemlich sicher, wie der Telefontest ausfallen wird. Es zeigt sich, dass er recht hat. Hinter sich hört er Isabelle fluchen: »So ein verdammter Mist. Nicht der geringste … was ist das hier für ein Ort?«
Kein Netz. Kein Signal. Kein Kontakt. Peter lässt seinen Blick über den leeren Horizont schweifen, den hellblauen Sommerhimmel. Dann schlägt er die Hände vor dem Mund zusammen und flüstert: »Die Sonne. Wo ist die Sonne?«
º
Die Sonne.
Stefan steht mit hängenden Armen und offenem Mund vor seinem Wohnwagen. Er sucht den Himmel noch einmal ab, als hätte er beim ersten Mal etwas falsch gemacht. Als hätte er etwas übersehen, das direkt vor seinen Augen gelegen hat. Aber es gibt tatsächlich keine Sonne, nur den blendend blauen Himmel, der wie von innen erleuchtet scheint.
Er geht ein paar Schritte in jede Richtung, um auch die Teile des Horizonts zu kontrollieren, die von Wohnwagen oder Autos verdeckt sind. Keine Sonne. Er richtet die Augen wieder nach oben. Die ganze Himmelskuppel ist gleichmäßig hell und hat überall denselben Farbton. Sie sieht nicht einmal wie ein Himmel aus, sondern eher wie etwas, das dorthin montiert worden ist, um einen Himmel darzustellen. Das Fehlen von Wolken oder Farbübergängen macht es unmöglich einzuschätzen, ob er sich zehn oder zehntausend Meter über ihm befindet.
Er schaut zu Boden und findet eines von Emils Spielzeugautos. Er hebt es auf und wirft es so hoch, wie er kann. Es fliegt vielleicht zwanzig Meter in die Höhe, bevor es wendet und hinabfällt und auf dem Rasen landet, ohne unterwegs auf ein Hindernis gestoßen zu sein.
Solange Stefan zurückdenken kann, hat er diese Angst mit sich herumgetragen. Mal stärker, mal schwächer, aber allgegenwärtig. Wenn diese Angst eine Stimme hätte, würde sie immer denselben Satz wiederholen: Alles wird dir genommen werden.
Wenn die Sonne verschwinden kann, kann alles verschwinden. Stefans Brust schmerzt, als würde etwas von innen daran ziehen. Er schaut zur Tür des Wohnwagens. Solange es Carina und Emil gibt, kann er beinahe alles ertragen.
Und wenn es sie nicht mehr gibt? Wenn auch sie verschwunden sind?
Sein Atem wird schwer. Er macht einen Schritt auf die Tür zu, hält inne. Wird von dem wahnwitzigen Impuls ergriffen, die Hände an die Ohren zu drücken und einfach nur zu laufen.
Er zwingt sich, ein paarmal tief durchzuatmen, und die Panik lässt nach und wird von der Qual des Überbringers schlechter Nachrichten ersetzt. Er will Carina nicht in diese Welt hineinwecken, er möchte Emil keinen Himmel ohne Sonne zeigen.
Stefan schließt die Augen. Presst die Lider so fest zusammen, wie es geht. Er setzt die Sonne zurück an den Himmel, stellt die Minigolfanlage wieder an ihren Platz, den Kiosk und das Trampolin. Er erschafft die Geräusche. Die Morgenbrise in den Laubbäumen, verschlafene Kinder, die am Ufer toben. Alles, was es geben müsste.
Als er die Augen öffnet, ist es wieder verschwunden. Er hat seiner Familie keine Welt mehr zu bieten, und er kann ihr auch keine machen. Er schaut die Tür an, und die Panik kehrt zurück. Steht er vielleicht vor einem leeren Wohnwagen?
Er hält es nicht länger aus. Mit einer schnellen Bewegung reißt er die Tür auf, steigt mit einem raumgreifenden Schritt hinein und steht mit klopfendem Herzen vor seiner schlafenden Frau, hört die Stimme seines Sohns. Solange er ganz still steht und nichts sagt, ist alles, wie es war. Ein ganz normaler Morgen auf dem Campingplatz. Bald werden sie frühstücken. Emil wird eine pfiffige Frage zur Beschaffenheit der Welt stellen …
Der Welt? Welcher Welt?
Stefan reißt sich zusammen und krabbelt ins Bett, bis er Carina von Angesicht zu Angesicht gegenüberliegt. Er streichelt ihre Wange und flüstert: »Liebling?«
Carina blinzelt ein paar Mal, bevor sie die Augen ganz aufschlägt und sagt: »Oh.« So macht sie es oft, wenn sie aufwacht, als hätte sie der Schlaf überrascht. »Oh. Hallo. Wie spät ist es?«
Stefan schielt zum Wecker hinüber, der zehn vor sieben anzeigt. Hat das überhaupt noch eine Bedeutung? Er streicht Carina eine schweißnasse Haarsträhne aus dem Gesicht und sagt: »Du, es ist etwas passiert.«
º
Weil es kein Netz gibt, blättert Isabelle in ihrem Portfolio.
Optikkette Synsam, 2002. Eine Nahaufnahme, die ihre blaugrünen Augen hervorhebt, im Kontrast zu dem schwarzen Brillengestell mit Fenstergläsern. Der Mund geformt, als würde sie an einer Olive saugen.
Guldfynd, 2002. Eine exklusive Ganzaufnahme mit chromatischem Licht, ein rückenfreies Abendkleid. Ein Prachtkerl im Frack nähert sich vorsichtig, als zögere er, eine solche Schönheit zum Tanz aufzufordern. Kleine Spotlights auf die Uhr und den Ring. Allein für die richtige Beleuchtung haben sie damals vier Stunden gebraucht.
Lindvalls Kaffee, 2003. Ihre perfekt geformten Nägel schließen sich um die knochenweiße Kaffeetasse (Kunstnägel, sie hat schon immer die Neigung gehabt, an ihren Nägeln zu kauen), das Licht scheint von unterhalb der schwarzen Flüssigkeit zu kommen und wirft Schatten, die ihre Wangenknochen hervorheben.
Gaultier, 2003. Von den Creds her der Höhepunkt, aber die Kampagne war für einen Herrenduft. Isabelle steht also etwas außerhalb des Fokus hinter einem schwarzhaarigen Mann, dessen Linien so scharf gezogen sind wie bei einer Comicfigur. Ein Grieche. Der schönste Mann, mit dem sie je zusammengearbeitet hat. Schwul, leider.
H&M, 2004. Die professionellste Session ihrer Karriere. Hätte der große Durchbruch werden sollen, die Sommerkampagne. Im letzten Augenblick wurde jedoch entschieden, auf die Ethno-Nummer zu setzen. Afrikaner, Asiaten und eine Eskimofrau. Eine Eskimofrau. Für die Sommerkampagne. Damals hatte Isabelle angefangen, Tafil zu nehmen.
Versandhaus Ellos, 2005. Es gibt nur einen Grund, warum sie diese Bilder in ihrem Portfolio gelassen hat. Die Serie bringt ihren Körper am besten zur Geltung. Bademode und Unterwäsche, zum Glück. Keine Omablusen.
PerfectPartner, 2009. Niemand würde bezweifeln, dass sie unsterblich in den Mann verliebt ist, dessen Wange sie streichelt, ihr Blick sagt alles. Peter war nicht glücklich, als es als Banner in seinem Mailprogramm auftauchte.
Gudrun Sjödén, 2011. Wenn man dreißig ist, muss man nehmen, was kommt. Aber es war eine ziemlich lustige Foto-Session in Marokko. Erdfarben und Wüstenlicht am Nachmittag. Die wogenden Stoffe. Ihre glitzernden, hungrigen Augen, als hätte sie gerade eine Oase erreicht. Als wäre sie die Oase.
Molly schmiegt sich auf dem Bett an sie, streichelt mit der Hand die Luft vor dem Bildschirm.
»Wie schön du bist, Mama.«
º
Benny hat sich bis zum Eingang des Vorzelts gewagt. Was seine Nase und seine Ohren ihm gesagt haben, bestätigen seine Augen. Ohne bewegt worden zu sein, befindet er sich an einem neuen Ort.
Er setzt sich und kratzt sich mit dem Hinterbein das Ohr, dann steckt er vorsichtig die Nase durch die Öffnung. Manche Gerüche sind noch da. Der Wohnwagen, der nach Kuh riecht und Katze enthält. Parfümduft von Sie.
Er schaut in die Leere hinaus, blinzelt gegen das Licht. Ganz anders als gestern und fast ohne Gerüche. Benny gähnt, schüttelt sich. Er dreht sich einmal um sich selbst und setzt sich wieder, steckt den Kopf durch die Öffnung und schaut in die andere Richtung.
Katze liegt im Fenster des Wohnwagens, der nach Kuh riecht. Benny streckt sich und vergisst seine Angst. Katze wird jetzt ausgeschimpft.
Er ist gerade vom Holzboden des Vorzelts heruntergestiegen und hat die Vorderpfoten auf den Rasen gesetzt, als jemand auf ihn zukommt. Ein großer Er. Benny erstarrt und bleibt einen Augenblick unentschlossen stehen. Dann zieht er sich zurück, dreht sich um und läuft zurück in den Korb.
º
Peter hatte den Wohnwagenurlaub als letzten Versuch betrachtet, seine Ehe mit Isabelle zu retten, ein abschließender Schock mit dem Defibrillator, bevor man den Patienten für tot erklärte.
Normalerweise hatten sie immer ein Fünf-Sterne-Hotel in irgendeinem fernen Land gebucht, mit Wellnessbehandlungen für Isabelle, während Molly im Kinderclub betreut wurde und Peter mit einem Krimi am Rand des Swimmingpools saß. Der Luxus stimmte Isabelle milder, und sie verbrachten ihre Tage in einem Schwebezustand, der sie zwar nicht aufmunterte, aber auch nicht herunterzog. Wenn sie nach Hause kamen, dauerte es immer noch ein paar Tage, bis sie wieder anfingen zu streiten.
Isabelle hatte der Idee, sich einen Wohnwagen zu leihen, natürlich sehr negativ gegenübergestanden, aber Peter hatte darauf bestanden, indem er darauf hinwies, dass er die Erinnerungen an die Kindheit mit seiner Mutter wieder aufleben lassen wollte. Das war zwar nicht gelogen, aber vor allen Dingen wollte er Isabelle eine letzte Chance geben. Sie hatte sie nicht ergriffen, und im Grunde hatte er schon vorher gewusst, dass es so kommen würde. Dass es nur ein Spiel für die Galerie war, damit man im Nachhinein auf diese Woche zeigen und sich sagen konnte: Da habe ich genug bekommen. Da ist das Fass übergelaufen.
Er hat genug, und das Fass ist übergelaufen. Er muss von hier weg. Lieber heute als morgen.
Peter geht auf Donalds Wohnwagen zu. Ein kleiner Beagle dreht sich um und läuft ins Vorzelt zurück, als Peter vor dem Eingang stehen bleibt und sich umschaut.
Der Wohnwagen ist ein Kabe Royal Hacienda, zehn Meter lang und an einen Cherokee SUV gekoppelt. Dazu kommt ein Vorzelt von mindestens zwanzig Quadratmetern. Teakmöbel und ein kleiner Garten in Tontöpfen. An den Zeltstangen hängen Fotos von Elvis Presley sowie ein paar retuschierte Aufnahmen von Indianern und Wölfen. Aus der Mitte des Gartentischs ragt eine kleine Fahnenstange, an der die amerikanische Flagge gehisst ist. Versteckt hinter den blühenden Topfpflanzen hängt ein auf Goldbrokat gestickter Sinnspruch: »Ein rechtes Wort zur rechten Zeit hilft dem andern und mildert sein Leid.«
Der Korb des Beagles steht direkt neben der Tür des Wohnwagens, und der Hund winselt, als Peter näher kommt, sein ganzer Körper sagt: Ich weiß, dass du mich schlagen wirst, aber tu es bitte, bitte nicht.
Die Angst vor Schlägen provoziert ihn. Man wird dazu verführt, so zu werden, wie es einem unterstellt wird, und Peter spürt den Impuls, dem Hund kräftig gegen den Kopf zu treten, damit er die Schnauze hält. Stattdessen geht er in die Hocke, streckt die Hand aus und sagt: »Ich bin nicht gefährlich.«
Der Hund flackert mit den Augen und drückt sein Kinn auf den Boden des Korbs. Wenn wir nichts mehr zu essen haben, dann können wir ja den Hund kochen. Peter schüttelt den Kopf und steht auf. Er ist nicht ganz bei Sinnen. Er muss hier weg, und zwar schnell.
Er klopft an die Tür des luxuriösen Wohnwagens. Es dauert ein paar Sekunden, dann beginnt der Wagen zu schaukeln und er hört schwere Schritte. Peter steckt die Hände in die Hosentaschen, drückt das Bonbonpapier zusammen und räuspert sich. Die Tür wird geöffnet.
Ein etwa siebzigjähriger Mann kommt zum Vorschein. Sein Schädel ist vollkommen kahl, aber auf seiner Brust wuchern buschige, weiße Haare. Ein großer, braungebrannter Bauch hängt tief über die rot-weiß gestreiften Boxershorts. Die leicht vorstehenden Augen verleihen seinem Blick eine gehetzte Intensität, als wäre er Raubtier und Beute zugleich. Als er Peter sieht, beginnt er zu strahlen.
»Ja, da schau her! Welch hoher Besuch am frühen Morgen.«
»Äh, ja«, sagt Peter und senkt den Blick.
Am vorhergehenden Abend war Donald herübergekommen, hatte sich zu ihnen gesetzt und angefangen, über den Strafstoß gegen Bulgarien im Jahr 2005 zu diskutieren. Er meinte, dass Peters Länderspielkarriere viel zu kurz gewesen sei, und zählte anschließend mehrere Gründe dafür auf, Spielsituationen, die Peter schon längst vergessen hatte.
Peter hatte ihm immer wieder einen Drink angeboten, damit er weitererzählte, obwohl Isabelle schon demonstrativ seufzte. Er hatte Donald ein paar Anekdoten aus seinen Jahren in der italienischen Liga serviert, und dieser hatte alles mit bewundernden Ausrufen aufgesaugt. Peter hatte sich in seinem eigenen Glanz gesonnt und sich gleichzeitig zutiefst dafür geschämt, dass er es so genoss.
Nach einer Weile war Donald wieder zurück zu seinem Wohnwagen gewankt, nicht ohne noch ein »arrivederci, maestro« über die Schulter zurückzuwerfen. Isabelle hatte Peter den gefühlsduseligsten Menschen genannt, der ihr je begegnet sei, und ihn daran erinnert, dass er den Großteil seiner italienischen Millionen mit einem missglückten Restaurantprojekt verschwendet hatte. Und so weiter, und so weiter. Ein ganz normaler Abend.
»Womit kann ich dienen?«
Donald hält sich am Türrahmen fest und steigt aus dem Wagen. Peter weicht einen halben Schritt zurück, um Platz für den Bauch zu schaffen, und sagt: »Es ist etwas passiert. Es ist schwer zu erklären, am besten schaust du es dir selbst an …« Peter folgt der amerikanischen Gewohnheit und fügt hinzu: »… Donald.«
Donald schaut sich um. »Was meinst du, Peter? Was ist passiert?«
Peter tritt rückwärts aus dem Vorzelt und lässt seinen Arm über die Umgebung schweifen. »Du musst es dir selbst ansehen. Sonst glaubst du mir nicht.«
Während Peter weiter zum letzten Wohnwagen geht, in dem die Leute noch schlafen, hört er Donald heftig nach Luft schnappen und leise murmeln: »Holy shit.«
º
Emil ist aus seinem Alkoven heruntergekommen und kniet zwischen Stefan und Carina im Doppelbett, schaut aus dem Fenster. Er zeigt auf den Horizont und wendet sich an Stefan.
»Wie weit ist es bis dorthin?«
»Bis zum Horizont, meinst du?«
»Ja.«
»Ungefähr fünf Kilometer, sagt man.«
Emil nickt, als ob er diese Antwort schon geahnt hätte, und sagt: »Vielleicht gibt es dahinter nichts mehr.«
»Was meinst du?«
»Man sieht ja nichts.«
Stefan schaut zu Carina hinüber, die kaum ein Wort gesagt hat, seit sie erst aus dem Fenster gesehen hat und dann für eine Minute nach draußen gegangen ist, bevor sie wieder ins Bett zurückgekehrt ist. Ihr Blick verliert sich im Nichts, und Stefan legt eine Hand auf ihre Schulter. »Liebling, wie geht es dir?«
»Das ist …«, sagt sie und deutet auf das Fenster. »Das ist doch vollkommen verrückt. Hast du das Telefon ausprobiert?«
»Ja. Es gibt kein Netz.«
Carinas Blick irrt über das Feld, aber es gibt nichts, woran er hängenbleiben könnte. Sie verbirgt ihr Gesicht in den Händen.
»Mama«, sagt Emil und tätschelt ihr den Rücken, »sei nicht traurig. Das kommt schon wieder in Ordnung. Oder, Papa?«
Stefan nickt. Es ist ein Versprechen, das zu nichts verpflichtet. Irgendwie kommt immer alles wieder in Ordnung. Manchmal zum Besseren, manchmal zum Schlimmeren. Aber irgendwann herrscht wieder Ordnung, auf die eine oder andere Weise.
Emil zieht ein Donald-Duck-Heft aus dem Regal über dem Bett und legt sich auf den Bauch. Er schaut die Bilder an, und seine Lippen bewegen sich, wenn er sich durch die Sprechblasen buchstabiert. Er ist groß genug, um zu verstehen, dass ihnen etwas sehr Seltsames, geradezu Unfassbares zugestoßen ist. Aber in seiner Welt gibt es noch viele solcher Dinge. Gewitter, Elche, elektrischer Strom, oder dass Eier hart werden, wenn man sie kocht, Kartoffeln dagegen weich. Das hier ist einfach nur ein weiterer Punkt auf der Liste. Sein Vertrauen ist groß. Mama und Papa werden das schon hinkriegen, irgendwie.
Carina nimmt die Hände vom Gesicht, kaut auf der Unterlippe und fragt: »Ist das echt?«
»Was meinst du?«
»Ich meine … sowas kann doch gar nicht sein. Ist das trotzdem echt?«
Stefan versteht ungefähr, was sie meint, obwohl ihm selbst diese Idee noch gar nicht gekommen ist. Dass sich das Ganze nur in ihren Köpfen abspielt, wie eine Halluzination oder eine Massenpsychose.
»Ich glaube schon«, sagt er. »Jedenfalls sind wir jetzt hier gelandet. Wie auch immer.«
»Okay«, sagt Carina und wendet sich vom Fenster ab. Sie atmet tief durch und streckt den Rücken. »Wie sieht es mit dem Essen aus? Wie viel Wasser haben wir noch?«
º
Der alte Polar-Wohnwagen der Milchbauern, der an einem weißen Volvo 740 hängt, strömt einen schwachen Geruch nach Gülle aus. Eine orange gestreifte Katze liegt im Fenster und glotzt. Peter hält inne und betrachtet das ganze Gespann. Es sieht aus, als wäre es hier zu Hause. Als hätten der Wohnwagen, das Auto und die Katze schon immer hier gestanden und Normalität ausgestrahlt.
Zwei Abende zuvor war Peter auf dem Weg in die Waschküche am Wohnwagen der Bauern vorbeigekommen. Sie hatten in ihren Klappstühlen gesessen und Kreuzworträtsel gelöst, auf einem CD-Spieler auf dem Tisch war ABBAs »Dancing Queen« gelaufen. Sie waren aufgestanden und hatten sich vorgestellt. »Lennart und Olof. Leicht zu merken, wie die alten Vorsitzenden der Bauernpartei.«
Peter klopft an die Tür und hört, wie jemand aufwacht. Donalds Wohnwagen hat geschaukelt. Dieser knarzt und vibriert, das Metall ächzt unter dem Gewicht der Person, die nach ein paar vergeblichen Versuchen die widerspenstige Tür aufklappt.
Peter weiß nicht, ob er Lennart oder Olof vor sich hat. Sie sind einander so ähnlich, dass er sie zuerst für Brüder gehalten hat. Dasselbe runde Gesicht und dieselben runden, tief liegenden, freundlichen braunen Augen. Dasselbe Alter, gut fünfzig, und dieselbe Größe. Dieselben von der Arbeit gebeugten Körper und dieselben schwieligen, kräftigen Hände.
Der Mann trägt eine blaue Latzhose, bei der nur einer der Träger geknüpft ist. Er blinzelt ins Licht, zu Peter hinaus.
»Entschuldige«, sagt er. »Ich muss erst einmal …«
Der Mann konzentriert sich auf den anderen Träger, und Peter schaut in den Wohnwagen hinein. Dann tritt er einen Schritt zurück, damit sich der Blickwinkel ändert. Damit er es nicht mehr sieht.
Mit dem Träger an seinem Platz wendet der Mann sich wieder Peter zu, und er scheint sich darüber zu wundern, dass er ihn nicht mehr am selben Ort wiederfindet wie zuvor.
»Tja, also?«, sagt er. »Guten Morgen?«
»Äh …«, sagt Peter, immer noch verwirrt von dem, was er im Wagen gesehen hat. »Es geht darum, dass … ja.«
Die Aussicht aus dem Wagen wird von keinem Vorzelt verstellt, sodass Peter sich damit begnügt, die Aufmerksamkeit des Bauern mit einer Handbewegung auf die Umgebung zu lenken. Dieser sieht sich um, beugt sich aus dem Wagen, um nach links und rechts schauen zu können, hebt anschließend den Blick zum Himmel und murmelt: »Das ist ja ein Ding …«
»Ich weiß auch nicht mehr als du«, sagt Peter. »Wir sollten uns vielleicht zusammensetzen, alle, die noch hier sind. Überlegen, was wir tun können.«
Der Blick des Mannes kehrt zu Peter zurück. Die tief liegenden Augen sehen beinahe durchsichtig aus, als wäre eine Scherbe des Himmels in ihnen hängengeblieben. Der Mann schüttelt den Kopf und sagt: »Tun?«
»Wir müssen doch … etwas tun.«
»Was können wir denn tun?«
Der Mann befindet sich offensichtlich im Schockzustand, was unter diesen Umständen wenig verwunderlich ist. Peter streckt eine Faust in die Höhe – der Capitano, der die Mannschaft vor dem Spiel um sich schart – und sagt: »Wir sehen uns, okay?«
Ohne auf eine Antwort zu warten, dreht er sich um und geht zu seinem Wohnwagen zurück. Hinter sich hört er den Mann sagen. »Olof, wach auf. Das musst du dir anschauen.«
Also hat Peter mit Lennart gesprochen. Er kratzt sich am Kopf. An diesem Morgen hat er schon einiges ertragen müssen: Durch die offene Tür hat er das Bett der beiden Bauern gesehen. Ein Doppelbett, auf dessen einer Seite ein riesiger Körper unter der Decke lag. Die andere Seite dagegen war leer.
Peter hält sich nicht für besonders vorurteilsvoll. Aber dass diese beiden alten Knacker … das kann er sich nur schwer vorstellen. Richtig schwer. Peter massiert seinen Schädel, als wolle er das Bild wegrubbeln. Er muss sich auch so schon genug Gedanken machen.
Was können wir tun?
Ja, genau das ist die Frage. Er selbst hat keine Ahnung. Er weiß nicht, warum er die Aufgabe übernommen hat, herumzugehen und die Leute zu wecken, aber er hatte das Gefühl, es tun zu müssen. Er kann sich nicht mehr erinnern, warum. Vielleicht wollte er einfach nicht mehr allein sein.
º
Fünf Pakete mit Schnellkochnudeln.
Ein gutes Kilo Reis.
Ein halbvoller Karton Makkaroni.
Zwei Dosen gehackte Tomaten.
Zwei Dosen Gemüsemais.
Zwei gelbe Zwiebeln.
Ein Kilo Kartoffeln.
Vier große Möhren.
Eine Paprika.
Halbvolle Tüten mit Haferflocken, Mehl und Zucker.
Preiselbeerkompott, Apfelmus.
Ein Liter Milch. Ein Liter Dickmilch.
Vier Eier.
Eine halbe Packung Knäckebrot, drei Scheiben Weißbrot.
Gewürze.
Kein Fleisch, kein Fisch. Sie hätten heute eigentlich ihren Großeinkauf erledigen wollen.
»Wenigstens ist der Wassertank voll«, sagt Stefan.
º
Die offene Fläche zwischen den Wohnwagen ist nicht besonders groß. Vielleicht hundert Quadratmeter, ein halber Tennisplatz. Auf dieser Fläche versammeln sich jetzt die Menschen. Man diskutiert über das Ereignis, als wäre es ein seltenes Naturphänomen. Dass man bewegt worden sei, oder dass die Umwelt verschwunden sei.
Carina ist nicht die Einzige, die an der Verlässlichkeit ihrer Wahrnehmung zweifelt. Auch Majvor, Donalds Frau, vermutet, dass es sich eher um einen Zustand als um einen geografischen Ort handelt. Im besten Fall um etwas Vorübergehendes, eine Art optischer Täuschung.
Die Männer neigen eher dazu, es als ein Problem zu betrachten, das es zu lösen gilt, eine Nuss, die sie knacken müssen. Sind sie hierher transportiert worden, und wenn ja, wie ist das vor sich gegangen? Oder ist alles um sie herum demontiert worden? Aber wie kann das sein? Und warum? Warum?
Lennart und Olof beteiligen sich an der Diskussion, sie hören zu und nicken freundlich, sagen aber nicht viel und tragen keine Theorien vor.
Die Handys werden untersucht, um herauszufinden, wann genau der Kontakt zur Umwelt abgerissen ist. Isabelle hat die letzte SMS bekommen. Eine Freundin, die von einer Party nach Hause gegangen ist. Die Nachricht ist um 02.26 Uhr eingetroffen. Danach nichts mehr.
Molly war bereits ein paar Minuten wach, als sie Isabelle kurz nach halb sieben geweckt hat.
Irgendwann im Verlauf dieser vier Stunden ist es passiert. Was auch immer es gewesen ist.
º
Die Menschen sind anderweitig beschäftigt, und Benny ergreift die Gelegenheit. Ein kurzer Spurt über dreißig Meter, dann steht er vor dem Fenster, in dem Katze liegt und sich aufplustert.
Katze ist Benny in vielen Punkten ähnlich, in anderen aber auch ganz anders. Das ist unangenehm und provozierend. Deshalb beginnt Benny Katze anzubellen.
Katze kann nicht bellen, allein das schon. Stattdessen steht sie auf und macht dieses Geräusch, das nach schnell fließendem Wasser klingt. Katze macht ihr Geräusch und Benny bellt, bis ihn eine Hand am Nacken packt und er Herrchens Stimme hört.
»Halt die Klappe, du dummer Hund.«
Benny jault und wedelt vergeblich mit den Pfoten, als er an der Nackenfalte zurück nach Hause getragen wird. Er sieht noch, wie Katze sich wieder hinlegt und sich abzulecken beginnt. Katze sieht zufrieden aus. Das reizt ihn dermaßen, dass er noch einmal bellt. Daraufhin fliegt er ein paar Meter durch die Luft, bis er mit dem Rücken zuerst in seinem Korb landet. Er jault vor Schmerzen auf und rollt sich zusammen, versteckt seinen Kopf unter der Decke.
º
»Wie behandelst du eigentlich deinen Hund?«
Isabelle hat sich nie für den Tierschutz engagiert, aber irgendetwas an Donalds Art ekelt sie an. Das Gefühl beruht vielleicht auf Gegenseitigkeit, denn Donald schaut sie an, als wäre sie eine Schnecke in seinem Garten. Er lächelt und sagt: »Darüber solltest du dir deinen hübschen, kleinen Kopf nicht zerbrechen.«
Isabelle verschlägt es nur selten die Sprache. Donalds Macho-Attitüde à la John Wayne ist in ihrer Naivität beinahe erschreckend. Sie schaut zu Peter hinüber, um zu sehen, wie er auf diese Bemerkung gegenüber seiner Frau reagiert. Er schaut zu Boden, ohne das Lächeln verbergen zu können, das um seine Lippen spielt.
»Nee, Leute«, sagt Donald, an alle gewandt. »Wir sollten einander schon ein bisschen Raum zum Atmen geben, oder?« Er breitet die Arme aus, als würde er unsichtbare Wellen zur Seite schieben. »Man braucht sich ja nicht gegenseitig auf die Zehen zu treten, wo wir jetzt so viel Platz haben, nicht wahr?«
Donald trägt eine alte Trainingshose. Isabelle mustert das Kleidungsstück, das im Schritt ein paar eingetrocknete Urinflecken erahnen lässt. Drei Schritte nach vorn und ein fester Tritt genau dorthin. Das wäre eine Maßnahme. Fürs Erste erhebt sie aber nur die Stimme und sagt: »Wir können natürlich so lange darüber streiten, wann und wie wir hierher gekommen sind, bis wir schwarz sind, aber wir sollten endlich rauskriegen, was es da draußen gibt. Vielleicht liegt ja zehn Kilometer entfernt der nächste Supermarkt? Frisches Brot und Wichsblätter für den Onkel.«
Sie schaut Donald in die Augen, als sie den letzten Satz sagt. Er läuft rot an, und der Tritt erscheint nicht mehr notwendig. Oder vielleicht doch, denn Donald macht einen Schritt auf sie zu. Peter stellt sich dazwischen und wirft Isabelle einen finsteren Blick zu, bevor er sagt: »Ich kann fahren. Die Wortwahl meiner Frau ist vielleicht nicht immer ganz … aber ich kann auf jeden Fall fahren.«
Isabelle hat eine tödliche Bemerkung gegenüber Peter auf der Zunge, aber Molly zupft sie an der Hand.
»Mama?«, sagt sie. »Ich hätte auch gerne was aus dem Laden.«
º
Emil mag es nicht, wenn viele Erwachsene auf einem Haufen versammelt sind. Ihre Stimmen und Bewegungen wirken gekünstelt, als wären sie im Fernsehen. Emil hält sich dicht an seine Mutter. Zum Glück sagt sie nichts zu den anderen Erwachsenen. Sie hat ihre Hand auf seine Schulter gelegt, und er darf seinen Kopf an ihren Oberschenkel lehnen.
Die Erwachsenen sprechen mit lauten Stimmen, und Emil hört, dass sie Angst haben. Am liebsten würde er mit Mama und Papa von hier wegfahren, aber er hat verstanden, dass das nicht geht. Dass man nirgendwo hinfahren kann. Im Moment jedenfalls.
Die Tante, die aussieht wie auf einem Werbeplakat, schreit hässliche Wörter, und Emil schüttelt den Kopf. Jemand sollte sie ausschimpfen. Aber nicht Mama und Papa. Sonst ruft sie ihnen auch noch hässliche Wörter zu. Der Mann von der Reklamefrau sagt, dass er fährt.
Emil schaut auf das Feld hinaus. Er hat das beklemmende Gefühl, dass sich weiter weg, wo man nicht mehr hinschauen kann, etwas Schlimmes verbirgt, und er findet es dumm, dass ausgerechnet der Mann von der Reklamefrau fahren will. Er wirkt nett und scheint zu wissen, was zu tun ist.
Emil schließt die Augen und versucht den Gedanken zu verdrängen, dass dort hinten etwas Schlimmes lauert. Er kneift die Lider zusammen und denkt an eine große Bürste, nein, an einen Staubsauger, der kommt und die dummen Gedanken wegsaugt. Erst in den Staubbeutel, und dann nimmt man den Beutel heraus und wirft ihn in die Mülltüte. Und dann kommt die Mülltüte in den Mülleimer. Und dann kommt der Müllwagen und, wohin kommt er dann?
Emil öffnet die Augen und will seine Mutter fragen, wo der Abfall hinkommt, wenn der Müllwagen ihn abgeholt hat, aber plötzlich steht ein Mädchen vor ihm. Es ist genauso groß wie er selbst und sieht ein bisschen wie die Reklamefrau aus. In Emils Kindergarten gibt es ein ähnliches Mädchen, es ist nett, aber ziemlich schrill.
»Wie heißt du?«, fragt das Mädchen.
»Emil«, sagt Emil und drückt sich fester an seine Mutter.
»Ich heiße Molly«, sagt das Mädchen. »Komm, wir spielen.«
Emil schaut zu seiner Mutter hoch. Sie sieht nicht richtig glücklich aus. Dann nimmt sie den Arm von Emils Schulter. Molly nimmt seine Hand und zieht ihn mit sich. Jetzt lächelt Mama und nickt. Emil lässt sich zu einem fremden Wohnwagen führen. Er findet es nicht so toll, aber er weiß nicht, wie er nein sagen soll.
º
Peter folgt Molly und dem Jungen, sieht sie im Wohnwagen verschwinden, während er selbst zum Auto geht. Seine Tochter findet überall Freunde. Falls das das richtige Wort dafür ist. Sie verschafft sich einen Hofstaat. Schart andere Kinder um sich und sagt ihnen, was sie zu tun haben. Er weiß, dass ihr der Junge bereits vorher aufgefallen ist, aber er war ihr zu kindisch, um sich mit ihm zu beschäftigen. Stattdessen hat sie sich an ältere Kinder gehalten, die aber nicht so alt waren, dass sie sie nicht mehr um den Finger hätte wickeln können. Jetzt, wo sie weg sind, ist der Junge offensichtlich gut genug.
Weg?
Peter lehnt sich an die Autotür und atmet tief durch. Es ist so still hier. Nichts als die Stimmen der anderen Menschen, die immer noch über ihre Verpflanzung diskutieren. Jetzt kommt es auf ihn an. Er soll den Weg hinaus finden und sie von der Leere erlösen.
Eine Kindheitserinnerung drängt sich ihm auf. Peter ist neun Jahre alt. Es ist November, und er steht vor der Tür zu der Wohnung, in der er und seine Mutter gerade wohnen. Mithilfe der Kette fischt er seinen Schlüssel aus der Hosentasche. Als er ihn ins Schloss stecken will, hört er ein Geräusch aus dem Keller. Er zuckt zusammen und verliert den Schlüssel, sodass er am Ende der Kette schaukelt und gegen sein Knie schlägt. Er keucht auf und bückt sich nach dem Schlüssel, als er plötzlich innehält. Und sich wieder aufrichtet.
Für ein paar Sekunden sieht er sich selbst von außen. Die viel zu dünne Jacke aus dem Secondhandladen, die Jeanshose, die unten schon ganz ausgefranst ist. Wie er vor der Tür zu einer dürftig eingerichteten Wohnung steht, in der er sich nicht wohlfühlt. Ihm wird bewusst, wie grau und trist seine Kindheit ist, immer auf der Flucht. Während dieser Sekunden, in denen die Angst wieder weicht, wird ihm klar, was er sich wirklich wünscht. Er möchte weg von hier.
Peter umklammert den Autoschlüssel in seiner Tasche. Damals, als er neun war, ging es um den diffusen Wunsch, erwachsen zu werden und selbst über sein Leben bestimmen zu können. Das Erwachsensein war ein verlockender, ferner Ort. Eines Tages würde er dorthin kommen. Aber hier? Vielleicht gibt es tatsächlich keinen Ausweg aus dieser Situation?
Peter schüttelt den Kopf. Die Leute verlassen sich auf ihn. Natürlich befinden sie sich irgendwo, und von irgendwo gibt es immer einen Weg nach irgendwo anders. So einfach ist das.
Er gleitet hinter das Lenkrad und zieht die Tür zu, die weich und mit einem dumpfen Geräusch ins Schloss fällt. Der Klang eines Neuwagens. Als er den Motor anlässt, sieht er im Rückspiegel, dass sich die Aufmerksamkeit der Gruppe auf ihn richtet. Er fährt eine langsame Kehrtwende und setzt das Lächeln auf, das er auch als Aerobictrainer verwendet: Ihr seid klasse, ihr macht das toll, und hebt die Hand zum Gruß, als er an ihnen vorbeifährt.
Sie winken zurück, und ihm fällt auf, wie einsam sie aussehen. Von einer unbekannten Hand zu einem unbekannten Zweck in die Leere hineingeworfen. Nicht einmal ein Baum leistet ihnen Gesellschaft. Paradoxerweise fühlt sich Peter in seinem Auto weniger einsam. Der Duft der Ledersitze, das Motorengeräusch und die Lampen und Leuchtdioden des Armaturenbretts, ja, allein die Vorwärtsbewegung schaffen ein Gefühl der Selbstgenügsamkeit. Ein eigenes Universum. Er verlässt sie, nicht umgekehrt.
Isabelle löst sich von der Gruppe und läuft ihm nach. Peter lässt das Fenster herunter und weiß wie üblich nicht, was ihn erwartet. Eine verbale Abreibung oder ein freundliches Abschiedswort.
»Du«, sagte Isabelle, »wenn du ein Geschäft findest, dann kauf etwas ein.«
Schweißperlen treten an ihrem Haaransatz hervor. Peter schaut auf das Feld hinaus. »Haben wir nichts?«
Sie schüttelt den Kopf. »Chips oder irgend sowas. Schokolade.«
»Wir haben Bananen.«
Isabelle seufzt und zeigt ihm eine zitternde Hand. Ihre Erkrankung heißt Hyperthyreose, wie Peter mittlerweile weiß. Überfunktion der Schilddrüse. Sie kann im Grunde genommen so viel essen, wie sie will, ohne davon zuzunehmen. Der Preis, den sie dafür bezahlt, sind Schweißausbrüche und Zitteranfälle, wenn die Maschine nichts bekommt, was sie verbrennen kann.
Peter schaut ihre zitternde Hand an und fragt sich, was passieren würde, wenn sie nicht von hier wegkommen und das Essen zu Ende geht. Es ist eine schreckliche Vorstellung. Und eine ziemlich interessante.
»Hast du gehört, was ich sage?«
»Ich habe es gehört«, sagt Peter und fährt die Scheibe wieder nach oben. Dann tritt er auf das Gaspedal. Nach einer Minute ist er von Leere umgeben.
º
»Das kommt überhaupt nicht in Frage!«
Als Donald vorgeschlagen hat, die Wagen über eine größere Fläche zu verteilen, ist er davon ausgegangen, dass sein eigener Wohnwagen den Ausgangspunkt dieser Expansion bilden würde. Jetzt erwartet man offenbar, dass er selbst ebenfalls umzieht.
Er schaut zu Majvor und schüttelt den Kopf angesichts der Dummheit der Leute. Rein praktisch gesehen ist es für sie viel schwieriger, den Standort zu wechseln, weil sie als Einzige ein ordentliches Vorzelt haben. Es müsste erst abgebaut und dann wieder aufgestellt werden. Aber dieses Argument hätte eigentlich überflüssig sein müssen.
Donald und Majvor sind Saisoncamper. Seit mittlerweile zwölf Jahren buchen sie jeden Sommer für fünf Wochen denselben Stellplatz in Saludden. Nur in diesem Jahr mussten sie auf die Wiese für Reisecamper ausweichen, weil ein Baum auf ihren Stammplatz gestürzt ist. Seit drei Wochen müssen sie es jetzt schon mit diesen Leuten aushalten, die kommen und gehen, wie sie wollen, nur weil das Personal den Finger nicht herausbekommt und endlich diesen scheiß Baum zersägt.
Die anderen sind seit höchstens einer Woche da. Und dann kommen sie an und verlangen, dass Donald umzieht!
»Kommt überhaupt nicht in Frage«, sagt er noch einmal und zeigt auf sein Vorzelt. »Man braucht einen ganzen Tag, um das Zelt wieder aufzubauen. Außerdem stehen wir schon seit drei Wochen hier.«
Der Typ mit der hässlichen Brille murmelt irgendetwas. Donald sieht ihn scharf an und bittet ihn, es noch einmal zu wiederholen.
»Aber stehen wir überhaupt noch dort, wo wir gestanden haben?«, fragt der Mann. »Rein technisch gesehen?«
Donald wird lauter und spricht mit derselben Stimme, die er auch gegenüber aalglatten Subunternehmern verwendet. »Rein technisch gesehen lautet die Frage, ob du mich überhaupt dazu zwingen kannst, meinen Wohnwagen zu bewegen, wo ich dir doch schon erklärt habe, was für ein Haufen Arbeit das ist.«
Der Schlaumeier rudert sofort zurück, hält die Hände abwehrend in die Höhe und sagt: »War nur so eine Idee.«
Donald breitet die Arme aus, als wollte er die ganze Gruppe umarmen, und sagt: »Ich lade euch alle zu einem Bier in mein Vorzelt ein, wenn ihr fertig seid.« Er bedeutet Majvor mit einer Geste, dass das Gespräch für seinen Teil beendet ist, und sie gehen nach Hause.
Als sie außer Hörweite sind, sagt Majvor: »Warum musst du immer so stur sein?«
»Stur? Du weißt doch selbst, was für eine Heidenarbeit es ist, diesen ganzen Scheiß mitsamt den Paletten und allem Drumherum zum Stehen zu bringen.«
»Ja, aber das hätten die anderen auch verstanden, wenn du es ruhig und vernünftig erklärt hättest. Und ich möchte nicht, dass du mir gegenüber so sprichst.«
Sie kommen in ihr Vorzelt. Donald zieht sich einen Stuhl heran und lässt sich mit vor der Brust verschränkten Armen hineinfallen. »Ich rede ja nicht deinetwegen so, mein Schatz, ich werde einfach so verdammt … Das kann ich dir sagen, wenn hier irgenwer ankommt und sich aufspielt, dann …«
»Was dann, Donald?«
Donald bückt sich, stützt sich auf dem Boden ab und holt ein Bier aus dem gasbetriebenen Kühlschrank. Er reißt die Dose auf, trinkt einen großen Schluck und wischt sich die Stirn ab. »Dann hole ich das Gewehr.«
Majvor starrt ihren Mann an, der anscheinend ungerührt auf den Eingang zum Vorzelt schaut, als würde er nur auf jemanden warten, der hereinkommt und sich aufspielt. Majvor wartet, bis sich sein Blick wieder zu ihr verirrt, bevor sie fragt: »Hast du das Gewehr etwa dabei?«
Donald zuckt mit den Schultern. »Natürlich. So kriminell, wie es heutzutage auf dem Campingplatz zugeht.« Er trinkt einen Schluck Bier. Ein paar Tropfen rinnen aus seinem Mundwinkel. Majvors Blick lässt nicht locker, und er fügt hinzu: »Ich will ja niemanden erschießen, das kannst du dir doch denken. Es ist nur zur Abschreckung.«
»Bewahrst du das Gewehr und den Verschluss wenigstens an unterschiedlichen Orten auf? Und die Munition?«
»Jaja. Natürlich.«
»Wirklich?«
»Ja, wenn ich es sage.«
»Ganz ehrlich?«
»Was soll denn dieses verdammte Rumgefrage …«
Donald dreht sich um und wühlt in der Kissentruhe, holt das batteriegetriebene Radio heraus und stellt es auf den Tisch. Er denkt sich gar nichts dabei, will einfach nur diese unangenehme Diskussion beenden.
»Ich glaube nicht, dass du irgendetwas hereinbekommst«, sagt Majvor. »So wie es gerade aussieht.«
Aber Donald hat das Gerät bereits eingeschaltet, und es zeigt sich, dass Majvor falschliegt. Aus dem kleinen roten Kasten strömt Musik. Genauer gesagt: »Alle haben vergessen« von Towa Carson.
Donald und Majvor erstarren vor Schreck und schauen einander an. Dass Donald das Radio eingeschaltet hat, ist eine reine Impulshandlung gewesen. Auf der Besprechung hieß es, dass weder Handys noch Computer funktionierten, dass es kein Netz gebe. Und trotzdem:
»Alle haben vergessen, doch ich nicht.
Mit jeder einsamen Nacht wächst die Erinnerung.«
Sie schweigen und hören sich das Lied an, als würde sich darin eine geheime Botschaft verstecken, eine Antwort auf ihre Fragen. Eigentlich hatten sie Towa Carson schon damals nicht gemocht, aber jetzt lauschen sie hingerissen und nehmen jede Silbe in sich auf.
Das Lied verklingt, und sie warten gespannt, was als Nächstes kommt. Vielleicht eine Stimme, jemand, der etwas sagt? Aber nein, nachdem das Lied in der Stille verklungen ist, ertönen die ersten Akkorde von: »Deine eigene Melodie« mit Sylvia Vrethammar. Und dann Sylvia selbst.
º
Molly und Emil spielen, dass sie Hunde sind. Zuerst sind sie ganz lange Hundewelpen gewesen und haben sich auf dem Boden des Wohnwagens herumgerollt, haben gekläfft und versucht, einander mit den Pfoten zu schlagen. Molly hält eine ihrer Sandalen zwischen den Zähnen. Jetzt schwingt sie den Kopf und wirft sie in die Dunkelheit unter dem Sofa.
Emil krabbelt dorthin und schaut darunter, winselt erbärmlich. Er ist ein kleiner Hund, der keine dunklen Orte mag.
»Der Welpe soll sie holen«, sagt Molly.
Emil winselt erneut und schüttelt den Kopf. Molly stellt sich auf die Hinterpfoten und bekommt menschlichere Züge, als sie sagt: »Der Welpe soll den Schuh holen, sonst ist der Welpe ein dummer Hund.«
»Der Welpe will nicht«, sagt Emil, noch immer mit halber Hundestimme.
»Der Welpe muss aber.«
»Der Welpe will aber nicht!«
»Und warum will der Welpe nicht?«
»Weil … weil …«, Emil schaut sich um auf der dringenden Suche nach einer Eingebung, bis sein Blick auf eine Rolle Toilettenpapier fällt. »Weil es ein ekliger Schuh ist, der nach A-a stinkt!«
Für einen Augenblick starrt Molly ihn streng an. Dann lässt sie sich nach hinten fallen und kichert mit einem klingenden, alles andere als hundeartigen Geräusch, das Emils kleines Hundeherz ein bisschen höher schlagen lässt.
Molly kichert und hält sich den Bauch, während Emil um sie herum auf dem Boden herumschnüffelt und so tut, als würde er an den Küchenschrank pinkeln. Molly hört auf zu kichern und geht wieder auf alle viere. Sie macht sich so groß wie möglich und sagt: »Jetzt sind wir ein Mamahund und ein Papahund, die sich treffen.«
Emil gibt seine schlappen Welpenpatschen auf und entscheidet sich für kräftige Beine und eine bedrohlichere Ausstrahlung. Er knurrt leise.
»Nein«, sagt Molly. »Du bist ein Papahund und in mich verliebt.«
Emil blinzelt und reißt die Augen auf, wie es Verliebte in Zeichentrickfilmen tun, stellt sich rosa Herzen vor, die aus seinem Kopf aufsteigen.
»Gut«, sagt Molly. »Und jetzt musst du an meinem Popo schnuppern.«
»Nee …«
»Das machen Hunde immer, wenn sie verliebt sind.«
»Warum?«
»Das ist doch egal. Sie machen es eben, und darum machst du es jetzt auch.«
Emil krabbelt um sie herum und schnuppert vorsichtig an Mollys Hinterteil. Er bekommt gerade noch mit, dass es ein bisschen nach Pipi riecht, ehe Molly sich herumwirft und die Zähne zeigt. Sie knurrt so tief und aggressiv, dass Emil Angst bekommt und sich zurückzieht, während er mit den Pfoten nach vorne schlägt.
»Was ist denn mit dir los?«, fragt Molly. »Bist du ein Spasti? So machen Hunde eben.«
»Ich bin kein Spasti!«
»Dann bist du eben ein Spasti-Hund.«
Für einen Augenblick steigen Emil die Tränen in die Augen. Dann stellt er sich einen Spasti-Hund vor und fängt stattdessen an zu lachen. Molly schüttelt den Kopf. »Du musst versuchen, an meinem Popo zu schnuppern, und dann werde ich böse, und dann musst du wieder versuchen, an meinem Hintern zu schnuppern, und ich werde wieder böse, und dann darfst du an meinem Popo schnuppern. Du hast echt keine Ahnung.«
»Ich habe aber keine Lust«, sagt Emil. »Ich bin nämlich ein Spasti-Hund.«
Molly starrt ihn wütend an, aber im Bruchteil einer Sekunde entspannt sich ihr Gesichtsausdruck. Sie lächelt und sagt: »Dann darf der Spasti-Hund mein Fell lecken.«
Emil leckt an Mollys Pulli, bis sie nickt und sagt: »Jetzt wollen sich die Hunde ausruhen.«
Sie legen sich nebeneinander flach auf den Bauch und tun für eine Weile so, als würden sie schlafen. Plötzlich zuckt Molly zusammen und hebt die Schnauze, schnuppert und flüstert:
»Jetzt spüren die Hunde, dass sich etwas Gefährliches nähert. Ein Feind.«
Emil schnuppert und riecht nichts außer dem Staub vom Teppichboden und ein bisschen Parfum. Er sagt: »Kein Feind.«
»Doch«, sagt Molly und rollt sich zusammen. »Ein großer und gefährlicher Feind. Die Hunde kennen ihn nicht. Er will die Hunde auffressen.«
»Nein.«
»Die Hunde haben Angst. Der Feind ist wie ein Elefant, obwohl er schwarz ist und einen großen Kopf mit vielen scharfen Zähnen hat. Er wird die Hunde beißen, bis sein Maul ganz blutig ist …«
»Nein!« Emil hat einen Kloß im Hals, und seine Augen brennen.
»Und dann kaut er auf den Hunden und es kracht, wenn alle Knochen zerbrechen …«
Emil hält sich die Ohren zu und schüttelt den Kopf. Er will nichts mehr hören. Denn er kann ihn sehen. Den Feind. Er ist groß und schwarz und er hat lange, scharfe Zähne und er wirbelt Staub auf, wenn er geht. Und er kommt näher, denn er will ihn auffressen.
Molly zieht eine seiner Hände vom Ohr weg und flüstert: »Aber ich weiß, wie man sich vor ihm schützen kann. Ich kann dich schützen.«