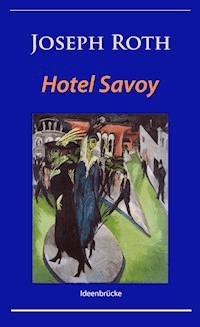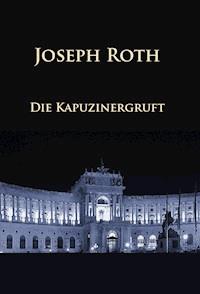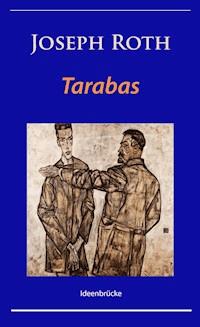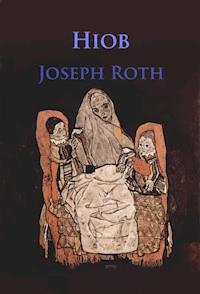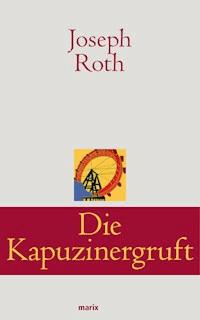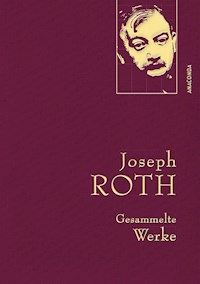Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Jude Mendel Singer lebt um 1900 mit seiner Frau und drei gesunden Kindern in einem russischen Dorf. Das vierte Kind ist von Geburt an krank. Ein Sohn wandert nach Amerika aus, der andere bleibt als Soldat in Russland. Als sich Mendels Tochter Mirjam mit einem Nicht-Juden einlässt, entschließt sich die Familie, nach Amerika zu gehen und den kranken Sohn zurückzulassen. In New York erlebt Mendel eine Reihe von schicksalshaften Ereignissen – ähnlich wie Hiob, von dem im Alten Testament erzählt wird. Mendel wendet sich von Gott ab. Wird er zu seinem Glauben zurückfinden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joseph Roth
Hiob (vereinfacht)
Roman eines einfachen Mannes
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Erster Teil
Zweiter Teil
Impressum neobooks
Erster Teil
Erstes Kapitel
Vor vielen Jahren lebte in Zuchnow ein Mann namens Mendel Singer. Er war fromm, gottesfürchtig und gewöhnlich, ein ganz alltäglicher Jude. Er übte den einfachen Beruf eines Lehrers aus. In seinem Haus, das nur aus einer großen Küche bestand, machte er die Kinder mit der Bibel bekannt. Er lehrte mit ehrlichem Bemühen und ohne aufsehenerregenden Erfolg. Hunderttausende vor ihm hatten wie er gelebt und unterrichtet.
Unbedeutend wie sein Wesen war sein blasses Gesicht. Ein Vollbart von einem gewöhnlichen Schwarz umrahmte es ganz. Den Mund verdeckte der Bart. Die Augen waren groß, schwarz, träge und halb verhüllt von schweren Lidern. Auf dem Kopf saß eine Mütze aus schwarzer Seide. Der Körper steckte im halblangen, landesüblichen jüdischen Kaftan.
Singer schien wenig Zeit zu haben und lauter dringende Ziele. Gewiss war sein Leben ständig schwer und zuweilen sogar eine Plage. Eine Frau und drei Kinder musste er einkleiden und ernähren. (Mit einem vierten Kind war sie schwanger.) Jeden Morgen dankte Mendel Gott für den Schlaf, für das Erwachen und den anbrechenden Tag. Wenn die Sonne unterging, betete er noch einmal. Wenn die ersten Sterne sichtbar wurden, betete er zum dritten Mal. Und bevor er sich schlafen legte, flüsterte er ein eiliges Gebet mit müden, aber eifrigen Lippen. Sein Gewissen war rein. Er brauchte nichts zu bereuen, und nichts gab es, was er unbedingt haben wollte. Er liebte seine Frau. Mit gesundem Hunger verzehrte er schnell seine Mahlzeiten. Seine zwei kleinen Söhne, Jonas undSchemarjah, prügelte er wegen Ungehorsams. Aber das Jüngste, die Tochter Mirjam, küsste er häufig. Sie hatte sein schwarzes Haar und seine schwarzen, trägen und sanften Augen.
Zwölf sechsjährige Schüler unterrichtete er im Lesen und Auswendiglernen der Bibel. Jeder von den zwölf brachte ihm an jedem Freitag zwanzig Kopeken. Sie waren Mendel Singers einzige Einnahmen. Dreißig Jahre war er erst alt. Aber seine Aussichten, mehr zu verdienen, waren gering, vielleicht überhaupt nicht vorhanden. Wurden die Schüler älter, kamen sie zu anderen, weiseren Lehrern. Das Leben verteuerte sich von Jahr zu Jahr. Die Ernten wurden schlechter und schlechter. Es gab weniger Karotten, die Eier wurden hohl, die Kartoffeln erfroren, die Suppen wurden wässrig, die Karpfen schmal und die Hechte kurz, die Enten mager, die Gänse hart und die Hühner ein Nichts.
So klangen die Klagen Deborahs, der Frau Mendel Singers. Sie schielte nach dem Besitz Wohlhabender und war neidisch auf den Gewinn der Kaufleute. Viel zu gering war Mendel Singer in ihren Augen. Sie warf ihm vor, dass sie so viele Kinder hätten, die Schwangerschaft, dass alles teurer wurde, die niedrigen Einkünfte und oft sogar das schlechte Wetter. Am Freitag scheuerte sie den Fußboden, bis er gelb wurde. Ihr Mann kam nach Hause, der Fußboden leuchtete ihm entgegen, gelb wie geschmolzene Sonne. Er setzte sich, sang ein Liedchen, dann schlürften die Eltern und die Kinder die heiße Suppe und sprachen kein Wort. Im Zimmer wurde es warm. Die Kinder legten sich auf die Strohsäcke in der Nähe des Ofens, die Eltern saßen noch und sahen in die letzten blauen Flämmchen der billigen Kerzen. Am Ende jeder Woche brach so der Sabbat an, mit Schweigen, Kerzen und Gesang. Vierundzwanzig Stunden später tauchte er unter in der Nacht, die eine graue Kette von mühseligen Wochentagen anführte.
An einem heißen Tag im Hochsommer, um vier Uhr nachmittags, setzte die Geburt ein. Deborahs erste Schreie stießen in den Gesang der zwölf lernenden Kinder. Sie gingen alle nach Hause. Sieben Tage Ferien begannen. Mendel bekam ein neues Kind, ein viertes, einen Knaben. Acht Tage später wurde er beschnitten und Menuchim genannt.
Im dreizehnten Monat seines Lebens begann Menuchim, Grimassen zu schneiden, wie ein Tier zu stöhnen, in jagender Hast zu atmen und auf eine noch nie dagewesene Art zu keuchen. Sein großer Schädel hing schwer wie ein Kürbis an seinem dünnen Hals. Seine Beine waren gekrümmt und ohne Leben. Seine dürren Ärmchen zappelten und zuckten. Lächerliche Laute stammelte sein Mund. Bekam er einen Anfall, so nahm man ihn aus der Wiege und schüttelte ihn ordentlich, bis sein Gesicht bläulich wurde und er beinahe keine Luft mehr bekam. Dann erholte er sich langsam. »Macht nichts«, sagte sein Vater, »es kommt vom Wachsen!« »Söhne geraten nach den Brüdern der Mutter. Mein Bruder hat es fünf Jahre gehabt!« sagte die Mutter. »Es wächst sich aus!« sprachen die andern. Bis eines Tages die Pocken in der Stadt ausbrachen, die Behörden Impfungen vorschrieben und die Ärzte in die Häuser der Juden drangen. Dr. Soltysiuks Blick fiel auf den kleinen Menuchim, er hob den Krüppel hoch und sagte: »Er wird ein Epileptiker. Aber ich könnte ihn vielleicht gesund machen. Es ist Leben in seinen Augen.«
Gleich wollte er den Kleinen ins Krankenhaus mitnehmen. Schon war Deborah bereit. »Man wird ihn umsonst gesund machen«, sagte sie. Mendel aber erwiderte: »Sei still, Deborah! Gesund machen kann ihn kein Doktor, wenn Gott nicht will. Soll er unter russischen Kindern aufwachsen? Kein heiliges Wort hören? Milch und Fleisch essen und Hühner auf Butter gebraten, wie man sie im Krankenhaus bekommt? Man wird nicht geheilt in fremden Krankenhäusern.« Wie ein Held hielt Mendel seinen dürren, weißen Arm zum Impfen hin. Menuchim aber gab er nicht fort. Er beschloss, Gottes Hilfe für seinen Jüngsten zu erflehen und zweimal in der Woche zu fasten, Montag und Donnerstag. So würde Menuchim gesund werden und kein Epileptiker.
Dennoch hing seit der Stunde der Impfung über dem Haus Mendel Singers die Furcht, und der Kummer durchzog die Herzen wie ein dauernder heißer und stechender Wind. Menuchims Anfälle hörten nicht auf. Die älteren Kinder wuchsen und wuchsen, ihre Gesundheit lärmte wie ein Feind des kranken Menuchims böse in den Ohren der Mutter. Es war, als würden die gesunden Kinder Kraft von dem Kranken erhalten, und Deborah hasste ihr Geschrei, ihre roten Wangen, ihre geraden Körper. Sie versäumte ihre Aufgaben in der Küche, die Suppe lief über, die Kochgefäße zerbrachen oder verrosteten, die Gläser zersprangen mit hartem Knall, der Schmutz vieler Sohlen und vieler Wochen lag auf den Dielen des Bodens, die Knöpfe fielen von den Hemden der Kinder wie Laub vor dem Winter.
Eines Tages, aus dem Sommer war Regen geworden, und aus dem Regen wollte Schnee werden, packte Deborah den Korb mit ihrem Sohn, legte Wolldecken über ihn, stellte ihn auf die Fuhre des Kutschers Sameschkin und reiste nach Kluczýsk, wo der Rabbi wohnte.
Deborah wohnte bei Kluczýsker Verwandten ihres Mannes. Sie schlief nicht. Die ganze Nacht kauerte sie neben dem Korb Menuchims in der Ecke, neben dem Herd; finster war das Zimmer, finster war ihr Herz. Endlich sah sie durch die Ritzen der schwarzen Fensterläden ein paar blasse Streifen des Morgens. Schnell erhob sie sich. Bald kochte der Tee, die Familie stand auf, sie setzten sich und tranken. Da hob Deborah ihren Sohn aus dem Korb. Er winselte. Sie küsste ihn schnell und viele Male, mit einer rasenden Zärtlichkeit. Hierauf packte sie ihn ein, schnürte einen Strick um das Paket und hängte sich ihren Sohn um den Hals, damit ihre Hände frei würden. Platz wollte sie sich schaffen im Gedränge vor der Tür des Rabbi.
Mit scharfem Heulen stürzte sie sich in die Menge der Wartenden. Jemand machte die Tür auf. Der Rabbi stand am Fenster, er kehrte ihr den Rücken. Plötzlich wandte er sich um. Sie blieb an der Tür, auf beiden Armen reichte sie ihm ihren Sohn, wie man ein Opfer bringt. Sie erblickte einen Schimmer von dem bleichen Gesicht des Mannes, das eins zu sein schien mit seinem weißen Bart. Sie hatte sich vorgenommen, in die Augen des Heiligen zu sehen, um sich zu überzeugen, dass wirklich in ihnen die mächtige Güte lebe. Aber als sie hier stand, lag ein See von Tränen vor ihrem Blick, und sie sah den Mann hinter einer weißen Welle aus Wasser undSalz. Ganz nah hörte sie die Stimme des Rabbi, obwohl er nur flüsterte:
»Menuchim, Mendels Sohn, wird gesund werden. Menschen wie ihn wird es nicht viele geben. Der Schmerz wird ihn weise machen, die Hässlichkeit gütig, die Verbitterung mild und die Krankheit stark. Seine Augen werden weit sein und tief, seine Ohren offen und aufmerksam. Sein Mund wird schweigen, aber wenn er die Lippen auftut, werden sie Gutes sprechen. Hab keine Furcht, und geh nach Haus!
»Wann, wann, wann wird er gesund werden?« flüsterte Deborah.
»Nach langen Jahren«, sagte der Rabbi, »aber frage mich nicht weiter, ich habe keine Zeit, und ich weiß nicht mehr. Verlass deinen Sohn nicht, auch wenn er dir eine große Last ist; gib ihn nicht weg von dir, er kommt aus dir, wie ein gesundes Kind. Und geh!« ...
Draußen machte man ihr Platz. Ihre Wangen waren blass, ihre Augen trocken, ihre Lippen leicht geöffnet, als atmeten sie Hoffnung. Gnade im Herzen, kehrte sie heim.
Zweites Kapitel
»Menuchim wird gesund werden, aber es wird lange dauern!« Mit diesen Worten betrat Deborah das Haus. »Es wird lange dauern!« wiederholte Mendel wie ein böses Echo. Es schlug drei von der Wanduhr, die Stunde, in der sich die Schüler am Nachmittag versammelten. Mendel begann, Wort für Wort, Satz für Satz aus der Bibel vorzutragen. Der helle Chor der Kinderstimmen wiederholte Wort für Wort, Satz für Satz. Wie Glocken schwangen die Oberkörper der Lernenden vorwärts und zurück, während über den Köpfen der Korb Menuchims fast in gleichem Rhythmus pendelte. Heute nahmen Mendels Söhne am Unterricht teil, die im klingenden Vorsagen den andern voran waren. Um sie zu erproben, verließ er die Stube. Der Chor der Kinder läutete weiter, angeführt von den Stimmen der Söhne. Er konnte sich auf sie verlassen.
Jonas, der ältere, war stark wie ein Bär, Schemarjah, der jüngere, war schlau wie ein Fuchs. Stampfend trottete Jonas einher, mit vorgeneigtem Kopf, ewigem Hunger, gekräuseltem Haar, das heftig über die Ränder der Mütze wucherte. Sanft und beinahe schleichend, immer wachen, hellen Augen, dünnen Armen, in der Tasche vergrabenen Händen, folgte ihm sein Bruder Schemarjah. Niemals brach ein Streit zwischen ihnen aus, zu unterschiedlich waren sie, getrennt waren ihre Reiche und Besitztümer, sie hatten ein Bündnis geschlossen. Aus Blechdosen, Streichholzschachteln, Scherben, Ästen bastelte Schemarjah wunderbare Sachen. Jonas hätte sie mit seinem starken Atem umblasen und vernichten können. Aber er bewunderte die zarte Geschicklichkeit seines Bruders. Seine kleinen, schwarzen Augen blinkten wie Fünkchen zwischen seinen Wangen, neugierig und heiter.
Einige Tage nach ihrer Rückkehr hielt Deborah die Zeit für gekommen, Menuchims Korb von der Decke abzuknöpfen. Nicht ohne Feierlichkeit übergab sie den Kleinen den ältern Kindern. »Ihr werdetihn spazieren führen!« sagte Deborah. »Wenn er müde wird, werdet ihr ihn tragen. Lasst ihn um Gottes Willen nicht fallen! Der heilige Mann hat gesagt, er wird gesund. Tut ihm nicht weh.« Von nun an begann die Plage der Kinder.
Sie schleppten Menuchim wie ein Unglück durch die Stadt, sie ließen ihn liegen, sie ließen ihn fallen. Sie ertrugen es schwer, dass die anderen Kinder, die hinter ihnen herliefen, wenn sie Menuchim spazieren führten, sich über ihren Bruder lustig machten. Der Kleine musste zwischen zweien gehalten werden. Er setzte nicht einen Fuß vor den andern wie ein Mensch. Er wackelte mit seinen Beinen wie mit zwei zerbrochenen Reifen, er blieb stehen, er knickte ein. Schließlich ließen ihn Jonas und Schemarjah liegen. Sie legten ihn in eine Ecke, in einen Sack. Dort spielte er mit Hundekot, Pferdeäpfeln, Kieselsteinen. Er fraß alles. Er kratzte den Kalk von den Wänden und stopfte sich den Mund voll, hustete dann und wurde blau im Gesicht. Wie ein Stück Dreck lag er in der Ecke. Manchmal fing er an zu weinen. Die Jungen schickten Mirjam zu ihm, damit sie ihn tröste. Zart, mit hüpfenden dünnen Beinen, einen hässlichen und hassenden Abscheu im Herzen, näherte sie sich ihrem lächerlichen Bruder. Die Zärtlichkeit, mit der sie sein aschgraues, verknittertes Gesicht streichelte, hatte etwas Mörderisches. Sie sah sich vorsichtig um, nach rechts und links, dann kniff sie ihren Bruder ins Bein. Er heulte auf, Nachbarn sahen aus den Fenstern. Sie verzerrte das Gesicht zur weinerlichen Grimasse. Alle Menschen hatten Mitleid mit ihr und fragten sie aus.
Eines Tages im Sommer, es regnete, schleppten die Kinder Menuchim aus dem Haus und steckten ihn in eine Tonne, in der sich Regenwasser seit einem halben Jahr gesammelt hatte, Würmer herumschwammen, Obstreste und verschimmelte Brotrinden. Sie hielten ihn an den krummen Beinen und stießen seinen grauen, breiten Kopf immer wieder ins Wasser. Dann zogen sie ihn heraus, mit klopfenden Herzen, roten Wangen, in der freudigen und grausigen Erwartung, einen Toten zu halten. Aber Menuchim lebte. Er röchelte, spuckte das Wasser aus, die Würmer, das verschimmelte Brot, die Obstreste und lebte. Nichts war ihm geschehen. Da trugen ihn die Kinder schweigsam und voller Angst ins Haus zurück. Eine große Furcht vor Gottes kleinem Finger, der eben ganz leise gewinkt hatte, ergriff die zwei Jungen und das Mädchen. Den ganzen Tag sprachen sie nicht miteinander. Ihre Lippen öffneten sich, ein Wort zuformen, aber kein Ton bildete sich in ihren Kehlen. Die Kinder krochen ins Haus zurück wie Hunde. Den ganzen Nachmittag noch warteten sie auf den Tod Menuchims. Menuchim starb nicht.
Menuchim starb nicht, er blieb am Leben, ein mächtiger Krüppel. Und er wuchs. Seine Beine blieben zwar gekrümmt, aber sie wurden ohne Zweifel länger. Auch sein Oberkörper streckte sich. Plötzlich, eines Morgens, stieß er einen nie gehörten, schrillen Schrei aus. Dann blieb er still. Eine Weile später sagte er, klar und vernehmlich: »Mama.«
Deborah stürzte sich auf ihn, und aus ihren Augen, die lange schon trocken gewesen waren, flossen die Tränen, heiß, stark, groß, salzig, schmerzlich und süß. »Sag Mama!« »Mama«, wiederholte der Kleine. Ein dutzendmal wiederholte er das Wort. Hundertmal wiederholte es Deborah. Nicht vergeblich waren ihre Bitten geblieben. Menuchim sprach. Und dieses eine Wort der Missgeburt war mächtig wie ein Donner, warm wie die Liebe, gnädig wie der Himmel, weit wie die Erde, fruchtbar wie ein Acker, süß wie eine süße Frucht. Es war mehr als die Gesundheit der gesunden Kinder. Es bedeutete, dass Menuchim stark und groß, weise und gütig werden sollte, wie die Worte des Rabbis gelautet hatten.
Allerdings: Noch andere verständliche Laute kamen nicht mehr aus Menuchims Kehle. Lange Zeit bedeutete dieses eine Wort, das er nach so schrecklichem Schweigen zustande gebracht hatte, Essen und Trinken, Schlafen und Lieben, Lust und Schmerz, Himmel und Erde. Obwohl er nur dieses Wort bei jeder Gelegenheit sagte, erschien er seiner Mutter Deborah reich an Ausdruck wie ein Dichter. Sie verstand jedes Wort, das sich in dem einen versteckte. Sie vernachlässigte die älteren Kinder. Sie wandte sich von ihnen ab. Sie hatte nur einen Sohn, den einzigen Sohn: Menuchim.
Drittes Kapitel
Vielleicht brauchen Segen eine längere Zeit zu ihrer Erfüllung als Flüche. Zehn Jahre waren vergangen, seitdem Menuchim sein erstes und einziges Wort ausgesprochen hatte. Er konnte immer noch kein anderes sagen.
Jonas und Schemarjah waren schon in dem Alter, in dem sie zu den Soldaten sollten und nach der Tradition ihrer Väter sich vor dem Dienst retten mussten. Andern Jungen hatte ein gnädiger und vorsorglicher Gott eine Krankheit mitgegeben, die sie wenig behinderte und vor dem Militärdienst beschützte. Manche waren einäugig, manche hinkten, der hatte einen Leistenbruch, jener zuckte ohne Grund mit den Armen und Beinen, einige hatten schwache Lungen, andere schwache Herzen, einer hörte schlecht und einanderer stotterte, und ein dritter hatte ganz einfach eine allgemeine Körperschwäche.
In der Familie Mendel Singers schien es, als hätte der kleine Menuchim die ganze Anzahl menschlicher Qualen auf sich genommen, die sonst vielleicht eine gütige Natur auf alle Mitglieder verteilt hätte. Mendels ältere Söhne waren gesund, kein Fehler konnte an ihrem Körper entdeckt werden, und sie mussten anfangen, sich zu plagen, zu fasten und schwarzen Kaffee zu trinken und wenigstens auf eine vorübergehende Herzschwäche hoffen.
Und so begannen ihre Plagen. Sie aßen nicht, sie schliefen nicht, sie torkelten schwach und zitternd durch Tage und Nächte. Ihre Augen waren gerötet und geschwollen, ihre Hälse mager und ihre Köpfe schwer. Deborah schloss sie wieder in ihr Herz. Für ihre älteren Söhne betete sie um eine Krankheit, wie sie früher um die Gesundheit Menuchims gefleht hatte. Das Militär erhob sich vor ihrem bekümmerten Auge wie ein schwerer Berg aus glattem Eisen und klirrender Folter. Leichen sah sie, lauter Leichen. Hoch und schimmernd, die Füße im roten Blut, saß der Zar und wartete auf das Opfer ihrer Söhne. Sie nahmen an einer militärischen Übung teil; schon dies allein war ihr der größte Schrecken, an einen neuen Krieg dachte sie nicht einmal. Sie war zornig auf ihren Mann. Mendel Singer, was war er? Ein Lehrer, ein dummer Lehrer dummer Kinder. Sie hatte anderes im Sinn gehabt, als sie noch ein Mädchen gewesen war. Mendel Singer trug nicht leichter am Kummer als seine Frau. Am Sabbat in der Synagoge, wenn das gesetzlich vorgeschriebene Gebet für den Zaren abgehalten wurde, dachte Mendel an die nächste Zukunft seiner Söhne. Schon sah er sie in der verhassten Soldatenuniform. Sie aßen Schweinefleisch und wurden von Offizieren mit der Reitpeitsche geschlagen. Sie trugen Gewehre. Er seufzte oft ohne erdenklichen Grund, mitten im Beten, mitten im Unterricht, mitten im Schweigen. Sogar Fremde sahen ihn bekümmert an. Nach seinem kranken Sohn hatte ihn niemals jemand gefragt, aber nach seinen gesunden Söhnen erkundigten sich alle.
Am sechsundzwanzigsten März, endlich, fuhren die beiden Brüder zur vorgeschriebenen ärztlichen Untersuchung. Beide waren tadellos und gesund. Beide wurden genommen. Noch einen Sommer durften sie zu Hause verbringen. Im Herbst sollten sie zum Militär einrücken.
Am Sonntag kehrten sie heim, mit Freikarten des Staates ausgerüstet. Schon reisten sie auf Kosten des Zaren. Viele ihresgleichen fuhren mit ihnen. Es war ein langsamer Zug. Sie saßen auf hölzernen Bänken unter Bauern. Die Bauern sangen und waren betrunken. Alle rauchten den schwarzen Tabak, in dessen Qualm noch eine ferne Erinnerung an Schweiß mit duftete. Alle erzählten einander Geschichten. Jonas und Schemarjah trennten sich nicht für einen Augenblick. Es war ihre erste Reise mit der Eisenbahn. Oft tauschten sie die Plätze. Jeder von ihnen wollte ein wenig am Fenster sitzen und in die Landschaft sehn. Ungeheuer weit erschien Schemarjah die Welt. Uninteressant war sie in Jonas' Augen, sie langweilte ihn. Der Zug fuhr durch das flache Land wie ein Schlitten über Schnee. Die Felder lagen vor den Fenstern. Die bunten Bäuerinnen winkten. Wo sie in Gruppen auftauchten, antwortete ihnen im Waggon ein dröhnendes Geheul der Bauern. Schwarz gekleidet, schüchtern und bekümmert saßen die zwei Juden unter ihnen, in die Ecke gedrängt vom Übermut der Betrunkenen.
»Ich möchte ein Bauer sein«, sagte plötzlich Jonas.
»Ich nicht«, erwiderte Schemarjah.
»Ich möchte ein Bauer sein«, wiederholte Jonas, »ich möchte betrunken sein und mit den Mädchen da schlafen.«
»Ich will sein, was ich bin«, sagte Schemarjah, »ein Jude wie mein Vater Mendel Singer, kein Soldat und nüchtern.«
»Ich freue mich ein bisschen, dass ich Soldat werde«, sagte Jonas.
»Du wirst schon deine Freuden erleben! Ich möchte lieber ein reicher Mann sein und das Leben sehn.«
»Was ist das Leben?«
»Das Leben«, erklärte Schemarjah, »ist in großen Städten zu sehn. Die Bahnen fahren mitten durch die Straßen, alle Läden sind so groß wie bei uns die Kaserne, und die Schaufenster sind noch größer. Ich habe Ansichtskarten gesehen. Man braucht keine Tür, um in ein Geschäft zu treten, die Fenster reichen bis zu den Füßen.«