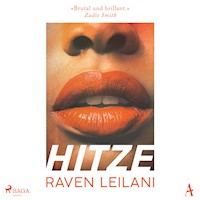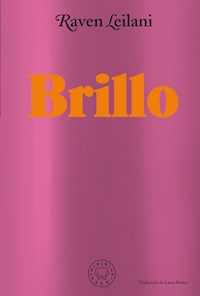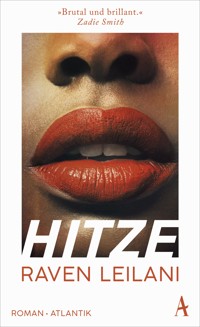
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantik
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ein elektrisierendes, scharfsinniges und komisches Buch darüber, was es bedeutet, heutzutage jung zu sein. Brutal und brillant!" Zadie Smith Ein Lieblingsbuch von Barack Obama New York Times-Bestseller " Das Debüt des Jahres. " The Guardian "Sexy und unverschämt lesenswert!" Daily Mail Die dreiundzwanzigjährige Edie lebt in Bushwick, Brooklyn, und hält sich nach ihrem abgebrochenen Kunststudium finanziell mit einem Assistenzjob in einem Verlag und emotional mit wechselnden Liebschaften über Wasser. Dann beginnt sie eine Affäre mit Eric, einem weißen Mann, der in einer offenen Ehe lebt und fast doppelt so alt ist wie sie. Während sich Edie mit Erics Ehefrau und vor allem mit der Adoptivtochter des Paares, Akila, einem Schwarzen Mädchen, anfreundet, verschieben sich alle Perspektiven. Edie scheint die einzige andere Schwarze Person zu sein, die Akila kennt, und die Beziehung zwischen den beiden wird bald wichtiger als alles andere. Auf einmal muss Edie sich mit ihrer eigenen Einsamkeit und dem schon immer in ihrem Leben gewesenen Rassismus und Sexismus neu auseinandersetzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Raven Leilani
Hitze
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Sophie Zeitz
Atlantik
Für meine Mutter
1
Als wir das erste Mal Sex haben, sitzen wir beide angezogen am Schreibtisch, während der Arbeitszeit, ins blaue Licht des Computers getaucht. Er ist im Norden von Manhattan und sichtet ein Bündel Microfiches, ich bin im Süden von Manhattan und gebe die Korrekturen eines neuen Labrador-Krimis ein. Er erzählt, was er zu Mittag gegessen hat, und fragt mich, ob ich es schaffe, ohne dass es jemand merkt, an meinem Platz im Großraumbüro die Unterhose auszuziehen. Seine Zeichensetzung ist tadellos. Er hat eine Vorliebe für Wörter wie schmecken und spreizen. Das leere Textfeld steckt voller Möglichkeiten. Natürlich habe ich Angst, dass die IT-Abteilung meinen Computer kontrolliert oder dass mein Internetverlauf wieder ein Disziplinar-Meeting mit der Personalleitung nach sich zieht. Aber das Risiko. Der Reiz eines dritten unsichtbaren Augenpaars. Die Vorstellung, dass jemand im Verlag mit diesem süßen Optimismus nach der Mittagspause über unseren Thread stolpert und sieht, wie behutsam Eric und ich uns diese private Welt erschaffen haben.
In seiner ersten Nachricht weist er mich auf ein paar Rechtschreibfehler in meinem Onlineprofil hin und erzählt mir, dass er eine offene Ehe führt. Seine Profilfotos sind lässig, ungestellt – ein grobkörniges Foto von ihm schlafend im Sand, ein Foto beim Rasieren, von hinten aufgenommen. Dieses letzte Foto löst bei mir etwas aus. Die schmutzigen Fliesen und der sich sanft auflösende Dampf. Sein Gesicht im Spiegel, ernst, still prüfend. Ich speichere das Foto auf dem Handy, um es mir später in der U-Bahn anzusehen. Frauen schauen mir über die Schulter und lächeln, und ich lasse sie in dem Glauben, er sei mein.
Ansonsten hatte ich nicht viel Erfolg bei Männern. Das ist Selbstmitleid. Es ist ein Fakt. Und hier ist noch ein Fakt: Ich habe tolle Brüste, die meine Wirbelsäule verformt haben. Weitere Fakten: Ich verdiene wenig. Ich finde nicht leicht Freundinnen, und wenn ich den Mund aufmache, verlieren Männer das Interesse an mir. Am Anfang läuft es immer gut, aber dann rede ich zu viel über meine Ovarialtorsion oder meine Miete. Aber Eric ist anders. Nach zwei Wochen unseres Chats erzählt er mir, dass die Hälfte seiner Familie mütterlicherseits an Krebs zugrunde gegangen ist. Er erzählt mir von einer Lieblingstante, die aus Fuchshaar und Hanf Salben machte. Und sich mit einer Maisblattpuppe beerdigen ließ, die sie von sich selbst gemacht hatte. Trotzdem beschreibt er die Orte seiner Kindheit liebevoll, das weite Farmland zwischen Milwaukee und Appleton, die Gelbbrustwaldsänger und Pfeifschwäne, die im Garten auftauchten und Körner suchten. Wenn ich von meiner Kindheit rede, dann rede ich nur von glücklichen Zeiten. Die Spice World-Videokassette, die ich zum fünften Geburtstag bekam, die Barbie, die ich, als ich allein zu Hause war, in der Mikrowelle schmolz. Der Kontext meiner Kindheit – die Boygroups, die Lunchables-Fertigsnacks, Bill Clintons Amtsenthebungsverfahren – unterstreicht den Generationenkonflikt natürlich noch. Eric ist empfindlich wegen seines Alters und wegen meines, und er strengt sich schwer an, die Lücke von dreiundzwanzig Jahren zu überbrücken. Er folgt mir auf Instagram und schreibt langatmige Kommentare zu meinen Posts. Antiquierter Internetslang durchsetzt von ernst gemeinten Bemerkungen über den Winkel, in dem das Licht auf mein Gesicht fällt. Verglichen mit den undurchsichtigen Avancen jüngerer Männer ist es eine Wohltat.
Wir chatten einen Monat lang, bevor unsere Terminpläne zueinanderpassen. Wir haben es früher versucht, aber es kam immer etwas dazwischen. Das ist nur eine der Ebenen, auf der sein Leben anders ist als meins. Es gibt Leute, die ihn brauchen, und manchmal brauchen sie ihn dringend. Zwischen seinen kurzfristigen Absagen stelle ich fest, dass ich ihn auch brauche. Deswegen habe ich nachts fieberhafte Träume von Durstgebilden – lange gelbe Wüstenstrecken, mit triefendem Moos behängte Kathedralen. Bis wir endlich unser erstes echtes Date festlegen, bin ich zu allem bereit gewesen. Er will in den Six-Flags-Freizeitpark.
Wir verabreden uns für Dienstag. Als er in seinem weißen Volvo anrollt, bin ich noch in der Phase der Date-Vorbereitung, in der ich das passende Lachen suche. Ich probiere drei Kleider an, bevor ich das richtige finde. Ich binde mir die Zöpfe hoch und trage Eyeliner auf. In der Spüle steht Geschirr, und die ganze Wohnung stinkt nach Lachs, und ich will nicht, dass er denkt, der Geruch hätte etwas mit mir zu tun. Ich ziehe mir eine komplizierte Unterhose an, die weniger Unterhose als ein Bündel von Schnüren ist, und stelle mich vor den Spiegel. Ich denke: Du bist eine begehrenswerte Frau. Du bist nicht ein Dutzend Rennmäuse in einer Pelle.
Der Volvo parkt in zweiter Reihe. Eric lehnt am Wagen und bleibt so, als ich aus dem Haus komme, die Augen hell und ruhig. Sein Haar ist dunkler, als ich dachte, ein Schwarz so tief, dass es blau wirkt. Sein Gesicht ist fast obszön symmetrisch, nur eine Braue ist höher als die andere, wodurch sein Lächeln ein bisschen selbstgefällig wirkt. Es ist der zweite Tag des Sommers, und alle Mächte der Stadt prallen an ihm ab. Ich strecke die Hand nach seiner aus, versuche, mich nicht an meiner Zunge zu verschlucken, und habe ein merkwürdiges Gefühl. Natürlich bin ich nervös. In echt wirkt er wie ein richtiger Daddy, sein Gesicht wach und hart, gemildert nur vom leichten Rückgang seines Haars. Aber das merkwürdige Gefühl hat nichts damit zu tun, nichts damit, dass ich hinter seinem sinnlichen Mund und der leicht schiefen Nase nach einem Hinweis suche, ob er genauso nervös ist wie ich. Das merkwürdige Gefühl hat damit zu tun, dass es Viertel nach acht Uhr morgens ist, und ich bin glücklich. Ich sitze nicht im L-Train, rieche jemandes lauwarme saure Gurken und wünschte, ich wäre tot.
»Edie«, sage ich und halte ihm die Hand hin.
»Ich weiß«, sagt er, und legt die langen Finger zwischen meine, zu sanft. Ich wollte dreister sein, wollte ihn mit einer lockeren, extrovertierten Umarmung begrüßen. Stattdessen dieser schlaffe Händedruck, er weicht meinem Blick aus, überlässt mir unmittelbar, unüberraschend die Macht. Und dann das Schlimmste, wenn du am helllichten Tag einen Mann kennenlernst, der Moment, wenn du siehst, wie er dich sieht, wie er im Bruchteil einer Sekunde entscheidet, ob zukünftiger Cunnilingus Pflicht oder Kür ist. Er öffnet mir die Tür, und am Rückspiegel hängt ein flauschiger blauer Würfel. Auf dem Beifahrersitz liegt eine halb volle Tüte Jolly-Ranchers-Bonbons. Seine Nachrichten waren ehrlich, voll von stotternder Aufrichtigkeit. Doch weil wir uns alles, was man sich beim ersten Date erzählt, schon erzählt haben, ist der Anfang schwer. Er macht eine Bemerkung über das Wetter, und dann sprechen wir über den Klimawandel. Nachdem wir eine Weile allgemein darüber geredet haben, dass wir irgendwann verbrennen, kommen wir an dem Freizeitpark an.
Es ist schwer, sich des Altersunterschieds nicht bewusst zu sein, wenn man von der buntesten Kindheitsstaffage umgeben ist. Die Tweety-Bird-Luftballons, die seelenlosen Plastikaugen von Taz, dem tasmanischen Teufel, Dippin’-Dots-Eisperlen. Als wir durch das Tor treten, fühlt sich die fructosehaltige Parksonne wie ein Anschlag an. Wir sind auf einem Kinderspielplatz gelandet. Er hat mich auf einen Kinderspielplatz geführt. Ich suche nach Hinweisen in seinem Blick, ob das ein Witz sein soll oder eine aufschlussreiche Manifestation seines Unbehagens wegen der gerade mal dreiundzwanzig Jahre, die ich auf der Welt bin.
Mich stört der Altersunterschied nicht. Abgesehen von der Tatsache, dass ältere Männer finanziell stabiler sind und ein anderes Verständnis der Klitoris mitbringen, ist da die starke Droge des Machtgefälles. Die Gefahr, sich im schwer aushaltbaren Fegefeuer zwischen ihrer Expertise und ihrem Desinteresse zu verfangen. Ihre Panik hinsichtlich der zunehmenden Gleichgültigkeit der Welt. Ihre Wut und ihre Erwachsenenkrisen, umgeleitet in die Reduktion deines Körpers auf schimmernde, elastische Teile.
Nur dass das alles für ihn Neuland zu sein scheint. Nicht nur das Rendezvous mit einer Frau, die nicht seine Frau ist und die Jahrzehnte jünger ist, sondern auch das Rendezvous mit einer jüngeren Frau, die zufällig Schwarz ist. Ich merke es an der vorsichtigen Art, wie er afroamerikanisch sagt. Wie er sich standhaft weigert, das Wort Schwarz zu sagen. Prinzipiell versuche ich es zu vermeiden, die Jungfernfahrt zu übernehmen. Ich will nicht die erste Schwarze sein, mit der ein Weißer ein Verhältnis hat. Ich halte die nervösen Zitate von Backpacker-Rap nicht aus, die aufgesetzte Umgangssprache, die Selbstgefälligkeit von rosa Männern in Kente-Stoffen. Als wir zu den Schließfächern gehen, stehen ein Vater und ein Sohn hinter einem Bugs-Bunny-Aufsteller und übergeben sich. Ich öffne die Tür meines Schließfachs und finde eine volle Windel darin. Eric ruft sofort einen Parkangestellten. Er sagt, es tut ihm leid, und die Entschuldigung scheint sich nicht nur auf die Windel, sondern auf die Wahl des Orts zu beziehen. Ich fühle mich mies. Ich fühle mich mies, weil ich instinktiv seine Gefühle auffangen möchte, anstatt vorzuschlagen, woanders hinzugehen. Weil wir deswegen beide meinen Versuch ertragen müssen, während des ganzen Dates zu beweisen, dass Ich mich gut amüsiere! und Dass er doch nichts dafür kann!
Ein Monat ist zu lang zum Chatten. In der Zeit, in der wir nur gechattet haben, hat meine Phantasie Blüten getrieben. Wegen seines großzügigen Gebrauchs des Semikolons bin ich einfach davon ausgegangen, dass dieses Treffen gut wird. Aber IRL ist alles anders. Erstens bin ich nicht so schnell zu Fuß. Ich habe keine Zeit, mir meine Worte zu überlegen oder in iOS-Notes clevere Antworten zu formulieren. Außerdem ist da der Faktor Körperwärme. Die nonverbalen Aspekte der Nähe eines Mannes, das Süße, das Animalische unter dem Rasierwasser, der Eindruck, der manchmal entsteht, als hätten Männer kein Weißes in den Augen. Der tiefsitzende adrenale Wahnsinn, die dünne Hülle ihrer Beherrschung. Ich spüre es an mir und in mir, als wäre ich besessen. Beim Chatten haben wir beide emsig die Lücken gefüllt. Wir haben sie mit Optimismus gefüllt, mit der Art von Sehnsucht, die aufhellt und verzerrt. Wir haben hypothetische Dinner ausgeschmückt, haben uns von den Arztterminen erzählt, vor denen wir Angst haben. Jetzt gibt es keine Lücken mehr, und als er mir den Rücken mit Sonnencreme einreibt, ist es mir gleichzeitig zu wenig und zu viel.
»Gut so?«, fragt er, sein Atem heiß in meinem Nacken.
»M-hm«, sage ich und versuche, nicht mehr aus der Berührung zu machen, als da ist. Aber seine Hände sind unglaublich. Sie sind warm und groß und weich, und ich hatte seit Monaten keinen Sex. Kurz denke ich, ich muss weinen, was nicht ungewöhnlich ist, weil ich häufig und überall weine, besonders bei der Olive-Garden-Werbung. Ich entschuldige mich und renne aufs Klo, wo ich in den Spiegel sehe und mir versichere, dass es wichtigere Dinge gibt als diesen Moment. Wahlkreisschiebung. Genealogie-Mischkonzerne, die meinen Wangenabstrich an den Staat verkaufen.
Natürlich ist da immer noch die Herausforderung, sexy auszusehen, wenn man in den Himmel geschleudert wird. Wie die meisten weißen Menschen, die im Wald Bohnen essen, ohne sich von der frischen Losung eines hungrigen Bären abschrecken zu lassen, betrachtet Eric seine Sterblichkeit und seinen weichen, fleischigen Körper als belanglose, zufällige Gegebenheit. Mir dagegen sind alle Arten, auf die ich vielleicht sterbe, schmerzhaft bewusst. Als der minderjährige Parkangestellte seufzend meinen Sicherheitsbügel herunterklappt und zu den Hebeln hinüberschlurft, denke ich deswegen an all meine unerledigten Angelegenheiten – das angebrochene Pistazieneis im Tiefkühlfach, die 1,5 Orgasmen, die ich meinem halb toten Vibrator noch abgerungen hätte, mein Mister Rogers-Box-Set.
Doch Erics Begeisterung ist ansteckend. Nach den ersten beiden Fahrten fange ich an, mich zu amüsieren, nicht nur, weil Sterben hieße, dass ich meinen Studienkredit nicht zurückzahlen muss. Er verschränkt die Finger mit meinen und zieht mich an der Schlange vorbei, offenbar war ihm das Parkerlebnis wichtig genug, um die Extragebühr zu berappen, damit wir uns nicht hinten anstellen müssen. Ich gehe mir die Schnürsenkel binden, und als ich zurückkomme, redet er mit dem Porky-Pig-Maskottchen über Einstiegsjobs im Bibliotheksarchiv.
»Wir können gutes Servicepersonal immer gebrauchen«, sagt er und drückt Porky seine Telefonnummer in den rosa Filzhandschuh. Wir besteigen zum dritten Mal die höchste Achterbahn auf dem Gelände, und Eric schreit wie beim ersten Mal. Er schreit wirklich, ernsthaft. Erst ist es befremdend, aber als wir den letzten Hang hinaufklettern, merke ich, dass es mir gefällt. Es gefällt mir sehr. Ich weiß nicht, ob es an der Dissonanz liegt, an der Mädchenhaftigkeit der Neigung im Gegensatz zu seiner Masse, oder daran, dass ich ihn um sein Staunen beneide – um die Wonne in seinem Grauen, die Bereitschaft, Bekanntes neu zu erleben. Seine Freude ist auf eine Art unverbraucht, die mir das Gefühl gibt, ich könnte meine Haut mit einem Reißverschluss herunterziehen und ihm den ganzen Schmodder darunter zeigen. Aber noch nicht. In seiner Begeisterung schwingt eine Traurigkeit mit, als wäre sie aufgesetzt, als müsste er mir etwas beweisen. Als wir den höchsten Punkt erreichen, sieht er mich an. Der Wind fährt ihm ins Haar. Durch seine Augen sehe ich mich selbst in Stücke gebrochen. Auf einmal tut es weh, so gewöhnlich zu sein, so durchschaubar zu sein, als er mich ansieht und so tut, als wäre ich nicht bloß die billigere Version des italienischen Sportwagens.
»Ich wünschte, jeder Tag könnte so sein«, sagt er, als wir ganz oben an der schlimmsten Stelle der Achterbahn sind, ganz oben, wenn sie einen kurz in der Luft festhalten und zwingen, den Fall vorauszuspüren. Im Park unter uns gehen die Lichter an. Alles, was ich will, ist, dass er kriegt, was er will. Ich will unkompliziert und anspruchslos sein. Ich will keine Reibung zwischen seiner Phantasie und der Person, die ich in Wirklichkeit bin. Ich will all das, und ich will nichts davon. Ich will, dass der Sex vertraut und lauwarm ist, dass er keinen hochkriegt, dass ich über meinen Reizdarm reden kann, dass wir durch unser gegenseitiges Trösten aneinander gebunden sind. Ich will, dass wir uns in der Öffentlichkeit streiten. Und wenn wir allein streiten, will ich, dass er mir vielleicht eine runterhaut. Ich will, dass wir ein langes, fruchtbares Hobby als Freizeitornithologen aufbauen, und dann will ich, dass wir am selben Tag erfahren, dass wir beide Krebs haben. Mir fällt seine Frau wieder ein, die Gondel kippt nach vorn, und wir fallen.
Gegen meinen Willen denke ich den ganzen Tag an seine Frau. Ich hoffe, dass sie ein aktives Mitglied der Nachbarschaftswache ist. Außerdem wäre es beruhigend, wenn sie beim Sex ganz still daliegt. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass sie cool ist. Vielleicht hat sie wirklich kein Problem damit, wenn ihr Mann ein Date mit einer Frau hat, die sechzehnmal so viele fruchtbare Eier hat wie sie. Vielleicht ist sie gelenkig, im Einklang mit der rückläufigen Venus, und benutzt natürliches Deo. Eine Frau, die sich von New Yorks Frauen so wenig bedroht fühlt, dass sie dieser geschlechtsreifen Horde einen Freibrief ausstellt, ihren Ehemann zu vögeln.
Nach ein paar weiteren Runden steuern Eric und ich einen nachgebauten Saloon mit einer erstaunlichen Fülle an Korbgeflecht an. Es ist das einzige Lokal im Park, das Alkohol ausschenkt, und über der Bar hängt ein Neonschild in Form des riesigen Schnurrbarts von Yosemite Sam. Die Kellnerin trägt einen Cowboyhut und knallt ein paar klebrige Speisekarten auf den Tisch. Dann leiert sie die Tageskarte herunter und gibt uns zu verstehen, dass wir als Gäste in ihrem Bereich sie kreuzweise am Arsch lecken können. Bisher sind Eric und ich Seite an Seite durch den Tag gesegelt. Jetzt sitzen wir uns gegenüber, und es tut beinahe weh. Seine ungeteilte Aufmerksamkeit ist wie die gebündelte Hitze eines Brennpunkts.
»Amüsierst du dich?«, fragt er.
»Ja, ich glaube schon.«
»Weil ich ehrlich bin, bei dir weiß ich nicht genau, woran ich bin, und normalerweise bin ich gut in so was.« Ich trinke mein Bier aus und versuche, meinen inneren Jubel zu verbergen, weil ich es geschafft habe, meine Bedürftigkeit und Negativität zu verbergen. »Du wirkst irgendwie unnahbar«, sagt er, und alle Kinder, die unter meinem Trenchcoat aufeinanderstehen, frohlocken. Unnahbar ist eine lässige Haltung, eine Entscheidung. Kein Mädchen aus Bushwick, das eine Dose Thunfisch ausleckt.
»Ich bin ein offenes Buch«, sage ich und denke an all die Männer, die mich unlesbar fanden. Bei diesen Männern habe ich Fehler gemacht. Ich habe mich an ihre Beine geklammert, als sie gehen wollten. Ich bin ihnen mit einer Flasche Listerine in den Flur nachgelaufen und habe gerufen Ich kann Strandlektüre sein, ich kann die Nebensätze streichen, bitte, ich überarbeite mich einfach noch mal.
Also gebe ich mir Mühe, unbeeindruckt zu sein. Ich versuche, mein Schweigen so lange wie möglich besonnen wirken zu lassen und nicht wie das Zögern aus Angst, mich zu blamieren.
»Triffst du dich noch mit anderen?«, fragt er.
»Nein. Willst du mich deswegen weniger?«
»Nein, willst du mich weniger, weil ich verheiratet bin?«
»Deswegen will ich dich mehr«, sage ich und frage mich, ob ich zu viel preisgebe, ob es ein Fehler ist zuzugeben, dass er der Einzige ist. Niemand will, was niemand will. Es riecht nach Gras, nach Klo und nach Popcorn, und am Tresen sitzt ein Mann neben einem riesigen Teddybären und weint leise. Zum ersten Mal kommt mir der Gedanke, dass Eric diesen Ort vielleicht gewählt hat, weil er hier garantiert niemanden trifft, den er aus der Stadt kennt. »Ich fand es schön, als du gefragt hast, ob ich mich amüsiere«, sage ich.
»Warum?« Er runzelt die Stirn, und mir fällt auf, dass ich den Ausdruck schon von ihm kenne, dass mir schon nach wenigen Stunden sein Mienenspiel so vertraut ist. Als ich daran denke, dass es von hier aus in nur eine Richtung geht und wir nie wieder in die relative Anonymität des Internets zurückkehren können, würde ich mich am liebsten zu einer Kugel zusammenrollen. Mir graut bei der Vorstellung, dass ich Gesten wiederhole, dass er mich ansieht, Muster erkennt und schweigend entscheidet, ob es Dinge sind, die er ertragen kann. Ich bin nicht in der Lage, gleiche Bedingungen zu schaffen. Manche Männer sind wenigstens so anständig, sofort mit ihren Macken herauszurücken. Aber alles, was ich von Eric gesehen habe, will ich wiedersehen. Sein verhaltenes väterliches Altmännerstirnrunzeln, seine sanfte Missbilligung.
»Weil ich das Gefühl hatte, dass du wirklich auf meine Antwort gewartet hast, dass es keine dieser Fragen war, die du stellst, weil du denkst, dass ich sowieso ja sage«, erkläre ich.
»Nenn mir ein Beispiel.«
»Hier: Bist du gekommen?«
»Du würdest ja sagen, auch wenn die Antwort nein ist?«
»Natürlich.«
»Aber dann bist du bloß eine kleine Lügnerin, oder?«, sagt er, und ich will antworten, Ja, ja, das bin ich.
»Lügst du nie, um keine Gefühle zu verletzen?«
»Nie.«
»Interessant«, sage ich. Natürlich ist es überhaupt nicht interessant, dass er das Privileg hat, ehrlich sein zu können. Es ist nicht interessant, dass er sich nichts anderes vorstellen kann. Er hat seine Freiheit mit meiner gleichgesetzt. Er denkt nicht an die Lügen, die man erzählt, um zu überleben, an die Freundlichkeit der Täuschung, die ich gerade jetzt demonstriere, als ich diesen bakterienverseuchten Hotdog esse. Es ist das erste Mal, dass ich ihn irgendwie verstehe. Er denkt, wir wären gleich. Er hat keine Ahnung, wie viel Anstrengung mich das kostet.
»Bei mir kannst du du selbst sein, weißt du«, sagt er, und ich muss mir auf die Zunge beißen, um nicht laut zu lachen.
»Danke«, sage ich, obwohl ich weiß, dass er nicht meint, was er sagt. Er will, dass ich ich selbst bin, wie eine Leopardin im Zoo sie selbst sein soll. Nicht draußen in freier Wildbahn, mit Sehnen zwischen den Zähnen.
»Und wenn ich dich nicht zum Orgasmus bringe, will ich, dass du mir das sagst«, erklärt er und winkt nach der Rechnung.
»Heißt das, wir schlafen miteinander? Läuft es gut?«
»Findest du nicht?«
Als wir zum Auto zurückgehen, fängt es an zu regnen. Es ist nur ein Nieseln, aber es ist unerwartet, und im Park ist das Abschlussfeuerwerk schon halb vorbei. Wir stehen auf dem Parkplatz und warten auf das Finale. Er legt den Arm um mich, als am Ende die weißen Dahliensterne verglühen. Ich drücke das Gesicht an sein Hemd, und es ist feucht von Schweiß und Chlor. Den ganzen Tag hatten wir keine Chance zu trocknen. Er berührt meinen Nacken, und seine Finger bleiben kleben.
Als wir ins Auto steigen, sind die Scheiben von innen nass. Er stellt den Scheibenwischer an und zieht das Hemd aus. Das Lächeln, das er auf den Lippen hat, als wäre er sich seiner selbst bewusst, löst den Wunsch bei mir aus, mich auf sein Gesicht zu setzen. Ich bin darauf vorbereit. Ich habe extra dieses Kleid an, weil es sich leicht ausziehen lässt. Aber dann legt er den Gang ein, und wir fahren los. Ich sehe zu, wie der Schein der Straßenlaternen sein Gesicht streift. Der Rückweg von Jersey in die Stadt ist ungewöhnlich frei. Er lässt den Arm aus dem Fenster hängen und singt mit leiser, fester Stimme den Song mit, der im Radio läuft. Es ist »Could Heaven Ever Be Like This« von Idris Muhammad. Das Lied kam 1977 heraus, drei Jahre nach Erics Geburt. Ich stimme so unverkrampft ein, wie ich kann, was immer noch ziemlich verkrampft ist.
»Woher kennst du das Lied?«, fragt er, und ich wäre gern cool. Ich würde gern sagen, ich hätte die Platte in einem Laden gefunden, falsch einsortiert hinter irgendwelchem Goblin-Prog. Nicht, dass ich Samples davon in zwei Songs gehört und von 2003 bis 2006 in primitiven Internetforen danach gesucht habe. Ich würde Eric gern erzählen, dass mich Donna Summers »Spring Affair« 2004 gerettet hat, aber die Ereignisse jenes Jahres hatte ich aus unserem Chat ausgespart.
»Ich liebe Disco«, sage ich, und er lächelt und dreht die Musik auf. So gleiten wir zurück in die Stadt, auf der Welle der späten Siebziger. Er fährt entspannt mit einer Hand am Steuer, und als es zu stinken anfängt, weiß ich, dass ich fast zu Hause bin. Er bleibt am Bordstein stehen, dreht die Musik herunter und fragt noch einmal, ob ich mich amüsiert habe.
»Ja«, sage ich, das Rauschen des Fahrtwinds noch in den Ohren.
»Wehe, du lügst mich an«, sagt er, und dann ist seine Hand auf meinem Schenkel. Schließt sich um meinen Nacken. Seine Berührungen haben kein erkennbares Muster, und er ist so still, dass ich ihn nicht einmal atmen höre. Ansonsten ist mir jede atmosphärische Verschiebung im Wagen bewusst: der verlorene Radiosender mit dem leisen FM-Knistern, nicht drin, nicht draußen, sodass zum trägen Kreisen seiner Finger hin und wieder die ölige DJ-Stimme aus dem Lautsprecher dringt, Ihr hört gerade …; die Innenbeleuchtung; der schwache Heiligenschein um seinen Kopf; seine Augen groß und hell.
»Ich will, dass du an meinen Fingern saugst«, sagt er.
»Okay«, sage ich und nehme einen Finger in den Mund. Und dann zwei. Und dann drei. Und plötzlich hakt er die Finger ein und zieht mich am Unterkiefer zu sich.
»Du miese Schlampe«, sagt er, und dann lässt er mich los.
»Komm mit.«
»Nicht heute. Lass uns am Donnerstagabend essen gehen.«
»Na gut«, sage ich, aber ich schäme mich. Ich hatte mich den ganzen Tag darauf gefreut, ihn in die Finger zu kriegen. Ich hatte extra mein Zimmer aufgeräumt und drei Packungen die Pille danach gekauft, falls etwas schiefgeht. Ich steige aus und winke ihm hinterher. Noch bevor ich die Treppe hochgehe, habe ich beschlossen, dass ich mich morgen krankmelde und den Rest der Nacht wild zu Top Chef masturbiere.
Leider ist mein Vibrator tot. Ich stelle alles auf den Kopf, aber die einzigen Batterien, die ich finde, sind keine Doppel-AAs. Ich versuche es mit den Fingern, doch kurz bevor ich komme, läuft eine Kakerlake über die Decke. Im Spiegel sehe ich, dass die falschen Wimpern an einem Auge abgegangen sind. Hoffentlich ist es jetzt erst passiert, und ich bin nicht den ganzen Tag mit einem traurigen Klebstofflid herumgelaufen. Ich schäme mich wegen meiner Vorbereitungen. Die neue Zahnbürste, die Eier und der LaCroix-Sprudel, die ich für unseren postkoitalen Brunch eingekauft habe. Ich mache mir ein Omelett und esse im Dunkeln. Ich denke an den Ausdruck in seinem Gesicht, als ich seine Finger im Mund hatte. Das Grinsen, das im blauen Dunkel schwebte.
Ich mache mich auf die Suche nach meinen Farben, und als ich sie finde, sind die meisten eingetrocknet. Es ist zwei Jahre her, dass ich das letzte Mal gemalt habe, aber in meinem Optimismus habe ich immer irgendwo eine Tüte mit Farben und Pinseln. Es liegt auch eine tote Maus in der Tüte, keine Ahnung, wie lang die schon da ist. Weil ich seit zwei Jahren meine Malsachen nach und nach aus dem Blickfeld geräumt habe. Ich bin aus Träumen erwacht, in denen meine Hände mit Ölfarbe und Terpentin verschmiert waren, und schon beim Zähneputzen war die Inspiration wieder verpufft. Das letzte Mal habe ich mit einundzwanzig gemalt. Der Präsident war Schwarz. Ich hatte mehr Serotonin und weniger Angst vor Männern. Jetzt sind das Cyan und das Gelb hart geworden. Ich brauche heißes Wasser, um sie aufzulösen. Ich mische die Farben, lasse das Acryl trocknen, und als es nicht stimmt, überarbeite ich es noch mal. Ich halte den Maßstab, so gut ich kann. Ich mische dreizehn Grüntöne und fünf Lilatöne, die ich nicht brauche. Mein Malspachtel bricht ab. Es ist fast fünf Uhr morgens, als ich ein passables Abbild von Erics Gesicht habe. Die Schräge seiner Nase im schummrigen Rotlicht des Armaturenbretts. Ich wasche die Pinsel aus und sehe zu, wie die Dämmerung in ihrer schmutzigen Großstadtform aufzieht. Irgendwo in Essex County liegt Eric mit seiner Frau im Bett. Es ist nicht das, was ich unbedingt will, einen Ehemann oder eine Alarmanlage, die im Verlauf unserer Ehe kein einziges Mal losgeht. Es ist nur, dass es graue anonyme Stunden wie diese gibt. Stunden, in denen ich verzweifelt bin, in denen ich Heißhunger habe, in denen ich weiß, wie aus einem Stern leerer Raum wird.
2
Am Donnerstagmorgen geht das heiße Wasser nicht, und einen neue Maus steckt in der Falle. Meine Mitbewohnerin und ich füttern seit sechs Monaten eine Mäusefamilie durch. Wir haben eine Reihe von Fallen ausprobiert und uns bei Home Depot angeschrien, welcher Tod am humansten wäre. Meine Mitbewohnerin wollte die Chemiekeule auspacken, aber keins der Fenster lässt sich öffnen. Deswegen haben wir schlichte Klebfallen, die künstlich nach Erdnussbutter riechen. Das Problem ist, um die Maus wieder abzukriegen, muss ich rausgehen und ihr Rapsöl auf die Füße kippen. Ja, es sind immer Löcher im Brot. Ja, die Vermieterin, eine dreiundzwanzigjährige Detox-Tee-Instagrammerin, die das Gebäude von ihrem Großvater geerbt hat, ignoriert meine E-Mails. Aber wir müssen alle essen. Wenn ich also auf der Straße stehe und versuche, die gestresste, stellenweise kahle Maus freizulassen, während die dicke gefleckte Deli-Katze von der anderen Straßenseite zusieht, habe ich das Gefühl, die Mäuseplage und ich sitzen im selben Boot. Auf dem Rückweg denke ich daran, wie wenig die Maus verlangt. Ich denke an Hühnerfett und Erdnussbutter. Ich denke daran, dass eine der Deli-Katzen noch vor dem Mittagessen von ihrer Irish-Spring-Kiste springt und die Maus in ihrem Schlund willkommen heißt.
Wieder oben ziehe ich mein am wenigsten zerknittertes Kleid an. Ich sehe in den Spiegel und übe mein Lächeln, denn sie haben mir einen neuen Schreibtisch zugewiesen, an dem meine Vorgesetzte mein Gesicht im Blick hat, und mir ist ihre wachsende Unzufriedenheit nicht entgangen. Sie sagen, sie haben mich umgesetzt, damit ich für die Kollegen besser erreichbar bin, aber ich weiß, es liegt an Mark. In den ersten zwei Jahren saß ich am äußeren Rand des Großraumbüros, wo das Kinderbuch-Imprint in die E-Book-Only-Liebesromanabteilung übergeht. Dort hatte ich das Glück, an der Wand zu sitzen, und konnte mir ungestört die Nase putzen. Jetzt bin ich ein Herdentier. Ich zeige den anderen die Zähne und tue so, als wäre ich überrascht vom Nichtfunktionieren der Verkehrsbetriebe. Einerseits bin ich stolz, in diese kleinen Interaktionen involviert zu sein, die bestätigen, dass ich hier bin, semisichtbar, und dass New York auch anderen Leuten auf dem Gesicht hockt, aber andererseits schwitze ich durch den Kabuki-Tanz, will die Hand ausstrecken und mich vom Text lösen.
Ich habe rund zehn Stunden bis zu meinem Date mit Eric, was heißt, ich darf so wenig wie möglich essen. Mein Verdauungstrakt neigt zu unvorhersehbaren Überreaktionen, und falls ich nur die kleinste Chance auf Sex habe, muss ich fasten. Manchmal ist der Sex es wert, manchmal nicht. Manchmal, nach einer vorzeitigen Ejakulation um elf Uhr abends, bleiben mir zwanzig Minuten zum nächsten McDonald’s mit laufender Eismaschine. Ich packe fürs Mittagessen eine Dose Oliven ein. Dann lege ich Lippenstift auf in der Hoffnung, das Erhalten der Farbe hält mich vom Essen ab.
Bis ich mich in den Zug quetsche, heizt die Sonne auf den Straßen von Manhattan den Müll auf. An der Montrose, Lorimer und Bedford staut sich der Verkehr, und die dunklen Tunnelwände machen aus den Fenstern Spiegel. Ich wende mich von meinem Spiegelbild ab, und ein Mann masturbiert unter einer Plane. Beinahe verliere ich meinen Sitzplatz an eine Frau, die am Union Square einsteigt, aber zum Glück ist sie wegen ihrer Schwangerschaft zu langsam. Als ich zur Arbeit komme, bin ich achtzehn Minuten zu spät, und die Lektoratsassistentinnen leiten die Flut der Anrufe schon an das Marketing weiter.
Ich bin Lektoratskoordinatorin beim Kinderbuch-Imprint, was bedeutet, dass ich die Lektoratsassistenten gelegentlich überprüfen lasse, wie Guppys ihre Nahrung verdauen. Ich berufe Meetings ein, bei denen wir diskutieren, warum Bären out sind und warum Kinder nur noch von Fischen lesen wollen. Die Lektoratsassistentinnen laden mich nicht ein, wenn sie zum Lunch gehen. Ich versuche, nahbar zu sein. Ich versuche, meine Gruppe markiger Nihilistinnen zu verstehen, die alle zum jüngeren Ende der Generation Z gehören. Es gibt nur eine Lektoratsassistentin, der ich aus dem Weg zu gehen versuche, und ausgerechnet sie kommt an diesem Donnerstagmorgen als Erste an meinen neuen, zentral gelegenen Tisch.
»Ich weiß nicht, wo diese Journalisten unsere Durchwahl herkriegen. Hast du Kevin gesehen?« Aria ist die Älteste des Stabs. Und sie ist außer mir die einzige Schwarze in unserer Abteilung, was den Vergleich zwischen uns zwingend macht, der nie zu meinen Gunsten ausfällt. Sie ist nicht nur immer da, um Halbwahrheiten über Dr. Seuss beizusteuern, die keiner kennt, sie ist auch entzückend. Entzückend, wie es nur Inselfrauen sind; Haut wie warmes synthetisches Metall. Also ist sie sehr beliebt im Verlag mit ihren glänzenden tobagonischen Augen und Apfelbäckchen und der unbedrohlichen Unschuldsmasche, die sie vor allen Berufsweißen abzieht. Ich meine, sie spielt das Spiel gut. Besser als ich. Aber wenn wir allein sind, selbst wenn wir uns mit geborgten Gesichtern an- sehen, erkennen wir uns. Ich sehe ihren Hunger, und sie sieht meinen.
»Keine Ahnung, vielleicht wurde er endlich von der Heritage Foundation hochgebeamt«, sage ich und greife nach dem Kaffee.
»Für mich ist das kein Witz«, sagt sie. Meistens rege ich mich nicht mehr darüber auf, dass sie wahrscheinlich eine Liste von Argumenten führt, warum sie meinen Job kriegen sollte, denn die Frage ist nicht mehr, ob sie ihn kriegt, sondern wann. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass ich immer noch mit ihr befreundet sein will. Am ersten Tag ist sie lammfromm und bildschön im Büro erschienen, wie zum Symbol geschaffen. Und wie man selbst es zu tun pflegt – wenn man immer die einzige andere im Raum ist und trotzdem die Hoffnung nicht aufgibt, im nächsten Raum wäre es vielleicht anders –, blickte sie sich um und suchte nach mir. Als sie mich fand, als wir uns an jenem Tag zum ersten Mal in die Augen sahen, beide von unserer Symbolpolitik erlöst, erfüllte mich eine kolossale Erleichterung.
Aber dann habe ich mich verrechnet. Zu viel Zorn zu früh geteilt. Zu viel Sind diese weißen Menschen denn zu fassen. Zu viel Scheißpolizei. Wir haben beide einen Abschluss in Doppelt-so-gut-für-halb-so-viel, aber ich glaube, sie findet den Eintrittspreis immer noch akzeptabel. Sie formt sich immer noch um, wartet darauf, erwählt zu werden. Und sie wird erwählt werden. Weil es eine Kunst ist – Schwarz und ausdauernd und friedfertig zu sein. Sie ist das alles, und sie schämt sich dafür, dass ich es nicht bin.
Ich rede mir gern ein, der Grund dafür, dass ich nicht ausdauernder bin, ist, dass ich weiß, wie es läuft. Aber manchmal sehe ich sie an und frage mich, ob das Problem doch ich bin, nicht sie. Vielleicht ist das Problem, dass ich schwach und zu empfindlich bin. Vielleicht ist das Problem, dass ich eine Büroschlampe bin.
»Die Macht, die du willst, geben sie dir nie«, sage ich, weil ich neidisch bin und weil es interessant ist, wie sie zwischen ihrer Maske und meinem Verschwörungsangebot schwankt. Sie beugt sich vor, und da ist er wieder, dieser süße, urheberrechtlich geschützte Geruch nach Schwarzem Mädchen – Jojobaöl, Pinklotion, Blue Magic.
»Woher willst du das wissen? Du bist immer noch Redaktionskoordinatorin, und du bist seit drei Jahren hier«, sagt sie, und ich könnte mein Dienstalter geltend machen, aber das wäre peinlich. Der Unterschied in unserem gesamten Jahreseinkommen beläuft sich auf eine Monatsrate meines Studienkredits.
»Wir haben einen Stapel Fahnen für die Badezeit-Serie reinbekommen. Kümmerst du dich darum?«, sage ich und drehe mich weg. Ich sehe nach, ob Eric eine Nachricht geschickt hat. Irgendeine Bestätigung, dass unser erstes Date wirklich gut war, oder ein Zeichen, dass er sich auf heute Abend freut. Ich überlege, ob ich ihm eine ausführliche Liste von Dingen schicken soll, die er mit mir machen darf, damit wir wissen, woran wir sind, aber mein erster Entwurf erinnert zu sehr an Helga Pataki aus Hey Arnold. Ich versuche, die Liste zu überarbeiten, aber dann gebe ich auf und gehe Kevin suchen, der das Buch akquiriert hat, um das sich dieser PR-Albtraum dreht, eine illustrierte Geschichte für das konservative Kind, eine lyrische Meditation über den Radikalismus der liberalen Medien und das Märtyrertum des ländlichen Amerika.
Wenn ich objektiv sein muss, finde ich die Kunst in dem Buch nicht schlecht. Stimmungsvolle Gouache-Sonnenuntergänge über dem Lager der Konföderierten. Lincolns schlaffe Gedankenblase, als er, enttäuscht vom Zustand seiner Partei, in die Zukunft blickt. Die fotorealistischen Darstellungen großstädtischer Verbrechen. Ich entdecke Kevin, der mit einer Socke in seinem Büro auf und ab wandert und telefoniert, während das jugendfreie Propagandawerk reißenden Absatz findet. Und da sehe ich Mark. Ich bin nicht stolz darauf, was ich dann tue, nämlich mich im Treppenhaus verstecken und die Luft anhalten. Von allen Männern im Verlag, mit denen ich geschlafen habe, hat er mich am meisten gekostet. Das Sprichwort »Spuck nicht auf deinen eigenen Teller« gilt nur, wenn der Teller voll ist. Meistens war das der beste Teil des Jobs.
Die Einarbeitung von Mike, seine kleinen Finger und der Jungpersonaler-Jargon, als ich ihn aus der Hose locke. Jake von der IT, der abends um sechs mit dem Chip-Schlüssel die Treppe hochkommt und mir etwas von Admin-Privilegien in den Nacken atmet, während er sich um das Supportticket wegen meines kaputten Bildschirms kümmert. Hamish von den Lizenzen mit der blauen Strähne im Haar und den haarigen Schenkeln im Stillzimmer, der mich so niedlich bittet, ihn Lord zu nennen. Tyler, Chef vom Dienst bei Lifestyle und Ratgeber, die aufgefächerten Hochglanzmagazine und Strumpfhalter, als er meinen Kopf herunterdrückt, während er mit dem Büro in Dublin telefoniert. Vlad von der Poststelle mit seinem gebrochenen Englisch zwischen den Styroporchips, die den Boden übersäen. Arjun von der britischen Vertriebsgruppe mit dem zurückgegelten schwarzen Haar und den Comicschurkenunterarmen, aufgestachelt von den skrupellosen Highperformern aus seinem Akademikerteam. Wieder Jake von der IT, weil die Computer scheiße sind und er den schönsten Schwanz hat, den ich kenne. Tyrell aus der Herstellung mit dem schiefen Lächeln auf der Weihnachtsfeier in der Klokabine, das fraktale Echo der Lichterkette im Spiegel seiner dunklen Augen. Michelle aus der Rechtsabteilung auf dem Kopierer, Nylonstrumpfhose um den Hals, während über uns die Neonröhren flackern. Kieran von den Nackenbeißern, der mich von hinten nimmt und die ganze Zeit davon redet, wie er mir die Gliedmaßen vom Rumpf abtrennt, und ich lache und lache und weiß nicht, warum. Jerry, der die lukrativen Young-Adult-Krebsbücher akquiriert und im Konferenzraum mit Blick auf 30 Rock Kuschelsex mit mir macht, und ich heule und weiß nicht, warum. Joe von True Crime, der nicht liest und laut und schnell kommt und mich n-- nennt und dann mommy. Jason von den MINT-Lehrbüchern, der will, dass ich für ihn heule, wie ich für Jerry geheult habe, was eine Erfahrung ist, die mich zum Heulen bringt, aber erst zu Hause. Adam von den christlichen Erotica, der mir ins Gesicht spritzt, und ich spüre nichts. Und dann noch mal Jake, weil meine Tastatur abkackt, aber diesmal kommt nicht Jake, sondern John von der IT, schiebt mir die Hand unter die Bluse und erzählt mir, dass Jake einen schlimmen Autounfall hatte und es nicht gut um ihn steht.
Und irgendwo dazwischen Mark. Mark, Leiter des Art Department, wo es nach warmem Papier riecht und alle glücklich sind. Wo seidige Stapel 18×24-Zoll-Bögen herumliegen und die Drucker in selbsterzeugter Hitze seufzen und wie ein Uhrwerk tiefe Schwarztöne und fluide Blaus ausstoßen, messerscharfe Panels, so gesättigt, dass man die Feuchtigkeit spürt, wenn man die frischen Drucke anfasst. Die Leute vom Art Department bewegen sich in lächelnden Trauben mit ihren Gestaltungskonzepten im Arm durchs Haus. Sie führen leidenschaftliche Debatten über Prägedruck und Verdana und Courier New. Sie haben ihre eigenen Arbeitszeiten und ihren eigenen Dresscode, jeweils in dieser schicken, nerdigen Nische, die die Domäne der klassischen Kunststudenten ist. Und ich wäre nichts lieber als eine von ihnen. Ich will beim Take-away gegenüber Dumplings bestellen und bis zehn im Büro bleiben, will den Farbverlauf von Ultramarine zu Kobalt zu Cyan im Hintergrund von Frank der Fuchs überprüfen. Ich habe mich dreimal beworben. Ich wurde zweimal zum Gespräch eingeladen. Beide Male haben sie mir erklärt, ich soll weiter Figurenzeichnen üben. Mark sagte, sie würden mich in die Kartei aufnehmen, worauf ich loszog und durch ein paar Abendkurse flog, die ich mir nicht leisten konnte, zu Fall gebracht von den Grübchen im menschlichen Muskelfleisch und besonders von den Mittelfußknochen. Ich blieb bei Graphit und Papier in der Hoffnung, dass mir das Medium im Gegensatz zu Farbe mehr Kontrolle verlieh, aber meine Figuren verschmierten mir immer unter dem Handballen.
An dieser Stelle habe ich unwillkürlich das Gefühl, am Ende einer Ereigniskette zu stehen, die mit einem einzigen Schmetterling anfing. Ich meine, mit einem halben Grad Unterschied würde alles, was ich je wollte, mir gehören. Ich bin gut, aber nicht gut genug, was schlimmer ist, als einfach schlecht zu sein. Ich bin fast. Der Unterschied zwischen dabei sein, wenn es passiert, und gerade noch aussteigen, um es in den Nachrichten zu sehen. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass im nächsten Zweig des Multiversums eine Version von mir existiert, die dicker und glücklicher ist, lächelnd in ihrem eigenen Atelier sitzt, mit Farbe hinter den Ohren. Aber immer wenn ich in den letzten zwei Jahren zu malen versuchte, war ich wie gelähmt.
Und Mark ist auch nicht gerade von der Kirchendecke gestiegen oder verströmt gebleichte Warhol’sche Coolness. Er ist ein erwachsener Mann im Kittel, der in seinem Büro frische Orchideen hat, Hartplastikspielzeug sammelt und Groeningeske Versionen vom Traum der Fischersfrau