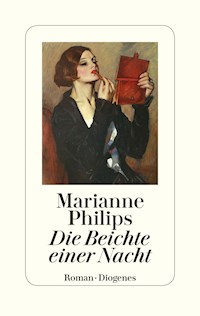Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Urachhaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Tag, der das ganze Leben erzählt Wien, Juni 1933. In der Luftbadgasse 12 feiern Hausbesitzer Hodl und seine Frau goldene Hochzeit. Doch das Haus vereint noch andere Schicksale unter seinem Dach. Der Jude Meyer Jonathan wartet auf seinen Enkel Daniel, der im antifaschistischen Widerstand arbeitet. Das geregelte Leben von Rosita gerät durcheinander, als plötzlich ihre große Jugendliebe vor ihr steht. Die ehemalige Operndiva Maria Ritter versucht, dem begabten Geiger Paul zu einer Karriere zu verhelfen, der jedoch viel lieber mit seinen Katzen in den Tag hineinlebt. Und just an diesem Tag erblickt ein Enkelkind der Hodls das Licht der Welt. Ein herrlicher Tag also - doch hört man nicht schon das unheimliche Grollen unsäglicher Geschehnisse, die sich über Europa zusammenbrauen? Meisterhaft und einfühlsam erzählt die brillante niederländische Schriftstellerin Marianne Philips von schicksalhaften Begebenheiten am Vorabend der großen Katastrophe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARIANNE PHILIPS
Hochzeit in Wien
Aus dem Niederländischenvon Eva Schweikart
Mit einem Nachwortvon Judith Belinfante
URACHHAUS
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
HOCHZEIT IN WIEN
1
Das Haus steht in der Luftbadgasse. Dort steht es schon zweihundert Jahre, und gut hundert davon befindet es sich im Besitz der Familie Hodl, die ursprünglich aus Tirol stammt, aber seit über einem Jahrhundert eine fruchtbare und fleißige Malersippe in Wien ist. Wenn Johannes Hodl und seine Frau Resi heute bei ihrer goldenen Hochzeit mitsamt allen Kindern und Enkeln und Urenkeln für den Bildteil der Zeitung fotografiert werden, sieht ganz Wien, wie fruchtbar und fleißig diese Familie sein muss, um so viele Nachkommen hervorzubringen und zu erhalten. Es ist keine gewöhnliche goldene Hochzeit, bei der Kinder und Verwandte einem alten Paar seinen letzten repräsentativen Festtag auf Erden bereiten, nein, hier zeigt ein noch nicht entwurzeltes Stück Wien seine außerordentliche Lebenskraft, und der Pfarrer von Mariahilf wird seinen Segen dazu geben, wenn die Hodls um elf nach der gesungenen Messe zur Kommunion gehen. Jetzt, um sechs Uhr morgens, sind die Nachbarn und die Malergesellen bereits emsig dabei, das Haus würdig zu schmücken.
Das Haus, acht Fenster und ein stilvolles vorspringendes Bogenfenster breit, hat pro Stockwerk zwei Wohnungen, von denen die mit Bogenfenster am schönsten und teuersten sind. Zu den drei Stockwerken kommt noch das Erdgeschoss mit Hodls Wohnung und Werkstatt. Das Erdgeschoss bedarf einer genaueren Beschreibung. In Mariahilf und Wieden gibt es zwar noch viele alte Häuser mit der gleichen Einteilung wie bei Hodls, im neueren Wien hingegen sind diese nicht mehr zu finden, stammen sie doch aus einer Zeit, in der die Bodenspekulanten noch nicht um jeden Meter feilschen mussten, sondern großzügiger zu Werke gehen konnten. Daher nimmt allein Hodls Hoftor, durch das man von der Straße in den Hausflur gelangt, eine Breite von viereinhalb Metern ein. Seine zwei Flügel aus guter, schwerer Eiche sind zusätzlich mit Eisenbeschlägen verstärkt – offenbar steckte den Wienern um 1700 noch die Angst vor den Türken im Blut. Im rechten Flügel ist eine schmale Tür, durch die die Bewohner nach sechs Uhr, wenn die Werkstatt geschlossen ist, mit ihrem eigenen Schlüssel ins Haus kommen, tagsüber jedoch steht das Tor weit offen, damit Hodls Handwagen mit dem Malergerät und den größeren Werkstücken ungehindert hinein- und hinausgeschoben werden können.
Der Hausflur hinter dem Eingang hat die Abmessungen eines Ballsaals und wird heute auch als solcher dienen. Sein Boden ist mit alten farbigen Fliesen ausgelegt, die dem Zahn der Zeit und der Abnutzung durch den Geschäftsbetrieb unbeschadet getrotzt haben und nun, da der gesamte Flur leer geräumt ist, mit einem verschnörkelten Barockmuster überraschen.
Rechts des Hausflurs befindet sich die Wohnung der Familie Hodl, sie ist natürlich kleiner als die Mietwohnungen darüber und muss, als die Familie noch stetig wuchs, seltsam übervölkert gewesen sein. Die Werkstatt liegt links des Flurs und nutzt diesen als Stellraum für alles Sperrige wie trocknende Schränke und Reklameschilder, Leitern, Karren und so weiter, heute aber selbstverständlich nicht. Hinten im Flur führt eine breite Eichentreppe zu den oberen Stockwerken, und obwohl die Feuerwehr schon mehrfach angemahnt hat, die Treppe müsse durch eine aus weniger brennbarem Material wie Eisen oder Beton ersetzt werden, nimmt Hodl diese behördliche Einmischung mit gleichmütigem Schulterzucken hin. Das schöne geschnitzte Geländer, das sich in einer anmutigen Spirale bis ins Obergeschoss mit der Balkendecke windet, ist Hodl seit seinem ersten Augenaufschlag vertraut, und er hofft, es bis zum letzten behalten zu können. Der ganze breite Hausflur war früher lediglich ein Durchgang zum Hinterhof, auf den man aus den Wohnungen ringsum herabschaut, aber seit Längerem schon ist zwischen Flur und Hof eine vierte Wand gemauert, und man kommt nur durch eine kleine Pforte in derselben in die Wildnis hinter dem Haus. Die Pforte wird allerdings regelmäßig genutzt. Zu Hodls Anwesen gehört nämlich ein Hinterhaus, ein kurioser kleiner Pavillon, den der erste Besitzer, noch kein Hodl, zu unbekannten Zwecken anbauen ließ, dessen galante Wandmalereien jedoch auf eine gewisse unsolide Absicht hindeuten. Er wird für wenig Geld vermietet, weil er nur durch die Terpentinluft in der Werkstatt oder über die Wüstenei des vernachlässigten Hofs zugänglich ist. Somit ist er prädestiniert dafür, der Bohème als Unterkunft zu dienen, und tut das schon seit Menschengedenken. Derzeit wohnt dort ein noch unentdeckter Geigenvirtuose, der vier Katzen und eine chronische Schwermut hegt.
Der Pavillon bekommt nie einen Sonnenstrahl ab, ist aber in dieser Hinsicht nicht schlechter dran als das große Vorderhaus, denn dieses wird wiederum von den hinteren Häusern der Gumpendorfer Straße überragt. Die gesamte Luftbadgasse liegt in ihrem Schatten, dem tiefen Schatten einer Seitenstraße, in der man die Häuser nicht instand hält, weil kein Sonnenlicht je offenbart, wie trist sie sind. Nur Hodl ist es natürlich seiner Berufsehre schuldig, dass seine Fassade ordentlich aussieht, darum besitzt er das ansehnlichste Haus der Straße, aber dazu braucht es auch nicht gerade viel. Denn die Luftbadgasse, die ein paar Meter tiefer als die Gumpendorfer Straße liegt und nur an einer Seite eine Zufahrt hat, weil sich an der anderen, zum Apollo-Theater hin, eine Treppe befindet, ist allein schon aufgrund ihrer Lage eine Totgeburt, in der sich selten ein Architekt mit sichtbarem Vergnügen betätigt hat. Sie ist nur für Leute akzeptabel, die an jedem beliebigen Ort zufrieden wären oder aber sich vom Leben zurückgezogen haben.
Die Erdgeschosse sind von kleinen Handwerkern belegt. Guten altmodischen Schneidermeistern, die eher ein solides Jackett als einen Smoking zu fertigen wissen und nur noch wenig, sowie ein paar Maßschuhmachern, die gar nichts mehr zu tun haben. Ein Kürschner, ehemals Atelierleiter eines Hoflieferanten, befreit die Kaninchenfelle vom Naschmarkt von schäbigen Stellen und fabriziert daraus billiges Mantelfutter für die Kaufhäuser. Und dann ist da der Mann, der Gipsmodelle gießt, aber wer zeichnet heutzutage noch nach Gips? Nur die Brennstoffhandlung floriert in dieser feuchten Ecke der Stadt, verschönert aber nicht das Gesamtbild und ist dem Hausbesitzer Hodl daher ein Dorn im Auge. Aber kann man von der Stadt verlangen, dass sie in einer Straße, in der nicht einmal der Müllwagen wenden kann, regelmäßig die Trottoirs fegt?
So viel zu den Erdgeschossen, aber auch die Wohnungen darüber bieten wenig Erfreuliches. Die Luftbadgasse (deren Wirklichkeit allerdings nur wenig frische Luft und in den Häusern nirgends eine Badegelegenheit aufweist) ist vor allem ihrer Lage wegen zur Zuflucht für menschliche Überbleibsel aus der Kaiserzeit geworden. Man wohnt dort nur eine Viertelstunde zu Fuß vom Ring, der Hofburg, der Kärntner Straße und der Oper entfernt sowie eine halbe Stunde vom Parlament und der Akademie. Die überflüssig gewordenen Offiziere, Oberkellner, Klavierlehrer, Architekten und Beamten, die mit dem Kaiser und den Erzherzögen in einer Lawine mitgerissen wurden, um schließlich in den Tiefen dieser Gasse zu landen, können so ohne Kosten für eine Straßenbahnfahrt die Luft der Inneren Stadt atmen, täglich am Ring entlangpromenieren oder sich in den Kaisergarten setzen, den keiner von ihnen Burggarten, wie es auf den Schildern steht, zu nennen beliebt. Wenn sie ihre Wohnungen verlassen, gehen sie noch sehr korrekt dynamisch, gleichwohl auf schiefen Absätzen, und tragen ihre Monokel oder Künstlerschlapphüte mit überkommener Eleganz, ohne zu ahnen, dass sie sich unter den Tweedanzügen und Trenchcoats der neuen Zeit wie eine längst überwundene Vergangenheit bewegen. Nicht dass sie sich etwas vormachen, nein, derzeit sind sie eben nicht auf der Siegerseite, aber nur Geduld, die Zeiten ändern sich, bald wird man sie anflehen zurückzukommen.
Ansonsten gibt es noch die flottierende Bevölkerung wie in jedem billigen Großstadtviertel. Ein paar junge Mädchen vom Opernballett, die jüngst wieder eine Gagenkürzung hinnehmen mussten, einige Büroangestellte mit Familie und in den Hinterhäusern viele, viele Arbeitslose, deren Kinder nicht mit anderen Kindern auf der Straße spielen dürfen, weil ihre Väter anständige Arbeitslose sind, die allmorgendlich mit irgendeiner unsinnigen kleinen Geschäftsidee in der Aktentasche losziehen, um ihr Glück zu versuchen. Nein, die Luftbadgasse ist beileibe kein Arbeiterviertel.
Johannes Hodl hat sein Haus gottlob ordentlich vermietet. Wenn er manchmal nachts in einer wachen Stunde über den menschlichen Inhalt seines Anwesens nachsinnt, fühlt er sich auf jeden Fall gegenüber anderen Eigentümern vom Schicksal begünstigt. Im ersten Stock links (mit Bogenfenster) wohnt Herr Friedemann, der im Krieg aus gemahlenem Stroh und Kartoffelmehl Spaghetti und Makkaroni herstellte, dann aber durch den Frieden und die Inflation den Großteil seines so glückhaft erworbenen Vermögens wieder eingebüßt hat. Jetzt leiht er den Kleinbürgern niedrige Beträge zu hohen Zinsen und verdient auf diese Weise noch mehr als genug für seine nicht ganz unschuldigen Liebhabereien und außerdem eine Kleinigkeit, um seinen dicken Pudel und eine ältere Großcousine, die ihm den Haushalt führt, zu beköstigen. Rechts von ihm hat der pensionierte Justizrat Kerner in vier dunklen Zimmern die Reste seiner Sammlung Josephinischer Möbel untergebracht. Sie werden ihn bis an sein Lebensende erhalten, gerade hat er drei Monate lang von einem Sekretär gelebt, und er besitzt einen einmalig schönen Tisch aus Nussbaumholz mit mosaikartigen Intarsien, der ihn gut zwei Jahre ernähren kann, ihn und seine arme gelähmte Frau.
Im zweiten Stock links mit dem Bogenfenster wohnt die einstmals weltberühmte Koloratursängerin Maria Ritter, die 1916 von der Operndirektion in den Ruhestand geschickt und deren Pension seitdem erstaunlicherweise nur mäßig gekürzt wurde – aber schließlich ist Wien ja die Musikstadt. Rechts davon lebt Herr Bergmann mit Frau und fünf Töchtern unter zehn Jahren; über ihn gibt es nichts weiter zu sagen, als dass er der Ehemann von Hodls jüngster Tochter ist und wohl zeit seines Lebens Prokurist in einer kleinen Versicherung bleiben wird, sofern diese nicht vorzeitig in Konkurs geht. Sein Vorderzimmer hat er an Fräulein Goldös vermieten dürfen, die schöne Hauptkassiererin von Korngross, über die es wiederum sehr viel zu sagen gibt, aber wenig Unangenehmes.
Meyer Jonathan wohnt im dritten Stock auf der teuersten, aber dennoch nicht teuren Seite (hier gibt es kein Bogenfenster mehr), und es ist vollkommen unerklärlich, wie er in der Luftbadgasse gelandet ist, denn er gehört unbestreitbar an den Hohen Markt oder in die Leopoldstadt, er ist nämlich Schreiber bei der jüdischen Gemeinde. Aber es muss Ausnahmen geben, und Meyer Jonathan ist in der Tat ein besonderer Mensch, das muss Hodl sich eingestehen. Wenn der bei ihm wohnende Enkelsohn den Malergesellen nicht mit aufrührerischen Theorien käme, würde Hodl dem alten Juden nur zu gern einen Platz unter seinem Dach gönnen, so aber betrachtet er die Wohnung im dritten Stock links als nicht dauerhaft vermietet.
Rundherum erfreulich ist dagegen die Belegung der Wohnung im dritten Stock rechts. Dort lebt eine ältere Handarbeitslehrerin mit ihrer Mutter, und obwohl Hodl den beiden Frauen die billigste Wohnung, direkt unter dem Flachdach, zu einem wirklich unbedeutenden Preis überlassen hat, verbeugt er sich vollendet höflich, wenn sie im Hausflur an ihm vorbeigehen. Denn die alte Dame ist eine wahrhaftige Gräfin. Wenn er der Tochter den Mülleimer die Treppe hinaufträgt, erwartet er keinen Dank – »Gern zu Ihren Diensten, Komtesse«. Das Namensschild am großen Hoftor ist ihm eine tägliche Freude. Von Wernizek-Bolnanyi – ganz Wien kennt den Namen und die Familie, wenngleich sie jetzt verarmt und seit ’18 entadelt ist. Ja, sein Haus ist tatsächlich das ansehnlichste in der Luftbadgasse.
Architektonisch gesehen gibt es auch nichts zu beanstanden, das Haus ist echter Wiener Barock, auch wenn das nie jemand zu Hodl gesagt hat und er einfach so ein wenig in sein schönes, gediegenes zweihundertjähriges Anwesen verliebt ist. Lediglich der Sandsteinschmuck unter dem Dachgesims gefällt ihm nicht sonderlich, er geht auf die Dekorationssucht des zweiten Hodl zurück, der 1874 in Ovale gefasste Darstellungen von Haydn, Beethoven und Mozart anbringen ließ, weil damals überall in Wien gebaut und dekoriert wurde und er außer Malermeister auch Posaunist in einem Musikverein war. Johannes Hodl, heute immerhin fünfzig Jahre verheiratet, weiß noch sehr gut, wie das Haus in seiner Kindheit ohne die Sandsteinfiguren aussah. Wenn es nach ihm ginge, würden sie gleich heute entfernt, aber auch mit zweiundsiebzig Jahren hat er noch einen Rest Pietät und Respekt vor seinem Vater. Sollen die Kinder später damit verfahren, wie sie wollen.
Da die Nachbarn und Gesellen ohnehin gerade beim Begrünen sind, haben sie die Gelegenheit genutzt und die alten Herren unter dem Dachgesims ein wenig herausgeputzt. Alle drei tragen nun Kränze aus Tannengrün, Beethoven blickt verdrießlich darunter hervor, aber Mozart macht sich mit seinem sehr flott, und der gute Papa Haydn wurde vom Lehrling mit einem Extrasträußchen an der Schleife seiner Zopfperücke bedacht. Die kleinen Jungen und die dicken Mütter aus den angrenzenden Häusern haben von unten Anweisungen gegeben, auch zum Arrangieren der Papierketten und der Tannengirlanden um die Fenster des ersten und zweiten Stocks. Jetzt nicken sie zufrieden und sehen zu, wie der erste Geselle mitten über dem Hoftor ein goldglänzendes herzförmiges Schild anbringt, auf dem in blitzeblauen Schnörkelbuchstaben und -zahlen steht: Ein Hoch auf das goldene Paar, 1883–1933.
All das geschieht so leise und umsichtig wie nur möglich und ganz früh am Morgen, denn das Jubelpaar soll ja überrascht werden. Johannes Hodl jedenfalls hat sich noch einmal im Bett umgedreht, als er Hammerschläge vernahm. Er ist ein gutmütiger Mann und gönnt jedem sein Pläsier, auch sich selbst.
Mutter Resi dagegen, die neben ihm liegt, fällt es schwer, nicht die Beine aus dem Bett zu heben. Gestern Abend ist zwar ihre älteste Tochter gekommen und hat gesagt, die Mutter dürfe an ihrem Ehrentag nichts, aber auch gar nichts tun und die kleine Resi und Maria seien schon ab halb sieben da, um alles herzurichten, aber sie weiß ja, wie es ist, wenn man solche Dinge den jungen Mädchen überlässt. Außerdem ist es natürlich völlig undenkbar, dass jemand anderes das Leinenzeug aus dem großen Mahagonigiebelschrank nimmt, zu dem nur sie einen Schlüssel hat. Selbst bei ihren vielen Entbindungen lag immer im Voraus alles Notwendige und mehr als das in einer Schublade der Chiffoniere bereit. Aber was, wenn die Kinder einem nicht sagen wollen, wie viele Leute eingeladen sind? Nein, Resi liegt nicht unbesorgt im Bett ihres fünfzigjährigen Ehebunds, und nun, da sie sogar an diesem Tag mit Sorgen umgeht, zwacken diese auf mancherlei Weise.
»Hast du alles in der Werkstatt verstauen können?«, fragt sie Hodl. Sie meint damit, ob der Hausflur auch ganz leer ist und nachher geschrubbt als Tanzboden dienen kann, aber eine Frau sagt nun einmal nie genau, was sie denkt. Johannes Hodl grunzt ein Ja und dreht sich auf die andere Seite. Er schläft nicht und will auch gar nicht schlafen, denn er ist hinreichend ausgeruht, er genießt ganz einfach die faule Gemütlichkeit in seinem guten Federbett, aus dem er heute nicht frühzeitig aufstehen und kontrollieren muss, ob seine Leute pünktlich sind.
Auch Resi dreht sich auf die andere Seite, sie kann nicht still liegen, weil sie keineswegs sicher ist, dass der Hausflur leer geräumt wurde. Und dann, ganz plötzlich, hält sie es nicht mehr aus, sie schiebt die Zudecke von ihren mageren blau geäderten Altfrauenbeinen, und schon sitzt sie auf der Bettkante.
Aber das kann Johannes nicht durchgehen lassen, denn was würden seine Kinder und die Nachbarn sagen, wenn die Mutter sich nicht überraschen lassen wollte? »Weib!«, ruft er, »kommst du denn nie zur Ruhe, ehe du im Sarg liegst?« Mit dem festen Griff seiner noch immer kräftigen Arbeitshände zieht er Resi aufs Kissen zurück und dann, weil es ihr Hochzeitstag ist und er beste Erinnerungen an die grüne Hochzeit hat, zieht er seine Frau noch näher zu sich heran, birgt ihren schmalen grauen Kopf in seiner Achselhöhle und sagt: »Lieg endlich still, du Quecksilber.« Ja, so etwas hat er auch bei der grünen Hochzeit gesagt, sie müssen beide lächeln, und Resi liegt nun tatsächlich ganze zehn Minuten still, ihr Vogelköpfchen fest an Hodls vertraut atmende Brust geschmiegt.
Dann aber schlägt die Wanduhr im Wohnzimmer halb sieben, und da sind auch schon Maria und die kleine Resi, lautlos vom ersten Gesellen eingelassen. Aber die Mutter hat nach wie vor ein scharfes Gehör, und jetzt ist sie nicht mehr zu bremsen, sie muss die Vorbereitungen im Wohnzimmer überwachen. Böcke und Bretter sind in einer Malerwerkstatt immer zur Hand, darum ist bereits ein hufeisenförmiger Tisch aufgebaut, die Möbel verschwinden fast unter grünem Schmuck, und jemand hat ein Grammofon mitgebracht. Das alles sieht Resi mit einem Blick, als sie den Kopf zur Tür hineinsteckt. Sogleich werden Rufe laut: »Nicht reinkommen!« Ja, aber kann man eine nach wie vor tätige Hausfrau und Mutter eines hundertköpfigen Geschlechts von dem abhalten, was sie sich in den Kopf gesetzt hat? Also geht Resi unbeirrt in ihr Wohnzimmer, und niemand wagt zu widersprechen, sie gibt ihre Anweisungen, verteilt Tischtücher und Servietten, steigt auf einen Stuhl, um an das geschliffene Bowle-Service im obersten Fach ihres Büfetts heranzukommen, und untersucht mit kundiger Zunge, ob die Hirschhörnchen, die ihre Zweitälteste in den letzten Tagen zu Hunderten gebacken hat, ihr und ihrem Haus Ehre machen.
Die Hirschhörnchen sind perfekt, aber während Resi zwischen Zungenspitze und Gaumen prüft, ob Hefe oder Backpulver im Teig verarbeitet wurde, fährt ihr der Schreck in die Glieder, weil sie vergessen hat, dass sie bis zur Kommunion nüchtern hätte bleiben müssen, und nun geht sie verwirrt und bedrückt wieder ins Schlafzimmer zu Hodl, um sich von ihm beruhigen zu lassen wie in allen verwirrenden Momenten ihres Lebens.
Und da hat Maria auch schon die Schlafzimmertür hinter ihrer Großmutter abgeschlossen. Hodl muss lachen, es hat doch etwas, einen Tag lang mit sich geschehen zu lassen, was die anderen wollen. Mit seinem gütigen Herzen hat er die Welt und ihre Bewohner sehr lieb, in seinem ganzen Leben ist ihm noch kein Mensch begegnet, der ihm vorsätzlich schaden wollte. Ja, solche Glücklichen gibt es tatsächlich …
2
Genau zur gleichen Zeit hält ein älterer Mercedes auf dem Feldweg am südlichen Rand des ehemaligen k. und k. Laxenburger Schlossparks, zwanzig Kilometer außerhalb Wiens. Ein junger Mann steigt aus und blickt umher. Nichts regt sich auf der grünen Ebene, die sich kilometerweit bis Mödling dehnt, nichts regt sich unter den dichten Eichenkronen des Parks, der seit 1918 vor sich hin verwildert. Der Mann geht auf einen kleinen Pavillon mit kunstvollen Barockverzierungen zu, dessen rosafarbener Putz aber an etlichen Stellen abgeplatzt ist, wie von Aussatz befallen sieht er aus. Der Mann fasst durch ein zerbrochenes Fenster, und als der Drehriegel nachgibt, klettert er hinein. Ganz kurz winkt seine Hand heraus. Die zweite Autotür fliegt auf, fünf junge Leute springen heraus und überkugeln sich dabei fast. Dann heben sie zwei mannslange Segeltuchpakete aus dem Wagen. Die Tür des Pavillons öffnet sich, die Pakete werden schwungvoll auf die Schultern genommen und hineingetragen. Keiner hat auch nur ein Wort gesprochen.
Fünf Minuten später tuckert der Mercedes gemächlich die Laxenburger Straße entlang in Richtung Wien. Der Fahrer eines Tanklasters, den der Wagen überholt, sieht durch die Fenster sechs ganz gewöhnliche junge Leute, der Mann am Steuer lässt sich gerade Feuer geben, hinten liest einer Zeitung und gähnt ausgiebig.
3
Der alte Meyer Jonathan hat seine Gebetsriemen abgenommen und küsst sie innig und andächtig, ehe er sie in den Beutel aus Seidenbrokat steckt. Der herbe, aromatische Ledergeschmack haftet noch an seinen Lippen, als er mit einem Lächeln seinen Tallit, den schönen weißwollenen Gebetsschal mit den schwarzen Streifen, sorgfältig zusammenlegt. Noch einmal berührt er die weichen Schaufäden und murmelt ein letztes »Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott, der Du uns durch Deine Gebote geheiligt hast«. Dann schiebt er den zum Viereck gefalteten Schal in den Tallitbeutel und zieht mit noch stiller Hand eine Schublade auf, in der er alles verstaut.
Auch in der Wohnung ist es noch still. Das vertraute Ticken der Uhr pocht Pulsschlägen gleich durchs Zimmer, auf dem Dach über ihm trippeln Taubenfüße, und irgendwo unten schlägt dumpf ein Hammer, aber all das gehört zur Stille dazu. Die Nesselgardine bauscht sich vor dem offenen Fenster wie von leisem Atem bewegt, und Meyer Jonathan empfängt das sanfte Kräuseln der Luft als eine Gnade. Er steht noch in der Stille Gottes.
Ja, selbst nach einer Nacht voller Sorge und Sehnsucht hat ihn das Morgengebet in die Stille der Gegenwart Gottes zurückgeführt.
Meyer Jonathan erlebt im Gang seiner Tage viele dieser stillen Momente. Vor allem beim Morgen-, Mittags- und Abendgebet. Aber auch, wenn er nach dem Trubel der Inneren Stadt die Synagoge in der Seitenstettengasse betritt und wie ein zufrieden und müde heimkehrender Landmann die Tür seines Arbeitszimmers aufklinkt. Dann umschließen die Wände wie Schutzmauern seine Seele. Ganz und gar still wird es aber erst, wenn er am Abend zu Hause sitzt und beim Lampenschein mit dem Federkiel die hebräischen Schriftzeichen auf das steife und doch lebendige Pergament setzt, die geliebten Buchstaben, jeder für sich klein und unscheinbar, zusammen jedoch das Wort bildend. Bogen für Bogen und Rolle für Rolle hat er mitgemurmelt, was da unter seiner Hand entstand. Viele, viele Texte und Sprüche, Thorarollen und Mesusot, ein Menschenleben lang, und stets aufs Neue kehrte darin, wie ein Refrain, die beglückende Verkündigung wieder: »Höre, Israel, der Ewige, Dein Gott, ist ein einiges, ewiges Wesen.«
Es ist die tiefste Gewissheit der Lehre, und wenn er diese ausspricht, steigt das innere Lächeln Meyer Jonathans in die lichte Stille Gottes auf.
Achtzig Jahre alt ist er, Haar und Bart sind silberweiß, aber seine Augen hinter der Brille werden von Jahr zu Jahr jünger. Wer mit ihm spricht und ihn ansieht, empfindet plötzlich eine Andacht, die sich bis in die Augen fortsetzt und dort ruhen will, so wie man sich auch mit dem Lächeln eines unschuldigen Kindes eins fühlt. Doch in Meyer Jonathans klaren Augen liegt nicht nur kindliche Arglosigkeit, da ist noch etwas anderes, für das die Menschen keinen Namen haben, weil es sich nicht in dem umgrenzten Raum findet, innerhalb dessen der menschliche Verstand Namen vergibt. Es fesselt den Blick des Gegenübers und weckt den Wunsch, diesem unbekannten Bekannten, dieser namenlosen Klarheit näher zu kommen. Und dann lächelt Meyer Jonathan, setzt seine Stahlbrille ab und ist mit einem Mal wieder ein kleiner weißhaariger Jude mit Hunderten feiner Fältchen um die große Nase und einem kurzatmigen Räuspern. Auf diese Weise kann er sich unter den Menschen bewegen, ohne dass jemand merkt, dass er mit Gott wandelt.
Inzwischen hat Meyer sein Bett gemacht und die Brotreste vom Frühstück für die Tauben auf die Fensterbank gelegt. Das tun viele in der Luftbadgasse, denn hier nisten die Tauben unter jedem verwahrlosten Dach, in jeder ungenutzten Nische. Überall im alten Wien nisten Tauben, nur nicht in den großen neuen Wohnblocks, die man eifrig zwischen die alte Bebauung gequetscht hat. In der Luftbadgasse jedoch trippeln sie hundertweise an den Hausfronten entlang und übers Straßenpflaster, sie gurren und schnäbeln und flattern aus Bodenluken empor, um am hohen Himmel spielerische Flüge zu vollführen und danach auf den Fensterbänken eine Mahlzeit vorzufinden. Aber niemand füttert sie so regelmäßig und hingebungsvoll wie Meyer Jonathan. Die hübsche Rotblonde, die ihm aus einem der hinteren Häuser der Gumpendorfer Straße immer so freundlich zunickt, sorgt auch gut für die Tauben und ist gewiss freigebiger als er, aber sie lässt schon mal ein paar Tage aus. Meyer Jonathan nie.
Heute haben die Tauben den Großteil seines Frühstücks bekommen, er selbst hat nur einen kleinen Streifen Brot gegessen. Kann ein alter Mann, der Stunde um Stunde in Sorge gelegen und auf Schritte gewartet hat, noch großen Hunger haben? Aber das Morgengebet sprechen, das Bett machen und frühstücken, das alles muss eben sein, auch wenn man die Nacht in Angst um den Sohn des Sohnes verbracht hat. Der Gott Israels fordert nichts Übermenschliches von seinem Volk, aber er verlangt, dass man das von ihm empfangene Leben achtet und jegliche Handlung mit Bedacht verrichtet. Darum sucht Meyer Jonathan nach dem Frühstück erst einmal die Schmutzwäsche zusammen, von sich und seinem Enkel Daniel; die Zugehfrau wird sie nachher in einer Küchenecke vorfinden.
Doch als er Daniels blau gestreiftes Hemd auf den Haufen legt und vorsichtig glatt streicht, muss er mit zugeschnürter Kehle den letzten Brotbissen wieder zurückdrängen. Mit einem Mal sieht er vor sich, wie Daniel morgens das Hemd mit ein paar Rucken über seinen braunen Lockenkopf, den kräftigen Hals und die muskulösen, vom kalten Wasser noch feuchten Arme zieht. Und sein Herz fragt: »Daniel, wo bist du, was machst du, wer stellt dir heute deinen Morgenkaffee hin?«
Meyer Jonathan hat naive Vorstellungen vom Studentenleben. Er glaubt, der Jurastudent Daniel Jonathan fände sein Glück im Studium um des Studiums willen und wäre nirgends glücklicher als an seinem Schreibtisch. Er glaubt, man könnte sich 1933 an der Wiener Universität ebenso beharrlich von der Welt abschotten, wie er und seine Freunde sich vor sechzig Jahren am Jüdischen Seminar in Krakau ganz in ihrem Talmudstudium vergruben. Deshalb macht er sich nun Sorgen um Daniel, den es offenbar zwei Tage und Nächte nicht an seinen Schreibtisch gezogen hat. Wäre Meyer nicht so kindlich unwissend, was das ruhelose, gewaltsame Leben in seiner Stadt und darüber hinaus anbelangt, dann würde er ahnen, dass die unpersönliche Leidenschaft, von der edle Gemüter manchmal wie besessen sind, derzeit junge Leute in aller Welt heißblütig zur Tat schreiten lässt und in den Kampf gegeneinander treibt, dann wäre er nicht so enttäuscht und besorgt wegen Daniels unstetem Kommen und Gehen.
Aber wie sollte ein junger und glühend revolutionärer Sozialist einem alten frommen Juden die Probleme und Katastrophen der Gegenwart verdeutlichen?Wie sollte er einem Weisen, der im Frieden Gottes lebt, begreiflich machen, was Großdeutsche und Austromarxisten, Schutzbündler und Heimwehren, Sozis und Nazis und Bolschewiken wollen? Das ist nicht möglich. Einzig möglich ist es, ihn zu lieben, als wäre er noch ein kleines Kind, und seine warme, vertrauensvolle Liebe anzunehmen, wie sie geschenkt wird. So macht Daniel es, und darum ist es wirklich sonderbar, dass er den Großvater zwei Tage ohne Bescheid gelassen hat.
Meyer Jonathan schließt das Fenster, es ist sieben, und er muss zur Arbeit. Zwar braucht er nicht vor acht im Sekretariat zu sein, aber ein Achtzigjähriger geht nicht in weniger als einer Stunde von der Luftbad- in die Seitenstettengasse. Auf diese Weise ist Meyer Jonathan lange außer Haus, täglich von sieben Uhr morgens bis vier Uhr nachmittags. Viele Stunden, in denen er Geburten und Todesfälle registriert und die Akten für das Archiv der jüdischen Gemeinde führt, viele Stunden, die aber nicht den gesamten Tag ausmachen. Der echte, der lebendige Tag beginnt für ihn nachmittags um vier auf der Schwelle seines Wohnzimmers, wenn er seine schwarze Kippa aufgesetzt und den ganzen Abend vor sich hat, um den Namen auf das blanke Pergament zu zeichnen.
Jetzt steht er vor seiner abgeschlossenen Wohnungstür und legt den Schlüssel unter die Fußmatte, wo die Zugehfrau ihn finden wird. Auch Daniel kennt das Versteck; wenn Gott will, dass Daniel heimkommt … ja, wenn es Gottes Wille ist, dass Daniel wieder heimkommt …
Meyer Jonathans Blick ist stumpf, als er gebückt den Schlüssel weiter unter die Matte schiebt. Gewiss ist es keine Sünde, wenn einem alten Mann um des Sohnes seines Sohnes willen das Herz schmerzt, obwohl Gott dieses Herz täglich mit seinem Glanz und seiner Gnade erfüllt. Gott selbst hat ihm dieses Menschenherz gegeben, das Schmerz ebenso tief empfindet wie Freude. Er widersetzt sich dem Schmerz nicht, nein, schließlich ist es Gottes Wille, dass Daniel mit Gojim und Ungläubigen verkehrt, es ist auch Gottes Wille, dass Daniel zwei Nächte fortgeblieben ist.
Darum richtet Meyer Jonathan sich wieder auf, so gerade es noch geht, und tastet im schwach beleuchteten Treppenhaus mit seinem Stock nach der ersten Stufe. Sein Arbeitstag hat begonnen, er muss sich sputen, um pünktlich zu sein. Aber in der Synagoge wird niemand merken, dass ihn das Mühe gekostet hat. Er ist achtzig und eine Schreiberrente ist klein, zu klein, um einen Studenten zu beköstigen. Ein paar Jahre noch muss er durchhalten, und warum auch nicht? Sein eigener Vater ist zweiundneunzig geworden.
Auf dem Treppenabsatz im zweiten Stock nimmt er seinen großen schwarzen Filzhut vom weißen Schopf, um das schöne Fräulein Goldös zu grüßen, das eben die Tür der Bergmann’schen Wohnung hinter sich zuzieht. »Sie sind aber früh dran!«, sagt sie erstaunt, »morgens bin ich Ihnen noch nie begegnet.«
»Ich denke, Sie selber sind heute früher unterwegs als sonst«, antwortet Meyer Jonathan, »denn ich bin heute spät dran.«
»Ja, ich bin zeitig aufgestanden, das Wetter ist zu schön, ich gehe schwimmen«, erwidert Fräulein Goldös, »es würde mich den ganzen Tag wurmen, wenn ich nicht im Wasser gewesen wäre.«
Erst jetzt fällt Meyer Jonathan das Rollköfferchen aus Segeltuch auf. Fräulein Goldös trägt ein rotes Hütchen auf den schwarzen Locken, sie ist breit in den Schultern, schmal in den Hüften, frisch und intelligent, und sie lacht herzlich mit weißen Zähnen und einem dunklen Klang in der Kehle. Sie ist Hauptkassiererin bei Korngross und hat keine Sorgen. Meyer spricht in Gedanken einen Segen über sie, zwar ist sie keine Jüdin, aber die lebenstüchtige Ungarin strahlt ebenfalls die Freude der Schöpfung aus. Freundlich und schön ist sie. Gott segne sie.
»Gestern habe ich Ihren Enkel gesehen«, sagt Fräulein Goldös, als sie vor Meyer Jonathan die Treppe hinabgeht. »Am Kärntner Ring mit einem Pulk anderer Studenten. Sie wollten in die Kärntner Straße, aber die war schon abgesperrt. Es heißt, dass die Universität schon wieder von der Regierung geschlossen wurde, wissen Sie Genaueres darüber? Huch, was haben Sie denn?«
Meyer Jonathan ist über seinen Stock gestolpert und hält sich am Treppengeländer fest. »Sie haben Daniel gesehen?«, wiederholt er.
»Ja, es hat wieder mal Krawalle in der Kärntner Straße gegeben – wirklich prima für die Ladenbesitzer dort, ausgerechnet diese Woche, wo die ganzen Rotarier zum Kongress in der Stadt sind und in Ruhe Einkäufe machen wollen. Es scheint etwas mit einem jüdischen Studenten vorgefallen zu sein, ein Skandälchen, ach was, alles Kindereien, sollen die Burschen lieber arbeiten. Ja, und dann schließt die Regierung auch noch die Universität, und jetzt gehen sie auf der Straße aufeinander los. Aber warum gerade in der Kärntner Straße? Das muss doch nicht sein, oder?«
Fräulein Goldös ist im Handel tätig, schon seit ihrem sechzehnten Lebensjahr, und die Kärntner Straße liegt ihr sehr am Herzen. Wien müsse heutzutage von den Fremden leben, sagt sie, da wasche man seine schmutzige Wäsche doch nicht in der Öffentlichkeit, direkt vor deren Augen! Bösebubenstreiche!
Sie hat sich aufgeregt, springt die letzten Treppenstufen hinab, hebt die Hand und schickt ein »Grüß Gott« zu Meyer Jonathan hinauf, der noch immer da steht, wo er sich festgehalten hat.
»Mein Gott, mein Erlöser, mein Hort im Leiden«, fleht er mit den Worten seines noch in ihm nachklingenden Morgengebets, »meine Zuflucht, mein Kelch des Heils, meine Hoffnung und mein Fels.«
Er trinkt den Kelch des Heils und lehnt den wankenden Körper an den Felsen.
Und dann kann er loslassen, er spürt wieder festen Boden unter den Füßen. Wenn Gott will, wird Daniel kein Haar gekrümmt, obwohl er sich zu Ordnungswidrigkeiten hat hinreißen lassen. Aber warum bloß ist der Junge zwei Nächte nicht heimgekommen?
Endlich hat Meyer den Hausflur erreicht, und selbst seinem besorgten Blick offenbart sich dessen ungewohntes Aussehen – die geschmückte Balkendecke, von der Tannengirlanden und Lampions herabhängen.
»Was ist denn los?«, fragt er den ersten Gesellen, doch schon fällt es ihm ein. »Meinen Glückwunsch«, sagt er höflich und drückt Hodls Ältestem die Hand.
»Heute Abend wird hier getanzt«, sagt der erste Geselle. »Mögen Sie auch das Tanzbein schwingen, Herr Jonathan?«
Aber der älteste Hodlsohn weiß, wie unziemlich die Frage ist, und schiebt den Gesellen beiseite: »Heute Nachmittag empfangen Vater und Mutter Gäste, da kommen Sie doch auch, oder?«
Meyer Jonathan nickt mehrmals; aber ja, die Hodls sind achtbare Leute, und eine goldene Hochzeit feiern zu dürfen, das ist eine Gnade Gottes, dazu muss man auf jeden Fall gratulieren, wenn sich die Gelegenheit bietet.
»Sehr gern, Herr Hodl«, sagt Meyer. Und dann geht er endlich die Luftbadgasse entlang, eine Viertelstunde zu spät, aber die Stadtbahn kann er nicht nehmen, der hohen Bahnsteige und der Kosten wegen. Er muss sich eben beeilen, das ist alles.
In der Gumpendorfer Straße kommt ihm ein Krankenwagen entgegen, er spürt einen Stich im Herzen, aber ja, Krankenwagen sieht man oft fahren. Trotzdem bleibt er stehen und schaut dem Auto nach, bis es an der Einfahrt zur Luftbadgasse vorbei ist. Dann setzt er seinen Weg fort, durch die Gumpendorfer Straße und die leere Eschenbachgasse, und als Nächstes ist der Burgring zu überqueren, aber auf seiner Seite, an der Ecke Babenbergerstraße, hat sich ein Auflauf gebildet. Etliche Burschen schreien und gestikulieren, von allen Seiten laufen Leute herbei. Meyer Jonathan geht nicht über die Straße, sondern folgt den anderen.
›Was mache ich denn da?‹, denkt er, doch seine alten Beine scheinen zu wissen, was sie tun. Und dann, als er ganz nahe ist, wogt die Menschenmasse hin und her, Arme recken sich empor, die Gruppe öffnet sich, und jemand wird mitten auf die Fahrbahn gestoßen.
»Schma Jisrael«, flüstert Meyer Jonathan und spürt bebend, wie der junge Mann auf das Pflaster hinschlägt. Seine Knie werden weich, so kann er nicht weiter. An ihm vorbei zieht unablässig der Strom derer, die um diese Zeit zur Arbeit müssen und dem Getümmel ausweichen, weil sie es eilig haben. Meyer dagegen lehnt an einem Laternenpfahl, ist mit einem Mal zu alt und zu müde, fast schon vom Leben losgelassen. Und doch muss er noch eine halbe Stunde gehen, schnell gehen, um beizeiten im Sekretariat zu sein. Wenn ihn jetzt jemand unterhaken und über die Straße führen würde, wäre er dankbar, obgleich er sonst in seinem eigensinnigen Altmännerstolz keine Hilfe annehmen will.
Ein paar Polizisten kommen hinzu und zerstreuen die Menge, auch die Zuschauer werden verjagt, aber keiner drängt Meyer Jonathan zum Weitergehen, die Polizei übersieht den alten Juden schlicht. Er wartet, weil er etwas wissen will, nämlich, was für Menschen das sind, die sich so wild und wie die Heiden gebärden.
Zwei junge Männer, eindeutig Studenten, kommen direkt auf ihn zu, er sieht sie und weiß: Darauf hat er gewartet. Sie sind rot im Gesicht und keuchen, und einer von ihnen hat seinen Kragen verloren.
Jawohl, so wird auch Daniel heimkommen, so ramponiert und dreckig, und da, der eine blutet aus der Nase, bloß gut, dass er das nun gesehen hat, so wird er die Fassung wahren können, wenn Daniel kommt.
Dann aber tauchen drei weitere Leute auf, zwei stützen den Dritten in der Mitte, der mühsam zu hinken versucht. Sie winken nach einem Taxi, aber welcher Chauffeur lässt sich schon die Polster von einem blutverschmierten Studenten verderben? Meyer Jonathan sieht das Taxi vorüberfahren, und sein Herz entsetzt sich darüber, dass der Mensch seinen Mitmenschen mit voller Absicht im Stich lässt. Aber immerhin war Daniel nicht unter den Studenten … erst jetzt wird ihm bewusst, dass er die ganze Zeit damit gerechnet hat, seinen Enkel zu sehen.
Um fünf vor acht biegt Meyer Jonathan in die Seitenstettengasse ein. Und da – nicht weit von seiner Synagoge – erblickt er Daniel. Daniel, wie er leibt und lebt, gewaschen und gekämmt, ohne Blutflecke, Daniel mit dem Kopf im Nacken, das dunkle Haar unbedeckt wie immer, Daniel mit seinem typischen kerzengeraden Gang. Gottlob, da ist er!
Meyer Jonathan schluchzt auf, kurz und trocken. Aber dann presst er die Lippen zusammen, der Junge darf ihm seine Angst nicht anmerken.
Nun hat auch Daniel seinen Großvater entdeckt und bleibt vor der Tür zur Synagoge stehen. Der alte Mann geht über die Straße, nicht vorsichtig genug allerdings, denn ein Taxifahrer wirft ihm einen erschrockenen und vorwurfsvollen Blick zu. Doch Meyer Jonathan hat bereits Daniels Arm ergriffen. Dessen weit offene Augen schauen hinab ins Gesicht des Großvaters, Meyer Jonathans Lächeln strahlt empor.
Aber dann lässt Meyer die Hände sinken, das Lächeln weicht einer ängstlichen Frage: »Ist dir was passiert, Junge?«
Es wundert ihn selbst, dass er das fragen muss. Daniel ist nichts passiert, das sieht man doch, er hat nicht eine Schramme. Trotzdem muss etwas geschehen sein, das Gesicht des Jungen ist nicht so, wie Meyer es kennt. Hart, kalt und weiß ist es und vor allem alt. Mit einem Mal sieht Meyer seinen Sohn, Daniels Vater, auf dem Totenbett, an dem er selbst das Gebet für die Sterbenden sprach. Daniels Züge sind so starr wie die eines soeben Verschiedenen, und dennoch versucht er, Meyer Jonathan anzulächeln.
»Was ist passiert?«, wiederholt Meyer, und zugleich weiß er, dass Daniel ihm nichts erzählen wird.