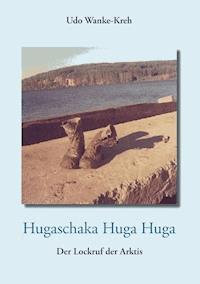
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was unsere Gesellschaft propagiert und worüber unsere Medien berichten, ist häufig etwas ganz anderes als das wirkliche Leben. Wer mit wachem Verstand ein wenig umherreist und mit den Menschen in anderen Ländern mitlebt, dem wird das schnell bewusst. Eine Großstadt wie New York, die einsame, karge Weite der Arktis, eine Spielerstadt wie Las Vegas, eine deutsche Kleinstadt zeigen überdeutlich Unterschiede. Es sind scheinbar verschiedene Welten. Kommt der Reisende nach Monaten zurück in seine vertraute Heimat, sieht und erlebt er sie anders als vor seiner Reise. Er hat ein Gefühl für die Nähe und Ferne entwickelt, die seine Denk- und Handlungsweisen beeinflussen und setzt andere Akzente als vor der Reise. Wie es dazu kommt, erzählt diese Reisebeschreibung aus England und Nordamerika, also noch innerhalb abendländischer Kulturen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reisen ohne Netz
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Reiseerlebnisse in England und Nordamerika
Zwei Monate England
New Yorker Impressionen
Mein erster Kurztrip
Mein zweiter Kurztrip
Die 200-Jahr-Feier in New York
Von New York bis Yellowknife
Von Yellowknife bis Vancouver
Von Vancouver bis Mexiko
Von Mexiko bis Florida
Stellungnahme zu meinen Reiseerlebnissen
Streunende Gedanken
Einführung
Reisen ohne Netz heißt, dass der Reisende auf sich gestellt ist. Es gibt keinen Reiseleiter! Versagt er, ist seine Reise zuende. Rundreisen im Ausland über mehrere Monate verselbstständigen sich, weil die Bedingungen und Probleme nicht vorhersehbar sind. Der Ausgleich sind überraschende Erlebnisse, aktives Leben und steigendes Selbstbewusstsein nach jeder ungewöhnlichen Herausforderung. Ändert sich die alltägliche, gewohnte Zivilisation, muss der Reisende sich umstellen. Beispielsweise in Weltstädten wie New York, der Arktis und der Spielerstadt Las Vegas. Sie gehören zu dieser Rundreise um Nordamerika, etwa 50 000 Kilometer im VW-Bus.
Zwischenmenschlich entfallen viele vorgefassten Meinungen und Konventionen. Die Kontakte sind direkt, man tauscht sich aus und hilft sich spontan. Es herrscht eine gewisse Trappermentalität, jeder weiß, dass er unter Umständen auf den anderen angewiesen sein könnte. Bereichernd sind all die kleinen Tricks und Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben, gerne denkt man daran zurück.
Meine Empfehlung: lesen Sie dieses unterhaltsame, kleine Büchlein.
Reiseerlebnisse in England und Nordamerika
Ich nehme es vorweg, eigentlich wollte ich eine Weltreise machen, doch die Welt war zu groß für mich. Zwar fuhr ich über 50 000 Kilometer und schaffte damit locker eine Erdumrundung, aber über England, Nordamerika und einen kleinen Abstecher nach Mexiko kam ich nicht hinaus. Die Reise dauerte knapp neun Monate, dann war ich reisemüde und pleite. Das Geld reichte noch für den Rückflug von Amerika und einen Monat, um wieder Fuß zu fassen. Die durchschnittliche Reisegeschwindigkeit lag bei 185 Kilometer pro Tag. Natürlich gab es Tage, an denen ich 600 und mehr Kilometer fuhr, was soll man sonst bei Regen machen? Dafür blieb ich auch mal ein paar Wochen an einem Ort. Allgemein lässt sich sagen, dass ich jeden Monat ein schönes und zwei angenehme Erlebnisse hatte, der Rest war Plackerei. Meine Reisekosten wurden von Monat zu Monat geringer. In den ersten Monaten verbrauchte ich rund 1000 DM zum Leben, gegen Ende der Reise waren es nur noch 350 DM ohne nennenswerten Verlust an Lebensqualität.
Zwei Monate England
Ab 1. April 1976 bummelte ich von Würzburg bis Ostende und verband die Fahrt mit dem Besuch einiger Freunde. Am 7. April setzte ich mit einer Autofähre von Ostende nach Dover über und erreichte gegen Abend London. Der Linksverkehr, vor dem ich etwas Bammel hatte, erwies sich als problemlos. Ich reihte mich ein, und nach ein paar Stunden machte es im Kopf „klick“, der Linksverkehr war eingerastet, wie auf dem Festland der Rechtsverkehr. In Greenwich, einem östlichen Londoner Außenbezirk, fuhr ich auf einen Parkplatz und verspürte mächtigen Hunger. Bis auf 1½ Pfund, rund 10 DM, hatte ich alles Bargeld ausgegeben, und die Banken waren bereits geschlossen. Gegenüber dem Parkplatz gab es das vornehme Speiserestaurant „Spread Eagle“, das mich unwiderstehlich anzog. Ich betrat das Lokal, sagte der Bedienung, dass ich nur noch 1½ Pfund hätte und ob ich dafür etwas zu essen bekommen könne. Das Personal machte sich einen Spaß daraus und servierte mir ein köstliches Mahl mit mehreren Gängen einschließlich Getränke. Nach dem Essen erkundigte sich die Bedienung freundlich, ob ich noch irgendwelche Wünsche hätte. Dann brachte sie mir auf einem kleinen Tablett, zwischen einer Serviette, die Rechnung über exakt 1½ Pfund, bedankte sich höflich für meinen Besuch und geleitete mich bis zur Tür. Es war ein beeindruckendes Begrüßungsgeschenk, und ich hatte meine erste Lektion in englischem Humor erhalten.
Satt und faul fuhr ich nicht mehr weiter, sondern legte mich im Auto schlafen. Nachts wachte ich auf, die Blase drückte, und ich fragte mich, was nun? Einfach aussteigen und halbnackt auf den Parkplatz zu pinkeln war mir zu peinlich und stillos. Ich erleichterte mich notgedrungen in ein leeres Glas. Es lief über, meine Hand wurde lauwarm überspült, was die Blase erneut anregte, und der letzte Tropfen ging ohnehin in die Hose. Von diesem Tag an hatte ich für derartige Notfälle eine große Flasche mit weiter Öffnung und Verschlussdeckel im Auto.
Am nächsten Tag, es war der 8. April, kaufte ich mir einen Stadtplan von London, zuckelte in die Innenstadt und verbrachte den Rest des Tages mit der Suche nach einem Campingplatz. Am späten Nachmittag erreichte ich einen sehr schön gelegenen Campingplatz bei London. Um mich nicht zu verfahren, fuhr ich einfach einem Linienbus hinterher, der seine Endhaltestelle in der Nähe des Campingplatzes hatte. Ein Busfahrer wies mich an der Endhaltestelle so gut ein, dass ich den Platz auf Anhieb fand. Von dort aus konnte ich wahlweise mit dem Bus oder der Bahn in die City fahren. Deshalb stellte ich das Auto ab und richtete mich gemütlich ein. Die nächsten Tage verbrachte ich damit, die Umgebung zu erkunden und eine Sprachschule in London zu finden. Der Campingplatz lag zauberhaft, umgeben von Eichen- und Buchenwald. Die Eichhörnchen waren handzahm, den ganzen Tag über Vogelgezwitscher, und selbst die Rehe zeigten wenig Scheu. Die Tage bekamen ihren eigenen Rhythmus: Einkaufen, Essen Kochen, Spaziergänge, Schulbesuch, Hygiene, Wäsche waschen, Aufräumen, Auto pflegen, Gitarre spielen und mit dem Nachbarn schwatzen, vorerst noch mit Händen, Füßen und in Bildern.
Die Suche nach einer Sprachschule war nicht schwierig, aber auf wendig. Es gab zu viele Schulen. Sie boten wahlweisen Unterricht für zwei, drei und vier Wochen bis hin zu mehreren Monaten an. Die Preise für den Unterricht lagen zwischen 30 und 60 Pfund für drei Wochen. Mitunter waren sie auch wesentlich höher. Ich entschied mich für die „St. George’s School“. Sie lag für mich günstig an der U-Bahnstation „Backer Street“. In dieser Schule belegte ich einen Kurs von vier Wochen mit insgesamt 80 Stunden und Sprachlabor.
2. Londoner Toilettenmann 3. Parlamentsgebäude in London mit Big Ben, um fünf Minuten vor drei Uhr 4. Mein Camp bei London 5. Ein tabakfressendes Eichhörnchen
Der Preis betrug 53 Pfund, rund 350 DM, also etwa 4,40 DM pro Stunde. Das „Sprachlabor“ bereitete mir echtes Kopfzerbrechen. Es war mir zu primitiv, um es begreifen zu können. Der korrekte Ablauf war folgender: Man setzte sich den Kopfhörer auf. Über den Kopfhörer wurde eine Frage gestellt. Dann folgte eine Pause, in der man die Frage zu wiederholen hatte. Danach folgte die korrekte Antwort auf die Frage, und man hatte auch sie zu wiederholen. Zwischendurch hörte der Lehrer mal rein, um zu kontrollieren, ob man es richtig machte. Mein Fehler war, dass ich die Frage, statt sie zu wiederholen, versuchte zu beantworten und die Antwort auf meine Antwort als „Richtigstellung oder Korrektur“ verstand. Ich versuchte zu laborieren, also mit dem Tonband in Interaktion zu treten und war verzweifelt, weil das nicht klappte. Die anderen Schüler plapperten fröhlich vor sich hin, und ich kam mir saublöd vor. Nachdem ich endlich diese Papageienmethode beherrschte, fragte ich mich wozu? Nachplappern ohne zu denken konnte ich ja bereits als Säugling und so viel Zeit, die Sprache wie ein Kleinkind zu erlernen, hatte ich nicht. Das war nicht die einzige Macke des Sprachkurses. Wir lernten kein Umgangsenglisch sondern Schulenglisch, das in der Praxis total versagte. Wenn ein Engländer wissen will, was etwas kostet, fragt er „how much?“ Wir lernten „What is the price of ...“. Für „Danke“ sagte der Engländer „thanks“. Wir lernten „many thanks for your kindness“. Sprach ich einen Engländer mit meinem Sprachschulenglisch an, zuckte er erst einmal zusammen und überlegte, ob ich ihn veralbern wolle. Antwortete er, verstand ich ihn nicht. Ich kannte weder die von ihm benutzten Redewendungen, die Idioms, noch die Vokabeln. Das Gesagte sinngemäß zusammenzusetzen war völlig unmöglich. Praktisch unbrauchbar waren auch die Lektionen. Ich lernte beispielsweise alle Teile eines Fahrrades auswendig. Dann folgte eine Story über einen Kaufhausbrand, ein Krimi mit Scotland Yard, und es wurde sogar poetisch mit dem Gedicht:
A ride on a tiger
Ther was a young lady of Niger
Who went for a ride on a tiger
They came back from their ride
With the lady in side
And a smile on the face of the tiger.
Mit diesem „lustigen“ Sprachschulenglisch war ich nicht einmal in der Lage, mir eine Fahrkarte zu kaufen oder eine vernünftige Frage zu stellen. Nach etlichen Misserfolgen wurde ich verklemmt und traute mich kaum noch den Mund aufzumachen.
Dabei ist es so einfach. Als Grundlage, um sich mit Englisch durchschlagen zu können, benötigt man rund 300 Vokabeln, die gebräuchlichsten Redewendungen und ein wenig Grammatik. Darüber hinaus braucht einem der Lehrer nur die Aussprache der 300 Vokabeln zu vermitteln und die Methode, sie benutzen zu können, also beliebig zu variieren. Damit kann man sich nicht nur durchschlagen, sondern mit Geschick und Wendigkeit sogar abendfüllende Gespräche führen. Trotzdem ist es nicht verkehrt, eine Sprachschule zu besuchen, auch wenn sie kaum etwas bringt. Man ist beschäftigt und findet, vor allem im Ausland, Anschluss. So gesehen war die Sprachschule ein harmonischer Einstieg in die Reise.
Nebenbei machte ich die übliche Touristentour, wie sie in jedem guten Reiseführer steht. Ein aktueller Stadtplan von London, einige Karten von England im Maßstab 1:750 000 bis 1:20 000, je nach Bedarf, und es bleibt einem nichts verborgen. Alle Erlebnisse, die darüber hinausgehen, bringen der persönliche Kontakt mit den Einheimischen und die Reiseerfahrung. Ein Beispiel für die Reiseerfahrung ist die Superkorrektheit der Engländer. Meinen Campingplatz musste ich nach 14 Tagen verlassen. Der Verwalter war unerbittlich, obwohl der Platz fast leer war. Kein Hinweis auf meine Sprachschule und persönlichen Probleme, nicht einmal ein Bestechungsversuch konnten ihn erweichen. Er nannte mir einen anderen Campingplatz, der ganz gut sei und sagte zu mir, in 14 Tagen könne ich zurückkommen, dann sei die „Sperrzeit“ abgelaufen.
Die Tage vergingen, und da fast alles neu und ungewohnt war, kam keine Langeweile auf. Nur die alltägliche Routine, die sich ständig wiederholenden Notwendigkeiten gingen mir auf den Geist. Auch der viele Regen, eine bleierne Schlaffheit, bedingt durch die Umstellung vom Berufsleben auf das Reiseleben sowie Erkältungen machten mir zu schaffen. Noch war ich nicht abgehärtet genug und vermisste die geordnete Behaglichkeit eines berufstätigen Bundesbürgers. Vor der Reise war mir nie bewusst geworden, wie gut es mir ging.
Einige Tage nach Beendigung der Sprachschule verließ ich am 13. Mai 1976 London und fuhr, einen großen Schlenker machend, durch Süd- und Westengland nach Liverpool. Ich fuhr, bis ich ein schönes Plätzchen gefunden hatte und verweilte dann so lange, bis die nähere Umgebung an Reiz verlor. Die täglichen Notwendigkeiten nahmen rund vier Stunden in Anspruch. An Fahrtagen kamen noch vier bis sechs Stunden Autofahren dazu. Auch die Reparaturen am Auto brauchten ihre Zeit, ein ewiges Gefummel. Mitunter waren es winzige Kleinigkeiten, deren Ursache erst einmal gefunden werden musste. Beispielsweise hat jeder Tank eine Entlüftung. Ist diese verstopft, erhält der Vergaser keinen Kraftstoff, weil der Druckausgleich fehlt. Die Reparatur dauert zwei Minuten, den Fehler zu finden kann Stunden dauern. Wer denkt denn an so etwas? Doch irgendwann sind einem die Funktionsabläufe beim Auto so vertraut, dass man Fehler systematisch einkreisen kann und relativ schnell findet. Mein VW-Bus war ja zum Glück noch so traditionell, dass ich mit dem Bordwerkzeug das Meiste selbst reparieren konnte.
Einige Eindrücke und Landschaftsbilder sollen meine Reise durch England, Cornwall und Wales abrunden. Den ersten größeren Stopp machte ich rund 80 Kilometer westlich von London in dem Dreieck zwischen den Orten Andover, Newburg und Marlborough. Die Landschaft strahlte Ruhe aus. Vereinzelt, im Abstand von mehreren Kilometern, standen einsame Gehöfte und es gab kleinere Ortschaften. Sie waren eingebettet in hügligem Gelände mit großen Grasflächen, unterbrochen von Wäldchen. Statt Menschen sah ich Schafe, Rinder, Fasane, Rabenvögel, Karnickel und bunte Wiesenblumen. Eine Gegend zum Verweilen und Pläne schmieden.
Von Andover aus fuhr ich nach Southampton und erkundigte mich dort zum ersten Mal nach einer Überfahrt nach Amerika. Es war unmöglich. Von Southampton aus fuhren nur noch Containerschiffe. Man bot mir einen Container für das Auto an. Für einen kleinen Container war das Auto 50 Zentimeter zu hoch. Im nächst größerem hätte ich „wenden“ können, und er war unbezahlbar. Man verwies mich auf Liverpool, Rotterdam und Hamburg, von dort aus verkehrten noch Stückgutfrachter. Ich fuhr an der Südküste Englands weiter bis nach Land‘s End in Cornwall. Sehr schön war der „Dartmoor Forest“. Die Landschaft ist reizvoll. Sie vermittelt ein Gefühl von Überlebenskunst unter schwierigen Verhältnissen. Land’s End selbst ist ein windiger, karger, felsiger, rauer Flecken. Außer etwas Viehwirtschaft und vielleicht Fischfang oder Schmuggel gibt es kaum einen Broterwerb.
Einige typische, allgemein bekannte Eigenheiten der Briten fielen auch mir auf. Da ist zum einen das Kampfsaufen, kurz vor der Polizeistunde. Der Wirt „bimmelt“ zum „last order“. Das ist die letzte Gelegenheit, um noch etwas zu bestellen. Tumultartig ordert jeder noch schnell ein paar Bier, die dann mit Bravour hinuntergestürzt werden. Auch das Essen hat seine Tücken. An den Imbissständen mit „Fish und Chips“ oder „Hot Dogs“ und den Speisebuden von Indern und Chinesen kann man sehr preiswert essen. Das kann aber auch sehr schnell in die Hose gehen - wörtlich genommen. Eine mittlere Preislage gibt es kaum. Die besseren Speiselokale haben eine internationale Küche vom Allerfeinsten. Die Preise sind für den Durchschnittsbürger unbezahlbar.
Sehr raffiniert ist die Spiel- und Wettkultur. Wenn zwei Angler auf der Mole sitzen, findet man gewiss einen Briten, mit dem man wetten kann, welcher von beiden den ersten Fisch fängt. Auch die Spielautomaten haben ihre eigene Faszination. Man sieht das Geld auf einer Platte, auf der sich ein Schieber hin und her bewegt. Jedes eingeworfene Geldstück verändert die Gesamtanordnung der Münzen. Fällt Geld über die Vorderkante der Platte, ist das der Gewinn. Bei jedem neuen Geldstück, das man einwirft, denkt man, jetzt muss doch das Gleichgewicht so gestört sein, dass eine ganze Lawine an der Vorderkante abstürzt. Tut sie aber nicht, und der Anreiz wird von Münzeinwurf zu Münzeinwurf größer. Wer hört schon ganz kurz vor dem „großen Gewinn“ auf? Diese Spielautomaten sind die reinsten Pleitegeier. Bevor man nicht seine letzte Münze verspielt hat, bleibt man dabei. Kaum ist man pleite oder will nur mal schnell wechseln, rasselt es beim Nächsten und man könnte sich vor Ärger in den Arsch beißen. Der blasierte, unbeteiligte Gesichtsausdruck des Briten beim Verlieren und Gewinnen sucht seinesgleichen.
Doch weiter ging die Reise über St. Ives, Ilfracombe und Porlock auf den nördlichen Uferstraßen von Cornwall und dann mit ein paar Abstechern durch Wales nach Liverpool. Dünen, Strände, Steilküsten, Regen, Naturparks, Verkehrsschilder, auf denen Schafe Vorfahrt haben, Bergstraßen und eine durchgängig freundlichgrüne Landschaft. Je näher ich Liverpool kam, umso stärker war das Leben auf den Tourismus ausgerichtet. Für jeden Depp sein eigener Nepp. Zum Glück hatte ich meinen Schlafplatz im Auto und war weitgehend Selbstversorger. Ein Problem ist die Suche nach einem geeigneten Platz zum Übernachten. Bei den ach so liberalen Briten darf offiziell jeder überall halten, parken und übernachten. Nur, alles was von der Straße abzweigt, ist entweder Privatbesitz oder durch irgendwelche anderen Schikanen, Verbote und Anordnungen gesperrt. Will man nicht direkt an der Straße oder einem reizlosen Platz übernachten, muss man zwangsläufig auf einen Campingplatz. Die große Freiheit, überall campen zu dürfen ist vergleichbar mit der Erlaubnis, in einer baumlosen Steppe auf Bäume klettern zu dürfen.
6. Im Hochland der Schafe 7. Dünen am Nordseekanal
Liverpool selbst ist eine liebenswürdige Stadt, so zwischen weltweit und englisch. Nach einigen ergebnislosen Versuchen, ein Schiff für die Überfahrt nach New York zu finden, ging ich in ein Reisebüro. Und siehe da, auf einmal klappte alles wie von selbst. Allerdings zu einem stolzen Preis. Das Reisebüro empfahl mir einen Flug von Liverpool nach New York, das sei preiswerter als eine Schiffsreise. Das Auto würde verschifft und wäre etwa zehn Tage später in New York, ich brauche es nur vom Hafen abzuholen. Die Gesamtkosten betrugen für den Flug, den Autotransport, die Vermittlung und spätere Nachzahlungen rund 2500 DM, also 1/6 meines Reiseetats. Auf den Autotransport entfielen insgesamt 1700 DM. Da ich das Auto nach meiner Reise für 350 Dollar (875 DM) in den USA verkaufte, kostete mich der Autotransport rund 825 DM. Dafür hätte ich den USA niemals ein brauchbares Auto einschließlich Ausrüstung kaufen können. Dass das Auto und die Ausrüstung nur für diese eine Reise dienten, war mir vorher klar. So gesehen war die Idee, das eigene Auto in die USA zu verschiffen, eine günstige Variante. Insbesondere auch deshalb, weil der Benzinverbrauch, im Vergleich zu den amerikanischen Autos, bei der Hälfte lag. Ich brauchte, bedingt durch meine Bleifußfahrweise und die Zuladung, rund 15 Liter pro 100 Kilometer. Um nur 90 bis 100 Stundenkilometer zu erreichen, war Vollgas Bedingung. Bei schlechten Wegstrecken und Stadtfahrten in den unteren Gängen erhöhte sich der Kraftstoffverbrauch.
New Yorker Impressionen
Am frühen Morgen des 30. Mai saß ich noch in Liverpool im Hausflur des Hotels, in dem ich übernachtete. Noch waren alle Türen verrammelt, sogar die zum Frühstücksraum. Zwei Hunde leisteten mir geduldig Gesellschaft, sie kannten die Frühstückszeiten besser als ich. Was für ein eigenartiger Morgen. Um 11.30 Uhr war mein Abflug und ich saß hungrig mit zwei Straßenkötern auf den Treppenstufen vor dem Frühstücksraum.





























