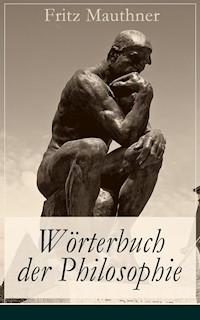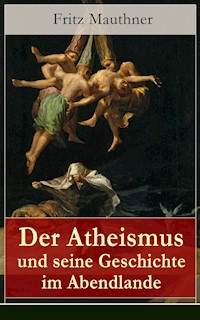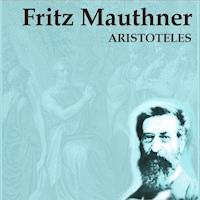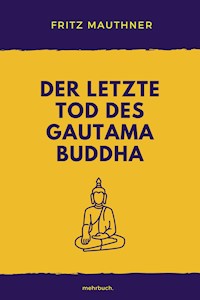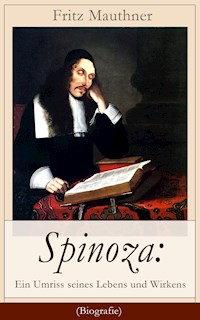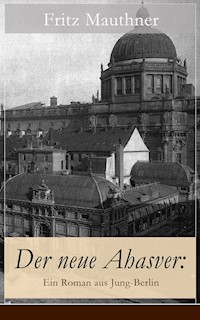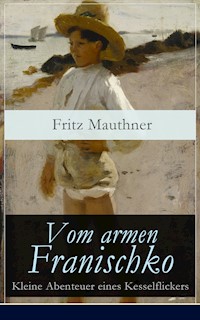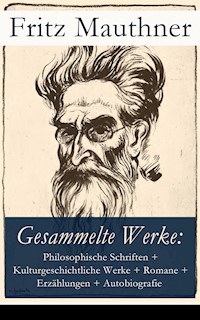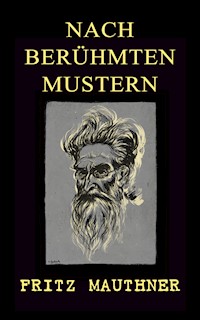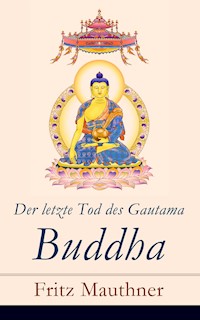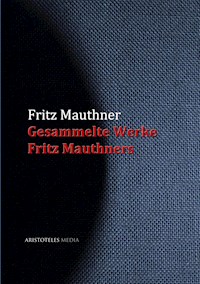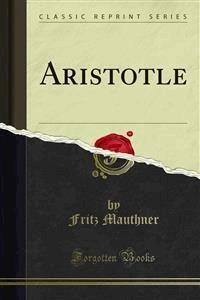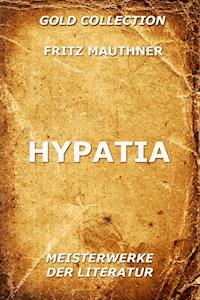
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Roman um die heidnische Philosophin Hypatia, die sich im Alexandria des 5. Jahrhunderts dem Christentum stellen muss.
Das E-Book Hypatia wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hypatia
Fritz Mauthner
Inhalt:
Fritz Mauthner – Biografie und Bibliografie
Hypatia
Ein Vorspiel
1. Die Jugend der Hypatia
2. Das Serapeum
3. Die Nazarener
4. Der neue Erzbischof
5. Ein Statthalter des Kaisers und ein Statthalter Gottes
6. Die Freier
7. Bei den heiligen Männern
8. Das Judenviertel
9. Die Pyramide des Cheops
10. Der heilige Ammonios
11. Die Katakomben
12. Hypatia
13. Der Ausgang
Nachwort zum dritten Bande
Hypatia, Fritz Mauthner
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849618339
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Fritz Mauthner – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 22. Nov. 1849 zu Hořitz bei Königgrätz in Böhmen, studierte in Prag Rechtswissenschaft, trat mit einem Sonettenzyklus: »Die große Revolution« (1871), der ihm beinahe eine Anklage auf Hochverrat eingetragen hätte, zuerst literarisch auf und ließ einige kleinere Lustspiele folgen, die auch mit Beifall ausgeführt wurden. Seitdem widmete er sich ausschließlich dem literarischen Beruf, zunächst als Mitarbeiter der deutschen Blätter Prags, und ließ sich 1876 in Berlin dauernd nieder. Einen durchschlagenden Erfolg erzielte er mit einer Reihe satirischer Studien, die den Stil der hervorragendsten deutschen Dichter der Gegenwart parodierten: »Nach berühmten Mustern« (Stuttg. 1879, 28. Aufl. 1895; neue Folge 1880, ebenfalls in zahlreichen Auflagen; Gesamtausgabe 1897). Weitere Sammlungen von kritischen Feuilletons und Satiren sind: »Kleiner Krieg« (Leipz. 1878), »Einsame Fahrten. Plaudereien und Skizzen« (das. 1879, 3. Aufl. 1890), »Dilettanten-Spiegel. Travestie nach Horazens Ars poetica« (Dresd. 1883), »Aturenbriefe« (2. Aufl., das. 1885), »Credo« (Berl. 1886), »Von Keller zu Zola« (das. 1887), »Schmock, oder die literarische Karrière der Gegenwart« (das. 1888), »Tote Symbole« (Kiel 1891). M. veröffentlichte ferner die Erzählungen und Novellen: »Vom armen Franischko« (Bern 1880; 7. Aufl., Dresd. 1886), »Die Sonntage der Baronin« (1880; 3. Aufl., Dresd. 1884), »Zehn Geschichten« (Berl. 1891), »Bekenntnisse einer Spiritistin (Hildegard Nilson)« (das. 1891), »Der wilde Jockey und anderes« (Münch. 1897), »Der steinerne Riese« (Dresd. 1897); sodann die Romane: »Der neue Ahasver« (das. 1881), »Xantippe« (das. 1884. 6. Aufl. 1894), »Berlin W« (I.: »Quartett«, das. 1886; II.: »Die Fanfare«, 1888; III.: »Der Villenhof«, 1890, mehrfach aufgelegt), »Der letzte Deutsche von Blatna« (Dresd. 1886, 5. Aufl. 1890), »Der Pegasus, eine tragikomische Geschichte« (das. 1889, 3. Aufl. 1894), »Hypatia« (Stuttg. 1892), »Der Geisterseher« (Berl. 1894), »Kraft« (Dresd. 1894, 2 Bde.; 3. Aufl. 1899), »Die bunte Reihe« (Münch. 1896), »Die böhmische Handschrift« (das. 1897). Auch veröffentlichte er Fabeln und Gedichte in Prosa u. d. T.: »Lügenohr« (Stuttg. 1892; 2. Aufl.: »Aus dem Märchenbuch der Wahrheit«, das. 1896). Neuerdings erregte M. die Aufmerksamkeit weiterer Kreise durch ein umfangreiches wissenschaftliches Werk: »Beiträge zu einer Kritik der Sprache« (Stuttg. 1901–02, 3 Bde.), in dem er mit Scharfsinn die Unzulänglichkeit des Ausdrucksmittels der Sprache darlegt.
Hypatia
Ein Vorspiel
Drei Stunden schon dauerte der Vorbeimarsch. Kaiser Julianos hielt auf seinem schweren Fuchs nicht weit vom Statthalterschlosse, am Ende der breiten Hafenstraße, umgeben von Offizieren, Beamten, Geistlichen und Literaten. Seit drei Stunden zogen an ihm die Regimenter vorüber, welche den Marsch nach Asien, den Siegeszug gegen die Perser antreten sollten. Hier, auf dem Hauptstapelplatze Alexandrias, hatte der Kaiser die Parade abgenommen; gegenüber am Bollwerk des neuen Hafens ankerten die Schiffe, welche noch heute abend ihn selbst und seine Begleiter nach Antiochia bringen sollten. Von dort wollte der Kaiser mit dem syrischen Heere der ägyptischen Armee zuvorkommen.
Die Zuschauer fingen bereits an zu ermüden. Es war erst die zehnte Stunde des Vormittags und im März, aber die Sonne brannte so glühend heiß auf die Stadt nieder, daß der Pöbel von Alexandria wünschte, das afrikanische Armeekorps wäre kleiner.
Zwei Fellachenjungen saßen auf einem starken Pfahle und hatten ihre langen Arme einander um die schwarzbraunen nackten Leiber geschlungen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
»Du,« rief der eine, »sieh mal, ein Philosoph ist über das Dach geflogen!«
Ein Marabu, den die Alexandriner, unbekümmert um seine Storchgestalt, nur um seines sonderbaren kahlen Kopfes willen den Philosophenvogel nannten, schwebte in ruhigem Fluge über das Dach der Akademie herüber, zog zwei weite, stille Kreise um das alte Gebäude, schlug dann mächtig mit den großen Fittichen und glitt endlich heran, um sich nicht weit von dem Standort des Kaisers auf eine verwitterte Säule niederzulassen. In den Lüften hatte das Tier ganz prächtig ausgesehen. Wie es aber jetzt auf einem Beine dastand, sich mit dem zweiten Fuße in unwahrscheinlicher Körperkrümmung den runzeligen Hals kratzte, wie dazu unter dem Schnabel ein langer Sack gleich einem graubraunen Barte hervorquoll, das war nicht eben schön. Darüber aber der kahle Kopf, ein ungeheurer Schädel, und darin zwei Augen, von denen man nicht wußte, ob sie mehr melancholisch oder mehr gravitätisch in die Welt blickten, das sah wirklich spaßig aus. Die beiden Fellachenjungen lachten denn auch kreischend auf, während drüben vor dem Kaiser wieder einmal ein Infanterieregiment den eingeübten Morgengruß rief, während von den Schiffen herüber hundertstimmige Zurufe erschollen und die Bürger kriegslustig wie eben Zivilisten ihre Bemerkungen über die Parade austauschten.
Die Fellachenjungen belustigten sich nun damit, den zweibeinigen Philosophen auf der Säule mit dem philosophischen Kaiser zu vergleichen. Sie hatten unrecht. Kaiser Julianos sah weder melancholisch noch feierlich drein. Die Ähnlichkeit, war ganz äußerlich. Ein unscheinbarer, kleiner, stämmiger Mann von etwa dreißig Jahren, saß er zu Pferde wie ein Rekrut. Nur sein geistreicher Kopf mit dem langen, schmutzigbraunen Philosophenbart und dem kahlen Schädel erinnerte entfernt an den Vogel auf der Säule. Und was die beiden Straßenjungen besonders zum Lachen reizte: genau so, wie der Marabu jetzt mit dem rechten Fuße andauernd und ernsthaft an den Schädelknochen kratzte und scheuerte, nachdenklich und eifrig, so kratzte und scheuerte der Kaiser in seinem unordentlichen Barte herum, während er das gerade vorüberziehende Regiment mit einigen kriegerischen Redensarten begrüßte.
»Vorwärts, Jungen! Wir wollen auf die Perser losdreschen, daß nur das leere Stroh von ihren Köpfen übrigbleiben soll! Es wird ein lustiger Krieg werden! Haben wir zusammen die tapfern Schwaben bei Straßburg in die Pfanne gehauen, so werden wir die Perser vor uns herjagen wie eine Hammelherde!«
Und der Kaiser wandte sich nach hinten, um den Großrabbiner von Jerusalem heranzuwinken.
»Euer Gesuch ist in Gnaden bewilligt. Ihr sollt das Geld erhalten, um euren alten Tempel wieder aufzubauen. Wenn ich aus dem Kriege nach Hause komme, so besuche ich euch einmal in Jerusalem. Da müßt ihr mir die geheimen Bücher über den Galiläer vorlegen, den ihr gekreuzigt habt. Ich sammle Materialien zu einer großen Satire auf den Gekreuzigten. Ich bin euch in Gnaden gewogen.«
Wieder klang ein Kommandoruf, und »Guten Morgen, Majestät!« schallte es durch das Geklirr von Eisen. Die letzte Abteilung der Infanterie war vorüber und die Kavallerie begann vorbeizuziehen. Des Kaisers Augen, die eben boshaft aufgeleuchtet hatten, blickten wieder ernsthaft.
»Guten Morgen, Panzerreiter!« rief er wie verwandelt mit mächtiger Feldherrnstimme. »Ihr seht brav aus! Adrett! Ihr werdet mir keine Schande machen! Ich habe mir sagen lassen, daß die persischen Mamsells ganz versessen sind auf afrikanische Kürassiere!«
Ein rohes Gelächter der nächsten Soldaten antwortete, und das ganze Regiment nahm sofort das Gelächter auf. Die Pferde wieherten und schritten in tänzelndem Marsche vorüber. Der Kaiser warf denen, die zuerst gelacht hatten, Kußhände zu, und sprach dann schon wieder mit dem ägyptischen Statthalter. Kurz und entschieden lauteten seine Befehle. Es handelte sich um Nachsendung junger Mannschaften, um den Proviant, vor allem um einen großen Getreidetransport, welcher von Oberägypten aus durch das Rote Meer an die Mündung des Euphrat gebracht werden sollte. Der Statthalter durfte sich keinen Einwurf erlauben.
Julianos zog sein Pferd einige Schritte zurück und ritt dann gegen die Gruppe der christlichen Geistlichkeit los, als ob er sie unter die Hufe seines Tieres bringen wollte.
»Na, ihr Pfaffen!« rief Julianos, und wieder kratzte er sich im Bart, während er mit den Schenkeln den Fuchs immer weiter gegen die Beine der Geistlichen trieb. »Na, ihr Pfaffen, habt ihr heute in euren sogenannten Gotteshäusern für den Sieg der Perser gebetet? Ich will es schon glauben! Aber meinethalben könnt ihr das ungestraft tun. Solche ohnmächtige Demonstrationen verfolge ich nicht. Ich brauche die Hilfe eures Gekreuzigten nicht. Ich möchte euch nur höflich gebeten haben, mit euren eigenen Katzbalgereien fertig zu sein, wenn ich nach dem Siege wieder unter euch trete. Ich möchte doch endlich wissen, woran ihr Galiläer eigentlich glaubt. Seit fünfzig Jahren, seit mein blutiger Oheim euch das Heft in die Hand gegeben hat, streitet ihr über die Natur eurer Gottheit. Na, Herr Erzbischof, haben Sie es endlich heraus?«
Der Erzbischof stand so dicht vor dem Kopfe des Pferdes, daß dessen Schaum ihm den weißen Bart benetzte. Der Kaiser suchte ihn noch weiter zu drängen, der Erzbischof stand aber fest, und das Pferd wollte nicht mehr vor.
»Majestät,« sagte Athanasios, »wir sind katholische Christen und werden uns von unserem Glauben weder durch die Schärfe des Wortes noch durch die Schärfe des Schwertes abwendig machen lassen. Die Privilegien, welche die Vorgänger Euer Majestät uns verliehen haben...«
»Die Privilegien hebe ich wieder auf!... Guten Morgen, Lanzenreiter!«
»Guten Morgen, Majestät!«
Ein Regiment leichter Reiter, das vor kurzem von der Donau nach Afrika versetzt worden war, um der ägyptischen Kavallerie gegen die Beduinen beizustehen, ritt vorbei. Es waren wilde, gelenkige Kerls mit langen Haarflechten und wirren schwarzen Schnurrbärten. Die Standarten dieses Regiments trugen über dem römischen Adler das Zeichen des Kreuzes und den Namenszug Jesu Christi. Der Kaiser ballte die Faust, aber freundlich grüßend rief er den Reitern in ihrer Muttersprache zu:
»Gedenket eures alten Ruhmes! Laßt euch von den Veteranen erzählen, wie sie unter den alten Götterstandarten in der Donauebene dreingehauen haben! Und wißt ihr noch, wie ihr unter meiner Führung auf Syrmisch losgegangen seid? Donnerwetter, das war ein Ritt! Wißt ihr noch? Eine halbe Meile in Karriere über Maisfelder hinüber und dann an den Rebenhügeln hinauf. Wir haben die Feinde heruntergeschmissen, daß sie mit ihren spitzen Helmen im Weinberg stecken blieben und mit den Beinen in der Luft gestikulierten, als wollten sie meinen Vetter zu Hilfe rufen. Der aber starb vor Schrecken über diese neuen telegraphischen Zeichen. Euer Regiment hat mir den ersten Sieg gebracht! Dafür sollt ihr in Persien neue Standarten kriegen. Mit einem großen › J‹ darauf. Das soll aber Julianos bedeuten. Am Tage der Weihe sollt ihr fünfzig Fässer persischen Wein austrinken dürfen – mit weiblicher Bedienung!«
Aufmunternd lachte der Kaiser auf. Doch kein Echo war zu hören. Stumm und ernst wie ein Regiment von Mönchen zogen die christlichen Reiter vorüber. Selbst die Pferde hielten gemessenen Schritt. Und feindlich blickte der Standartenträger, ein riesiger Mann mit langem geflochtenem Schnauzbart, den Kaiser an. Der wurde bleich, aber das Blut kehrte in seine Wangen zurück, als der Träger hundert Schritte weiter die Standarte wie zum Gruße senkte. Dorthin auf die erste Stufe der Kathedrale hatte sich der Erzbischof mit seiner Geistlichkeit, nach der heftigen Ansprache des Kaisers, zurückgezogen. Und dieser sah noch, wie der greise Athanasios die rechte Hand erhob und die christliche Fahne des Regiments segnete.
Der Kaiser stieß seinem Fuchs die Sporen in die Flanken, daß er sich plötzlich hob und dann zwischen den Lanzenreitern und der kaiserlichen Suite vorsprengte. Mit eigener Hand riß Julianos dem Fahnenträger die Standarte aus der Hand, warf sie zu Boden, und mit eigener Hand riß er ihm von der Schulter die Litzen, die seine Würde bezeichneten.
»Du bist degradiert,« schrie der Kaiser, seiner selbst nicht mehr mächtig. »Als gemeiner Soldat wirst du den Krieg mitmachen und wirst Zeuge sein, wie wir die Altäre des Zeus in der persischen Hauptstadt aufrichten! Und wenn du nicht im Kriege fällst, du meuterischer Hund, so wirst du bei der Rückkehr vor den Augen deines Erzbischofs den Tod deines Galiläers sterben, beim Zeus, bei der Sonne, beim ungenannten Gotte! Ich bin doch neugierig, wer hier auf Erden den kürzeren ziehen wird! Ob er, der Sohn des Zimmermanns aus Galiläa, oder ich, der römische Kaiser, der Herr der Welt! Marsch!«
Ohne Standarte zog das Reiterregiment weiter. Die musterhafte Disziplin hielt vor und Julianos lachte höhnisch auf, als er wahrnahm, wie diese christlichen Soldaten, ohne mit der Wimper zu zucken, sich die schwere Beleidigung gefallen ließen.
Dann wandte er sein Pferd und bemühte sich, durch Scherzworte und siegessichere Rufe den Eindruck seiner raschen Tat zu verwischen. Die Reiter blieben unbewegt. Aber die nächstfolgenden Truppen jubelten ihrem Kaiser wieder zu, und als erst gegen elf Uhr die Artillerie an die Reihe kam und unter der verwunderten Unruhe der Zuschauer die ungeheuren Belagerungsgeschütze, von unzähligen Ochsen gezogen, über das Pflaster donnerten, da nahm die Parade einen stolzen Ausgang.
Die Bevölkerung flüchtete vor der sengenden Sonnenglut in die Häuser. Der Kaiser aber schien nicht ermatten zu wollen. Nicht einmal die Einladung zu einem Frühstück im Schlosse nahm er an. Er ließ sich aus der Bude der nächsten Obstverkäuferin ein Brot und ein paar Datteln bringen und nahm die einfache Mahlzeit zu Pferde ein, während noch die Lastwagen mit dem Gepäck der Offiziere in endloser Reihe hinter dem Armeekorps einherrasselten.
»Ich muß noch heute vor Nacht absegeln und möchte nicht fort, ohne die Sehenswürdigkeiten der Stadt in Augenschein genommen zu haben. Ich bitte die Herren, sich mir anzuschließen. Das erste und wichtigste wird sein, daß ich mir die altberühmte Akademie und Bibliothek mal näher ansehe. Da soll ja auch allerlei christlicher Unfug sich eingenistet haben. Wir wollen gründlich ausfegen. Wer übernimmt die Führung?«
Der Präsident der Akademie trat vor und bat mit schwacher Stimme um die Gnade, an dem schönsten Tage seines Lebens ...
»Weiß schon! Sie sind einer von den unsicheren Kantonisten. Sind unter meinem allerchristlichsten Vetter, dem Mörder, für ein Hochzeitskarmen Professor, und dann zum Lohn dafür, daß Sie siebzig Jahre alt waren, Präsident geworden. Na, übernehmen Sie mal die Tête.«
Der Kaiser sprang rasch vom Pferde, und der Zug setzte sich in Bewegung, voran der Kaiser, lebhaft und jugendlich. Neben ihm, immer um einen Schritt zurück, mit dem Kopfe aber unter unaufhörlichen Bücklingen stets in Hörweite voraus, der Präsident der Akademie. Hinter ihnen das militärische Gefolge des Kaisers und eine stattliche Menge von Professoren und Geistlichen. Einzelne Geschäftsleute drängten sich zu und verstanden es, sich vom Kaiser in ein Gespräch ziehen zu lassen, bevor noch der Haupteingang erreicht war. Julianos hatte den Präsidenten nach der Anzahl der Bücher gefragt. Als der alte Herr mit der Antwort zögerte, rief der Papierfabrikant Josseph auf drei Schritte Entfernung herüber: »Warum fragt der Kaiser nicht mich? Ich weiß auswendig, daß 35.760 Bände machen allein die Astronomie aus.«
Die alten Räte und Offiziere, die schon unter Konstantin und dessen Söhnen amtiert hatten, erschraken über diesen neuen Bruch des Hofzeremoniells. Der Kaiser aber winkte den Fabrikanten Josseph freundlich heran und stellte seine weiteren Fragen an ihn. Josseph blieb keine Antwort schuldig. Das Homerzimmer enthalte 13.578 Bände, griechische Philosophie 75.355 und so weiter.
Plötzlich blieb der Kaiser nachdenklich stehen und sagte: »Hören Sie, lieber Josseph, Sie sollen Hoflieferant werden, aber nur, wenn ich mich überzeugt habe, daß Ihre Angaben richtig sind. Ich will die letzte Ziffer mit dem Katalog vergleichen.«
»Gott, gerechter!« rief Josseph zitternd und doch wieder frech. »Gestatten Majestät mir untertänigst, Ihnen zu sagen, daß das noch nie ein Kaiser gemacht hat. Nu ja, ich will zugeben, weil Majestät hat wissen wollen alles so genau, habe ich ein paar kleine Ziffern erfunden. So wollen es sonst immer die Kaiser haben. Aber die Tausender waren richtig. Und ich will Ihnen sagen, Majestät: Ist es für Majestät nicht genug, wenn die Tausender richtig sind?«
Der Kaiser lachte herzlich und versprach, sich die Lehre zu merken.
So gelangte man durch eine namenlose Seitengasse in die Töpferstraße und vor den Haupteingang der Akademie. Eine mächtige Säulenhalle, auf deren Stufen Hunderte von Beamten und Dienern des Hauses Aufstellung genommen hatten, lud zum Eintritt ein. Zur Rechten und zur Linken standen Bildsäulen griechischer Philosophen und Dichter.
Man betrat das Gebäude, und von Saal zu Saal übernahm ein anderer der Professoren die Erklärung.
Als wäre er ein Bibliothekar von Fach, der nur seiner Studien wegen nach Alexandria gekommen, ging Julianos überall hin, zog da ein seltenes Exemplar aus der Reihe hervor, kletterte dort auf einer der bequemen Leitern bis zur Decke hinauf, um sich von der Richtigkeit irgendeiner Angabe zu überzeugen, oder er setzte sich gar mit einem Bande der schönen Ausgabe des Homer an eines der kleinen Tischchen nieder und las ein paar Verse.
Die griechischen Dichter fesselten den Kaiser allein gegen eine Stunde, und von den Philosophen wollte er sich gar nicht trennen. Mit Platons Staatslehre in der Hand führte er ein lebhaftes Gespräch über Jugenderziehung und setzte es fort, während er schon den Flügel der mathematischen Bibliothek betrat. Hier gestand er freimütig ein, daß er ein Laie sei, und ließ sich von den Professoren der einzelnen Fächer so im Vorüberfliegen Vorträge über den augenblicklichen Stand der besonderen Disziplinen halten. Das Gefolge war vollkommen ermattet, und zweimal schon hatte der alte Präsident der Akademie es gewagt, Majestät zu einem kleinen Imbiß einzuladen, der in dem prachtvollen Empfangssaal vorbereitet sei. Davon wollte der Kaiser nichts wissen. Wer ihm diene, müsse ebenso frugal leben können, wie er selber.
Mit Theon, dem berühmten Professor der Mechanik, begann der Kaiser ein Gespräch über die Konstruktion eines neuen Belagerungsgeschützes. Der Kaiser bewies einige Kenntnisse in der Ballistik und gab dem Gelehrten eine allgemeine Idee, wie die Schleuderkraft der alten Maschine verdoppelt werden könnte. Professor Theon, der schon mehrere wissenschaftliche und praktische Arbeiten für die kaiserliche Artillerie ausgeführt hatte, schien heute nicht recht bei der Sache zu sein. Schließlich fiel es dem Kaiser auf.
»Was ist denn das, lieber Theon? Sie wurden mir als einer der treuesten Anhänger unserer alten Götterreligion gerühmt. Ich habe auf Sie gerechnet. Sie wissen, was dieser Feldzug für mich bedeutet. Sie wissen, daß ich diesen Perserkrieg glorreich beendigen muß, um dann in langer Friedensregierung den inneren Feind besiegen zu können, den neuen galiläischen Atheismus, der gegen unsere alte Religion, gegen Götter und Thron das Haupt erhebt. Sie wissen, daß ich dieses Gesindel zu Paaren treiben will, welches allgemeine Gleichheit und Brüderlichkeit und was weiß ich lehrt und den Galiläer zu einem neuen Philosophen machen will. Haben Sie keine Lust, mir dabei zu helfen?«
Theon, ein stattlicher Mann von wenig über vierzig Jahren, beugte sich herab, als ob er dem Kaiser die Hand küssen wollte. Leise sagte er mit Tränen in den Augen:
»Verzeihung, Majestät, niemals werde ich zu den Christen übergehen. Die Götter haben keinen treueren Diener. Aber heute nacht – vor vierzehn Tagen hat mein junges Weib mir ein Kind geschenkt – und heute nacht ist mein junges Weib gestorben, hat mich mit der Kleinen allein gelassen! Heute nacht! Ich allein mit dem Kinde!«
Der Kaiser drückte dem Professor herzlich die Hand.
»Verzeihen Sie mir! Bleiben Sie in meiner Nähe!«
Und in nervöser Hast eilte der Kaiser in den nächsten Saal, rücksichtslos und unermüdlich.
Es war sechs Uhr vorüber, als der Kaiser den Neubau betrat, dessen erste Abteilung die Bibel der Juden in zahlreichen hebräischen Exemplaren und die Übersetzung der siebzig Dolmetscher, sowie zahlreiche Kommentare und Hilfswerke enthielt. Hier warteten seit vielen Stunden die jüdischen Rabbiner und die christlichen Geistlichen, um dem Kaiser ihre Kenntnisse zur Verfügung zu stellen. Julianos fragte unter allerlei Scherzen und Bosheiten die Juden nach der Geschichte ihrer heiligen Bücher und las auch auf der Stelle ein Kapitel aus der Septuaginta. Der Oberrabbiner hatte ihm zur günstigen Vorbedeutung etwas aus der Eroberung Kanaans vorgelegt.
»Eure Moses und Josua sind viel zu gute Soldaten gewesen, um erträglich Philoseophen zu sein. Sie haben zu viele Gesetze gemacht. Aber immerhin habe ich Achtung vor dem Alter dieser Bücher. Ich will in Asien eurer gedenken, wenn ich etwas Hebräisches finde. Ich lasse alles auf Schweinsleder abschreiben.«
Zum drittenmal war der Erzbischof vorgetreten, um in einer vorbereiteten Rede die Bedeutung der Judenbibel für den neuen christlichen Glauben auseinanderzusetzen. Jetzt gelang es ihm, zu Worte zu kommen. Jesus Christus habe das Zeremonialgesetz abgeschafft, welches Seiner Majestät mit Recht so sinnlos erscheine; und wenn Majestät die Gnade haben wollte, einen Saal weiter zu gehen, so werde er die schönste Sammlung aller wichtigen Schriften der christlichen Philosophen vorfinden.
»Ich bitte, sich nicht zu stören, meine Herren!« rief der Kaiser höhnisch. »Ziehen Sie sich zu Ihren christlichen Philosophen zurück und fasten Sie dort, wenn Sie wollen, wie Ihre neuen Menschenbeglücker, die Mönche! Bei dem Gedanken, daß christliche Philosophen meine geistige Kost sein könnten, habe ich plötzlich einen solchen Hunger bekommen, daß ich die Einladung des Herrn Präsidenten annehme, für mich und alle guten Bürger des Reiches. Entscheiden Sie selbst, Herr Erzbischof, ob Sie ein Glas Wein oder ein Kapitel Origenes vorziehen. Dieser heilige Herr soll ja ausnehmend asketisch gewesen sein!«
Der Kaiser faßte Theon unter den Arm, und über Origenes spottend folgte er dem Präsidenten in den großen Prunksaal, wo drei mächtige Büffets aufgestellt waren und wohin sich nun das kaiserliche Gefolge mit Auflösung aller Ordnung stürzte. Der Kaiser selbst nahm mit absichtlicher Enthaltsamkeit nur ein Brot und ein Glas Wein, während die Offiziere und Professoren gieriger, als es wohl Hofsitte war, über die guten Dinge herfielen. Selbst die christliche Geistlichkeit, die widerwillig gefolgt war, vergaß beim Essen ihren Zorn und ihre Sorgen. Nur die Juden berührten nichts.
Der Kaiser sprach wieder mit Theon über die Verbesserung der Belagerungsstücke. Theon sollte sein Weib in Ruhe begraben und betrauern, dann aber mit dem Direktor der Artilleriewerkstätten in Verbindung treten und das geplante neue Geschütz möglich zu machen suchen. Theon hatte ein Glas arabischen Weines zu sich genommen und wollte eben lebhafter als bisher des Kaisers Berechnungen verbessern, als ein lauter Lärm von der Straße die Aufmerksamkeit des Kaisers ablenkte. Rasch schlug Julianos die Portieren zum Balkon beiseite und trat hinaus, um selbst zu sehen, was vorgehe.
»Alles will er selbst sehen,« flüsterte Josseph einem Vetter zu.
Unten in der Töpferstraße hatten sich über tausend Menschen versammelt und schienen zwei Parteien zu bilden, die heftig miteinander stritten. Man hatte das Erscheinen des Kaisers nicht bemerkt. Dieser schickte hinunter, um eine zuverlässige Meldung zu erhalten. Bevor aber der Bote zurückkehrte, war Professor Theon auf den Balkon gestürzt und hatte sich dem Kaiser zu Füßen geworfen.
»Schützen Sie mein Kind, Majestät! Man will es mir taufen.«
Der Kaiser trat in den Saal zurück. Die Ader auf seiner Stirn war angeschwollen. Geschlossen versammelten sich seine Offiziere um ihn. So hatte er ausgesehen, als in der Schlacht bei Straßburg der Verrat des Kaisers Constantius ihn einer Niederlage nahe brachte und nur seine persönliche Tapferkeit den Sieg der Schwaben verhinderte.
Der Kaiser ließ sich berichten. So viel war gewiß, daß der christliche Gesellenverein den Tumult im Akademiegebäude dazu benutzen wollte, um das kleine Töchterchen des Professors Theon gegen den Willen des Vaters zu einer Christin zu machen. Die christliche Amme war bestochen worden, und die Absicht wäre gelungen, wenn ein jüdischer Bibliothekdiener nicht aufgepaßt und Zeter geschrien hätte. Nun standen sich auf der Straße die jungen Leute vom Gesellenverein, welche dem Erzbischof unbedingt zur Verfügung standen, auf der einen Seite, die Griechen und Juden auf der andern Seite gegenüber. Man hatte die Amme mit dem Kinde in das Akademiegebäude zurückgebracht und führte sie jetzt in den Prunksaal vor den Kaiser. »Majestät,« rief Theon, »noch bevor das Kind geboren war, haben sie mein armes Weib gequält, es der neuen Kirche zu versprechen! Dann haben sie der Kranken keine Ruhe gelassen und durch unaufhörliche Bedrohungen die Todeskrankheit wohl verschuldet! Jetzt wollen sie das arme Würmchen Maria taufen, damit ich auf meine alten Tage anstatt eines lieben Kindes eine Feindin, eine Christin, im Hause habe!«
Der Kaiser winkte die Amme zu sich heran und nahm ihr das Kind aus den Armen. Das lag schlafend in seinem Steckkissen und bewegte nur leise das holde Köpfchen, als der Kaiser sich herabbeugte und die weihe Stirn mit seinen harten Barthaaren berührte. Todesstille herrschte im Saal.
»Uns beide sollen sie nicht erobern, du armes Geschöpf!« flüsterte der Kaiser. »Dich nicht und mich nicht, so wahr ich Julianos heiße!«
»Ihr Herren!« rief er dann so laut, daß das Kind erwachte und mit seinen schwarzen, wunderbaren Augen aufschaute, »ihr Herren, ich habe Eiligeres zu tun, als Frevler hier zu strafen! Aber ich kündige euch an, daß der Krieg gegen die Perser nur ein Vorspiel sein soll dessen, was ich gegen die inneren Feinde meines Reiches im Sinne trage. Dieses Kind bleibt unter meinem Schutz. Jeder Fluch der Unterwelt und jeder Blitz der Überirdischen soll die verdammte Hand treffen, die es wagt, das Kreuzeszeichen über mein Patenkind zu machen. Maria wollen sie dich taufen, du armes Ding, und dir die lebendige Seele ertöten, wie sie die Seele der Welt vernichten wollen. Die Lebensfreude wollen sie auslöschen, wie sie dem Griechentum jede Lust und jede Freude vergällt haben für lange Zeit. Mord und Tod, Herr Erzbischof! Zittern Sie vor meiner Rückkunft! Dieses Kind aber soll keinen der demütigen Christennamen tragen. Ich weihe es dem obersten Gott im Himmel, dem Zeus Hypatos, dem höchsten Zeus, und ich nenne es Hypatia.«
Mit beiden Händen hob der Kaiser das Kind empor, mit derselben Bewegung, mit der der griechische Priester bei den heiligen Mysterien der unbekannten Gottheit Opfer darbrachte. Rührung und Friede lag auf seinen Zügen.
»Ihr heiligen alten Götter! Wenn ihr noch lebt, wenn ihr mich liebt und wenn ihr gewillt seid, den Galiläer nicht zu euren himmlischen Sitzen aufsteigen zu lassen, so schützt mir dieses Kind! Ich werde niemals mehr ein Weib haben und Kinder. Wer euch dient, der muß verzichten auf eigenes Glück. Ich nehme dieses Kind für euch als das meine an. Laßt es der Erde zum Pfande, daß Griechenlands Schönheit und Wahrheit und Griechenlands Freude dauern werden, trotz dem Galiläer und seinen Pfaffen. Heilige Götter, schützt mir das Kind, wie ihr mich zum Siege führen werdet, für mich und für mein Reich!«
Ein leises Weinen des Kindes unterbrach die unheimliche Stille, welche den Worten des Kaisers folgte. Julianos ließ das Kind dem Vater und ging dann mit mächtigen Schritten auf den Erzbischof los. Drohend ballte er die Faust und sagte nichts als: »Auf Wiedersehen nach dem Siege! Erst den Perser, dann den Galiläer! Ich bin erst dreißig Jahre alt, und wenn ich nur zehn Jahre das Heft in Händen behalte, so soll die Welt für immer es gespüren! Es ist Zeit, ihr Herren, wir schiffen uns ein.«
Und ohne ein Wort weiter zu verlieren, eilte Julianos die Treppen hinunter. Nur die Offiziere folgten ihm. Unten hatte eine Abteilung der Marinesoldaten Posto gefaßt. Unter ihrer Eskorte marschierte der Kaiser und seine Suite dem Hafen zu. Dort wurde er von einer unzähligen Volksmenge mit Hochrufen empfangen. Die Griechen, die Juden und das ganze Volk der altgläubigen Ägypter hatten von seinem Auftreten gegen die Klerisei gehört und jubelten ihm zu. Begeisterung und Glück strahlte aus des Kaisers Augen. Dicht vor der kleinen Laufbrücke, die ihn auf das Admiralsschiff tragen sollte, richtete er sich, so hoch er konnte, auf und rief, als könnte es die ganze Stadt hören, mit schmetternder Kommandostimme:
»Seht ihr die Sonne, die rotglühend dort im Meer untergeht? Ihr glaubt, sie wäre tot, ihr glaubt, die alten Götter wären gestorben. Aber morgen früh, wenn unsere guten Schiffe uns schon weit von hier dem Kampf und dem Sieg entgegenfahren werden, morgen früh wird sie sich allgegenwärtig in dem Glanze des ersten Tages wieder erheben und wird uns leuchten, uns und aller Kreatur. Daß ihr es wißt, unser aller höchster Gott, der höchste Zeus und der Gott der Juden und euer Gott Serapis, es ist die Sonne, die jetzt schlafen geht, aber auferstehen wird und niemals sterben. Mein Gott, mein Gott, segne mich im Scheiden und segne mein Werk und lasse uns siegen über die Nacht der Galiläer!«
Noch eine weite Handbewegung, als wollte er priesterlich die Stadt segnen, die er verließ, und die Sonne segnen, die blutig untertauchte, dann sprang Kaiser Julianos auf sein Schiff, unter hundertstimmigem Rufen wurden die Taue eingezogen und langsam schwamm das Fahrzeug vom Ufer hinweg, zwischen den andern Schiffen hindurch und majestätisch mit vollen Segeln, die im Abendschein rötlich strahlten, aus dem Hafen hinaus.
Der Philosophenvogel verließ das Dach der Akademie und folgte in weiten Kreisen seinem Kaiser. Lange, lange schwebte er hoch über den Masten, dann kehrte er mit schweren, harten Flügelschlägen zurück und stellte sich mit einem Beine auf einen vorgeschobenen Steinbalken der Akademie, dort, wo das Patenkind des Kaisers längst wieder schlief. Der Marabu kraute sich den Kopf mit dem linken Fuße und klapperte mit dem Schnabel und schloß sorgenvoll die Augen.
Die Sonne! Die Sonne! Mein siegreicher Kaiser! Sie ist nicht gut, ist hart wie die Götter; wohl läßt sie uns leben, doch liebt sie uns nicht. Sie will nur Wüste, sie will nicht dein Wohl. Moloch – Mörderin – Wüstengewaltige? Steine brütet sie, Steine statt Brot! Armer Kaiser, armes Kind!
Und der Philosophenvogel wachte noch lange auf dem Steinbalken über dem Bettchen Hypatias, während Alexandria schon schlief und außer dem uralten Marabu nur noch der Erzbischof wachte, der Erzbischof und sein Sekretär, welche Briefe schrieben nach Rom, nach Konstantinopel und nach Persien, an die Feinde des Kaisers Julianos.
1. Die Jugend der Hypatia
Unter der Pflege einer treueren Amme, einer ehrlichen braunen Fellachin, war Hypatia ein Jahr alt geworden und zum Geburtstag hatten sich viele Kollegen Theons und viele Beamte aus der Stadt mit hübschen und kostbaren Geschenken eingefunden. Das Patenkind des Kaisers, da es so schön und ernst und glücklich in seiner Wiege lag, wurde wie eine Prinzessin bedacht. Auf das Wort des Kaisers hin hatten griechische Hexen und ägyptische Pfaffen, sowie jüdische Kabbalisten dem kleinen Fratzen eine glänzende Zukunft vorausgesagt. Da war keiner unter den Gratulanten, welcher nicht an die Zauberei seiner Religion oder an die Macht des Kaisers Julianos geglaubt hätte. Und so erhielt die kleine Hypatia hundert Gaben, die sie nicht verstand, darunter viele geheimnisvolle Mittel gegen Krankheit und Not, Amulette, welche so ein Glückskind doch niemals brauchen konnte. Und die Blüte der heiligen Lilie, welche der Philosophenstorch mühsam genug aus dem innersten Gärtlein des Ammontempels für das Kind geholt hatte und welche er ihr nach einem Fluge von vielen Meilen bei Sonnenaufgang durch das Fenster vor die Wiege warf, wurde von achtlosen Männern zertreten.
Auf seinem mächtigen Fluge nach der heiligen Lilie erfuhr der traurige Marabu schlimme Neuigkeiten von anderen weitgereisten Vögeln, von Adlern und Geiern. Doch er mußte schweigen, denn man hätte ihm doch nicht geglaubt. So saß er denn Tag und Nacht trübselig da und verschmähte die leckersten Fische. Sechs Wochen später kam das schreckliche Gerücht zu Fuße nach Alexandria, so unsicher und ängstlich freilich, daß die Parteien der Stadt stumm und tatenlos sich gegenüberstanden. Kaiser Julianos sei tot!
Wieder vier Wochen später war es kein Gerücht mehr. In der glühenden Wüste jenseits des Tigris hatte sich das römische Heer aufgerieben im Kampfe gegen die feindliche Natur. Julianos war vielleicht ein guter Soldat gewesen, ein großer Feldherr war er nicht. Oder die Perser mußten aus der Umgebung des Kaisers beraten gewesen sein. Nichts gelang, nirgends stellte sich der Feind zur Schlacht, Armee und Volk von Persien mit allem Vieh und allen Vorräten zogen tiefer und tiefer ins Innere des Landes und ließen das kaiserliche Heer allein in einer Wüste. Wo eine Stadt eingenommen wurde, da schlugen wenige Stunden später die Flammen an allen vier Enden empor.
Und dann kam der furchtbare Tag im Engpaß, wo der Kaiser bei der Nachhut überfallen wurde, wo er wie ein Rasender der Überzahl entgegenritt und mitten im Gedränge von der Seite den tödlichen Schuß empfing. In der Todesnot hatte der gelehrte Libanios ausgehalten neben ihm, und sein Bericht verkündete der Welt die letzten Worte des letzten römischen Kaisers. Das hervorquellende Blut wollte Julianos mit der rechten Hand zurückhalten, bald aber warf er es dem Himmel entgegen, als wollte er sich selbst dem Zorn des neuen Gottes als Menschenopfer darbieten. Dann sank er zurück, graue Todesblässe überzog sein Antlitz und er flüsterte: »Galiläer, jetzt hast du gesiegt.«
Libanios fügte seinem Berichte verdammende Worte über die Mörder seines Herrn hinzu.
Ein neuer Kaiser stieg auf den Thron und bald wieder ein neuer. Doch in Alexandria hörte man nur ihre Namen und fragte immer nur noch nach den Mördern des Kaisers Julianos. Es hieß, der König von Persien hätte demjenigen seiner Soldaten, der sich rühmen könnte, den römischen Kaiser getroffen zu haben, ein Vermögen versprochen. Aber kein Perser machte sein Recht geltend. Man erzählte, der erste Schuß des Treffens hätte dem Kaiser gegolten, und dort, woher der Schuß kam, standen keine Perser. Zwei Tage lang wagte der Erzbischof von Alexandria nicht sein Haus zu verlassen. Denn der Pöbel drohte ihn zu steinigen und nannte ihn laut den Mörder des Kaisers. Doch wieder kam aus Konstantinopel ein Schiff, mit Gold für die Kirche von Alexandria und mit neuen Verordnungen, welche den Kaiser Julianos einen Abtrünnigen und Gotteslästerer nannten. Da zog der Erzbischof frei vor allem Volk in seine Kathedrale und las ein Hochamt; der Pöbel von Alexandria stand am Wege und verhöhnte die armen Soldaten, die nun aus dem unglücklichen Feldzuge heimkehrten, krank und in Fetzen, Krüppel und Invaliden.
Einer von den rückkehrenden Soldaten, der degradierte Fahnenträger eines Reiterregiments von der Donau, beichtete lange im Privatzimmer des Erzbischofs Athanasios. Man kannte ihn nicht, nicht ihn und nicht das fürstliche blonde Weib an seiner Seite; aber man nannte ihn den Mörder des Kaisers und wollte ihn nicht dulden in der Stadt. Der alte Fähnrich aber warf stolz die schwarzen Flechten in den Nacken, strich sich trotzig den geflochtenen Schnurrbart und betete in allen Kirchen und suchte sich ein Heim für das Weib, das er irgendwo in Germanien erbeutet hatte. Er fand endlich ein Obdach in dem verlassenen Gespensterhaus, einem burgartigen Bau, hinten an der Stadtmauer, zwischen den ägyptischen Museumsanlagen und den Friedhöfen, zwischen dem Serapeum und der Totenstadt.
Was der Marabu vor ihrem Fenster klapperte und was der Vater vor ihrer Wiege traurig immer wieder sagte: »Galiläer, du hast gesiegt!« das schien der kleinen Hypatia gleich drollig. Denn sie lächelte, wenn der Vater neben ihr stand, und sie lachte, wenn der Philosophenstorch durch das offene Fenster ungeschickt zu ihr hineinspazierte, um ihr die Zeit zu vertreiben.
Es war einsam geworden in der Akademie seit dem Tode des Kaisers. Monatelang ängstigten sich die Professoren vor dem Übermut des Erzbischofs Athanasios, und auch später, als von Konstantinopel der Befehl gekommen war, nichts an dem Bestehenden zu ändern, die strenge Weisung, die heidnischen Lehrer der Hochschule auf den Aussterbeetat zu setzen, sie aber zunächst im ungekränkten Genuß ihrer Stiftungen zu belassen, da blieb es einsam und still in den Zellen und auf den Höfen der berühmten Schule. Drüben das neu erhöhte und vergoldete Kreuz der Kathedrale überragte nun das Dach der Sternwarte.
Gerade unter der Sternwarte hatte Professor Theon seine kleine Dienstwohnung. Der Mathematiker war sein Flurnachbar. Theon lebte und schlief in seiner Arbeitsstube; sein Wohnzimmer hatte er dem Kinde und der Pflegerin überlassen, der braunen Fellachin.
Noch ein anderes junges Menschenwesen lebte dort, wenige Schritte von der kleinen Hypatia. Isidoros, ein siebenjähriger Junge, ein hochaufgeschossener, brauner, schwarzhaariger, langarmiger Spatzenschreck, durfte im Vorzimmer des Mathematikers hausen, schlafen oder studieren, leben oder sterben. Niemand wußte so recht, wem dieser scheue und doch wieder rücksichtslose Knabe gehörte. In den Gesindezimmern der Akademie erzählte man sich darüber eine wüste und unwahrscheinliche Geschichte. Ein ägyptischer Priester, der ja zur Ehelosigkeit verurteilt war, sei der Vater, eine Nonne, eine Verwandte des erzbischöflichen Sekretärs, sei die Mutter. Ägyptisches und syrisches Blut, eine nette Mischung! Das Kind sei vor dem erzbischöflichen Palais ausgesetzt gewesen, aber als es dem Verhungern nahe war, von irgendeiner gutmütigen Dienstmagd in seinem Weidenkorbe nach der Akademie herübergebracht worden. Und die Anatomiediener behaupteten, Isidoros sei eigentlich schon tot und ihnen verfallen gewesen; man habe den Knaben künstlich zum Leben gebracht. Genug, für das Waisenkind fand sich in der kleinen Stadt, welche die Akademie hieß, zwischen weltentrückten Lehrern und einer reichlich besoldeten Dienerschar ein Plätzchen zum Weiterwuchern. Wie das Unkraut zwischen den Steinen in den Ecken der Höfe, so schoß er auf, genährt und gestoßen wie die halbwilden Hunde auf diesen Höfen. Und wenn niemand wußte, in wessen Obhut Isidoros aufwuchs, wer ihn kleidete und wer ihm Unterricht erteilte, so fragte der Knabe am wenigsten danach. Zur Mittagszeit aß er etwas an der Schwelle, welche die nächste war, schlechte Kleider erhielt er mehr, als er völlig zu Fetzen tragen konnte, und seine Kenntnisse, ja, um seine Kenntnisse war es eine seltsame Sache.
Als Isidoros etwa fünf Jahre alt war, verbreitete sich plötzlich in der ganzen Akademie die Nachricht, er sei ein Wunderkind. Zwei Professoren, Theon und der Mathematiker, hatten ihn beobachtet, wie er den Sandweg am Springbrunnen des dritten Hofes dazu benutzte, um die geometrischen Linien einer schwer zu berechnenden Mondfinsternis grob, aber richtig mit einem Stäbchen nachzuzeichnen. Man staunte und forschte und es kam heraus, daß der kleine Junge womöglich alle mathematischen und astronomischen Vorlesungen durch die offenen Fenster oder drinnen im Saale selbst, hinter einem Wandpfeiler versteckt, mit angehört hatte und unter den ordentlichen Schülern schon lange als ein närrischer Weisheitsschatz galt. Eine nähere Untersuchung ergab, daß Isidoros alle die verzwickten Formeln und langen Zifferreihen nur auswendig wußte, daß er ihren inneren Zusammenhang mitunter ungefähr ahnte, gewöhnlich aber gar nicht verstand.
Auf Wunsch des alten Mathematikers wurde Isidoros in die Kinderschule gesteckt. Dort verschlang er mit glücklicher Gier binnen vier Monaten, womit die anderen Schüler sich jahrelang abplagten. Seit dieser Zeit eben durfte er im Vorzimmer des Mathematikers schlafen, und sogar an den Kaiser nach Konstantinopel ging ein Bericht über das Wunderkind ab. Und wirklich setzte eine der Prinzessinnen eine kleine Stiftung für den Knaben aus. Er sollte gute christliche Bücher zum Geschenk bekommen und zu einem Streiter für den neuen Glauben erzogen werden. Weiter reichte die Stiftung freilich nicht.
So war der Flurnachbar des schönen kleinen Heidenkindes; aber er bekümmerte sich um Hypatia weder im Guten noch im Bösen.
Diese wuchs trotz der Nähe ihres Vaters nicht gerade in gelehrter Gesellschaft auf. Ihre Amme führte das kleine Hauswesen weiter und war für das Kind die einzige Beschützerin und Erzieherin. Der gute Marabu gewöhnte sich, seine müßige Zeit bei Hypatia zuzubringen; aber in seinem Wesen lag mehr Betrachtung als Belehrung, und überdies verstand sie sein Klappern noch nicht, denn sie hatte noch keinen Schulunterricht genossen. Der Vater selbst liebte sein Kind über alles, aber er sah es fast nie, höchstens einige Minuten des Morgens, wenn er der Fellachin das viele Geld für den Hausstand übergab und sich darüber wunderte, daß die Amme ihm dabei immer über die Schlechtigkeit der Marktweiber klagte. Er nannte das: mit der Wirtschafterin rechnen.
Diese Art der Hauswirtschaft gedieh der kleinen Hypatia nicht eben zum Schaden. Die Fellachin war immer in der Lage, das süße Kind mit allerlei Leckerbissen zu verwöhnen, für seine Kleidung die feinsten Gewebe einzukaufen und es von Zeit zu Zeit durch die Zaubermittel der Priester und der alten Weiber vor Krankheit zu bewahren.
Wirklich wuchs Hypatia so heran, ohne daß ihr gelehrter Vater jemals durch eine Sorge um das Kind gestört wurde. Hypatia stand in ihrem siebten Jahre, als dieses Leben die erste Änderung erfuhr. Es war in einer warmen und klaren Maiennacht und Professor Theon hatte die Zuverlässigkeit eines neuerfundenen Meßinstruments auf der Sternwarte geprüft. Es war ihm wieder einmal gelungen, einen Irrtum des Ptolemaios festzustellen, einen Rechenfehler in der Umlaufszeit eines Planeten. Noch vor Sonnenaufgang kehrte er in seine Wohnung zurück und war recht überrascht, als er da in Wolken von Räucherwerk zankende alte Hexen und Pfaffen vorfand.
Hypatia war gegen Mitternacht auf den Tod erkrankt, und die Fellachin hatte sich nicht anders zu helfen gewußt.
Theon trat an das Bettchen des Kindes, das mit glühenden Wangen im Fieber lag, sein schwarzes Wunderauge starr nach der Zimmerdecke richtete und den Vater nicht kannte. Theon blieb eine Weile hilflos vor Überraschung und Jammer, dann suchte er einen Kollegen von der medizinischen Fakultät auf, mehr um seine Not zu klagen als um Hilfe zu erbitten. Denn die Mathematiker betrachten die Medizin als eine unkontrollierbare und unzuverlässige Wissenschaft. Der Arzt aber, der das schöne Kind vom Hofe der Akademie her wohl kannte, begleitete Theon sofort in dessen Wohnung zurück. Dort gab es einen heftigen Auftritt. Die Zauberer wurden endlich zu allen Teufeln gejagt, und die Amme versprach unter Tränen, sich allen Anordnungen des Arztes zu fügen.
Nach fünf sorgenvollen Tagen und Nächten wurde das Kind für gerettet erklärt. Aber Theon, der hilflos und fremd unaufhörlich neben dem Krankenbettchen saß, erfuhr zu seinem Kummer, wie sehr das geistige Leben des Mädchens bisher vernachlässigt worden war. Natürlich konnte sie nicht lesen und nicht schreiben. Aber nicht einmal ordentlich griechisch sprechen konnte sie, die Tochter des griechischen Weisen, das Patenkind des Kaisers. Mit der Amme hatte sie immer in der ägyptischen Mundart geplaudert, ebenso mit ihren Spielkameraden, und für den Vater und dessen Morgengruß hatten ein paar Dutzend griechische Worte genügt. Anstatt homerischer Verse wußte sie nur ein paar ägyptische Auszählsprüche auswendig. Und der gelehrte Professor mußte die verhaßte Mundart sprechen, um sich seinem kranken Kinde verständlich zu machen.
Während Hypatia sich nur langsam von der schweren Krankheit erholte, besprach der müßige Theon mit dem Arzte, mit seinem Flurnachbar und mit anderen Kollegen, wie sein Hauswesen nach den Grundsätzen einer vernünftigen Erziehungslehre umzugestalten wäre. Da sollte eine zuverlässige und gebildete Gesellschaftsdame gewonnen, da sollte für das Kind ein geeigneter Lehrer gefunden werden. Als der Arzt aber nach einigen Wochen Hypatia, die schon längst ungeduldig geworden war, für vollkommen hergestellt erklärte und sie aus seiner Behandlung entließ, nahm Theon aufatmend das neue Meßinstrument wieder zur Hand, um die Rechnung jener warmen Maiennacht zu Ende zu führen.
Der unermüdlich fleißige Isidoros hatte sich kurz bis vor ihrer Erkrankung ganz und gar nicht um seine Nachbarin gekümmert. Sein Studium duldete überhaupt keine Spielgenossen, und Mädchen verachtete er doch gar zu sehr, um von so was Notiz zu nehmen. Ein unwissendes Kind und dazu noch sechs Jahre jünger als das Wunderkind der Akademie. Aber kurz vor Hypatias Erkrankung war in dem flegelhaft aufgeschossenen Wunderknaben eine ernste Veränderung vor sich gegangen.
Seitdem er die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hatte, war aus dem wißbegierigen Jungen ein unersättlicher Bücherwurm geworden. Die Professoren plauderten mit ihm, die älteren Studenten ließen sich von ihm bei ihren Arbeiten helfen; aus alledem wie aus dem ungeordneten Besuche der Vorlesungen hatte sein Hochmut Nahrung gesogen. Nur in den Räumen der Bibliothek, unter den unerschöpflichen Bücherschätzen hatte er noch Neues zu lernen gehofft.
Sein eigentlicher Leiter sollte ein alter Mönch sein, der etwa dreißig Jünglinge zu Geistlichen oder Mönchen erzog. Was aber hier gelehrt werden durfte, das wußte Isidoros besser als sein Lehrer, und so waren Mönch und Knabe froh, wenn sie einander nicht sahen. Ohne Führer, ohne Freund hatte der Wunderknabe sich selbst einen einfachen Lehrgang entworfen. Er hatte sich die Aufgabe gestellt, sämtliche zweimalhunderttausend Bücher der Bibliothek durchzulesen. Plötzlich kam zu der Lernwut auch die Eitelkeit. Mit den seltensten Büchern, mit ungeheuren Folianten, hatte er sich breit in die große Halle gesetzt, als wollte er Studenten und Professoren herausfordern. Durchreisenden Fremden, welche die Bibliothek besichtigten, war der Junge gezeigt worden. Pedantisch gekleidet wie ein alter Schulfuchs, eitel wie ein junger Zirkusreiter, so sollte Isidoros dreizehn Jahre alt werden, in demselben warmen Monat Mai, in welchem Hypatia erkrankte.
Um diese Zeit fing der junge Gelehrte zu denken an. Es kam über ihn die Ahnung, daß die unzähligen Dinge, die er gelernt hatte, einander widersprachen. So konnten doch nicht alle Autoritäten gleich gut sein! Alle Lehrer der Akademie hatten ihn unterrichtet, aber keiner hatte ihm von den Rätseln gesprochen, die ihn jetzt zu umgeben begannen. Isidoros sehnte sich nach einem Führer, nach einem Freund. Am liebsten hätte er sich von einem hundertjährigen Priester an der Hand nehmen und willenlos lenken lassen.
In diesem Zustande seiner Seele war es, daß Isidoros eines Tages, eben am ersten Mai, kurz vor Sonnenuntergang in der Halle des zweiten Hofes saß und las. Nicht weit von ihm spielten kleine Mädchen zuerst Ringelringelrosenkranz und dann Verstecken. Es störte ihn nicht einmal. Plötzlich schoß eines der Kinder wie ein Windspiel um ein Gebüsch von Rosenlorbeer herum auf ihn zu und duckte sich, schelmisch lächelnd, hinter seinem großen Folianten nieder.
»Nicht mucksen!« sagte das Mädchen.
Isidoros wollte im ersten Augenblick das Kind fortstoßen; dann wollte er würdevoll mit seinem Folianten einen stilleren Platz aufsuchen; endlich entschloß er sich herablassend, wie es seinem höheren Alter geziemte, das kindische Spiel zu beobachten. Doch auch das vermochte er nicht. Was zwischen seinen Knien und dem Folianten kauerte ...ja, was war denn das? Warum schien es ihm eine Offenbarung, daß die kleine Hypatia vom Laufen erhitzt schwer atmete, daß sie vertrauend und doch ängstlich zu ihm aufblickte? Ja, war denn das Wirklichkeit? Gab es solche Augen auf der Welt? Augen waren doch sonst nur blöde, gerötete, blinzelnde Schlitze, durch welche der menschliche Geist Buchstaben sehen konnte. Und diese Augen...
Isidoros konnte nicht begreifen, warum aus seinen eigenen blinzelnden und geröteten Augen Tränen hervorschossen. Um sich Haltung zu geben, legte er die zitternde Hand auf des Mädchens Locken und sagte recht freundlich:
»Du bist die kleine Hypatia?«
»Ja, die Prinzessin. Sie sagen es bloß, um mich zu necken; aber ich bin wirklich das Patenkind des Kaisers, und wenn ich groß bin, bekomme ich ein goldenes weißes Kleid.«
Die Kinder wurden bald nach Hause gerufen. Es war dunkel geworden und Isidoros saß noch lange in der Halle. Das große Buch lag auf der Erde, und er träumte. Noch niemals, seitdem er denken konnte, hatte er so geträumt. Noch niemals hatte er in müßigen Stunden an etwas anderes gedacht als an Lehrer und Schriftsteller, an Aufgaben und ihre Lösungen. Heute war etwas Neues über ihn gekommen, etwas, was wie Phantasie aussah und ihn zwang, an Menschen zu denken und noch dazu an das Kind mit den schwarzen Wunderaugen, an das Patenkind des Kaisers, an die verwunschene Prinzessin. Vielleicht war Julianos nicht tot, vielleicht war er der Mann, der die Zweifel lösen und der nach seiner Rückkunft Philosophie und Glauben versöhnen konnte. Vielleicht nahm einst Kaiser Julianos den gelehrten Isidoros bei der Hand und führte ihn in einen glänzenden Tempel, wo in Flammenbuchstaben auf goldenen Blättern das Geheimnis der Welt enthüllt wurde, vielleicht gab Kaiser Julianos dem gelehrten Isidoros die Prinzessin zur Frau und machte ihn zum Cäsar und zum Imperator.
Isidoros verbrachte die Nacht mit Schluchzen und wand sich in Krämpfen, und er sah noch häßlicher aus als sonst, als er mit Sonnenaufgang wieder in die Halle trat und wartete, daß Hypatia erschien. Heute hielt er eine Liebestragödie des Euripides in den Händen; er las sie und erschrak über sich selbst, weil er sich mit keinem Gedanken um die Grammatik und um die Ausleger bekümmerte, sondern nur um die süße Sprache und den holden Inhalt der Verse.
Isidoros hatte niemanden, mit dem er von seinen neuen Schmerzen hätte sprechen können, und auch die Prinzessin ließ er nichts ahnen, er sprach kein Wort mit ihr und schreckte sie mit seinen bösen Augen von sich, wenn sie in seine Nähe kam. Aber lange konnte er ihren Spielen zuschauen, und bei Nacht schlich er wohl vor ihr Fenster und beneidete den frechen Marabu, der über ihrer Kammer sein Junggesellennest gebaut hatte und die Nacht über auf einem Beine Schildwache stand, und wenn die Sonne aufging und Isidoros heimlich in seine Wohnung schleichen wollte, den Schnabel ganz spöttisch verzog.
Kein Lehrer und kein Schüler ahnte, was in der Seele des Isidoros vorging, als Hypatia nun bald darauf wieder erkrankte. Kein Schlaf kam in seine Augen, und in einem finsteren Keller der Akademie vollführte er Totenbeschwörungen, um das Leben des Kindes beschützen zu helfen, heimlich bezahlte er in den Kirchen der ägyptischen Götter Fürbitten für eine kranke Prinzessin und hatte den Eid geschworen, keine Nahrung über seine Lippen zu bringen, bevor Hypatia gerettet war.
Als das Patenkind des Julianos endlich wieder auf dem Hofe erschien, durchsichtige Blässe auf den Wangen, die Wunderaugen noch erweitert, groß, schlank geworden, wie eine richtige Prinzessin, und als sie plötzlich, weil sie müde war oder sich so verwandelt hatte, mit ihren Altersgenossen nicht mehr spielen wollte, da meldete sich Isidoros zum Amte eines Lehrers der Kleinen. Linkisch und lächerlich trat er vor Theon hin und setzte altklug auseinander, wie er zu alt zum Schüler und zu jung zum Professor sei, und wie es ihm gut tun würde, sich zum ersten Male in der Unterweisung der kleinen Hypatia zu üben. Isidoros wurde noch bleicher als sonst, als sein Antrag ohne jeden Widerspruch aufgenommen wurde und als gar Hypatia auf den Ruf des Vaters hereintrat.
»Hypatidion,« sagte der Profefsor mit liebevoller Zerstreutheit, »du bist nun in dem Alter, wo auch ein Mädchen in die Schule gehen soll. Möchtest du lesen und schreiben lernen?«
»Nein!«
»Warum nicht, Hypatidion?«
»Die lesen und schreiben können von den Mädchen, sind ebenso dumm wie ich und patzig dazu.«
»Was für ein Ausdruck, Hypatidion?«
»Na ja, sie haben sich so. Und überhaupt, ich will nicht in die Schule gehen, da ist es erbärmlich gräßlich.«
»Hypatia,« sagte da Isidoros und seine Stimme zitterte, »möchtest du bei mir in deiner Stube oder im Garten etwas lernen?«
»Bei dir? Lernen ja! Du siehst nicht aus wie ein Lehrer.«
Seit diesem Tage war Isidoros der Lehrer der kleinen Hypatia. Niemand kümmerte sich um sie, auch der eigene Vater nicht. Ganz allein Isidoros erfuhr, daß in der Akademie ein neues Wunderkind heranwuchs. Aber Hypatia war anders als er. Er war dreizehn Jahre alt und hatte noch niemals »warum« gefragt. Er hatte mit seinen Gedanken die Abgründe über und unter der Erde durchmessen, hatte alle Dichter und Götter kennen gelernt, hatte die Bücher der Kritiker und Atheisten gelesen und hatte sich nacheinander den Dichtern und Göttern, den Kritikern und Atheisten unterworfen und hatte niemals »warum« gefragt. Und dieses kleine Wundermädchen mit den furchtbaren schwarzen Augen hatte in der ersten Minute der ersten Unterrichtsstunde »warum« gefragt, als Isidoros ihr ein A auf die Tafel aufzeichnete und behauptete, das heiße A. »Warum?«
Selige Stunden! Selige Jahre!
Binnen kurzem hatte man sich daran gewöhnt, den gelehrten Isidoros täglich bei gutem Wetter mit seiner kleinen Schülerin in der Lorbeerlaube des ersten Hofes sitzen zu sehen. Nur dem Lehrer und der kleinen Schülerin wurde ihr Umgang nichts Altgewohntes, nichts Alltägliches. Isidoros wußte nicht, wie man Kinder unterrichtete. Er hatte es nicht gelernt und es den Professoren nicht abgesehen. Doch wenn er es auch gekonnt hätte, das Patenkind des Kaisers ging seinen eigenen Weg. Sie wollte alles wissen und nichts ohne Zusammenhang. Es dauerte zwei Jahre, bevor sie geläufig lesen und schreiben konnte, aber da hatte sie auch schon zugleich eine Welt in ihrem kleinen Kopfe. Sie malte keinen Buchstaben hin, ohne nach der Bedeutung des Zeichens zu fragen, und nach seiner schönsten Form und nach seiner Geschichte. Isidoros mußte sich abquälen wie ein junger Professor, um der Kleinen das ABC so beizubringen, wie sie es lernen wollte. Wonach niemand forschte, das verlangte Hypatia zu wissen, und Isidoros hätte sich lieber die Zunge abgebissen, als ihr jemals mit einem »Das weiß ich nicht« gegenüberzustehen. In seinen Büchern und bei ägyptischen Geistlichen lernte er nach, was ihm noch fehlte, um den Wissensdurst des Kindes zu befriedigen. Mit ganz neuen Kenntnissen ausgestattet, betrat er die Laube oder das Stübchen, und wie ein Spielgenosse kramte er aus, was er mitgebracht hatte. Das hieroglyphische Zeichen, aus dem der griechische Buchstabe geworden war, und die lateinische Form, die er jetzt bei den Römern angenommen hatte. Das war ein köstliches Spiel, die drei Schriften nacheinander zu malen, zu lesen und zu schreiben und dann wohl auch hinauszugehen in die Totenstadt, dort Blumen zu pflücken und zu zerpflücken und Inschriften zu buchstabieren und darüber zu plaudern, welchen Unsinn die Ägypter von ihren Göttern glaubten, oder hinüber zu laufen zu den beiden großen Obelisken hinter dem Hause der Hafenpolizei und darüber zu sprechen, wie die alten ägyptischen Könige vor der griechischen Zeit diese Steine aufgerichtet hatten als Herren der Welt, und wie sie dann doch von uns Griechen besiegt worden waren. Es war köstlich, vier Wochen lang an dem Delta herumzumalen und sich über die Weisheit zu wundern, mit welcher der Erfinder der ägyptischen Schrift dafür gesorgt hatte, daß man sich bei dem Buchstaben Delta auch etwas denken konnte. Es war köstlich, bei dieser Gelegenheit die Wunder des Nils zu vernehmen, die Märchen von seinem Schwellen und Sinken, von den Göttern, die ihn aussandten, das Land zu befruchten, von dem Nil mit seinen sechzehn Kindern, die alle nicht lesen und nicht schreiben konnten und doch so herzige Bengel waren, und in deren Fülle so schöne Geheimnisse verborgen lagen, daß Isidoros stundenlang sprechen und Hypatia stundenlang hören konnte, beide ohne zu ermüden. Das war eine Schule! In der einen Ecke des Rohrsofas saß Isidoros und hielt seine kranken Augen still und gezähmt auf das Kind gerichtet und sprach und sprach, was er für sie allein gelernt hatte, und in der anderen Ecke saß zurückgelehnt die kleine Prinzessin und suchte mit ihren großen Augen alles in sich aufzunehmen, wie sie das Sonnenlicht mit ihnen einzusaugen schien. Wenn sie eines ihrer ewigen »Warum« dazwischen zu werfen hatte, so sprang sie auf und stellte sich vor den Lehrer hin und zog das Kleidchen über das Knie herunter und stemmte die Händchen in die Seite und fragte: »Wie das? oder »Warum?« oder sie rief gar: »Das glaub' ich nicht!« und dann sprang der Lehrer auf und drohte sie zu strafen, und sie lief um den Tisch herum und klatschte in die Hände und rief in einem fort: »Das glaub' ich nicht, das glaub' ich nicht!« Bis er die Schiefertafel ergriff und ihr, was er gesagt, aufzeichnete oder aufschrieb; dann legte sie wohl nachdenklich die Schiefertafel auf den Teppich und warf sich längelang davor nieder und stützte ihr Köpfchen in beide Hände, daß die schwarzen Locken zur Rechten und zur Linken zwischen den Fingerchen niederflossen, und prüfte und las stumm und aufmerksam, bis sie endlich ruhig wieder aufstand und dann nichts sagte als: »Weiter!« Da war Isidoros glücklich und erzählte ihr wohl zur Belohnung ein schönes Schiffermärchen aus der Heimkehr des Odysseus, damit sie nur endlich einmal befriedigt war und nicht »warum« fragte.