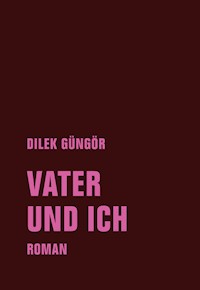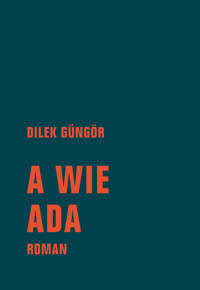Inhaltsverzeichnis
Cover
Inhalt
ICH BIN ÖZLEM lesen...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Impressum und Copyright
Dilek Güngör
ICH BIN
ÖZLEM
Roman
1
Der Geruch von geschmortem Fleisch hängt warm und schwer in der Luft. Meine Kleider, meine Haut, alles an mir riecht nach Fett und angebratenen Zwiebeln. Bevor die Gäste kommen, werde ich duschen.
Dass mir das noch immer nachgeht.
Manchmal erwische ich mich dabei, wie ich meinen Ärmel an die Nase hebe, an meinem T-Shirt schnuppere, an meinen Haaren. Einfach so, mitten am Tag. Das T-Shirt riecht nicht unangenehm, auch unter den Achseln nicht, nur Deo und warme Haut. Aber was, wenn ich doch stinke und bloß nichts rieche?
Beim ersten Mal bin ich über mich selbst erschrocken. Ich war an jenem Morgen auf dem Weg zur Arbeit, meine Haare noch nass vom Duschen, und als ich unten im Haus an den Briefkästen vorbeikam, blieb ich stehen, zog den T-Shirt-Ausschnitt über meine Nase und atmete ein. Orangenduschgel, Persil, alles in Ordnung.
Es ist fast dreißig Jahre her, aber die Angst, dass ich stinken könnte, hat sich gehalten. Zum Glück riefen sie mich im Schulbus nie Kümmeltürke und auch nicht Knoblauchfresser, was auch nicht richtig gewesen wäre, denn zu Hause aßen wir keinen Kümmel und selten Knoblauch. Zwiebeln schon. Lauchzwiebeln roh zum Essen und auch die Knollen, von innen nach außen. Die zarten Schichten in der Mitte sind mild und saftig. Ich erzählte es nur niemandem in der Schule.
2
Es klingelt, Johanna kommt mit einer großen Papiertüte im Arm die Treppen hoch. Sie ist außer Atem.
»Warum hast du nicht den Aufzug genommen?«
Ich nehme ihr die Tüte ab.
»Der braucht immer so lange.«
Sie streift sich die Schuhe ab, wäscht sich die Hände im Spülbecken und packt ihre Einkäufe aus. Rucola hat sie gekauft, Kopfsalat und Champignons, Fertigdressing, Croutons und kleine Mozzarellakugeln im Becher.
»Ich muss den Salat erst noch machen, ich war bis eben im Büro, wir waren heute nur zu dritt.«
Sie entschuldigt sich auch für das Fertigdressing. Für die abgepackten Croutons.
»Mozzarella können wir auch weglassen, wenn ihr den nicht mögt.«
Selbstverständlich ist Johanna in der Lage, einen Salat zuzubereiten. Aber meine Geschäftigkeit, wie ich die Deckel anhebe, rühre und die Hitze herunterdrehe, wie ich Zwiebeln würfle, zwischendrin Schneidebretter abspüle, Dill zupfe und Zitronen in Schnitze schneide, das muss sie einschüchtern. Drei Töpfe gleichzeitig auf dem Herd und dann noch ein Brot im Ofen, woher soll sie wissen, dass ich nur so tue, als hätte ich alles im Griff? Dass erst die Linsen hätten weich werden müssen, bevor ich die Zwiebeln hätte in die Suppe geben dürfen? Den Schaum auf den Linsen habe ich auch vergessen.
»Sobald die Linsen aufkochen, musst du den Schaum vorsichtig abschöpfen«, sagte meine Mutter immer und löffelte den grauen Schaum aus dem Topf. Wie ich es hasste, bei ihr am Herd zu stehen.
»Schau zu und merke es dir.«
Ich wollte mir nichts merken. Mich interessierte nicht, wie man Suppe kocht, ich würde keine Frau werden, die mit dem Abendessen auf ihren Mann wartet. Keine meiner Freundinnen musste neben ihrer Mutter stehen und kochen lernen.
»Nur weil ich ein Mädchen bin. Nur weil wir Türken sind.«
»Red doch keinen Unsinn. Was hat das denn damit zu tun? Willst du dich später von Nudeln und Fischstäbchen ernähren? Jeder Mensch muss kochen können.«
»Hörst du da zu?«, fragt Johanna und geht zum Radio. Es läuft ein Beitrag über Balkonpflanzen und zu welcher Tageszeit man sie am besten gießt. Aber gleich kommen die Nachrichten, und dann wird wieder die Integration für gescheitert erklärt, wie bereits in den 17 Uhr Nachrichten und in der Woche davor und eigentlich schon von Anfang an. Ich schiebe mich an ihr vorbei und schalte es aus.
»Du brauchst es nicht auszumachen. Ich wollte es nur leise drehen.«
»Nein, das läuft nur so nebenbei, um mich abzulenken.«
»Wovon denn?«
»Vom Kochen.«
Warum habe ich nicht einfach Spaghetti gemacht? Tomaten aus der Dose, Zwiebeln und Knoblauch, die hätten so lange vor sich hinköcheln können, bis die Gäste da sind. Im Kühlschrank liegt ein großes Stück Parmesan und das Basilikum wächst büschelweise auf dem Balkon. Dass ich mir selbst gerne viel Arbeit mache, weiß ich. Aber allein Johanna zuliebe hätte ich den Aufwand bleiben lassen sollen. Jetzt steht sie am Küchentresen und denkt, sie müsse den perfekten Salat zu meinem perfekten Abendessen zubereiten.
Meine Mutter kochte jeden Abend, reichlich. Das Essen musste zumindest noch für den nächsten Tag reichen, für den Mittag und für den Abend. Wenn die grünen Bohnen und der Reis in den Töpfen abgekühlt waren, füllte sie zwei große Portionen in die Blechdosen mit den blauglänzenden Deckeln. Morgens um sechs kamen die Dosen mit einer Thermoskanne Nescafé in den Korb, den nahmen meine Eltern mit zur Arbeit. Meine Mutter kochte aus Gewohnheit in großen Mengen, sie hatte fünf, mein Vater vier Geschwister. Und noch heute bringt mein Vater jeden Samstag einen Kofferraum voll Lebensmittel vom Wochenmarkt mit nach Hause, und meine Mutter entscheidet sich im Zweifel immer für den größeren Kochtopf, obwohl sie nur zu zweit sind. Allerdings will sie niemanden beeindrucken, von niemandem gelobt werden. Sie kocht, weil es immer gut ist, ein warmes Gericht auf dem Herd zu haben und weil man nie wissen kann, ob nicht doch jemand überraschend vorbeikommt.
Bei meinen Freunden gab es abends Vesper. Brot, Käse, Aufschnitt und saure Gürkchen, Apfelsaft oder Pfefferminztee für die Kinder, Mineralwasser für die Mutter und für den Vater ein Bier. Niemand kochte am Abend außer uns, und mir wäre es lieber gewesen, wir hätten auch gevespert. Dann hätte ich mir keine Gedanken machen müssen, ob ich nach Essen rieche. Meine Mutter aber wollte ein richtiges Abendessen.
»Boah, stinkts hier. Scheiße, dass man die Fenster im Bus nicht aufmachen kann.«
Ich drehte mich nicht um. Ich tat so, als hörte ich es nicht. Ich wusste ja, wer da hinten in der letzten Sitzreihe lachte und sich mit der Hand Luft zufächelte. Jack und dieser Kleine aus der Nachbarschule, er hatte schon einen Flaum auf der Oberlippe und manchmal verdrosch er andere mit seinem Turnbeutel. Manchmal waren sie noch mehr, stets in einer Gruppe, in wechselnder Besetzung, Jack und sein Kumpel aber immer mit dabei. Im Unterricht saß Jack hinter mir, meist ließ er mich in Frieden, manchmal war er richtig nett und lieh mir ein leeres Blatt oder eine Tintenpatrone. Trotzdem hielt ich mich fern von ihm, besonders nach dem Klingeln. In Wirklichkeit hieß Jack nicht Jack, er hieß Jochen, aber in Englisch hatten wir alle englische Namen. Stefan hieß Steve und Eva hieß Eve, auf Özlem passte nichts, also nahm ich Nancy, das hatte die Englischlehrerin vorgeschlagen.
Beim Wenden der Auberginen ist mir heißes Fett auf den Unterarm gespritzt, ich lasse kaltes Wasser darüber laufen, aber die kleinen roten Flecken brennen und am Handgelenk hat sich ein Bläschen gebildet. Es ist mir ein Rätsel, warum ich bei jedem Essen mit Freunden eine noch großzügigere, noch herzlichere Gastgeberin sein will als alle anderen. Warum ich mich von Mal zu Mal übertreffen muss. Dabei bin ich keine großzügige Gastgeberin. Eine großzügige Gastgeberin scheut weder Mühe noch Kosten, ich aber kaufe, was im Angebot ist, ich kaufe gutes Fleisch, aber nicht das beste. Ich gehe nicht auf Märkten umher und befühle die Tomaten, ich nehme die, die am rotesten aussehen. Trotz allem gelte ich als die leidenschaftlichste Köchin von uns allen. Schwierig ist das nicht, keine meiner Freundinnen legt Wert darauf, eine gute Köchin zu sein. Sie sagen bei jeder Gelegenheit, wie ungern sie kochen. Sie beschäftigen Putzfrauen, Kindermädchen und lassen sich die Einkäufe abends nach Hause liefern. Ich dagegen knete auch nach der Arbeit rasch ein Kilo Pizzateig, rufe Philipp an, damit er auf dem Heimweg Salami mitbringt und lade am Abend die Nachbarn zum Essen ein. Das liegt an meiner Kultur, sage ich, uns sind Essen und Bewirten, der Gast und das Teilen wichtig. Schon als kleine Mädchen schauen wir uns das Kochen bei unseren Müttern und Schwestern ab. Wenn ich so rede, sehen mich alle am Tisch an und lachen ein wenig verunsichert, keiner weiß, ob ich es nicht doch ernst meine. Warum sollte ich es auch nicht ernst meinen? Immerzu wird in meiner Küche, ich sage das auch so, in meiner Küche, gekocht, immer steht ein Topf auf dem Herd und ich in meiner Leinenschürze strahlend dabei. Ach, das bisschen, das bereitet mir keine Mühe. Gleich werde ich die Fladenbrote aus dem Ofen ziehen und mich über das krosse Braun freuen. Mein Rücken schmerzt, und ich würde mich am liebsten auf den Küchenboden legen, aber meine Gäste sehen hoffentlich nur Lebenslust und Appetit.
3
Ich gehe Philipp im Flur entgegen, mein Mann kommt von der Arbeit. Meist mache ich mir die Mühe nicht, heute schon, an den anderen Tagen ich rufe ihm bloß ein Hallo entgegen von dort, wo ich gerade bin. Er kommt dann zu mir, gibt mir einen Kuss, und oft halte ich ihm nur die Wange hin, manchmal den Mund. Er muss denken, dass ich mich nicht freue. Dabei schaue ich jeden Tag schon ab sechs auf die Uhr.
Philipp hat Vanilleeis und Blaubeeren mitgebracht, ich will ihm die Tüte aus der Hand nehmen, aber er lässt sie nicht los. Erst kapiere ich nicht, dass er sie festhält, und ziehe noch einmal daran.
»Lass ruhig, ich mache das schon«, sagt er. Ich weiß sofort, worauf er anspielt. Er hat eine Art, sich über mich lustig zu machen, über die ich auch lachen kann.
»Sehr witzig. Jetzt gib her, du Idiot.«
In der Küche drückt er Johanna an sich und hebt sie in die Luft. Sie ist schmal und zierlich, selbst ich könnte sie hochheben.
»Soll ich den Tisch decken?«, fragt er. Und wie er so vor den Tellern steht, tun mir plötzlich all die Male leid, die ich ihn voller Ungeduld angefahren habe, weil er die falschen Teller genommen hat. Er nimmt die großen flachen aus dem Schrank, wir brauchen auch die tiefen für die Suppe. Es ist egal, ich werde sie nachher dazustellen. Er soll sich nicht fühlen wie ein Kind an der Schultafel.
Johanna fragt, wo wir Servietten haben, und ich gebe ihr einen Packen roter Papierservietten aus der Schublade.
Zuhause rissen wir Quadrate von der Küchenrolle ab, wenn wir Gäste hatten. Dass man auch etwas anderes als Küchenpapier zum Mundabwischen nehmen konnte, stellte ich erst fest, als ich einmal bei meiner besten Freundin Stefanie zu Abend aß. Bei Stefanie gab es ein Esszimmer, darin einen großen Holztisch mit einer Schublade, in der das Besteck und die Stoffservietten lagen. Jeder in der Familie besaß eine eigene, mit einem Lötkolben hatte jemand die Namen der Eltern und der Kinder auf Holzringe gebrannt, die Servietten zusammengerollt und sie durch die Ringe gezogen. Ihr Vater saß am Kopfende, die zwei kleineren Geschwister auf der Bank, Stefanie und ich ihnen gegenüber, die Mutter gleich an der Küchentür. Vor dem Essen beteten wir »Komm, Herr Jesu, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen.« Ich betete mit, obwohl Stefanies Mutter sagte, ich müsse das nicht. Es gab auch Tischregeln. Aufstehen durfte man erst, wenn alle aufgegessen hatten, und wer die Ellbogen auf den Tisch stützte, wurde ermahnt und auch diejenigen, die die Wurst ohne Brot aßen oder zu viel Saft tranken. Nach der vierten Klasse kam Stefanie aufs Gymnasium, ich auf die Realschule, und obwohl wir in derselben Stadt lebten, verloren wir uns aus den Augen. Ich habe sie nie wiedergesehen. Ihre Mutter wohnt noch immer in dem efeubewachsenen Haus mit dem roten Balkon, angeblich lebt Stefanie in Freiburg. Meine Mutter traf ihre Mutter in der Sauna, sie hat mir sogar Grüße ausrichten lassen. Man müsste einfach mal hingehen und klingeln. Aber so etwas tue ich nicht.
Johanna erinnert mich ein wenig an Stefanie. Die blonden Haare, die Haut, die Sommersprossen, die hellen Fingernägel. Sie haben beide etwas Unschuldiges, Unbedarftes, Sorgenfreies. Nivea und Labello und weiße Söckchen am Sonntag. Ist das ein Spleen, meine Versessenheit auf dieses nicht nur sauber, sondern porentief rein? Ich mag Johanna, ich mag sie sehr, aber wenn ich ihr das erzählen würde, würde sie mich für verrückt halten. Philipp brachte Johanna und ihren Sohn eines Tages nach dem Kinderschwimmen mit. Luis und Jakob, inzwischen beide schon sechs, sind, seit sie das Seepferdchen zusammen gemacht haben, die allerbesten Freunde, die es gibt.
»Ich freu mich, dass du sie magst«, hatte Philipp gesagt, nachdem Johanna und Luis gegangen waren.
Für ihn ist alles viel einfacher. Er kommt mit allen Menschen ins Gespräch, er ist freundlich, er ist interessiert, er ist witzig, er hört zu, er ist nicht laut, er denkt nach und im Zweifel hält er den Mund. Paare ergänzen sich angeblich, der eine sucht im anderen das Gegenstück zu sich selbst. Das kann man von uns nicht sagen, wir passen in ein, zwei Dingen gut zusammen, wir können miteinander reden, ich mehr als er, uns beieinander entschuldigen, ich öfter bei ihm als er bei mir, und wir lachen miteinander, auch wenn er viele meiner Witze nicht lustig findet. Das bisschen scheint auszureichen, um den Rest zusammenzuhalten.
»Tobias bringt noch Wein mit«, sagt Johanna und sie sieht auf die Uhr. Gleich ist es acht. Außer Tobias, ihrem Freund, kommen noch Eva und Ralf zum Essen. Ralf ist ein alter Schulfreund von Philipp und Eva seine schöne, neue Freundin. So neu ist sie nicht mehr, seit drei Jahren sind sie zusammen, aber wenn man bedenkt, dass Johanna und Tobias schon seit Unizeiten ein Paar und Philipp und ich seit neun Jahren verheiratet sind, gehen Ralf und Eva als Frischverliebte durch.
Unsere Kinder schlafen heute bei Oma und Opa, bei Philipps Eltern also. Meine Mutter nennen die Kinder nene, meinen Vater dede, so wie ich meine Großeltern nene und dede genannt habe und es noch immer tue. Mich irritiert nur, dass meine Cousinen in der Türkei, die als kleine Mädchen zu unserer Großmutter ebenfalls nene sagten, mich und die Kinder korrigieren, wenn wir von nene sprechen.
»Anneanne, sag den Kindern, dass sie anneanne sagen sollen, nicht nene.«
»Warum nicht?«
»Weil anneanne viel schöner ist und weil deine Mutter noch viel zu jung für nene ist. Nene sagt man zu ganz alten Frauen.«
»Wir haben doch auch nene zu unserer nene gesagt.«
»Also ich sage anneanne.«
Den Wechsel von nene zu anneanne, zu Muttersmutter, muss ich verschlafen haben. Mein Fehler ist mir peinlich, wie es mir immer peinlich ist, wenn mein Türkisch korrigiert wird. Ich spreche es vorsichtig, oft befallen mich Zweifel, mitten im Satz, und plötzlich erinnere ich mich nicht mehr daran, ob ein Wort, das ich seit jeher benutze, richtig ist. Heißt es wirklich ışığı kapa, heißt es nicht ışığı kapat? Mach das Licht aus, mit einem t am Ende? Meine Eltern und ich haben immer kapat gesagt, oder nicht? Auf das Türkisch meiner Eltern ist kein Verlass. In ihren Familien waren beide die ersten, die man in die Schule schickte, aber auch nur so lange, bis sie einigermaßen lesen und schreiben gelernt hatten, meinen Vater fünf, meine Mutter vier Jahre. Wozu muss ein Mädchen auch länger in die Schule? Auf dem Feld gab es Arbeit, mehr als genug, zuhause vier jüngere Geschwister, und die Schafe mussten hinunter an den Fluss getrieben werden. Gut möglich, dass meine Eltern Fehler in ihrer Muttersprache machen, ohnehin sprechen sie einen Dialekt, und manche Ausdrücke verstehen schon die Leute in der nächsten Stadt nicht mehr. Manchmal lese ich ein türkisches Wort oder höre es bei Leuten, die sehr gutes Türkisch sprechen, und bin überrascht, dass sie es benutzen, ein Wort, dass ich bis dahin nur von meinen Eltern gekannt und das ich für ein Wort aus dem Dorf gehalten habe. Ich erkläre unseren Kindern, dass wir in Zukunft anneanne sagen werden, doch sie gewöhnen sich nicht an das neue Wort, sie rufen ihre Großmutter weiter nene, auch deshalb, weil mir andauernd nene herausrutscht.
»Lass die Kinder sagen, was sie wollen«, sagte Johanna. »Ich habe immer Momi zu meiner Oma gesagt.«
Seither lasse ich die Kinder in Frieden.
Ich schneide ein Stück vom warmen Brot ab, stelle Olivenöl und Salz auf den Tisch. Im Bad ziehe ich T-Shirt und Hose aus. Philipp steckt den Kopf herein.
»Soll ich mich auch umziehen?«
»Brauchst du nicht.«
Ich bürste mir die Haare und schüttle sie aus, aber der Geruch nach Brot und Bratfett verfliegt nicht. Draußen lacht Johanna, jemand schlägt eine Schranktür zu, Gläserklirren, Philipp sagt irgendetwas.
Wie gerne würde ich die Wanne volllaufen lassen, untertauchen und mit dem Kopf auf den Boden der Wanne sinken. Ich mag es, wenn meine Haare um meinen Kopf schweben und sich die Ohren mit Wasser füllen. Als Kind saß ich in der Wanne, bis sich meine Haut an den Fingerkuppen wellte. Dann kam meine Mutter herein, krempelte sich die Ärmel hoch und streifte sich einen kese über die Hand, einen Waschlappen aus grober Kunstseide. Damit er nicht wieder abrutschte, wickelte sie sich das Band am Saum des Lappens eng ums Handgelenk. Sie rieb meine Arme ab, meinen Rücken, den Nacken, die Beine, den Bauch. Sogar die Haut zwischen meinen Zehen, langsam, aber fest. Meine Haut rötete sich und unter dem Lappen rollten sich alte Haut und Schmutz zu feinen, dunklen Würstchen, als hätte man auf Papier radiert. Je länger sie rieb, desto länger wurden die Würstchen.
»Schau, wieviel Dreck abgegangen ist«, sagte sie stolz und wischte sich die Hitze aus der Stirn. Hinterher schäumte sie mich von oben bis unten ein, oft schmeckte ich die Seife nach dem Baden noch im Mund.
»Jetzt bist du wieder blitzblank.«
Auch als Stefanie bei uns übernachtete, wurden wir gebadet und abgerieben. Es war das erste Mal, dass eine meiner Schulfreundinnen über Nacht blieb, und wir schliefen mit meiner Mutter im Elternbett, weil mein Bett für uns Mädchen zu klein war. Stefanies Eltern ließen sich gerade scheiden, die Mutter trennte sich vom Vater, weil er ihr keine Blumen mehr kaufte. So hatte es mir Stefanie erklärt. Wir waren beide in der ersten Klasse und begriffen nicht ganz, warum sich Erwachsene trennten, wenn es keine Blumengeschenke mehr gab. Aber so war das wohl, und ohnehin machte ich mir viel mehr Sorgen um das abendliche Bad und das Schlafengehen. Ich hatte versucht, um das Baden herumzukommen, aber es war Freitag und am Freitag badeten wir. Erst ich, dann mein Vater und am Schluss meine Mutter. Ich hatte Angst, dass meine Mutter mich vor Stefanie mit dem kese abreiben könnte und sie dann sehen würde, wie dreckig ich war.
Stefanie und ich kippten Litamin ins Badewasser und drehten den Hahn so lange auf, bis sich der Schaum über unseren Knien türmte. Wir formten uns Haartollen und dicke Bärte aus dem Schaum, und ich hoffte, dass meine Mutter uns vergaß. Aber sie vergaß uns nicht, sie fragte Stefanie nicht einmal, ob sie abgerubbelt werden wollte. Sie krempelte sich wie immer die Ärmel hoch, fasste Stefanie um den Oberarm und fing an, mit dem kese ihren Nacken abzureiben.
»Oh, kuck mal wie dreckig du bist«, sagte meine Mutter.
Stefanie freute sich über die Würstchen und erzählte später allen in der Schule davon.
Ich wasche mir das Gesicht und fahre mir mit einem Frotteewaschlappen über die Achseln. Die Haare binde ich im Nacken zu einem Zopf, niemand wird an meinem Kopf riechen, niemand wird mich für dreckig halten.
4
Tobias ist schon in der Küche, er hat Johanna von hinten umschlungen, küsst sie auf die Wange, sie dreht den Kopf und küsst ihn auf den Mund, und gleich nochmal. Johanna kichert und er tut so, als wolle er sie in den Nacken beißen.
Philipp und ich küssen uns nie so. Philipp würde gerne, wir küssen uns viel zu wenig, sagt er, aber meist ist mir nicht nach Küssen. Philipp sagt, wenn ich ihn küsse, küsse ich pflichtbewusst, routiniert, zur Begrüßung und zum Abschied. Stempelküsse nennt er sie. Ich weiß nicht, warum ich keine Lust aufs Küssen habe. Wenn Philipp nicht da ist, denke ich mit einem warmen, schönen Gefühl an ihn, ich warte auf ihn, aber sobald er zur Tür hereinkommt, verfliegt die Erwartung, und ich denke ans Abendessen und daran, dass wir den Kindern die Fingernägel schneiden müssen.
Wie oft habe ich mir vorgenommen, ihm zu sagen, dass ich mich den ganzen Tag auf ihn gefreut habe? Dass ich froh bin, dass wir zusammen sind, froh, dass ich nicht darauf hoffen muss, dass er heute Zeit für mich hat, nicht hoffen muss, dass er Lust hat, mich am Abend zu sehen. Hier ist sein Zuhause, hierhin kehrt er Tag für Tag zurück, ich bin bei ihm zuhause und er bei mir. Jeden Tag nehme ich mir vor, ihm eine gute Nacht zu wünschen und einen guten Morgen, statt mich einfach mit einem Buch ins Bett zu verziehen oder im Bad die Morgennachrichten anzudrehen, während er duscht. Und jeden Tag lasse ich es bleiben.
Eva und Ralf kommen Arm in Arm aus dem Aufzug, sie küssen sich im Flur, sie küssen sich im Türrahmen, sie küssen sich am Tisch. Ihre Küsse tun mir nicht weh wie Johannas und Tobias’ Küsse. Deren Küsse spüre ich im Bauch, sie drücken mich unterhalb der Rippen, ich weiß nicht, ob das der Magen ist oder das Herz.
Für mein Kleid macht mir Eva ein Kompliment, ich sage Dankeschön und lächle und verkneife es mir zu sagen, dass ich es schon ganz lange habe und dass es irre reduziert war und dass und dass und dass. Philipp gibt jedem eine Kelle Suppe in den Teller. Johanna nimmt sich ein Stück Zitrone und drückt den Saft in die Suppe.
»Isst man das so, ja?«, fragt Eva.
»Du kannst sie auch ohne Zitrone essen, probiere erst mal. Es schmeckt aber besser mit Zitrone. Ich hatte mal eine pakistanische Freundin, die gab frische Tomaten und Koriander dazu. Das kannst du auch machen. Im Kühlschrank ist ein bisschen Koriander. Möchtest du?«
Jetzt fange ich wieder an zu reden.
»Und das Brot jetzt hineinbröckeln?« Ralf nimmt sich eine Scheibe und hält sie mir entgegen.
»Das Brot kannst du zum Salat oder einfach so essen, wie du willst.«
Sie sollen mich nicht fragen, sie sollen einfach essen. Aber das verhindere ich, weil ich ihnen in alles reinrede.
Philipp und Ralf kennen sich noch aus der Schule, nach dem Abitur hat Ralf lange Zeit in den USA und in Argentinien gelebt. Beim Einkaufen traf Philipp ihn zufällig auf der Straße wieder, er hatte nicht gewusst, dass er wieder in Deutschland war. Ralf sieht gut aus, er hat schönes, dunkelblondes Haar, er ist groß und kräftig, er wirkt viel älter und erwachsener als Philipp, in einer althergebrachten Art männlich, das macht mir Eindruck. Philipp ist einer, der manchmal in einem T-Shirt mit dem Periodensystem auf der Brust zur Arbeit geht. Sich nicht um Löcher in seinen Klamotten schert. Sogar seine Schuhe haben Löcher. Mit Eva treffe ich mich hin und wieder zum Mittagessen, aber Ralf begegne ich immer nur mit anderen an Geburtstagen oder im Kinofoyer, kurz bevor der Film beginnt. Dann grüßen wir uns und reden über dies und das, aber sobald wir einmal zehn Minuten miteinander alleine sind, erstirbt das Gespräch. Ich habe den Eindruck, dass er sich nicht für mich interessiert, ich kann nicht einmal sagen, ob er mich mag. Philipp mag ihn gerne, er ist ihm ein treuer Freund, also versuche ich, ihn auch zu mögen.