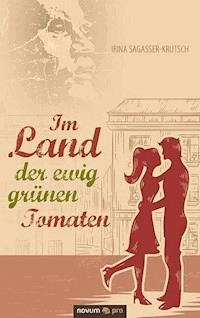
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum pro Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Eine junge Journalistin beginnt nach ihrem Studium bei einer Regionalzeitung fern der Heimat in Westsibirien zu arbeiten. Dabei lernt sie das Leben mit all seinen Widrigkeiten kennen. Mal stößt sie auf Menschen mit ungewöhnlichen Schicksalen, mal verliebt sie sich und verliert ihre jugendliche Naivität. Der gesunde Optimismus, mit dem die Autorin in die Zukunft schaut, lässt alle Ereignisse und Handlungsträger in dem Roman in einem besonderen Licht erscheinen. In dieser Hinsicht vereint die Autorin einerseits ihre Nähe zur russischen Literatur und andererseits zur modernen deutschen Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2013 novum publishing gmbh
ISBN Printausgabe: 978-3-99026-930-5
ISBN e-book: 978-3-99026-931-2
Lektorat: Angelika Glock
Umschlagfotos: Yuzach | Dreamstime.com, Sergey Yakovlev | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Übersetzung aus dem Russischen:
Dipl.-Ing. Natalija Krutsch
Dr. Phil. Larissa Abel
Literarische Bearbeitung:
M. A. für Romanistik und Germanistik Ulrike Grünwald
www.novumverlag.com
***
„Guten Morgen, Chefin!“ Der verantwortliche Redakteur Natan Kolodotschko, ein großer kahlköpfiger Mann mit gehässig wirkenden Falten um den großen Mund, schien außer sich. „Ich will’s jetzt wissen!“ Er ließ sich schwer in einen Sessel fallen. „Wann endlich werden in unserer Zeitung die Eilmeldungen rechtzeitig eingereicht?“
Er griff sich theatralisch an den Kopf, machte eine Pause und präzisierte giftig:
„Es ist schon elf Uhr morgens, aber das Industrieressort hat den Artikel über den ersten Abschnitt der Inbetriebnahme des Heizkraftwerkes immer noch nicht abgegeben!“
Die Frage des Ressortleiters war rhetorisch und also bleibend. Die Eilmeldungen (das sind aktuelle oder Sensationsberichte) werden in den Redaktionen immer erst in letzter Minute abgegeben. Dies ist ein Grundprinzip, und nur überpünktliche Redakteure gewöhnen sich wahrscheinlich nie daran.
Ich fühle immer mit ihnen, weil ich weiß: Genau sie sind es, die in der letzten Minute vor Drucklegung fluchend das ganze in liebevoller Arbeit von ihnen erstellte Layout, die elegant gestaltete grafische Gestaltung der zukünftigen Zeitung, zugunsten der Eilmeldung umwerfen müssen.
Die Tür zum Empfangszimmer war halb geöffnet, und durch den Spalt sah ich den niedlichen Spaniel, der dem verantwortlichen Redakteur gehörte und Dosyl1hieß. Wie immer wartete er treu vor der Tür auf seinen Herrn. Ein junger Mann mit schlohweißem Haar und in blauer Uniform hockte neben dem Hund und strich ihm über den Kopf, wobei er die langen, herunterhängenden Ohren zurückzog. Auf dem Boden neben ihm lag eine nachlässig hingeworfene Schirmmütze mit himmelblauem Mützenrand.
1Dosyl: russ. für Eilmeldung.
Irgendetwas an diesem jungen Fliegerschüler mit seinen weichen Gesichtszügen kam mir bekannt vor.
Ich riss mich von der idyllischen Szene los. „Natan Georgiewitsch, sollte die Eilmeldung aus dem Industrieressort noch auftauchen, bitte sofort zu mir auf den Ring.“
Als „Ring“ bezeichneten die Journalisten ironisch meinen Tisch, von dem aus zuweilen gnadenlos korrigierte Berichte entweder in die Zeitungsausgabe oder in den Papierkorb wanderten.
„Einverstanden. Ordnung muss sein“, brummte versöhnlich der verantwortliche Redakteur, ohne auf die Ironie zu reagieren, und nahm, dennoch sichtlich unzufrieden mit mir, Kurs auf die Tür.
Ich habe mir seit Langem abgewöhnt mit dem verantwortlichen Redakteur über die mit Verspätung abgegebenen Eilmeldungen zu diskutieren. Darüber war schon allzu oft in den Besprechungen, in Anwesenheit der ganzen Redaktion, diskutiert worden. Außerdem war es Natan Georgiewitsch selbst, der die rechtzeitige Abgabe von Artikeln zu überwachen hatte. Er versuchte das jedoch immer wieder auf die Chefredakteurin, also auf mich, abzuwälzen. Und er war immer wieder enttäuscht, wenn es ihm nicht gelang.
„Ich sagte ‚Guten Tag!‘“
Ich hob den Blick. Vor mir stand der junge Mann in der Uniform der Zivilluftfahrt. Erst jetzt merkte ich, dass sein Haar nicht altersweiß, sondern weißblond war. Die wie mit Mehl bestäubten, dichten Wimpern zitterten leicht, seine Haare waren modisch mit dem Scheitel in der Mitte frisiert, und seine blassen langen Finger kneteten die Schirmmütze.
„Ich hab’s gewusst! Sie können sich nicht an mich erinnern!“, sagte jetzt der junge Flugschüler herausfordernd. Es klang fast drohend.
„Ich sehe Sie heute zum ersten Mal, junger Mann“, sagte ich gelassen und zuckte mit den Schultern. Dabei drückte ich den Klingelknopf auf dem Tisch.
Die Sekretärin der Redaktion, Galina Poletajewa2, betrat geräuschlos den Raum.
2 Galina heißt mit Nachnamen Poletajew, die weibliche Form ist Poletajewa.
„Galina Nikolajewna3, bringen Sie dem jungen Mann und mir bitte Tee mit Zitrone!“
3 In der vertrauten, aber höflichen Anrede benutzt man im Russischen jedoch den Vornamen zusammen mit dem Namen des Vaters, als Tochter von Nikolaj heißt sie also Nikolajewna.
Ich deutete auf den Stuhl. „Ich höre Ihnen zu.“
Er schaute sich wie gehetzt um, gehorchte aber und nahm Platz. Seine Schirmmütze legte er auf die Knie, schwieg eine Weile und fragte dann mit leiser Stimme:
„Und meinen Vater, haben Sie den auch schon vergessen?“
Wie ein Blitz durchfuhr mich die Erkenntnis. Meine Knie wurden auf einmal butterweich. Wie im Traum stand ich auf und tat einen Schritt auf ihn zu:
„Sergej …!“ Ich stockte einen Moment. „Sohn … du bist es! Du bist so erwachsen geworden!“
„Ich bin nicht Ihr Sohn!“ Die Augen des jungen Fliegers verengten sich, der Blick wurde hart.
„Sie haben vor vielen Jahren meinen Vater getötet!“
Als hätte ich seine schlimmen Worte nicht gehört, setzte ich mich neben ihn und nahm seine weich geknetete Schirmmütze.
„Du hast dich entschlossen Pilot zu werden? Warum, Sergej?“
Er schwieg.
Ich kämpfte gegen den Kloß im Hals und begann von Neuem: „Ich glaubte damals nicht, dass ich jenen Tag überleben würde, Serjoscha …“
Ich stand auf, ging zum Fenster und schaute ins endlose Blau des Himmels, das von dem geraden weißen Kondensstreifen eines Düsenflugzeugs durchzogen wurde, und sagte:
„Du solltest wissen, Serjoscha, für das, was geschehen ist, darf man niemandem die Schuld geben.“
Ich ging wieder zu ihm, umfasste seine Schultern und zog seinen Kopf zu mir.
„Ich weiß“, schluchzte er. „Ich weiß.“
Dann entzog er sich meiner Umarmung, räusperte sich, und seine feucht gewordenen Augen glänzten wie zwei reife, braune Kastanien. Ich sah plötzlich den jungen Iw wieder vor mir. Aber es war nicht der blonde Iw, in Wirklichkeit war es sein albinoweißer Sohn.
Die Sekretärin brachte den Tee. Sergej redete jetzt wie ein Wasserfall. Er erzählte, dass seine verwitwete Mutter schon ein Jahr später ihren Stellvertreter geheiratet habe.
Als zwei weitere Kinder zur Familie dazugekommen waren, hatte sein Stiefvater darauf bestanden, den zwölfjährigen Sergej in ein Internat zu schicken. Dort wartete er, halb vergessen von seiner Mutter, die mit Familie und Partei beschäftigt war, ungeduldig auf die Sommerferien, die er bei seiner Tante Milda verbringen durfte, der jüngeren Schwester seines Vaters. Sie liebte den Jungen über alles.
Besonders schwer war es für ihn im ersten Jahr gewesen. Schlaflose Nächte wechselten mit Nächten, in denen Sergej den immer gleichen Traum hatte: Ich kam zusammen mit seinem Vater ins Internat, um ihn nach Hause zu holen. Wir alle drei waren glücklich und lachten …
Warum sein Vater in diesem Traum mit mir und nicht mit seiner Mutter kam, konnte er sich selbst nicht erklären …
Seine Großmutter war kurz nach dem Tod seines Vaters gestorben, und Sergej konnte sich nur noch daran erinnern, wie der rasende Stiefvater seiner Mutter verboten hatte, zur Beerdigung zu fahren.
„Es fehlte noch, dass du, eine Kommunistin und Obkom-Führungskraft4, zur Beerdigung einer Baptistin fährst!“, schrie er, ohne auf Sergej zu achten.
4Obkom: Abkürzung für oblastnoj komitet, ist die Gebietsverwaltung. Als politische Führungskraft war sie auch Vorbild und durfte nicht in Kontakt mit nur geduldeten Baptisten stehen.
Die Mutter fuhr nicht hin.
Sergej beendete die Internatsschule mit einer goldenen Medaille und wurde sofort an der elitären Hochschule für Luftfahrt in Riga angenommen. Wie man es auch betrachtete, seine Mutter arbeitete damals immer noch im Obkom, was auch eine wichtige Rolle bei der Aufnahme gespielt hatte. Aber sein Stiefvater, der zielstrebig auf der Karriereleiter nach oben gestiegen war, nachdem er Sergejs Mutter geheiratet hatte, war jetzt ihr Chef geworden.
Nun war Sergej im letzten Semester und machte sein Praktikum vor dem Diplom am Flughafen von Nowosibirsk.
Die ganze lange Zeit hindurch hatte er den Traum gehegt, mich aufzuspüren, zu treffen und mir ins Gesicht zu sagen, dass ich schuld am Tod seines Vaters sei. Es schien ihm sehr wichtig, mir mitzuteilen, dass ich, indem ich ihm seinen Vater genommen hatte, seine Zukunft ruiniert hatte.
Mein Name tauchte oft in den Zeitungen auf, und so wusste er, dass ich in der Hauptstadt der Teilrepublik Kasachstan, in Alma-Ata, lebte und arbeitete. Er musste also nur noch eine Dienstreise in diese Stadt bekommen. Und jetzt war dieser Tag gekommen.
Wie erstarrt hörte ich Sergej zu. Und vor meinen Augen sah ich wieder die im Westen des gigantischen Sibirien gelegene Stadt und mich, eine begeisterte junge Journalistin aus der Hauptstadt Kasachstans, in deren Diplom die Tinte noch nicht trocken war und die im Auftrag der Propagandaabteilung des Zentralkomitees der kommunistischen Partei kam. Und so hatte damals alles begonnen …
17. SEPTEMBER
In der Sprache der Dichter ist die Frau ein Geschöpf aus Versen, Blumen und Früchten. Aber zu Luisa passt das überhaupt nicht. Sie ist ein Geschöpf aus Sarkasmus, Scharfsinnigkeit und nicht versiegenden Einfällen. Luisa ist meine Chefin, Luisa Belmarjan, die Leiterin des Ressorts Investitionsbau in der Regionalzeitung.
Sie ist geistreich und nie um eine pfiffige Bemerkung verlegen.
„Steck deine Nase nicht in fremde Angelegenheiten!“, sagte sie augenzwinkernd und mit einem Aufblitzen der Goldkrone an ihrem Vorderzahn, als ich versuchte, drei Rubel in die Gemeinschaftskasse zu legen. Dann wurde sie gleich wieder ernst: „Arbeite erst einmal ein halbes Jahr, im Moment brauchst du jede Kopeke!“ Und sie legte sechs Rubel in die Kasse, für sich und für mich.
Westsibirien definiert sie als „Land der ewig grünen Tomaten“, denn sie reifen hier nicht an der Pflanze, sondern höchstens unterm Bett der Gartenbesitzer.
Einmal bestellte sie über den Moskauer Versandhandel ein Kopiergerät. Der Briefwechsel dauerte ein halbes Jahr, mal hatten die zu viele Bestellungen, mal war das bestellte Gerät nicht auf Lager, und dann verschwand ihre Bestellung spurlos. Die letzte Benachrichtigung brachte sie außer sich:
„Das ist kein Versandhaus“, sagte sie giftig. „Das ist ein Saftladen!“
Einige ihrer Scharfsinnigkeiten sind allerdings schlichtweg gefährlich. Einmal, als sie Dienst hatte, wurde in der Ausgabe turnusgemäß anlässlich des Jahrestags der Oktoberrevolution eine von den Arbeitern irgendeines Betriebes verfasste Ergebenheitsadresse an Breschnew veröffentlicht: Über eine halbe Seite berichteten sie, mit welchen „Großtaten“ sie den Jahrestag begingen.
Luisa summte beim Korrekturlesen des Textes leise die Melodie eines damals weitverbreiteten Liedes , aber mit ihrem eigenen sarkastischen Text:
„Briefe, zärtliche, schreibt man an Breschnew,
Hab sie auswendig gelernt!“
Der stellvertretende Chefredakteur Jakob Grin, der mit ihr zusammen Dienst hatte, hörte es und begann sie leise ernstlich zu tadeln. Ich brachte gerade Korrekturfahnen und hörte zufällig Grins verärgertes „Du Teufelsweib, willst du etwa hinter Gitter?!“
Aber das „Teufelsweib“ lachte nur zur Antwort und las am nächsten Tag vor einer Besprechung laut von der ersten Seite der „Prawda“ eine angeblich dort veröffentlichte Meldung vor:
„Der Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR, Oberkommandierender der Streitkräfte der UdSSR, Träger des Internationalen Leninpreises, der geniale, große Hoffnungen weckende junge Schriftsteller Leonid Iljitsch Breschnew verabschiedete sich heute zur Erholung … ins Bett! Im Bett wurde er von seiner Gattin Viktoria Breschnewa und anderen offiziellen Persönlichkeiten empfangen.“
Wir lachen. Schwer zu glauben, dass wir diese zahlreichen, im Grunde sinnlosen Titel unseres „genialen“ Generalsekretärs Tag für Tag etliche Male in der Zeitung nach einer von der Regierung eingeführten Reihenfolge gehorsam abschreiben und aufzählen. Und Gott bewahre, wenn man etwas auslässt oder das Wort „Generalsekretär“ klein- statt großschreibt!
Heute Morgen, vor der Besprechung, als wir alle auf die Chefredakteurin Rimma Wassiljewna Odinzowa warten, die alle einfach „Maman“ nennen, liest Luisa wie gewöhnlich laut aus der Zeitung vor:
„Moskau. KGB der UdSSR. Gestern Morgen fand im Pressezentrum des KGB eine Pressekonferenz statt. Die Mitarbeiter des KGB beantworteten die zahlreichen Fragen der Pressevertreter …“
Luisa macht eine bedeutungsvolle Pause. Die Anwesenden halten gespannt ihr Lachen zurück. Sie liest weiter vor:
„Spät in der Nacht bildete sich eine weitere Versammlung, in der die zahlreichen Fragen der KGB-Mitarbeiter von den Pressevertretern beantwortet wurden …“
Die Journalisten lachen lauthals. Im Türrahmen steht Maman. Ohne eine Spur des Lächelns im Gesicht sagt sie müde zu Luisa:
„Ich fürchte, dass DU dort bald wirklich ein paar Fragen beantworten musst …“
Zerknirscht senkt Luisa den Kopf und sagt halblaut, ohne irgendjemanden direkt anzusprechen: „An der Universität haben wir noch gelernt, Freiheit sei notwendig. Ich kann keine Notwendigkeit erkennen, nicht das zu sagen, was man sagen möchte!“
Der Parteiorganisationssekretär der Zeitung, Bugajew, der während der ganzen Zeit, in der Luisa die Mitteilung vorlas, geschlummert hatte, wachte plötzlich auf, reckte den Hals und versuchte durch Blättern in der Zeitung herauszufinden, auf welcher Seite der Prawda diese Mitteilung veröffentlicht war.
Danach verstummte Luisa und kommentierte ein paar Tage lang die Tagesereignisse nicht mit ihren geistreichen Äußerungen. Doch als ich heute nach dem Mittagessen zu ihr in ihre Abteilung ging, drückte sie mir verschmitzt einen Zettel in die Hand, auf dem stand: „Kurze Inhaltsangabe der Zeitung Znamja (der Zeitung, in der wir die Ehre haben zu arbeiten):
„Leonid Iljitsch Breschnew fuhr weg. Kossygin fuhr weg. Suslow fuhr weg.
Leonid Iljitsch Breschnew kam zurück. Kossygin kam zurück. Suslow kam zurück. Chefredakteurin Odinzowa.“
Als sie sah, dass ich mich vor Lachen kaum halten konnte, nahm sie mir den Zettel weg, zerriss ihn sorgfältig in viele kleine Stücke und zerknüllte diese nachdenklich zwischen den Fingern: „Vielleicht sollte ich sie aufessen? Damit sie dem Feind nicht in die Hände fallen!“
Wir lachen und plötzlich kommt mir der Gedanke, dass tagtäglich unendlich viele Berichte von Plenartagungen, Kongressen, Sitzungen, Besprechungen, offiziellen Treffen und Besuchen veröffentlicht werden, bei deren Lektüre man Gefahr läuft, sich den Kiefer durch Gähnen auszurenken. Keiner außer den Zensoren, Journalisten und Korrektoren liest sie, und doch nehmen sie den Löwenanteil der Zeitungsfläche ein. Wie viel Platz würde frei werden für wirklich interessante Artikel, wie zum Beispiel den vor Kurzem eingereichten, in dem ein Leser, ein Wirtschaftsfachmann, sich dem Problem widmete, wie man das Steuersystem im Land verbessern könnte. Ich erinnere mich, dass er dieses verbesserte System als Grundstein für den Wohlstand des Landes und seiner Bürger bezeichnete.
Als ich den Artikel las, der mit der Post gekommen war, hatte ich ungläubig gelacht: „Steuern und Wohlstand?!“
Eduard Sorin, der Chef des Industrieressorts (für alle einfach Edik), dem ich an diesem Tag half, Berge von Leserbriefen zu bearbeiten, seufzte und sagte mit einer für mich unverständlichen Traurigkeit:
„Die Sache ist die, Kleines, der Mann hat hundertprozentig recht. Doch wir werden den Artikel weder veröffentlichen noch weiter über dieses Thema diskutieren. Wir gehen einen anderen Weg.“
Er setzte ein geheimnisvolles Grinsen auf, nahm den schon zur Hälfte korrigierten Artikel aus meiner Hand und warf ihn feierlich in den Papierkorb.
„Aber wieso denn?“ Ich schaute ihn verblüfft an. „Sie sagen doch selbst, dass er ‚hundertprozentig‘ recht hat?“
„Natürlich hat er recht“, sagte Edik und schaute mich mit einem fast verliebten Blick an. Und ich spürte fast physisch, welches Vergnügen ihm meine Naivität bereitete.
„Das lässt sich nicht erklären, Kleines, das kommt mit der Zeit …“
Ich widersprach ihm nicht und ging zu meiner Chefin, die nach der Mittagspause mit einer winzigen Schachtel zurückgekehrt war. Darin glänzten kleine goldene Ohrringe in Form von Tröpfchen.
„Siehst du“, sagte sie, fast wie zur Rechtfertigung, „auch ich habe der allgemeinen Psychose nachgegeben und gekauft. Man sagt, dass im kommenden Jahr das Juweliergold noch einmal um 200 bis 300 Prozent teurer wird. Und ich habe zu Hause keine Unze Gold, ein anständiger Dieb hätte gar nichts zu klauen!“
Wir lachten. Mir gefielen die Ohrringe. Ich musste sie wohl übermäßig gelobt haben und Luisa seufzte bedauernd, aber zu allem bereit: „Möchtest du sie? Ich schenke sie dir!“
„Nein, ich möchte sie nicht.“ Ich besinne mich plötzlich. „Ich habe keine Löcher in den Ohren. Also nur, wenn du sie mir zusammen mit den Löchern in den Ohren schenken würdest …“
Eine Stunde später schneite Iwanow, der neue Chef des Kulturressorts, zu uns herein. Er stand eine Weile, atmete aus irgendeinem Grund tief die Luft unserer Abteilung ein und sagte dann zu Luisa:
„Hab’ gehört, das Vögelchen in deinem Nest kriegt langsam Federn. Wird scharfsinnig!“ Er warf mir einen liebevollen Blick zu.
„Das heißt, dass es bald auf und davon fliegt!“
Dann drehte er sich mit dem ganzen Körper zu mir:
„Weißt du, dass die zweite Auflage von Leonid Iljitsch Breschnews Buch ‚Das kleine Land‘5 erschienen ist?“
5 Leonid Iljitsch Breschnew: Malaja zemlja – vozroschdenjie; celina. Izd. Polititscheskoj Literatury, Moskwa 1981.
Leonid I. Breschnew: Das kleine Land – Erinnerungen. Ed. Neue Wege, Berlin 1978.
„Nee“, antwortete ich unsicher.
„Es ist erschienen“, bestätigte Iwanow, „nur mit einem neuen Untertitel: ‚Irgendwas ist mit meinem Gedächtnis. Das, was ich nicht erlebt habe, daran erinnere ich mich am liebsten‘“
Luisa lachte und hielt sich mit der Hand den Mund zu. Iwanow strahlte: „Mädels, Humor hilft uns beim Bauen und Leben!“
Und er entfernte sich gemessenen Schrittes.
LUISA
Sie wurde am 22. Juni 1941 geboren. An dem Tag, an dem das faschistische Deutschland in der Sowjetunion einfiel. Ihr Vater, ein Armenier, Aschot Belmarjan, zählte in den Dreißigerjahren zu den sogenannten „Hunderttausend“. Das waren Komsomolzen und Kommunisten, die „auf Wunsch der Partei und des Volkes“ in die Provinz geschickt wurden, „um das Bewusstsein der parteilosen Massen zu wecken“. So kam er nach Westsibirien, um dort im Gubkom6 des Komsomol zu arbeiten.
6Gubkom: Gubernskaja kommissija, Staatliche Kommission.
Auf den ersten Blick verliebte er sich in Luisas Mutter Emma, die zierliche Russlanddeutsche mit goldfarbenem Haar. Heiß und bedingungslos, eben auf kaukasische Art. Emmas Eltern, die aus der deutschen Kolonie an der Wolga kamen, waren enteignet und Anfang der Dreißigerjahre nach Westsibirien verbannt worden. Sie hatten ihren zukünftigen „Schwiegersohn“ gleichzeitig gehasst und gefürchtet. Und Emma hatten sie eindringlich verboten, mit einem Komsomolzen auszugehen.
Doch die Jugend reagiert auf Verbote auf ihre Art. Aschot und Emma trafen sich nun heimlich. Unerwartet wurde die dreijährige Dienstreise des braven Komsomolzenführers vorzeitig beendet. Jetzt sollte er „das Bewusstsein der parteilosen Massen“ in Armenien wecken. Und in einer der weißen Nordnächte im Jahre 1939 lief die goldhaarige Emma aus ihrem Elternhaus fort. Lief davon mit dem zärtlichen Aschot Belmarjan ins sonnige Armenien. Dort wurde auch Luisa geboren. Den Namen gab ihr ihr Vater, der in den ersten Tagen des Zweiten Weltkriegs als Politruk7 an die Front ging und im August 1941 in den Sümpfen Weißrusslands für immer verschwand.
7Politruk: im Zweiten Weltkrieg militärischer Führungskader, der sich mit der politisch-erzieherischen Arbeit befasste.
Zur selben Zeit wurden seine Schwiegereltern und Emmas vier Brüder auf Stalins Befehl in Viehwaggons geladen und als „deutsche Spione und Saboteure“ in ein Arbeitslager in den Bezirk Magadan geschickt.
Die Alten, die die Entbehrungen und Erniedrigungen nicht ertrugen, starben noch auf dem Weg nach Magadan. In den Gulags8 verlor sich auch die Spur ihrer Brüder. Und die helläugige Emma selbst, die immer ein wenig erschrocken wirkte und mehr Mädchen als Frau war, wurde in die sogenannte Arbeitsarmee in die Uralwälder geschickt. Hier starb sie kurz darauf wegen der mangelhaften Ernährung und der schweren Waldarbeit.
8Gulag, auch GULag: ist das Akronym für Hauptverwaltung der Besserungsarbeitslager und gleichzeitig das Synonym für ein umfassendes Repressionssystem in der Sowjetunion, bestehend aus Zwangsarbeitslagern, Straflagern, Gefängnissen und Verbannungsorten.
So wurde Luisa zu einem Waisenkind. Die Eltern ihres Vaters, die Emma niemals in ihre Familie aufgenommen hatten (weder Armenierin noch Russin – wo hat er diese Deutsche aufgegabelt? Wai, wai …), zogen ihre Enkeltochter jedoch mit viel Liebe auf. An nichts ließen sie es ihr fehlen, aber ebenso ließen sie ihr auch keine Eigenheiten durchgehen.
Als sie sechzehn wurde, bat Luisa, die von ihren Großeltern das krankhafte Selbstwertgefühl und von ihrem Vater das ungehorsame Gemüt geerbt hatte, außerdem die kurze gebogene Nase und kleine, sinnliche Lippen, ihre armenischen Großeltern um die Erlaubnis, nach Sibirien gehen zu dürfen. Sie wollte dort nach den Brüdern ihrer Mutter suchen.
Die Großeltern ließen sie widerwillig gehen. Sie sollte sich nur nach den Brüdern ihrer Mutter erkundigen und dann sofort wieder nach Hause zurückkehren. Und so brach das gerade mal gut eineinhalb Meter große goldhaarige Mädchen mit den blauen Augen, die sie von ihrer Mutter hatte, aus Armenien auf nach Sibirien.
Dort kam sie aber nicht an. Unterwegs lernte sie ein paar georgische Abiturienten kennen, die ihr wegen ihrer geringen Größe den Namen „Meter mit Schirmmütze“ gaben und sie überredeten mitzukommen, Sibirien „für später“ zu lassen. Luisa beschloss, dass ihre verschollenen Onkel auch noch eine Weile warten könnten, und erklärte sich einverstanden.
So kam sie nach Moskau und schrieb sich dort an der Fakultät für Journalistik der Moskauer Staatsuniversität ein …
Während des Monats der Aufnahmeprüfungen schlossen Abiturienten aus allen Ecken des Landes die widerspenstige, helläugige kleine Armenierin ins Herz.
Das war im Jahr des Internationalen Jugendfestivals in Moskau, als die Worte „Frieden und Freundschaft“ zur Parole aller Jugendlichen der Welt wurden.
Luisa, die zwar die Aufnahmeprüfungen bestanden hatte, aber nicht zugelassen wurde, feierte noch ein paar Nächte mit ihren neuen Freunden unter den Klängen des überall gesungenen Liedes „Moskauer Nächte“9, verpulverte dabei ihr letztes Geld und fuhr erst dann „schwarz“ auf dem Dach eines Zuges nach Westsibirien.
9Podmoskowskije wetschera: „Russische Nächte“, auch in Deutschland bekanntes russisches Volkslied.
Die vier Brüder ihrer Mutter fand sie nie, obwohl sie die Suche viele Jahre hindurch fortsetzte. Erst dreißig Jahre später, zu Zeiten Gorbatschows im Jahre 1987, erhielt sie unerwartet aus dem Hauptquartier des KGB in Moskau ein Dokument über die Rehabilitation der Brüder ihrer Mutter, die, wie lakonisch mitgeteilt wurde, im Jahre 1943 in einem der Lager im Hohen Norden verstorben waren.
Nach Armenien kehrte Luisa trotzdem nicht zurück. Im Jahre 1957 mischte sich der Komsomol in ihr Leben. Nach dem Misserfolg an der Universität ging sie, ungeachtet der Proteste seitens ihrer Großeltern und als träte sie in die Fußstapfen ihres Vaters, nach Sibirien, um dort als Komsomol-Hilfskraft an einer der Baustellen zu arbeiten. Sie wurde abgehärtet, gewann körperlich an Kraft und lernte das Leben kennen. Doch ihre Seele war nach wie vor voller Romantik, und nach wie vor träumte sie vom Journalismus. Zu diesem Zeitpunkt begann sie bereits kleine Berichte für die Komsomol-Zeitungen zu schreiben.
Drei Jahre später wurde sie vorbehaltlos an der Universität angenommen: Wie hätte es auch anders sein sollen, sie war ja im Komsomol, war erste Kranführerin, war begabt …
Zugegeben, eine Schönheit war sie nicht, die stumpfe, stark gebogene Nase beherrschte ihr ansonsten sympathisches Gesicht, machte es markant, fast männlich. Deshalb hatte Luisa, trotz blonder Locken und sinnlicher Lippen, keinen Erfolg beim anderen Geschlecht.
Dafür aber hatte sie mehr als genug Freunde. In journalistischen Kreisen hielt man sie für kompromisslos und sehr talentiert. Man fürchtete ihre böse Zunge und ihre erbarmungslose, aber gerechte Feder. Sie lebte in ihrem geliebten Westsibirien, arbeitete als Chefin des Investitionsbauressorts in der Regionalzeitung und hatte eine chaotische, mit Möbeln und Büchern vollgestopfte Einzimmerwohnung, ein Geschenk ihrer reichen, armenischen Verwandtschaft.
Jedes Jahr im November fuhr sie, koste es, was es wolle, nach Armenien in Urlaub. Von dort brachte sie für die ganze Redaktion einen großen Korb mit riesigen armenischen Pfirsichen mit, die in weiches Moos gebettet waren. Ihr himmlisches Aroma und herrlicher Geschmack versetzten die Bewohner des „Landes der ewig grünen Tomaten“ in Entzücken.
So lebte sie, bis sie in ihrem einunddreißigsten Lebensjahr plötzlich die Liebe zu dem Bauingenieur Boris Osokin wie ein Blitz traf. Er war Junggeselle, ein unscheinbarer, schüchterner Mann und tollpatschig wirkender Brillenträger. Sein Zimmer im Wohnheim teilte er mit dem sympathischen, aber verantwortungslosen Künstler und Trinker Wasja. Boris hatte eine Leidenschaft: die Jagd. Das einzig Wertvolle in seinem Besitz waren drei Jagdgewehre. Sie waren selten und sehr teuer. Er bewahrte sie in einem speziell für diesen Zweck angefertigten Schrank auf. Das war alles, was ihm etwas bedeutete: die deutschen Jagdgewehre „Sauer, drei Ringe“10.
10 Hersteller J.P. Sauer & Sohn, Suhl; 3-Ring Krupp-Lauf.
Luisa traf ihn oft in den Sitzungen der Bauingenieure. Und einmal lockte sie ihn zu ihrem Geburtstag und überraschte nicht nur Boris, sondern auch ihre Kollegen mit der relativ aufgeräumten Wohnung und köstlichen Speisen. Besonders gut waren ihr die winzigen armenischen Golubzy aus Fleisch und Gemüse, eingewickelt in Weinblätter, gelungen. Dazu reichte sie wunderbare Soßen, gewürzt mit Dutzenden Kräutern, und einen Cocktail aus Kognak mit rohem Ei nach dem Rezept ihres Vaters. Man kann sagen, der erstklassige armenische Kognak floss an diesem Abend in Strömen. Er löste die Zungen und gab den Gefühlen freien Lauf.
Boris war von jetzt an häufig bei Luisa, sie lasen viel gemeinsam, und er interessierte sich plötzlich für Philosophie und Kunst. Dann zog er ganz zu ihr. Er begann sich mit Luisas Beratung modisch und geschmackvoll zu kleiden und nahm zu. Dann ließ er sich einen „Tschechowschen“ Bart wachsen, der ihn intelligent aussehen ließ, und beschaffte sich eine teure italienische Brille mit dunklen Gläsern, die sein Gesicht geheimnisvoll wirken ließ.
Zur Jagd ging er nun mit dem Chef des Fernsehsenders, Jakowlew (Luisa hatte sie miteinander bekannt gemacht), und feierte die erfolgreiche Jagd im Wald, jedes Mal in dem teuren Restaurant Slawjanka am See, zu dem nicht jeder Zugang hatte.
In den Kreisen, in denen er sich ab und zu mit Luisa zeigte, erregte er, auffällig und wortkarg, wie er war, Interesse bei den Frauen. Das führte schließlich dazu, dass er Luisas Gegenwart, ihr ewiges Chaos in der Wohnung und ihre scharfe, aber eben auch gnadenlose Zunge immer mehr mied.
Luisa, die zu diesem Zeitpunkt im siebten Monat schwanger war, traf ihn zufällig bei einer Besprechung, sprach ihn an und musste sich mit Schrecken anhören, dass sie nicht sein Kind trage und dass ihn, Boris Osokin, mit ihr, Luisa Belmarjan, nichts außer rein geschäftlichen Interessen verbinde. Und davon bekomme man bekanntlich keine Kinder.
All das sagte er mit undurchdringlicher Miene und blickte durch die dunklen Brillengläser an Luisa vorbei. Nur seine rechte Hand suchte unruhig und vergeblich die ganze Zeit etwas in der Tasche seines perfekt sitzenden Anzugs. Luisa verzog spöttisch ihre blass gewordenen Lippen und sagte aufgebracht: „Verdammt sollst du sein, Judas …“ und sie verließ ihn, durch die Schwangerschaft unförmig geworden, mit schwerfälligem Gang, aber hoch erhobenen Hauptes.
Ein halbes Jahr später, als seine Tochter Oljenka − sie war ihm wie aus dem Gesicht geschnitten − drei Monate alt wurde, heiratete Boris die Tochter des Leiters eines großen Bauunternehmens. Aus seinem Wohnheim zog er aus und in eine große neue Dreizimmerwohnung ein. Er fuhr nun einen gebrauchten Moskwitsch, ein Geschenk seines Schwiegervaters, und schien Luisa vergessen zu haben.
Der Vaterschaftstest bestätigte, dass Oljenka seine Tochter war. Er lachte jedoch nur zynisch und bestritt es weiterhin. Auch dabei half ihm wieder sein mächtiger Schwiegervater: Er wurde nie zur Zahlung von Unterhaltsleistungen verpflichtet.
Ein Jahr später wurde in Boris Osokins Familie ebenfalls eine Tochter geboren. Die Ironie des Schicksals wollte es, dass man auch sie Oljenka, Olga, nannte. Mithilfe des Schwiegervaters wurde Boris Osokin schnell zum Chef der Mobilen Mechanisierten Kolonne für den Wohnbau in entfernten Regionen ernannt. Er widmete sich ganz seiner Arbeit, hatte einen weisen Führungsstil und beherrschte sein Metier. Seine Kolonne stellte die Wohnbauten immer fristgerecht und ohne Mängel fertig. Er bekam einen Dienstwagen, ein Büro mit rotem Partei-Telefon11, eine Sekretärin und ein gutes Gehalt. Kurz gesagt, eine bedeutende gesellschaftliche Stellung.
11selektornaja swjaz’: rotes Telefon mit direkter Wahlverbindung zur Parteizentrale.
Aber nach fünf Jahren teilte eines Tages der Chef der Mobilen Kolonne, Boris Osokin, dem inzwischen ein Bauch gewachsen und dessen Gesichtsausdruck launisch-mürrisch geworden war, seiner Frau mit, dass er sich scheiden lassen wolle. Seine Frau begann zu weinen, und sein Schwiegervater bekam einen Wutanfall. Er erinnerte seinen Schwiegersohn an dessen Situation vor der Heirat und drohte, ihn fertigzumachen. Wie sich später herausstellte, waren das keine leeren Versprechungen.
Im Verantwortungsbereich der vormals erfolgreichen Führungskraft Boris Borissowitsch Osokin tauchten unerwartet hohe Nachzahlungsforderungen auf, der Diebstahl von Baustoffen im Wert von über hunderttausend Rubel und nicht fristgerecht oder überhaupt nicht fertiggestellte Objekte …
Boris drohte eine Gerichtsverhandlung und Gefängnis. Der Schwiegervater lud den Schwiegersohn liebenswürdig in sein Büro ein, machte ihn mit den Dokumenten, die ihm zur Last gelegt wurden, vertraut, und erwähnte beiläufig, wenn er den Gedanken an Scheidung verwerfe, würden die Anschuldigungen nicht weiter verfolgt.
Osokin antwortete dem Schwiegervater nicht, schlug nur krachend die Tür hinter sich zu und entlud seine Wut laut schimpfend vor der verblüfften Sekretärin. Er wusste, dass er unschuldig war und dass die Beweise gefälscht waren. Aber er wusste auch, dass er mit Sicherheit im Gefängnis landen würde. Sein geliebter Schwiegervater würde schon dafür sorgen, dass der ungehorsame Schwiegersohn bestraft würde!
Am gleichen Tag sah man Boris bei der Sparkasse, wo er eine große Summe abhob, dann bei der Post, wo er ein Paket verschickte und schließlich im Kaufhaus beim Graveur. Zur Arbeit kehrte er nicht mehr zurück. Er ging nach Hause, spielte eine halbe Stunde mit seiner Tochter und ließ sie vor Entzücken kreischen, als er ihr einen großen Hasen mit langen Ohren schenkte, den er im Kaufhaus gekauft hatte. Dann schloss er sich im Wohnzimmer ein, leerte dort in einem Zug ein großes Glas Kognak, aß gedankenverloren eine Praline „Eisbär“ hinterher und ließ sich dann in den großen Ledersessel fallen.
So schien er lange gesessen zu haben, mit gesenktem Kopf und die gepflegten weißen Hände zwischen den Knien herabhängend. Er antwortete weder auf das Klopfen seiner Frau noch auf das Rufen seiner Tochter, stundenlang. Als draußen früh die winterliche Dämmerung eintrat, stand er auf, trank den Rest des Kognaks aus der Flasche und holte sein Gewehr aus dem Safe, der raffiniert in einen polierten Wandschrank eingelassen war. Er setzte sich auf den Boden, säuberte liebevoll die Läufe mit dem Ladestock, stützte den Schaft der Waffe am Schreibtisch ab und nahm den Lauf in den Mund …
Der Schuss versetzte das provinzielle Städtchen in Aufregung. „Sauer, drei Ringe“ ist ein ausgezeichnetes Gewehr, und Boris war ein guter Schütze. Auch wenn es darum ging, sich selbst zu erschießen. Der Schuss zerschmetterte seinen Schädel, er war auf der Stelle tot.
Obwohl die Familie des Schwiegervaters versuchte, alles wie einen Unfall darzustellen (in der letzten Zeit sei Boris oft angetrunken gewesen, auch vor dem Tod habe er getrunken), kam die Wahrheit doch einige Tage später ans Licht.
Nach der Beerdigung bekam die von den Ereignissen tief getroffene Luisa ein Paket per Post zugestellt. Darin war Geld. Viel Geld. Boris schrieb in seinem Abschiedsbrief an sie, das Geld sei für seine Tochter Olga, die er zu seinen Lebzeiten nicht hätte anerkennen können.
„Jetzt weiß ich es“, schrieb er. „Ich bin ein Feigling. Ich war ein Feigling, als man meinen Vater fand und ich ihn aus Angst nicht anerkannte. Ich war ein Feigling, als unsere Tochter zur Welt kam und ich wiederum sie nicht anerkennen konnte. Ich war der größte Feigling, als ich eine Frau heiratete, die ich nicht liebte, und ihr dies nicht gestand …
Nur so konnte ich mich ihrer Familie anschließen, mit deren Hilfe ich beabsichtigte, mich von meiner Feigheit zu befreien, da diese Familie zu den Mächtigen gehörte …
Doch ich hatte mich geirrt. Ich blieb immer noch ein Feigling. Und jetzt weiß ich, die Feigheit ist mein Kreuz, das ich mein Leben lang zu tragen habe. Deswegen kann ich nicht weiter leben. Und dieses ist meine letzte Geste, wahrscheinlich ist es auch Feigheit …“
Weiter schrieb er, dass er sich mit der seelischen Armut seiner neuen Familie nicht habe abfinden können. Er bat seine Tochter und Luisa um Verzeihung. Und er bat darum, dass sie ihn in gutem Andenken bewahren sollten.
Auch über seine Gewehre verfügte er: Das Gewehr, das ihn getötet hatte, wurde auf sein Geheiß mit ihm beerdigt. Das andere bekam der Künstler Wasja, mit dem er früher im Wohnheim gewohnt hatte. Und das Dritte, mit einer eingravierten Widmung, erhielt seine Tochter Olga Belmarjan. So hing das Gewehr − bedrohlich und doch fast wie ein Kunstgegenstand − in Luisas Wohnung auf einem Teppich an der Wand. In mir weckte es Angst und Achtung zugleich. Auch wenn Luisa sagte, das Magazin des Gewehrs werde beim Chefredakteur des Fernsehsenders, Jakowlew, aufbewahrt, und das an der Wand hängende „Sauer, drei Ringe“ sei genauso harmlos wie ein Besen in der Ecke.
Wie man mir später hinter vorgehaltener Hand in der Redaktion erzählte, war der Vater von Boris, Wassilij Osokin, im Zweiten Weltkrieg an der Front verschwunden. Es gab Gerüchte, dass er von den Faschisten gefangen genommen worden sei. Man hatte ihn in der russischen „Befreiungsarmee“ unter General Wlassow12kämpfen sehen, aber am Ende des Krieges war es ihm gelungen, nach Südamerika zu entkommen. Verglichen mit dem Schicksal der Zwangsarbeit in sibirischen Wäldern oder des Erschossenwerdens wegen Landesverrats hatte Wassilij Osokin natürlich das bessere Los gezogen! Die Option Südamerika wurde für ihn zu einem erfolgreich ausgespielten Trumpf. Der Einsatz war sein eigenes Leben, das Leben, das durch den Dienst in der „Befreiungsarmee“ besudelt worden war und für das am Ende des Krieges keiner auch nur eine Kopeke gegeben hätte …
12Wlassow: Oberbefehlshaber der sowjetischen Armee. In deutscher Gefangenschaft wechselte er die Seiten und baute die Russische Befreiungsarmee (ROA), auch Wlassow-Armee genannt, auf, die auf der Seite des Deutschen Reiches gegen die Sowjetunion kämpfte.
In den Sechzigerjahren, auf dem Höhepunkt des sogenannten Chruschtschowschen Tauwetters, kamen durch das Internationale Rote Kreuz Nachrichten von Boris’ Vater. Er lebte in Argentinien, hatte eine Farm und suchte nun seine Frau und seinen Sohn.
Plötzlich interessierte sich der KGB lebhaft für Boris’ Mutter, eine unscheinbare Buchhalterin auf dem Lande. Nach einigen Verhören war sie vor Angst wie gelähmt und schwor, nie mit Wassilij Osokin verheiratet gewesen zu sein, womit sie die Ermittler nicht wenig verwirrte. Wenig später steckte sie sich bei der Arbeit mit einer Grippe an, die in eine schwere Lungenentzündung überging. In dem Jahr, in dem Boris zwanzig Jahre alt wurde, starb seine Mutter unerwartet, und Boris wurde vorsorglich, für alle Fälle, aus dem Komsomol und aus der Universität ausgeschlossen.
Es war, als öffnete sich ein Abgrund vor ihm. Er wurde plötzlich zum Außenseiter. Und das alles wegen eines Vaters, den er nie gesehen hatte, nie geliebt hatte, wegen dessen aber nun sein ganzes vorheriges Leben wie ein Kartenhaus in sich zusammenfiel.
Er begann auf dem Bau zu arbeiten. Nach drei Jahren wurde er wieder an der Universität zugelassen, und schon früher wurde er wieder in den Komsomol aufgenommen. Eine bessere Empfehlung als die durch den Gebietskomsomol hätte es für ihn nicht geben können: „Der Baggerführer Osokin widerstand den Provokationen des internationalen Imperialismus und zeigte das große sowjetische Bewusstsein eines sowjetischen Bürgers und Erbauers des Kommunismus, indem er Basil Osokind (so nannten sie jetzt seinen Vater), der in einem für uns feindlichen Argentinien lebt, nicht als Vater anerkannt hat …“
Ich möchte anmerken, dass der Komsomolze und spätere Kommunist Osokin nicht nur den Vatersnamen „Wassiljewitsch“ in einen beliebig gewählten „Borissowitsch“ änderte, sondern auch jahrelang gehorsam die dicken Briefe seines Vaters ungeöffnet zum KGB brachte. Trotz allem verlor er nie seine lähmende Angst vor etwas.
Wahrscheinlich hatte er recht, nur die Kugel konnte ihn von seiner Angst befreien.
Aber Luisa und ihre kleine Tochter taten mir leid …
26. SEPTEMBER
Jetzt wohne ich königlich in einem winzigen Zimmer im Wohnheim für Eisenbahner. Maman hat das letzte Woche erreicht, und ich freue mich unendlich darüber. Das Wohnheim ist recht komfortabel mit Zentralheizung, Toilette und einer Dusche, in der ab und zu sogar warmes Wasser fließt.
Allerdings befindet sich mein „Appartement“ im kalten Halbkellergeschoss neben der öffentlichen Toilette, die auch ich aufsuche, wenn sie frei ist. Und fünf Meter von meiner Tür entfernt ist eine Küche mit Bewirtungsraum, die wegen der besonderen Arbeitszeiten der Bahn rund um die Uhr geöffnet ist. Das bedeutet, dass die Besatzungen der Dieselzüge hier Tag und Nacht ihre Verpflegung bekommen und ich Tag und Nacht die Schritte, das Türenschlagen und den sonstigen Krach höre.
Trotz alldem bin ich unendlich glücklich. Endlich kann ich mit meinen Gedanken allein bleiben. Und ich kann, wann immer ich Lust dazu habe, Zeitungsartikel schreiben, Gäste empfangen, schlafen, gedankenverloren die Decke anstarren oder in Unterwäsche im Zimmer herumlaufen.
Bis jetzt hatte ich bei Luisa gewohnt, auf einem Klappbett hinter dem Bücherschrank, der seltsamerweise mitten im Zimmer gegenüber dem einzigen Fenster stand. Deswegen war es im Zimmer selbst sogar im Sommer immer dämmerig wie an einem regnerischen Herbsttag, und bei mir hinter dem Schrank war es bis spät in die Abendstunden so hell, wie es nur im Norden sein kann. Doch nicht von der Sonne, sondern von einem sich am Horizont erstreckenden, hellen Himmelstreifen. Luisa erzählte mir, dass dieser Streifen im Sommer, in der Zeit der weißen Nächte, oft mit rosafarbenem oder grünlichem Licht geheimnisvoll bis zum Sonnenaufgang leuchte.
Jetzt gehört alles der Vergangenheit an: Die allabendlichen „Konzerte“ der vierjährigen Olga Borissowna, wenn sie nicht schlafen will, der Luisa den Kopf zu waschen droht, wenn sie nicht gehorcht, die späten Abendessen mit der alltäglich gewordenen Pilzsuppe, die stundenlangen nächtlichen Diskussionen über brennende Themen, und als Folge davon chronischer Schlafmangel.
Aus Luisas Einzimmerwohnung im dritten Stock zog ich in ein zehn Quadratmeter kleines Kellerzimmer. Ein eisernes Bett mit Drahtgeflecht, ein Holztisch ohne Tischdecke, zwei Stühle und ein Einbauschrank im winzigen Flur, das ist alles, über das ich im Moment verfüge. Und dennoch komme ich jetzt von der Arbeit und freue mich auf die Begegnung mit MEINEM ZIMMER.
Und es ähnelt tatsächlich schon meinem Zimmer. Ich habe einen Spiegel mit Bronzerahmen gekauft, drei Regalbretter aus Holz für die Bücher, eine Leinentischdecke, eine Tischlampe und einen kleinen farbigen Bettvorleger. In dem winzigen Flur habe ich einen Hocker aufgebaut, den ich von Luisa bekommen habe, und darauf feierlich eine neu erworbene Kochplatte platziert: Hier wird meine Küche sein.
Auf den Tisch in meinem Zimmer habe ich lila Chrysanthemen gestellt, an die Wand Reproduktionen gehängt, Bilder von Tschurlonis13, Monet und Levitan, und auf dem Fensterbrett fand ein kleiner Radioempfänger „Majak“14 Platz, den ich im Kaufhaus erworben habe. Und gestern Abend schleppte Luisa mir zur Einzugsfeier einen alten Korbsessel aus der Datscha an. Ich warf eine farbige Wolldecke darüber, und das zuvor unpersönlich wirkende Zimmer verwandelte sich! Danach musste ich allerdings bedrückt feststellen, dass drei Viertel meines Monatsgehalts verschwunden waren!
13Tschurlonis, Mikulajus Konstantinas (Mikolas): 1875−1911, bedeutender litauischer Maler und Komponist.
14Majak: Radioempfänger, Modell Majak.
Ich nähere mich meinem neuen Zuhause und plötzlich überfallen mich widersprüchliche Gefühle. Zu Luisa muss ich nicht mehr hin, und doch zieht es mich in ihr ewiges Chaos.
Die Sonne geht gerade erst unter. Der purpurrote Sonnenuntergang lodert noch hinter den weit entfernten Wohnblöcken, doch in einigen Häusern sind schon die Lichter an. Im Haus gegenüber dem Wohnheim wohnt im zweiten Stock der Alkoholiker Stjopa. In seiner Küche gibt es weder Vorhänge noch einen Lampenschirm. Nur eine Glühbirne hängt an einem langen Draht.
Vor dem Haus hatte sich nach dem Regen eine große Pfütze gebildet. Von ihrer glatten Wasseroberfläche wurde das orangefarbene Licht von Stjopas Glühbirne reflektiert, das berührte mich. Ich stand eine Weile vor der Pfütze, atmete tief durch und warf ein Steinchen auf das Spiegelbild der Lampe. Plätschernd löste sich der Widerschein in Hunderte leuchtender Kreise auf. Plötzlich hatte ich keine Lust mehr, zu Luisa zu gehen.
Abend, Schmutz und Einsamkeit umgaben mich …
30. SEPTEMBER
Der Tag war erstaunlich warm, und als ich von einem Redaktionsauftrag zurückkam, bog ich im Stadtpark in eine golden leuchtende Ahornallee ein, die weit vom Eingang entfernt war. Ich setzte mich auf eine freie Bank, blinzelte in die sanfte Nachmittagssonne und gönnte mir ein wenig Entspannung. Gedankenverloren nahm ich wahr, dass auf jeder Bank eine stark geschminkte Frau mit übereinandergeschlagenen Beinen saß. Auf den Schuhsohlen bemerkte ich etwas Weißes.
„Was spielt sich denn hier ab?“, schoss es mir durch den Kopf.
Ich schloss die Augen und streckte mein Gesicht den warmen Strahlen der Herbstsonne entgegen. Eine ungeduldige Männerstimme riss mich aus dem Dahindösen.
„Wie viel, frage ich dich?“
Ich öffnete die Augen. Vor mir stand ein Angestellter mittleren Alters. Ziemlich sympathisch, mit Bürstenhaarschnitt, in offen stehendem hellen Mantel, mit Anzug und Krawatte. In seinen Händen hielt er eine Mappe mit Papieren. Solche hatte ich oft im Obkom und im Gorispolkom15 gesehen.
15Gorispolkom:gorodskij ispolnitelnij komitet: die Stadtverwaltung.
Ich starrte ihn befremdet an.
„Was ist, bist du neu?“, fragte der Mann im Mantel interessiert. „Du hast keinen Preis auf der Sohle. Hast du vergessen ihn aufzuschreiben? Was nimmst du für einen Besuch?“
„Für welchen Besuch?“, fragte ich ganz verwirrt. „Was meinen Sie damit?!“
„Dummes Ding“, spuckte der Mann entrüstet aus. „Willst du wirklich wissen, was ich damit meine?“
Auf den anderen Bänken wurde laut gelacht. Der Mantel drehte mir den Rücken zu und begab sich zur nächsten Bank, wo er leise mit einem noch ganz jungen Mädchen über etwas verhandelte.
Offensichtlich war die Verhandlung erfolgreich. Eine Melodie vor sich hin summend, ging er an mir vorbei und warf mir im Gehen grob zu:
„Verschwinde hier, solange du noch unversehrt bist!“
„Was erlauben Sie sich?!“ Ich erstickte beinahe vor Empörung.
Die Geschminkten, die uns mit Interesse beobachtet hatten, kicherten bereitwillig. Erst jetzt merkte ich, dass jede auf den Schuhsohlen mit Kreide geschriebene große weiße Ziffern trug:
5, 10, 15 …
Plötzlich wurde ich rot im Gesicht. Warum, wusste ich selbst nicht. Mit glühendem Gesicht stand ich auf und ging unter den belustigten Blicken der „Bankdamen“ schnell davon.
In der Redaktion fragte ich Luisa, noch immer berührt von einem nicht definierten Gefühl der Peinlichkeit, was die Ziffern auf den Sohlen der Frauen in der Ahornallee bedeuteten.
„Da sieh mal einer an!“, wunderte sie sich. „Wie bist du denn dahin geraten?“
Ich murmelte irgendetwas Unverständliches.
„Das sind die ‚Bankprostituierten‘ unserer Stadt“, erklärte Luisa ruhig und schaute mich aufmerksam an. „Die zugänglichsten unter anderem. Diejenigen, die teurer und sozusagen ‚anständiger‘ sind, bestellt man telefonisch. Und die Ziffern auf den Schuhsohlen nennen den Preis, den sie verlangen …“
Luisa besann sich einen Moment.
„… sagen wir, für ein Treffen mit einem Mann im Bett.“
„Wir haben doch keine Prostitution im Land“, erwiderte ich kleinlaut.
„Natürlich haben wir keine“, stimmte Luisa mit einem Achselzucken zu. „Geh und schau, wahrscheinlich hast du geträumt, dass dort jemand mit Preisen auf den Schuhsohlen sitzt!“
OMAR CHAIJAM
Da sitze ich und lese mit Spannung den Brief meiner Studienkollegin Elena Schumacher, die in der Hauptstadt geblieben war. Gleich nach dem sechsten Semester hatte sie einen schönen Uiguren mit dem beeindruckenden Namen Omar Chaijam16 geheiratet. Die Kommilitoninnen hatten voller Neid geseufzt, dass sie ihn schon seines Namens wegen geheiratet hätten.
16 Omar Chajjam (Khayyam) war auch der Name eines berühmten Mathematikers, Astronomen, Physikers und Philosophen, 1048 in Nischapur geboren und dort 1131gerstorben.
Und Elena zog mit ihrem Omar in eine kleine Stadt unweit der Hauptstadt, hielt sich abseits und begann ein Familienleben zu führen. Im achten Semester gebar sie eine Tochter, eine kleine, temperamentvoll wirkende Asiatin mit schriller Stimme und widerspenstigem Charakter. Damals gingen wir alle hin, um den jungen Eltern zu gratulieren. Wir waren entzückt von dem Kind, das dem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten schien und sogar so viel von dem stark dominierenden asiatischen Erbteil hatte, dass nichts mehr für das europäische Äußere Elenas, ihr leuchtend blondes Haar und ihre blauen Augen, übrig blieb. So als ob Omar die Tochter nicht nur gezeugt, sondern auch geboren hätte.
Jetzt ist Lenas dunkelhäutige Tochter, die paradoxerweise Swetlana17 genannt wurde, drei Jahre alt. Und aus dem Brief erfuhr ich eine unerwartete Neuigkeit: Sie hatte sich von ihrem Omar scheiden lassen, der außer dem Namen leider wohl nichts mit dem berühmten arabischen Dichter und Denker gemeinsam hatte.
17Swetlana: Übersetzung des russischen Namens „die Leuchtende“.
Wir wussten, dass schon bald in Elenas Familienleben Probleme aufgetaucht waren. Der Muslim Omar hatte seiner Frau gleich nach der Geburt der Tochter verboten, die Vorlesungen zu besuchen. Listig brachte sie es jedoch fertig, die Universität abzuschließen, indem sie sich für das Fernstudium ummeldete. Das war allerdings noch nicht alles. Es zeigte sich, dass Omar nicht nur drogenabhängig war, sondern dass er selbst auch mit Drogen handelte, die ihm aus der berühmt-berüchtigten Tschujskaja Dolina, im Grenzgebiet zwischen Kasachstan und Kirgistan, geliefert wurden. Dort wuchs auf Tausenden von Hektar wilder Hanf, der dann zur Herstellung von allen möglichen Drogen, unter anderem auch Marihuana, verwendet wurde.
Elena war gleich aufgefallen, dass ihr Mann über seine Verhältnisse lebte. Er kaufte einen Wolga und feierte die Geburt der Tochter im teuersten Restaurant der Hauptstadt. Darüber hinaus kündigte er seine Arbeit als Techniker in der Zuckerfabrik und hatte doch immer noch viel Geld. Diese Tatsache führte zu einer ernsten Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten.
Omar nannte gerade heraus seine Geldquelle und schlug Lena zynischerweise vor, so ein „Onkelchen“ zu rauchen. Als sie dies energisch ablehnte, freute er sich sogar: Jetzt gebe es jemanden, der mit klarem Kopf mit den Lieferanten verhandeln könne. Doch Lena verlangte, dass er sich sofort aus dem Drogenhandel zurückzöge und seinen Drogenkonsum beendete, sonst würde sie es melden.
Omars Reaktion war nicht vorherzusehen. Unter Drogeneinfluss schlug er Lena brutal zusammen.
Elena reichte sofort die Scheidung ein. Sie schrieb, dass sie wohl noch nie in ihrem Leben so viele Demütigungen und Enttäuschungen erlebt hätte. Das unterwürfige Betteln um Verzeihung, mit dem der erschreckte Omar ihr unheimlich zugesetzt hatte, hatten sich abgewechselt mit ausführlichen Drohungen, sie zu töten oder ihre Tochter zu entführen.
Sie stand es durch und ließ sich scheiden. Wegen ihrer Tochter und ihrer eigenen Ruhe ging sie aber einen Kompromiss ein. Sie meldete das „Geschäft“ ihres Exmannes nicht bei der Polizei. Dem konnte allerdings so oder so niemand mehr helfen. Er tröstete sich bald mit einer drogensüchtigen Freundin und vergaß vollkommen, dass er eine Tochter hatte, die ihm wie aus dem Gesicht geschnitten schien. Ich erinnerte mich daran, wie unangenehm er uns überrascht hatte, als wir alle Swetlana bewunderten: „Was heißt es schon, eine Tochter zu bekommen?“, prahlte er damals, nicht mit dem Großmaul eines Betrunkenen, wie ich erst jetzt verstehe, sondern vollgepumpt mit Drogen. „Fünf Minuten Spaß, sonst nichts!“
So wie es aussieht, war es nur das für ihn gewesen.
Jetzt fing Lena wieder an zu arbeiten. Sie ließ ihre Tochter bei ihren Eltern, die Rentner waren, und ging als Korrespondentin zu einer Regionalzeitung. Ihr dichterisches Talent und ihr Scharfsinn erblühten zu neuem Glanz, sie gewann wieder Freude am Leben, von dem Omar Chaijam ihr gewissenlos vier ganze Jahre geraubt hatte.
Den Brief schrieb sie mir, nachdem sie ihr erstes Gehalt bekommen hatte. Ihre Freude darüber, gemischt mit der unangenehmen Entdeckung, dass Geld die Eigenschaft hat, spurlos zu verschwinden, drückte sie in einem Vierzeiler aus:
„In mein Notizbuch
legte ich sieben Scheine …
würde mir je wieder einer Scheine
gegen entbehrliche Scharfsinnigkeiten tauschen?!“
Ich werde ihr schreiben, damit sie die Sache genau durchschaut: Die Scheine ersetzen Scharfsinn nicht! Und in unserem Arbeitsleben ist Scharfsinn keine Hilfe, sondern er stört.
Das betrifft besonders die Journalisten in Regionalzeitungen. Sie haben noch geringere Gehälter als wir …
7. OKTOBER
Fantastisch! Nächste Woche will Maman Luisa und mich auf eine Dienstreise in den Ural schicken. Wir sollen spannende Berichte und Fotos von der Inbetriebnahme der Wasserleitung „Ischim-Irtysch-Kama“ mitbringen. Und ich fahre nicht bloß als „kreative Beobachterin“, sondern als Fotokorrespondentin mit! Es gibt eine einfache Erklärung dafür: Luisa hatte noch nie in ihrem Leben eine Kamera in der Hand. Ich schon. Unser Fotokorrespondent Schenja Herman hat mir schon eine seiner besten Kameras gegeben, eine japanische Nikon.
Als er sie mir gab, deklamierte er lustig mit einem Wortspiel: „Nikon ist eine berühmte altkirchenslawische Kamera, die derzeit nach altem russischen Rezept in Japan hergestellt wird!“ 18
18Nikon: Wortspiel um die japanische Kamera Nikon und den russischen Patriarchen und Kirchenreformator Nikon, 17. Jahrhundert.
Ich lachte höflich. In meinem Kopf spukte aber nur ein Gedanke, der nichts mit Kreativität zu tun hatte: Ich hatte furchtbare Angst, dass die Kamera geklaut werden könnte. Aber ich freute mich auf die nächste Woche.
STRAUSS-WALZER
Ich bemerkte sie sofort, als ich den Saal betrat. Ich sah sie an und bedauerte aus mir unerklärlichem Grund, dass ich nicht direkt neben ihr saß.
Es war eigentlich nichts Bemerkenswertes an ihr. Sie war von kräftiger Figur, größer als der Durchschnitt und trug ein violettes Abendkleid mit einem auffälligen Ausschnitt auf dem Rücken. Ihr Gesicht war sonnengebräunt, sie hatte die Lippen fest aufeinandergepresst, entweder aus Abneigung gegenüber den Mitmenschen, oder aus Angst, sie zufällig anzulächeln. Oberflächlich blickte sie aus zusammengekniffenen, dunklen und undurchdringlichen Augen in die Runde, ohne den Blick an irgendetwas zu heften.
Das war alles.
Die Gäste versammelten sich gerade erst, und ich beobachtete sie weiter aus einiger Entfernung. Sie war sicher nicht nur eine starke, sondern auch eine außergewöhnliche Persönlichkeit, ging es mir durch den Kopf. Auf einmal hatte ich das Bedürfnis, einen Männeranzug anzuziehen, am besten eine Husarenuniform mit Epauletten an den Schultern und mit prächtigem Zobelpelz besetzt, und dann, einen langen Säbel hinter mir über den Boden schleifend und mit den Sporen klirrend, zu ihr zu gehen und sie mit einer angedeuteten Verbeugung zum Tanzen aufzufordern.
Ich musste lachen, als ich mir ihren Gesichtsausdruck vorstellte: wie Verlegenheit in ihren undurchdringlichen Augen sichtbar werden würde, wie sich ihr kleiner Mund vor Erstaunen öffnen würde und wie sie mir den Tanz wegen meiner geringen Größe versagen würde. Das brachte mich vollends in gute Stimmung.
Der kraushaarige, freundlich aussehende Leiter der Informationsabteilung, Wolodja Schewelew, setzte sich zu mir, und während ich noch seine nicht gerade raffinierten Komplimente beantwortete, stand die Unbekannte auf und ging, allen ihren geraden und fast bis zur Taille entblößten Rücken präsentierend, zum Flügel, der auf einem Podium in der Ecke das Saales stand. Bevor sie auf das Podium trat, hielt sie ihr langes Kleid mit einer eleganten Geste zurück.
Ich bewunderte sie.
Zwei Männer in eleganten Anzügen und mit ähnlich kaltem und ausdruckslosem Gesicht folgten ihr und blieben an den Flügel gelehnt stehen.
Ich konnte mich nicht mehr zurückhalten und ging hinterher. Ich wusste, dass bei diesem Instrument manchmal die Gis-Taste aussetzte.
Als Antwort auf meine Warnung bedachte mich die Unbekannte mit einem kalten Blick, ihre Augen waren kastanienbraun, und sie fing an mit steifen Fingern die Vertonung der Verse von Jessenin „Ahorn, du mein Ahorn“19 zu spielen.
19Klen ty moi, opawschii, Verse von Sergej Jessenin, 1895–1925, volkstümlicher Dichter, unter anderem verheiratet mit Isadora Duncan.
Ich empfand die Situation irgendwie als unangenehm − die gepflegten, undurchdringlichen Gesichter der Männer mit ihren vollen Lippen, die ziemlich gezwungen den Text des Liedes mehr sprachen als sangen, und die Komplimente, die sie ihr machten, trotz der steifen Art, mit der sie spielte (drei Jahre Musikschule).
Und besonders dieser Typ mit dem grau melierten Bürstenhaarschnitt. Hatte ich ihn schon irgendwo gesehen?
Ach ja! Die Ahornallee, die Preise auf den Schuhsohlen, seine Überheblichkeit und die Verabredung, die er mit der jungen Prostituierten getroffen hatte …
Auf einmal spürte ich, dass ich auf etwas Verbotenes und Gefährliches gestoßen war.
Er erkannte mich nicht, oder tat er nur so?
Eilig kehrte ich zu Schewelew zurück. Ich sagte ihm, dass die Frau, ebenso wie die Männer, den Blick einer Sphinx hätte, versteinert, bewegungslos und alles durchdringend. Ich zuckte mit den Schultern. Der Wunsch, mich in einer Husarenuniform vor ihr zu präsentieren, war verflogen.
„Das sind die Jungs aus dem Obkom“, erklärte Schewelew lachend und schenkte mir Wein ein. „Der eine, der mit den kurz geschnittenen grauen Haaren, ist Instrukteur der Propaganda- und Ideologieabteilung im Obkom, der andere, der sich die ganze Zeit hinter seinem Rücken versteckt, ist ein kleiner Fisch, ihr Assistent.“
In diesem Moment betrat der Typ aus der Landwirtschaftsabteilung den Raum, elegant bis in die Zehenspitzen. Ihm zu Ehren saß heute die ganze Redaktion im schicksten Restaurant der Stadt. Iwan Moon feierte seinen fünfunddreißigsten Geburtstag. Sein sandfarbener Anzug saß wie angegossen. Seine Haare waren streng nach hinten gekämmt, in der gleichen Farbe wie der Anzug. Er hatte kleine Geheimratsecken. Aber mir schien es, als unterstrichen sie nur seine Eleganz. Moon sah mich flüchtig mit ausdrucklosem Blick an, dann sah er SIE am Flügel und ging langsam zu ihr. Auf den energischen Händedruck des Mannes mit Bürstenhaarschnitt hin verzog er seine Lippen zu einem Lächeln und klopfte dem Assistenten freundschaftlich auf die Schulter. Dann wandte er sich ihr zu.
Ich sah, wie sie sich ihm entgegenstreckte, etwas zu ihm sagte und ihn auf die Wange küsste. Er lachte, umfasste ihre Taille und zog sie mit sich zu einem Tisch, wo sie sich setzten. Ich weiß nicht warum, aber plötzlich hatte ich das Gefühl, als zerrisse alles in mir. Ohne nachzudenken, was ich tat, stand ich auf und ging zum Flügel und spürte beim Hinsetzen, dass der Drehstuhl noch ganz warm von ihr war. Ohne an die defekte Gis-Taste zu denken und mit starkem Tritt auf das Pedal, als wollte ich das Instrument anspornen, schlug ich in die Tasten. Hinter meinem Rücken spürte ich, wie sich alle zu mir umdrehten, als sie die majestätisch schwungvollen Klänge des Strauß-Walzers „An der schönen blauen Donau“ vernahmen.
Er tanzte den Walzer mit ihr, und ich war in guter Stimmung: Der alte, gut gestimmte Flügel kam unter meinen Fingern in Schwung und gab ziemlich laute, wenn auch manchmal etwas scheppernde Töne von sich. Es sah so aus, als hätten meine Eltern nicht völlig umsonst sieben Jahre lang den Klavierunterricht für mich bezahlt.
Zum Glück hatten sie nicht versucht, aus falschem elterlichem Ehrgeiz eine professionelle Pianistin aus mir zu machen. Ich hatte einfach aus Spaß mit der netten Olga Dawidowna geübt, regelmäßig die Stunden besucht und − nicht immer rechtzeitig − die Prüfungen abgelegt.
Meine nette Musiklehrerin! Die witzige und trotz der grauen Stellen im krausen Haar jung aussehende, schwarzäugige Jüdin wusste, eine große Musikerin würde aus mir nicht werden. Doch sie machte aus mir eine gute Begleiterin.
Das war ihr Ziel und manchmal klapste sie mir auch bei falschen Akkorden ungehalten auf die Finger.
Mit dem letzten Akkord setzte ich quasi dem Tanz einen Schlusspunkt und spielte im Anschluss daran, wie zur Lockerung der Finger, die dahinfließenden „Wasserspiele“ von Ravel. Erst jetzt bemerkte ich, dass fast alle Gäste um mich herum standen. Moon, der in seinem sandfarbenen Anzug wie ein Diplomat aussah, kam zu mir und nahm meine Hände in seine. Er sah mir erstaunt in die Augen, küsste beide Hände nacheinander und sagte: „Ich würde Sie gerne zum Tanzen auffordern, doch wer würde es wagen, sich jetzt nach Ihnen an dieses Instrument zu setzen?!“
Länger, als es der Anstand erlaubt, hielt er meine Hände in seinen, und sofort spürte ich IHREN scharfen Blick auf mir.
„Mein Gott, das ist ja seine Frau“, durchfuhr es mich in später Erkenntnis. „Die berühmte, unerreichbare Frau, die im Obkom der Partei eine Abteilung leitet!“
Meine Laune besserte sich schlagartig. Ich setzte mich erneut an den Flügel, und der Raum füllte sich mit den mächtigen Klängen des Walzers „Amurwe1len“. O Gott, wie sehr hatte ich früher dieses Stück in der Musikschule gehasst! Umso klarer, sauberer und virtuoser klang es jetzt. Es war, als erinnerten sich die Finger plötzlich an die wochenlangen quälenden Übungen und spielten jetzt mit eleganter Leichtigkeit und fehlerlos.
Ich war wahrhaftig gut in Form an diesem Abend.
Doch weswegen eigentlich? Doch nicht etwa, weil der „sandfarbene Anzug“ seine Frau vergaß und meine Hände küsste?
Fast den ganzen Abend stand ich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Und irgendwann, schon gegen Ende, fing ich ihren Blick auf, der voller Verachtung und Überheblichkeit war. Als wenn sie mir kalt und vernichtend sagen wollte: „Deine Bemühungen sind umsonst, Kleine. Ich gebe zu, du bist eine gut dressierte Klavierspielerin! Doch mehr auch nicht. Der sandfarbene Anzug und sein Besitzer gehören mir, und nur mir!“
Sie drehte sich mit dem ganzen Körper zu Moon und küsste ihn plötzlich wie betrunken auf die Lippen. Dabei stieß sie ungeschickt ein Glas mit Wein um.
Und trotz beharrlicher Bitten spielte ich an diesem Abend nicht mehr. Ich saß neben Schewelew, nippte am hellen Zinandali20 in meinem Glas und aß Obst.
20Zinandali: Wein aus Georgien.
Und am nächsten Tag taten mir vor Überanstrengung die Finger weh. Der alte Flügel hatte schwer zu spielende Tasten …
14. OKTOBER





























